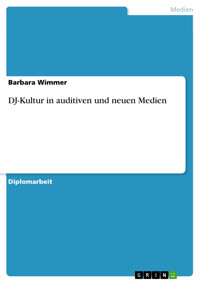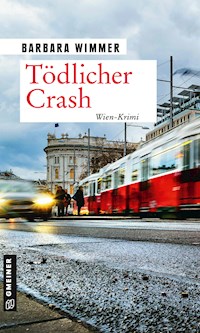
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wien 2022. Der Finanzminister der Republik Österreich ist stolz auf sein selbstfahrendes Auto - eines der ersten, die im Lande zugelassen wurden. Doch plötzlich prallt das hochmoderne Fahrzeug gegen eine Baumallee. Der Tod des Politikers sorgt für großes Aufsehen. Anfangs ist unklar, ob es sich dabei um einen Unfall handelt. Oder steckt ein Hacker-Angriff dahinter? Die kritische Investigativ-Journalistin Stefanie Laudon aus Wien will den Fall für das Blatt „24 Stunden“ aufklären und gerät plötzlich selbst ins Visier der Ermittlungen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Wimmer
Tödlicher Crash
Kriminalroman
Zum Buch
Geheimnisvoller Tod Wien 2022. Der Finanzminister der Republik Österreich ist stolz auf sein selbstfahrendes Auto – eines der ersten, das im Lande zugelassen wurde. Doch plötzlich prallt das hochmoderne Fahrzeug auf dem Weg in seine Heimat, einer kleinen Gemeinde am Attersee in Oberösterreich, gegen eine Baumallee. Der Tod des Politikers sorgt für großes Aufsehen. Anfangs ist unklar, ob es sich dabei um einen Unfall handelt, oder die Schuld beim Computersystem liegt. Oder steckt ein Hacker-Angriff dahinter?
Die kritische Investigativ-Journalistin Stefanie Laudon aus Wien will den Fall für das Blatt »24 Stunden« aufklären und gerät plötzlich selbst ins Visier der polizeilichen Ermittlungen. Durch jahrelang gespeicherte Social-Media-Postings, „Precrime“-Computer, die ermitteln, ob jemand verdächtig ist, und Funkzellenabfragen wird ihr das Leben schwer gemacht. Wie kommt sie da bloß wieder raus? Und wie kam der Finanzminister wirklich ums Leben?
Barbara Wimmer ist preisgekrönte Netzjournalistin, Buchautorin und Vortragende. Sie wurde in Linz geboren und zog danach zum Studieren nach Wien. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften begann sie als Journalistin bei einer großen Tageszeitung zu arbeiten. Sie schreibt als Redakteurin seit rund 15 Jahren über Technik-Themen wie IT-Sicherheit, Netzpolitik, Datenschutz und Privatsphäre. Wimmer entwickelte im Laufe der Zeit zahlreiche Ideen, wie sich Zukunftsthemen auch literarisch spannend verarbeiten lassen. 2018 gewann sie den Journalistenpreis »WINFRA«, 2019 wurde sie mit dem Dr. Karl Renner Publizistikpreis und dem Prälat Leopold Ungar Anerkennungspreis ausgezeichnet. »Tödlicher Crash« ist ihr erster Kriminalroman. barbara-wimmer.net
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Madrugada Verde / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-6316-7
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog
Klick. Stefanie Laudon fotografierte ihre gerade frisch erworbene Eulen-Handtasche mit ihrem Smartphone. Sie saß in ihrem Hotelzimmer in Barcelona und schickte das Foto an Paul Mond. Er hatte ihr eine Message gesandt mit einem YouTube-Link zu einem Konzert seiner Lieblingsband. Natürlich verwendeten die beiden dazu »Signal«, diesen supersicheren Messenger, der die Nachrichten zuverlässig verschlüsselte und den selbst der berühmte Whistleblower Edward Snowden schon vor Jahren empfohlen hatte. Schade, dass sie Snowden nie persönlich getroffen hatte. Sie wäre neugierig gewesen, ob er wirklich so ein Patriot war, wie der Guardian-Journalist Ewen MacAskill in seinem Vortrag behauptet hatte, als sie diesen zum Interview getroffen hatte. Dieses Interview, das sie nie vergessen würde, weil es so bewegend gewesen war. Ihr Smartphone vibrierte und machte Bling.
»Hast du Spaß in Barcelona?«, schrieb ihr Paul zurück. Auch er hatte sein Smartphone praktisch rund um die Uhr bei sich. Als IT-Systemadministrator musste er schließlich ständig erreichbar sein. Er hatte oft genug Bereitschaftsdienst. Aber auch seine Freunde schickten ihm permanent Nachrichten via Signal. Nur so war das Leben eines »IT-Sysadmin«, wie sich die Mitglieder dieser Berufsgruppe selbst gerne abkürzten, erträglich. Durch Kommunikation, Unterhaltung, Ablenkung.
Stefanie schmunzelte, als sie die Nachricht von Paul las. Heute hatte Paul wohl wieder einen seiner guten, optimistischen Tage. Oft genug war er so in seine Arbeit vertieft oder so von den Kundengesprächen genervt, dass er nicht richtig auf das, was sie ihm schickte, reagierte. Die Journalistin beschloss darauf, ein ihnen beiden sehr vertrautes Spiel miteinander zu starten. Sie antwortete ihm:
»Nein!«
»Doch!«
»Nein!«
»Doch!«
»OH!«
Der Dialog, der aus einem französischen Film stammte, war im Internet längst zum Kult geworden und die beiden scherzten damit häufig herum, um sich gegenseitig zu provozieren. Bling. Bling.
»:)«
»:D«
»Was ist an der Tasche so besonders?«, fragte Paul. Frauen und ihr Faible für Handtaschen waren für ihn ein Rätsel. Ein Phänomen, das er einfach nicht verstand.
»Na, die Eule!«
Stefanie war ein großer Eulenfan. Die Tasche selbst war aus Kork und kam mit einer vergoldeten Metall-Kette. Unter der lila Eule stand außerdem ein Spruch: ›You only live once.‹ (Man lebt nur einmal.) Das vergaß man in der Praxis bloß so oft! Auch Stefanie hatte erst nach Barcelona auf Urlaub fliegen müssen, um sich wieder daran zu erinnern, dass die Arbeit nicht alles im Leben war. Weg von zu Hause, weg von der Arbeit. Die Luft des Meeres einatmen. Rund um den Placa Sant Jaume die kleinen, engen Gassen mit ihren zahlreichen individuellen Läden erkunden. Die Graffiti fotografieren, die hier selbst an den Hauseingängen als Street-Art-Kunstwerke zu finden waren. Stefanie fühlte sich hier richtig frei. Endlich musste sie einmal nichts über die Hintergründe zu irgendwelchen Fehltritten von Politikern recherchieren oder zu Umweltkatastrophen oder zu den jüngsten Angriffen auf staatliche Websites von Cyberkriminellen. Fünf Tage war sie weg von ihrer Redaktion, dem Blatt »24 Stunden«, für das sie im Ressort »Tagesthemen« als angestellte Redakteurin schrieb. Und Stefanie genoss jede Sekunde ihrer Freiheit. Nur ganz am Anfang, noch bevor sie ins Flugzeug gestiegen war, hatte sie kurz noch ein wenig einer aktuellen Geschichte, die sie nicht so abzuschließen vermochte, wie sie es sich vorgenommen hatte, nachgetrauert.
»Und jetzt, lieber Paul, gönne ich mir noch einen Cocktail! Hab noch einen schönen Abend!«
Paul war bereits wieder in seine Arbeit vertieft. Er richtete gerade eine neue Mailingliste für die Mitglieder des Vereins ein, bei dem er Vorstandsmitglied war. Der letzte Vorstand des Wiener Hackerspaces »Metalab« hatte nichts als Chaos zurückgelassen. Es war eine Menge Arbeit liegen geblieben, die Paul nun in seiner Freizeit aufarbeiten musste. Aber er tat es gerne. Der Hackerspace, das war seine Identität, sein Zuhause. Dort konnte er hingehen, wenn ihm zu Hause die Decke auf den Kopf fiel. Oder er Projekte im Kopf hatte, für die er den 3-D-Drucker brauchte, oder den Lasercutter oder Zeug zum Löten. Oder eine schnellere Internetverbindung, denn sein eigener Zugang zu Hause kam nicht über die 70 Mbit Download-Geschwindigkeit hinaus. Das reichte manchmal bei weitem nicht aus. Paul klopfte gerade eine wilde Kombination an Buchstaben und Sonderzeichen in die Tastatur, als der Messenger Signal noch einmal aufblinkte. Stefanies Nachricht war bei ihm angekommen. Immer wenn er an Stefanie dachte, wurde ihm warm ums Herz. Er hatte lang gebraucht, bis er sich das selbst eingestehen konnte, anfangs tat er seine Gefühle ab und redete sich ein, dass er sowieso keine Chance bei der selbstbewussten, intelligenten, superhübschen Frau hatte. Aber in Wahrheit hatte er schon lange ein Auge auf sie geworfen. Bisher hatte sie seine Annäherungsversuche nicht erwidert. Trotzdem stellte er sich ab und zu vor, wie sie wohl nackt aussah unter ihren frechen, bunten Kleidern, die sie gerne trug.
»(K)« (Kuss), schrieb er ihr zurück mit einem Emoticon.
Und: »Trink nicht zu viel ohne mich!«
Paul starrte noch eine Weile auf sein Handy, bevor er sich wieder seinen Aufgaben im Hackerspace zuwandte, aber Stefanie schrieb nicht mehr zurück. Sein Smartphone blieb still.
Kapitel 1
November 2022
»Sofort verkaufen!«, schrie Wolfgang Steinrigl als letzte Worte geschäftig in die Freisprechanlage seines Android-Telefons, bevor er gleich darauf auflegte. Eigentlich brauchte er die Kopfhörer zum Telefonieren schon lange nicht mehr. Als er vor zwei Jahren zum Finanzminister angelobt worden war, hatte er lange Zeit einen Chauffeur. Bis er vor drei Monaten sein Auto wechselte. Es gab ein großes Medienecho, als er auf die selbstfahrende Kutsche umstieg, eine von dreien in ganz Österreich. Die anderen beiden gehörten ebenfalls Millionären, wie er einer war – mit dem Unterschied, dass diese im Gegensatz zu ihm mit Politik rein gar nichts am Hut hatten. Seine Parteifreunde in der Konservativen Familien Partei (KFP) waren ebenso wenig von seinem Umstieg auf den Flexus Alpha begeistert wie seine Minister-Kollegen des Koalitionspartners. Vor allem den grünen Technologieminister wollte Steinrigl mit dem Kauf seines Flexus Alpha ärgern. Der setzte doch tatsächlich weiterhin auf Carsharing-Modelle mit E-Autos! Dabei hatte der Öko-Freak bereits mehrfach wichtige berufliche Termine verpasst. Einmal, weil er kein freies Auto gefunden hatte, einmal, weil sein E-Auto kurz vorm Ziel liegen geblieben und die Ladestation außer Betrieb war und einmal, weil die Anzeige, wie viele Kilometer ohne Stromtanken noch übrig waren, defekt war. Wie oft war Karl Schlögerl schon zum medialen Gespött geworden deswegen! Wie oft hatte er versucht, die Medienberichte über ihn zu unterbinden. Jedes Mal hatte sich Steinrigl fast zu Tode gelacht darüber.
Einem Steinrigl dagegen machten Schlagzeilen wie »Finanzminister zum Beifahrer degradiert!« nichts aus. Vor allem dann nicht, wenn sie von dieser Emanze Stefanie Laudon stammten und in dem selbst ernannten Qualitätsblatt »24 Stunden« abgedruckt waren. Hauptsache, die beliebte »Heute Mittag« feierte seinen neuen autonomen Spitzenwagen ordentlich ab. Die Journalisten von dort hatte er auch vorab zu einer Testfahrt eingeladen. Und sie hatten es ihm gedankt mit einem wohlwollenden Bericht. So funktionierte das in Österreich seit Jahren. Erfolgreich.
Sein Flexus Alpha, der konnte sich nämlich sehen lassen. Weiß war er, passend zu seiner weißen Weste, sagte sich Steinrigl beim Kauf. Oben am Dach befand sich ein 360-Grad-Laser, der die gesamte Umgebung im Umkreis von 100 Metern scannen konnte. Daneben war ein Mikrofon verbaut, das Umgebungsgeräusche sowie Sirenen herannahender Einsatzfahrzeuge hören konnte. Vorne waren links und rechts Distanzsensoren und Kameras angebracht sowie ein Radargerät. Vom integrierten GPS-System brauchte Steinrigl sowieso gar nicht zu reden. Aus der Kombination Sensordaten und Straßenplan wusste das Auto zudem immer ganz genau, wo es war und an welchen Objekten es gerade vorbeifuhr. Es konnte sowohl Straßenschilder korrekt lesen als auch berechnen, was andere Verkehrsteilnehmer als Nächstes zu tun gedachten. Sein Auto, das war die Zukunft. Und er war einer der Ersten, die damit in Österreich fahren durften. Er fuhr sogar extra nach Kalifornien, um den Spitzenwagen dort Probe zu fahren, bevor er ihn nach Österreich importierte.
Die lokale Noofle-Vertretung hatte ihm dabei geholfen, denn es lag auch in ihrem Interesse, dass autonome Autos sich rasch überall in der Welt verbreiteten. Noofle hatte intensiv mit allen Mitteln daran gearbeitet, Österreich zum »Vorzeigeland« für autonome Autos zu machen. Während die Bemühungen bei Steinrigl durch diverse Vergünstigungen beim Flexus Alpha-Import aus den USA sofort von Erfolg gekrönt waren, musste der US-Konzern jedoch rasch erkennen, dass der Technologieminister nicht so einfach zu überzeugen war. Zu groß waren seine Bedenken, dass damit der US-Autoindustrie ein Vorsprung verschafft werden würde, weil die Europäer noch nicht ganz so weit waren. Gegen die Technologie selbst hatte freilich auch der Technologieminister nichts einzuwenden. Ihm ging es letztendlich vor allem darum, etwas Zeit zu gewinnen. Zeit für die europäischen Autobauer.
Die Regierung hatte daher äußerst lange über die Förderungen und Freigabe von Teststrecken für autonome Autos verhandelt. Auch wenn sich der Slogan »Österreich als Vorzeigeland für autonome Autos« recht gut anhörte, kam es nicht sofort zu einer Einigung, denn die Bundesländer kämpften regelrecht darum, Erster zu werden. Die erste Zone für Tests befand sich letztendlich auf der A2 zwischen Graz-West und der Laßnitzhöhe in der Steiermark. Doch das Bundesland Oberösterreich folgte bereits in der zweiten Welle. Das freute Steinrigl, den gebürtigen Oberösterreicher aus St. Mergen im Attergau, besonders. Und es nützte seiner Heimatgemeinde ungemein. Genauer gesagt seinem Freund Hansi Huber. Der besaß einen Technologiebetrieb, der von den neuen Aufträgen enorm profitierte. Sein Lobbying, das über diverse externe Beraterfirmen gelaufen war, damit man nicht nachvollziehen konnte, wer dahinter steckte, war hier sehr erfolgreich gewesen. Und es war zu seiner großen Freude geheim geblieben. Was wäre das für ein Skandal gewesen, wenn das rausgekommen wäre! Auch wenn an und für sich gar nichts dabei war, wenn man ein bisschen nachhalf, bei den Förderungen von bestimmten Firmen. Oder?
Seit 1. November 2022 waren dank einer Gesetzesnovelle autonome Autos endlich auf den Straßen Österreichs zugelassen. Und Steinrigl war nun einer der Ersten, die mit einem derartigen Fahrzeug unterwegs waren. Davor hatte er schon mit einigen Modellen das freihändige Fahren auf der Autobahn ausprobiert, das seit Mitte 2019 zugelassen war. Was war das für ein Hochgenuss gewesen! Er hatte bei 120 km/h beobachtet, wie die Landschaft an ihm vorbei gezischt war und er hatte den Kühen beim Weiden zugesehen, wie wenn er mit seinem Chauffeur unterwegs gewesen wäre. Aber pssst… Eigentlich hätte er damals strikt auf die Straße sehen müssen, das war Vorschrift. Um den Mund Steinrigls bildeten sich Falten. Er lächelte. Jetzt verzichtete er freiwillig auf seinen Chauffeur, dessen Job durch das neue Auto praktisch wegrationalisiert worden war. Um den tat es ihm am Ende fast leid, denn Markus Kummer war ein guter Mann. Er war immer pünktlich, höflich, nie aufdringlich und sehr dezent gewesen. Auch wenn Steinrigl manchmal eine andere Dame als seine Ehegattin in seinem Dienstwagen mitnahm (was ab und zu vorkam), machte Kummer nie irgendeine Bemerkung. Er verhielt sich diskret. Und er konnte gut zuhören. So manches Mal sah er Dinge viel klarer, nachdem er sie Kummer anvertraut hatte.
Jetzt aber saß Steinrigl alleine in seinem Auto. Mit seinen Gedanken war er noch bei dem wichtigen Telefonat von vorhin. Draußen war es nebelig und schon fast finster. Es hatte zwischen null und ein Grad und der Nebel gefror auf dem Boden. Bei diesen Verhältnissen war Steinrigl besonders dankbar dafür, dass er nicht mehr selbst fahren musste. Es herrschte Glatteisgefahr. Steinrigl war am Heimweg einer wichtigen Fachtagung, bei der er eine flammende Rede zum Thema »Mehr privat, weniger Staat« gehalten hatte. Er wollte noch rasch einen kurzen Abstecher zu seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Thomas machen. Thomas war sein Sorgenkind. Er hatte ihm vor ein paar Wochen geschrieben, dass er einen Teil seines Grundstücks verkaufen müsse, weil er seinen Millionen-Kredit nicht zurückzahlen konnte. Die Geschichte wollte er sich persönlich anhören. So hatte der Hof doch jahrelang fette Gewinne gemacht. Warum waren da jetzt plötzlich so hohe Schulden da? Wirklich wegen der paar Melk-Roboter für den Stall? Da musste seinen Bruder wohl einer grundlegend falsch beraten haben! Es taugte also nicht jede neue Technologie etwas. Steinrigl war tief in seine Gedanken versunken.
Das selbstfahrende Auto fuhr mit knapp 98 Stundenkilometern über die Bundesstraße, als das Auto plötzlich abrupt nach links ausbrach. Der Finanzminister zuckte zusammen und starrte auf den Bildschirm vor ihm. Am Display blinkte ein violettes Strichmännchen auf. Diese grafische Darstellung bedeutete so viel wie »ein Mensch ist im Weg«. Aber aufgrund der Dunkelheit und des starken Nebels, im Winter war es um 16 Uhr praktisch stockfinster, konnte Steinrigl auf der Fahrbahn nichts erkennen. Absolut nichts. Und alles ging auch noch so schnell! Steinrigl versuchte sofort reflexartig selbst ins Geschehen einzugreifen, in dem er das Lenkrad nach rechts drehte. Genau für solche Notfälle war aufgrund der strengen Sicherheitsvorschriften in Europa überhaupt noch ein Lenkrad verbaut worden – aber nichts geschah. Im Gegenteil: Das Auto beschleunigte auf 130 Stundenkilometer und raste schnurstracks auf die Baumallee zu, die sich direkt vor dem weißen Gefährt befand. Wenige Sekunden später prallte der Flexus Alpha mit voller Geschwindigkeit an die Buche, die am Wegesrand neben weiteren zehn Bäumen stand.
Steinrigl blieb nicht einmal Zeit für einen letzten Gedanken. Nur das Gesicht seines Bruders Thomas flackerte kurz vor seinem Tod noch einmal auf. Seine Luftzufuhr wurde abgeschnitten, der linke Lungenflügel eingequetscht, der Kopf prallte mit voller Wucht gegen den Airbag. Die Scheibe zersprang beim Aufprall in Tausende kleine Einzelteile. Game over.
Kapitel 2
Plötzlich war es still. Bis auf die Krähen. Sie liebten den Nebel, der sich auf den Feldern, die direkt hinter der Baumallee lagen, festgesetzt hatte. Vom Aufprall aufgescheucht, krächzten die Tiere, als ob es um ihr eigenes Leben ginge, das gerade ausgehaucht worden war.
Wenige Meter von der Unfallstelle entfernt war ein leises Wimmern zu hören. Die 13-jährige Melanie trat in die Pedale ihres rosaroten Fahrrads. Es war so kalt, dass ihr Atem in der Luft zu sehen war. Sie hatte keine Handschuhe an. Ihre Finger waren verschrumpelt vor Kälte und ihr Gesicht leicht gerötet. Melanie verließ die Straße und radelte direkt auf den Flexus Alpha zu.
»Hallo?«, fragte die Schülerin schüchtern und mit leiser Stimme. »Geht es Ihnen gut?« Melanie blieb zuerst angelehnt am Sattel ihres Fahrrads stehen und wartete ab. Aus dem Wageninneren war keine Antwort zu hören. Das dunkelhaarige Mädchen, das ihr Smartphone aufgrund des Schocks noch mitten auf der Straße fallen gelassen hatte, wusste nicht, was es als Nächstes tun sollte. Melanie war überfordert. Eben hatte sie noch mit ihrer Oma telefoniert, die ihr befohlen hatte, nach der Schule noch beim Steinrigl-Bauern wegen der frischen Milch vorbeizufahren, als plötzlich dieses Auto von hinten kam und drauf und dran war, sie zu rammen. Melanie konnte sich nicht erklären, warum der Wagen so plötzlich beschleunigte. Es machte überhaupt keinen Sinn.
Das Mädchen stieg jetzt vom Rad ab und ging auf das Auto zu. Das Auto, das sah irgendwie komisch aus mit all den Kameras am Dach. Ihr Blick blieb aber nicht lange an den Kameras hängen, sondern wanderte ins Wageninnere. Das, was sie dort sah, schockierte sie. Da drin lag ein etwa 50-jähriger Mann, der die Augen weit geöffnet hatte. Überall war Blut. Das lief auch aus den Augen und aus der Nase. Vom restlichen Körper war kaum etwas zu sehen, weil der Mann vom Fahrersitz gerutscht war und merkwürdig verdreht dalag. Melanie wusste sofort, dass der Mann tot war. Und sie erkannte ihn. Es war ein berühmter Politiker. Einer, der fast jeden zweiten Tag im Fernsehen zu sehen war. Irgendein Minister, aber was für einer, das hatte Melanie vergessen. Und der war der Bruder vom Steinrigl-Bauern, dem lokalen Bürgermeister aus St. Mergen im Attergau. Melanie musste wegsehen, von dem vielen Blut wurde ihr übel.
Wie in Trance lief das Mädchen zurück zur Straße. Ihre Backen waren jetzt noch röter vor Aufregung als vorhin vor Kälte. Wie wild begann es zu winken, als sich das nächste Auto näherte. Sigrid Steinrigl sah Melanie gerade noch rechtzeitig und bremste. Die Reifen quietschten. Die brünette, mütterlich wirkende rundliche Frau, bei der sich bereits tiefe Falten in die Stirn eingekerbt hatten, stieg langsam aus ihrem zehn Jahre alten roten Kleinwagen aus, der bereits mehrere Dellen am Heck vorzuweisen hatte. Einen neuen konnte sich die Familie aber derzeit nicht leisten.
»Was ist passiert? Ist dein Rad kaputt gegangen?«, fragte Sigrid Steinrigl das kleine Mädchen, nachdem sie das Fenster runtergekurbelt hatte. Sie sah zuerst nur das Mädchen, nicht aber den weißen Flexus Alpha am Wegesrand. Was für ein Zufall, dass ausgerechnet die Ehefrau des Bruders des gerade verunglückten Mannes stehen blieb, dachte das Mädchen. »Nein«, antwortete Melanie und zitterte am ganzen Leib. Zu mehr Worten war sie nicht fähig. Alles ging so schnell. Und da drüben lag immerhin ein Toter. Der erste Tote, den sie je gesehen hatte. Mit dem Zeigefinger deutete Melanie auf den zerschmetterten weißen Wagen, der an den Bäumen klebte und aus dem leichter Rauch aufstieg.
Erst jetzt bemerkte Sigrid Steinrigl, dass da ein Unfall stattgefunden hatte. Sie schlug die Hände vor ihrem Gesicht zusammen und sagte stockend: »Mädchen, geht es dir gut? Bist du verletzt? Hast du schon die Rettung gerufen? Ist da noch wer drin?« Melanie schüttelte den Kopf. Sigrid Steinrigl versuchte sich zu erinnern, wo sie ihr Handy verstaut hatte. Sie hatte es während des Autofahrens nie neben sich, damit sie sich selbst nicht in Versuchung brachte. Telefonieren am Steuer stand nicht ohne Grund unter Strafe. Sie hielt sich akribisch daran. Gerade am Land wurde man wegen so etwas ja sofort angezeigt. Das Smartphone befand sich in ihrer Tasche am Rücksitz. »Hast du dein Handy in der Nähe? Kannst du 144 anrufen?« Melanie nickte. Auch wenn sie wusste, dass es sinnlos war. Der Mann im Auto war nicht mehr zu retten. Und ihr Handy hatte sie irgendwo auf der Straße verloren, sie musste es erst suchen gehen.
Sigrid Steinrigl lief unterdessen im Eiltempo auf den Flexus Alpha zu. Der Wagen kam ihr merkwürdig vor. Irgendwie neumodisch. Aber auch gleichzeitig bekannt. Wo hatte sie den schon mal gesehen? War das etwa eines dieser neuartigen Fahrzeuge, die von selbst fuhren? Ohne dass es einen Fahrer gab? Warum war dann da drin ein Lenkrad zu sehen? Das dachte sich die Bauersfrau und Gattin des Bürgermeisters von St. Mergen im Attergau. Der Gemeinde, deren Ortsschild nur noch drei Kilometer entfernt vor ihnen lag. Dann erst begannen ihre Gehirnzellen langsam weiterzuarbeiten: Hatte sich nicht der Wolfgang gerade vor kurzem so einen Wagen angeschafft? Jetzt erst schaute Sigrid Steinrigl genauer hin. Plötzlich sah sie nicht mehr das Lenkrad, sondern den Mann, der dahinter saß. Und erkannte die dichten, schwarzen Haare von Wolfgang. Und dann sah sie seine Augen. Seine offenen, weit aufgerissenen braunen Augen, von denen es fast den Anschein hatte, als würden sie aus den Augenhöhlen herausquellen. Einmal mehr schlug Sigrid Steinrigl die Hände vor ihrem Mund zusammen. Und stieß einen leisen Schrei aus. Der Schrei klang ziemlich verkorkst. So als hätte ihr gerade jemand ein Messer in den Rücken gerammt und sie hätte es geahnt. Der Schrei klang überrascht und unterdrückt gleichzeitig.
Melanie, die die Bürgermeistergattin die ganze Zeit beobachtet hatte, drehte sich dezent weg und ließ Sigrid Steinrigl mit ihrem Schmerz und Entsetzen allein. Sie suchte den Boden nach ihrem Handy ab – und fand es dann auch relativ rasch. Es lag direkt neben der Straße an der Stelle, an der sie fast überfahren worden war. Erst jetzt wählte sie den Notruf 144. »Kommen Sie rasch, auf der Bundesstraße ist ein Auto gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer ist, glaube ich, tot. Zumindest hat er seine Augen offen. Und … es ist ein Prominenter«, fügte die Schülerin am Ende leise hinzu. Sie beschrieb die Unfallstelle und machte halbwegs präzise Angaben zur Entfernung vom nächsten Ort. Dann sah sie wieder zu Sigrid Steinrigl hin.
Die war mittlerweile in die Knie gegangen und auf den Boden gesunken. Sie weinte, zitterte und trauerte. Tief versunken und nicht bereit, diese Emotionen und ihr Leid mit irgendwem zu teilen. Melanie dachte sich: Ich muss jetzt stark sein. Tapfer ging sie zur Bürgermeistergattin hin und strich ihr vorsichtig über den Rücken. Die Schwäche und Verletzlichkeit der Frau ermutigten das Mädchen, selbst mutig zu sein. Mutiger, als es eigentlich war. »Es wird alles gut«, flüsterte Melanie. Weil ihr nichts Besseres einfiel. So tröstete sie ihre Mama immer, wenn sie traurig war.
Auf den Lippen von Sigrid Steinrigl zeichnete sich ein leichtes Grinsen ab und sie murmelte leise: »Damit könntest du recht haben, Mädel.« Ein Satz, den Melanie in dieser Situation ganz und gar nicht verstand. Sie runzelte die Stirn und entfernte reflexartig ihre Hand vom Rücken der Frau.
Kapitel 3
Es dauerte nur wenige Stunden, bis sich die Meldung über den Tod des Finanzministers via Nachrichtenagentur bei den Medien des Landes verbreitet hatte. »Wolfgang Steinrigl: In den Tod gerast«, lautete eine der ersten Schlagzeilen der Online-Plattform »Heute Mittag«. Über das soziale Netzwerk Facebook verbreitete sich die Meldung in Windeseile. Die Boulevard-Plattform war deswegen immer am schnellsten bei der Verbreitung von Neuigkeiten, weil in der Redaktion bereits ein Agentur-Roboter zum Einsatz kam. Das bedeutete, dass ein Roboter die Eilmeldungen, die über Nachrichtenagenturen verbreitet wurden, automatisch online stellte. Nur über den Titel schaute noch ein Mensch, um die Nachrichten auf die Klientel abzustimmen. Text und Bild stammten direkt von der Nachrichtenagentur. Das war natürlich ein Wettbewerbsvorteil für das Medium, aber ein nicht unumstrittener. Es war schon mehr als einmal vorgekommen, dass die Schlagzeile mit einem falschen, völlig unpassenden Bild versehen war und somit das Gespött der gesamten Branche auf sich gezogen hatte. Und Medienmenschen behielten ihre Schadenfreude nur sehr selten bei sich.
»Fataler Unfall: Finanzminister tödlich verunglückt«, war in der Online-Ausgabe von »24 Stunden« zu lesen. Stolze neun Minuten nach der Meldung bei »Heute Mittag«. Als Hashtag, das war ein durch ein Raute-Symbol markiertes Stichwort, etablierte sich in den Social-Media-Diensten wie Facebook und Twitter »#steinrigl«. Es trafen im Sekundentakt neue Kurzmitteilungen dazu ein. Durch den Hashtag konnte man außerdem gleich erkennen, ob die Anzahl der Jubel- oder Trauermeldungen überwogen und was das Ableben des Ministers bei den Menschen auslöste. Unter den Kurzmitteilungen befanden sich zahlreiche Beileidsbekundungen, aber auch viele Erleichterungsausrufe und bösartige oder ironische Kommentare. Steinrigl war eben nicht bei jedem beliebt gewesen. »Wo bleibt die Sondersendung im TV?«, fragten sich einige Nutzer und schimpften auf den öffentlich-rechtlichen TV-Sender. Andere veröffentlichten Bilder, bei denen der Slogan »Mehr privat, weniger Staat«, der über einem Foto mit dem Kopf von Wolfgang Steinrigl prangerte, durchgestrichen war. So etwas nannte man ein sogenanntes Meme, das sich rasch weiterverbreitete, in dem es von vielen verschiedenen Nutzern geteilt wurde. Das gehörte zu den klassischen Internetphänomenen, die sich auch 2022 noch wacker hielten.
Wie genau der Finanzminister gestorben war und dass er mit seinem heißgeliebten, brandneuen, autonomen Auto unterwegs gewesen war, war offenbar noch nicht bekannt geworden. Zumindest gab es darüber vorerst keine Kommentare. Doch nicht nur auf Facebook und Twitter überschlugen sich die Mitteilungen zum Ableben des Finanzministers, auch in den Redaktionen des Landes ging es heiß her. Es war 19 Uhr. Viele Politik- und Chronik-Redakteure hatten bereits Feierabend oder befanden sich gerade am Weg zu Abendterminen. Die Redaktionskonferenzen waren um die Uhrzeit auch schon längst vorbei. Aber natürlich musste das Ereignis noch in die Blätter des Landes gebracht werden. In der Redaktion von »24 Stunden« saß Armin Tumler. Der 55-jährige Wirtschaftsredakteur war an dem Tag zum Abenddienst eingeteilt. Als ihn die Kollegen vom Online-Team über den Tod des Finanzministers informierten, drehte er als Erstes seine Tasse, die vor ihm stand, nach links. Auf dem Bild, das dadurch zum Vorschein kam, war eine Palme zu sehen, die ihn an seinen letzten Urlaub erinnern sollte. Armin Tumler nahm einen kräftigen Schluck aus der Tasse – und darin war kein Kaffee, sondern etwas Stärkeres. Dann seufzte er laut und machte sich widerwillig an die Arbeit.
19.33 Uhr. Das Smartphone von Stefanie Laudon vibrierte seit wenigen Minuten in immer kürzeren Abständen. Wenigstens hatte sie den Ton, also das Bling-bling, abgedreht. Aber warum hatte sie es auch unbedingt zu sich auf den Tisch legen müssen? Das war wohl die Macht der Gewohnheit gewesen, die sie jetzt aus ihrer Entspannung herausriss. Endlich hatte sie einmal komplett abschalten können, war weit genug weg von ihrem Alltag. Dort lautete ihr Credo berufsbedingt nämlich: »Immer erreichbar sein, weil, es könnte ja etwas passieren.« Jetzt saß sie gerade in einem Restaurant in der Altstadt von Barcelona. Am Placa Reial gab es zahlreiche nette Innenhöfe, rundherum herrschte hektisches Treiben. Ein paar Tische weiter führte gerade eine Gruppe von Jungs einen akrobatischen Tanz auf. Dazu dröhnte laute Musik aus dem Ghettoblaster. Nicht schlecht, die Kunststücke. Dafür musste man ordentlich trainieren. Sie stocherte noch ein wenig in der vegetarischen Paella herum, die vor ihr am Tisch stand. So richtig schmecken wollte sie ihr nicht. Da war sie wohl auf einen Touristen-Nepp reingefallen. Das Smartphone vibrierte erneut, was bedeutete, dass sie schon wieder eine neue Nachricht erhalten hatte. Stefanie legte ihre Gabel zur Seite und kaute hastig den Bissen zu Ende. Sie seufzte einmal tief und holte Luft. Dann klappte sie die Lederhülle auf, in der sie das Gerät zum Schutz vor Kratzern aufbewahrte. Sie war natürlich neugierig, was es so Dringendes gab. Nicht umsonst hatte sie sich vor mehr als zehn Jahren für den Journalismus als Beruf entschieden, obwohl die Bedingungen schon damals alles andere als rosig waren. Schlecht bezahlt. Hoher Konkurrenzdruck. Miserable Arbeitszeiten. Aber die Neugier … die Neugier und ihr großer Drang, die Welt zu verändern, ließen Stefanie jeglichen Rat ihrer Universitätsprofessoren und Lehrer, besser etwas »Gescheites« zu lernen, ignorieren.
»Steinrigl ist tot«, stand nüchtern in der Messenger-Nachricht von Facebook, die ihr ihre Freundin Meggie Winter geschickt hatte. »Freu dich, der alte Sack von Finanzminister wird uns nicht mehr das Leben schwermachen!!«, war dagegen in der Signal-Nachricht von Paul Mond zu lesen. Sie schrieb beiden kurz zurück: »WOW!!!! Was für News!« Die anderen Nachrichten waren Push-Mitteilungen von diversen Nachrichtendiensten, die sie abonniert hatte und die ebenfalls mit Steinrigls Tod Alarm schlugen. Diese konnte sie getrost ignorieren.
Die halb aufgegessene Paella, die so schmeckte, als wäre sie mit billigem Fertig-Pulver und viel zu lange gekocht worden, hatte die Journalistin nun völlig vergessen. Emotional ließ sie der Tod des Finanzministers erst einmal kalt. Es löste nichts in ihr aus. Absolut nichts. Als Privatperson hatte sie Wolfgang Steinrigl nie kennengelernt. Als Politiker hatte sie ihn in ihren Kommentaren oft genug kritisiert. Für sie war er ein unsympathischer konservativer Politiker, der das österreichische Sozialsystem immer weiter aushöhlte, dem Staat am Ende nur geschönte Bilanzen präsentierte und dabei auf die Änderungen, die das Land wirklich brauchte, vergaß. Sie verstand daher die Freude von Paul über den Tod Steinrigls. Sie selbst dachte sich eher, den vorzeitigen Tod, den hatte keiner verdient. Auch kein Arsch, der oft genug versucht hatte, bei ihrem Chefredakteur zu intervenieren, um ihre Berichte zu stoppen.
Statt weiter zu essen, begann sie aber dennoch zu recherchieren. Schließlich gab es da etwas, was sie durchaus stutzig werden ließ bei der Sache: Wie war Steinrigl eigentlich gestorben? Sie hoffte, das als Erstes auf Twitter rauszufinden. »›Mehr privat, weniger Staat‹ hat damit hoffentlich ein Ende«, schrieb einer der schärfsten Kritiker Steinrigls auf Twitter. Stefanie kannte ihn persönlich und versah seinen Eintrag sofort intuitiv mit einem Smiley. Doch das war jetzt nicht das, was sie am meisten interessierte. Verdammt, sie wollte wissen, wie der Finanzminister gestorben war!
Wolfgang Steinrigl war schon immer einer gewesen, der gerne mit teuren Dingen protzte. Interessanterweise hatte das die Bevölkerung nie gestört, im Gegenteil. Er gab den Menschen das Gefühl, dass auch sie das alles, was er hatte, erreichen konnten. Frei nach dem amerikanischen Motto: Vom Tellerwäscher zum Millionär. Zuletzt hatte er vor allem mit seinem supertollen neuen Wagen, den er eigens aus den USA hatte einfliegen lassen, ordentlich angegeben. Ein autonomes Auto. Und genau dieses war es, das Stefanie schon vor ein paar Wochen interessiert hatte. Paul hatte ihr erzählt, dass derartige Fahrzeuge in der Vergangenheit recht einfach gehackt werden konnten und dass er es geschafft hatte, in das Steuerungssystem des Fahrzeugs einzudringen. Stefanie war daraufhin neugierig geworden, sie hatte außerdem eine gute Geschichte gewittert, denn Steinrigl hatte sich auch massiv dafür eingesetzt, dass diese Autos so schnell wie möglich in Österreich zugelassen würden. Sie hatte sich da schon gefragt, ob auch Schmiergelder von der Autolobby geflossen waren oder ob das Wunderauto von Steinrigl gar ein Geschenk, eine Art Bonus, der Autolobby gewesen war. Umso faszinierender war es für sie gewesen, als Paul ihr erzählt hatte, dass es auch Laien gelingen würde, sich in das Autosystem einzuloggen.
»Das muss ich ausprobieren«, war ihr erster Gedanke gewesen. Sie hatte Paul, der keine Ahnung hatte, was sie plante, die Anleitung dafür abgerungen. Er hatte ihr per Signal-Nachricht einen Link mit den Hinweisen, die bereits im Internet kursierten, zugeschickt. Stefanie ließ es sich nicht nehmen, diese Anleitung auch Schritt für Schritt auszuprobieren. Und sie hatte es tatsächlich geschafft, ins Steuerungssystem von Steinrigls Auto einzudringen. Sie war so schockiert darüber gewesen, dass sie gleich wieder ausgestiegen war und niemandem davon erzählte. Das war ein paar Tage vor ihrer Abreise nach Barcelona gewesen.
Als sich Stefanie nun am Smartphone die Bilder ansah, die zum Tod Steinrigls bisher auf Twitter veröffentlicht worden waren, stellte sie fest: Da ist er ja, der Flexus Alpha! Das Wunderauto des Ministers. Wenn auch total beschädigt, mit zahlreichen Schrammen am Vorderheck: Das war das autonome Auto, auf das der Finanzminister so stolz gewesen war. In Stefanies Kopf begann es zu rattern. Steinrigl war tatsächlich im Auto gestorben! Konnte ihre Aktion vor der Abreise zum Tod geführt haben? Hatte sie vielleicht irgendwas im Steuerungssystem verstellt, so dass etwas davon nicht mehr richtig funktionierte? Wer konnte schon wissen, was sich in den Code-Zeilen, die sie nicht verstand, aber brav ausgeführt hatte, tatsächlich verborgen hatte? Was, wenn darin ein Befehl versteckt war, der das System manipulierte? Hätte ihr Paul das nicht im Fall der Fälle gesagt? Andererseits: Paul hatte keineswegs damit rechnen können, dass sie diese Anleitung auch tatsächlich selbst ausprobierte! Stefanie fühlte sich merkwürdig, in ihrem Bauch grummelte es. Und das lag möglicherweise nicht nur an der unterdurchschnittlichen Paella.
Sie hatte den selbstfahrenden Wagen am Bild sofort erkannt. Ein Wunder, dass das noch keiner ihrer Kollegen aufgegriffen hatte. Aus ihrem Bauchgefühl heraus, ohne lange nachzudenken, veröffentlichte sie auf Twitter folgende Frage: »Wurde Wolfgang Steinrigl von seinem selbstfahrenden Auto in den Tod katapultiert?« Wenn sie ein wenig länger darüber nachgedacht hätte, hätte sie sich diese Frage wohl besser verkniffen und zuerst einmal versucht, mit Paul abzuklären, ob sie tatsächlich eine Mitschuld an dem Tod Steinrigls haben konnte. Aber Paul wollte sie mit so etwas nicht via Signal-Nachricht konfrontieren. Klar, der Messenger galt als supersicher und sie hatten sich schon oft über Hacks auf diesem Weg ausgetauscht und es war noch nie etwas passiert. Aber jetzt betraf es SIE. Sie könnte möglicherweise in einen Mord verwickelt sein. Oder war es ein unglücklicher Unfall gewesen?
Unfälle mit teilautonomen Fahrzeugen hatte es in der Vergangenheit schon mehrere gegeben, das wusste Stefanie. Sie hatte das immer wieder gespannt mitverfolgt. Vor ein paar Jahren war etwa ein 38-Jähriger ums Leben gekommen, dessen Tesla gegen eine Leitplanke gefahren war. Das Auto hatte Feuer gefangen und der Fahrer hatte nicht überlebt. Natürlich hatten Autokonzerne damals immer dem Fahrer die Schuld gegeben. Schließlich hätte er nicht die Hände vom Lenkrad nehmen dürfen, hieß es. Aber beim neuen Nexus Alpha spielte das jetzt keine Rolle mehr. Der war genau so konstruiert, dass er völlig selbstständig fahren konnte und der Autobauer übernahm in der Regel die volle Haftung für Schäden oder Unfälle. Stefanie war daher, auch abseits der quälenden Fragen, ob sie selbst etwas damit zu tun gehabt haben könnte, sehr gespannt, wie sich die Causa Steinrigl und Nexus Alpha entwicklen würde. Sie war so gespannt, dass sie die Finger nicht von ihrem Smartphone lassen konnte, und nachsah, was sich im Netz getan hatte.
Mit ihrer Twitter-Frage hatte Stefanie eine wahre Welle an Diskussionen ausgelöst. Ihre Kurzmitteilung wurde tausendfach weiterverbreitet und Hunderte Menschen, von denen sie viele nicht kannte, antworteten ihr. Geduldig scrollte sie sich auf ihrem Handy durch die zahlreichen Kommentare in der Hoffnung, dass sich darunter auch einer fand, der ihr vielleicht weiterhelfen konnte. Schließlich war sie mit zahlreichen Sicherheitsforschern auf Twitter befreundet. Doch von diesen hatte sich vorerst keiner an der Diskussion beteiligt. Stattdessen hatten politikinteressierte Menschen geantwortet, die sich mehr für die Person Steinrigls interessierten als für selbstfahrende Autos. Der Tod des Ministers bewegte eben sehr viele Menschen emotional.
Stefanie hatte in der Eile übrigens völlig vergessen, die Ortungsdienste auf ihrem Smartphone abzudrehen. Das hieß: Ihre Kurzmitteilung auf Twitter war mit der Ortsangabe »Placa Reial, Barcelona« versehen. Derartige Ortsangaben drehte die technikaffine Journalistin, die sehr auf ihre Privatsphäre bedacht war, ausschließlich im Urlaub auf, und zwar aus praktischen Gründen. Sie nutzte die Funktion, um ihre Fotos später auf ihrem Computer besser zuordnen zu können. Jetzt aber konnte die ganze Welt sehen, dass sie gerade in Barcelona war. Und die tausendfach geteilte Nachricht, die es zu späterer Stunde auch noch in die TV-Nachrichten schaffte, konnte sie jetzt auch nicht mehr löschen. In diesem Moment fiel es der 33-jährigen Redakteurin allerdings gar nicht auf. Erst als einer ihrer Leser auf Twitter Stunden später mit der Frage: »Barcelona? Nice! Wünsche eine schöne Zeit« reagierte, bemerkte Stefanie, dass sie die Ortsangabe aktiviert hatte, und drehte diese für die nächsten Tweets gleich ab. Sie schaltete außerdem das akustische »bling bling«, das mit jeder neuen Reaktion auf ihren Tweet folgte, relativ rasch wieder ab, als die ersten Gäste von den Nachbartischen aufmerksam zu ihr rüberblickten.
Schon bald titelte die erste Online-Zeitung in Österreich: »Killermaschine Flexus Alpha«, eine weitere: »Roboter-Auto brachte Finanzminister um«. Technik-Feindlichkeit war in vielen Redaktionen noch immer weit verbreitet. Schließlich waren aus der Sicht vieler Chefredakteure auch die Social- Media-Dienste schuld daran gewesen, dass die Bedeutung ihrer Medien immer weiter sank. Die böse Technikbranche kostete sie Umsatz und Reputation. Vor allem in den Redaktionen, in denen es noch Herausgeber jenseits der 70 gab, die das Ruder einfach nicht aus der Hand geben wollten, wurde massiv Stimmung gegen alles, was mit Robotern zu tun hatte, gemacht. Die Roboter kosteten schließlich auch Jobs und waren deshalb sowieso böse. Und Technikfeindlichkeit kam im Land immer gut an. Nicht umsonst zählte Österreich seit Jahren innerhalb der EU zu den Ländern mit den meisten Skeptikern, was neue technische Innovationen betraf. Da hatte auch kein wirtschaftsliberaler Finanzminister, der zahlreiche Erleichterungen für Start-ups beschlossen hatte, die Stimmung im Land bisher auf Dauer ändern können. Unter den jüngeren Journalisten war dies freilich etwas anders, doch die hatten in den Redaktionen meist noch nicht das Sagen, sondern mussten widerwillig zur Kenntnis nehmen, was ihre Chefredakteure für eine Blattlinie verfolgten.
Bei »24 Stunden«, dem Blatt, bei dem Stefanie Laudon arbeitete, war das freilich ein wenig anders. Die Qualitätszeitung war eine der ersten in Österreich, die online auf eine Kooperation mit Facebook gesetzt hatte. Das brachte am Ende nicht nur fette Zugriffe und damit schöne Statistiken für die Werbeindustrie, sondern auch viel Geld. Stefanie hatte diese Kooperation initiiert, auch wenn sie selbst sehr skeptisch bei dem Gedanken war, die Leser der Zeitung damit in die Fänge einer einzigen großen, kommerziellen Firma zu treiben. Einer Firma, die dann praktisch im Alleingang bestimmen konnte, welche Inhalte auf welche Art und Weise angezeigt und platziert wurden. Nichtsdestotrotz überwogen für das Medienhaus klar die Vorteile. Und Stefanie war jung und clever genug, um hier mitzuspielen und die Vorteile zu erkennen, die derartige Kooperationen mit sich brachten. Sie kannte sich mit technischen Dingen irrsinnig gut aus. Es wurde ihr praktisch in die Wiege gelegt, denn ihr Vater war Informatiker und lehrte sie schon in jungen Jahren das Programmieren. Die Journalistin erinnerte sich daran, wie sehr ihr das spielerische Arbeiten am Rechner Spaß gemacht hatte. Sie hatte ihre Kenntnisse auch noch weiter vertieft, als sie älter war. Für ein Informatikstudium hatte ihr dann allerdings doch ein wenig die Leidenschaft gefehlt. Sehr zur Enttäuschung ihres Vaters, der sie gerne als seine Nachfolgerin in der Firma etabliert hätte. Aber Herr Laudon hatte immer akzeptiert, dass seine Tochter ihren eigenen Kopf hatte. Aufzwängen wollte er ihr nie etwas. Gelernt hatte die Journalistin von ihrem Vater allerdings trotzdem wirklich viel. Zu ihrem früh erworbenen Wissen zählte etwa auch, dass man immer gewisse Tools einsetzen sollte, um seine Online-Aktivitäten zu verschleiern. Nur ihre Freundin Meggie weigerte sich bisher konstant, auf den verschlüsselten Messenger, den sie mit dem Großteil ihrer Freunde, Bekannten und Informanten gleichermaßen zur mobilen Kommunikation einsetzte, zu wechseln. Ihr Problem, dachte sich Stefanie. Dabei wäre es doch so einfach, zu wechseln.
Das Smartphone wollte an diesem lauen Abend in Barcelona einfach nicht mehr verstummen. Die grauenvolle Paella war mittlerweile abserviert und die Journalistin hatte vom Kellner die Rechnung verlangt. Die turnende Männerschar war bereits weitergezogen und am Platz kehrte langsam ein wenig Ruhe ein. Die meisten Touristen zogen sich jetzt in eine der zahlreichen Bars, die es in der näheren Umgebung gab, zurück oder verschwanden nach langen Sightseeing-Tagen schlichtweg in ihre Hotels. Am Tisch vor Stefanie vibrierte es erneut. Jetzt, kurz vor 23 Uhr, schrieb ihr auch endlich die eigene Redaktion eine Nachricht.
»Steinrigl tot, autonomes Auto involviert – wie schnell kannst du hier sein?«
Stefanie wetzte ungeduldig auf ihrem Stuhl herum. Eine innere Unruhe durchströmte ihren Körper. Was tun? Zurückfliegen oder abschalten? Eigentlich hätte sie noch drei weitere Tage in dieser wunderschönen, aber doch sehr von Touristen überlaufenen Stadt verbracht. Der Todesfall Steinrigl interessierte sie aber aus journalistischer Sicht sehr. Sie war neugierig: War es ein Unfall, war es ein technischer Defekt oder war es Mord? Hatte das Lobbying der Autoindustrie etwas damit zu tun? Oder gar sie selbst und ihr unerlaubtes Eindringen in das System? Alles war möglich! Ihr Herz schlug schneller, als sie an diese Fragestellungen dachte und wie sie diese aufarbeiten würde. Da gab es eigentlich nichts mehr zu überlegen. Sie schrieb ihrem Chef eine E-Mail, um ihm mitzuteilen, dass sie es bis morgen Mittag zurück nach Wien schaffen könnte. Dann rief sie bei der Airline an, um ihren Flug umzubuchen. Das war, wie sich herausstellte, gar kein Problem. Die Morgenmaschine am nächsten Tag war nicht ausgebucht. Stefanie kaufte sowieso immer ein sogenanntes »flexibles Ticket«, das man jederzeit umbuchen oder stornieren konnte. Zu oft war es ihr in der Vergangenheit schon passiert, dass sie dringend in die Redaktion zurückmusste. Im Ressort »Tagesthemen«, in dem sie fix angestellt arbeitete, ging es eben um das Tagesgeschehen. Die Redaktion zahlte ihr die Kosten für den Aufpreis des Tickets außerdem immer ohne Murren. Es war nicht das erste Mal, dass sie es auch in Anspruch nehmen musste.
Stefanie winkte den hübschen Kellner, mit dem sie kurz zuvor noch geflirtet hatte, herbei, damit ihr dieser endlich ihr Wechselgeld retourbrachte. Das hasste sie an Spanien, dass man hier in den Restaurants am Ende immer so lange warten musste. Wenig später brachte er ihr die fünf Euro 20 Cent in der Schale an den Tisch und lächelte sie ein letztes Mal an, bevor er sich weiterer Kundschaft zuwandte. »Adios«, sagte sie, doch das hörte er nicht mehr. Sie war schließlich nur eine weitere Touristin, die Geld in die spanische Stadt brachte. Über den Placa de George Orwell, an dem zahlreiche Einheimische in Tapas-Bars herumsaßen und sich lautstark unterhielten und lachten, ging Stefanie schnurstracks in ihr Hotel. Dass die Leute ausgerechnet an dem Platz so viel Spaß hatten, an dem an Orwell und an 1984 gedacht wurde! Das war fast ein wenig ironisch. Den Rest des angebrochenen Abends verbrachte Stefanie mit weiterer Online-Recherche. Wie oft war der Flexus Alpha bereits in Unfälle verwickelt gewesen? Wie gingen diese in der Regel aus? Wie war das selbstfahrende Auto programmiert? Kurz nach zwei Uhr früh drehte die blondhaarige Journalistin erschöpft ihren Laptop ab und gähnte. Morgen, das wusste sie, würde ein langer Tag werden.
Kapitel 4
Das Treiben in der Redaktion war hektisch wie immer, als Stefanie Laudon am nächsten Tag am frühen Nachmittag hereinplatzte. Bis zum Redaktionsschluss der Länderausgabe um 17.30 Uhr waren noch mehrere Stunden Zeit. Am Bildschirm im Newsroom blinkten die neuesten Zugriffszahlen, rechts davon war der Fernsehapparat ohne Ton aufgedreht. Die Bilder des zertrümmerten Flexus Alpha waren in Dauerrotation zu sehen. Am Screen poppte die Frage auf, die Stefanie Laudon bereits am Vorabend gestellt hatte: »War das selbstfahrende Auto für den Tod von Wolfgang Steinrigl verantwortlich?« Nach den Bildern des Todesfahrzeugs wurde ein Foto der 13-jährigen Melanie eingeblendet. Sie war der erste Mensch an der Unfallstelle. »Ich bin nach der Schule mit dem Rad ins Dorf gefahren. Es war ganz nebelig, aber ich merkte, dass hinter mir ein Auto war. Das Auto hat dann ganz plötzlich beschleunigt. Ich habe mir gedacht, dass der Mann mich überfahren wollte. Ich habe keine Ahnung, warum das Auto auf mich zugerast ist. Ich hatte große Angst davor, zu sterben. Doch dann ist es plötzlich doch noch nach links ausgewichen«, schilderte Melanie den Vorfall. Sie war die einzige Augenzeugin gewesen. Direkt dabei, als der Finanzminister gestorben war. Und selbst fast Opfer des selbstfahrenden Autos. Sie hatte auch den Aufprall mit angesehen. Dazu sagte sie jetzt im Fernsehen: »Es war schrecklich. Es war überall Blut, als ich nachgesehen habe, ob er noch lebte.«
Der Text klang fast ein wenig wie auswendig gelernt oder die 13-Jährige war einfach schüchtern und hatte vorab einstudiert, was sie sagen würde. Eine grauenhafte Vorstellung, dass ein Kind so etwas mit ansehen musste und kurz davor selbst noch eine massive Todesangst gehabt hatte. Die Bilder und Gefühle werden Melanie wohl ihr Leben lang nicht mehr aus dem Kopf gehen, dachte Stefanie, bevor sie sich an ihre eigentliche Arbeit erinnerte. Darüber nachzudenken, wie es der kleinen Melanie ging, war schließlich nicht ihr Thema des Tages. In der Geschichte der Kleinen sowie im Privatleben von Wolfgang Steinrigl wühlten bereits die Kollegen herum. Stefanie kam es, anders als ihren Kollegen bei der Boulevard-Presse, auch nicht in den Sinn, die 13-Jährige an den Pranger zu stellen und wild darüber zu spekulieren, ob nicht das Mädchen mit ihrem Rad einfach zu weit in die Mitte der Fahrbahn geraten war und das Auto gar keine andere Wahl gehabt hatte, als ihr auszuweichen. Bei »Heute Mittag« waren derartige Gerüchte zu lesen.
Stefanies Aufgabe hingegen war es, die technischen Hintergründe zum selbstfahrenden Noofle-Fahrzeug zu recherchieren.
Noofle hatte natürlich, wie fast alle Autobauer, die etwas auf sich hielten, auch in der Vergangenheit schon teilautomatisierte Fahrzeuge auf die Straßen gebracht. Die hatten sich allerdings eher mittelmäßig verkauft und waren, technologisch betrachtet, bestenfalls Durchschnitt. Doch mit dem Flexus Alpha war es dem Konzern tatsächlich gelungen, das allererste Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das gänzlich ohne menschliche Hilfe unterwegs war. Ein Auto, in dem der Passagier sogar hinten Platz nehmen konnte, wenn er wollte. Es war möglich, in Ruhe Nachrichten zu konsumieren, Präsentationen vorzubereiten oder das großflächig aufgerüstete Unterhaltungsprogramm inklusive Brillen, die einem eine veränderte Realität vorgaukelten, in Anspruch zu nehmen. Die meisten Menschen, die mit dem Flexus Alpha unterwegs waren, saßen aber trotzdem noch vorne. Und ein Lenkrad, das man im Zweifelsfall bedienen konnte, gab es auch noch. Sich beim Autofahren zurückzulehnen und das Ruder gänzlich abzugeben, das schafften die ersten Nutzer der neuen Technologie emotional dann doch noch nicht. Steinrigl hatte sich zwar bei einem Pressetermin mit seinem neuen Flexus Alpha mit beiden Händen winkend am Rücksitz ablichten lassen, aber am Unfalltag war er dann doch vorne im Auto gesessen, wie Stefanie messerscharf festgestellt hatte.
Nachdem die Entscheidung im Straßenverkehr beim Flexus Alpha gänzlich in den Händen der Maschine lag, musste Stefanie für ihren Artikel eine alte Debatte ausgraben, die sie eigentlich schon lange Zeit als abgeschlossen betrachtet hatte. Da gab es schließlich eine jahrelange Vorgeschichte, die niemand besser im Gedächtnis hatte als die 33-jährige Journalistin von »24 Stunden«.
Selbstfahrende Autos müssen, seit sie in Österreich auf den Straßen zugelassen sind und eingesetzt werden dürfen, auch über Leben und Tod entscheiden. Doch nach welchen ethischen Prinzipien sollen autonome Autos dabei vorgehen? Genau über diese Frage hatte es bereits in der Vergangenheit heftige Diskussionen gegeben – nicht nur in Österreich. Das Thema betraf schließlich die gesamte Welt. Forscher hatten versucht, zu einem Ergebnis zu kommen, indem sie mehrere Tausend Menschen befragt hatten. Nur einigen konnte man sich einfach nicht. Es hatte dazu Krisengipfel ähnlich den Welt-Klimagipfeln gegeben, bei denen hochrangige Forscher auf den Gebieten der Künstlichen Intelligenz, Robotik, Computer Vision und Ethik mit Politikern, die entsprechende Gesetze zu verabschieden hatten, und Wirtschaftstreibenden, Autobauern und Industriellen zusammengetroffen waren. Doch rausgekommen war dabei meistens nichts. Am Ende waren die USA mit einer eigenen Regelung vorgeprescht, von der man eigentlich erwartet hatte, dass sich auch Europa daran orientieren werde.
Die Einigung sah so aus: Das Lenkrad im Auto, das sollte bleiben. Der Mensch darf sich damit immer über die Maschine stellen und selbstständig eine Entscheidung über das Fahrverhalten seines Fahrzeugs fällen und in die Geschehnisse eingreifen. Die Insassen dürfen zudem nie vom Autopiloten in Lebensgefahr gebracht werden. Falls dies doch passiert, haftet der Autohersteller.
Für den Fall Steinrigl bedeutete dies Folgendes: Selbst wenn der Flexus Alpha die 13-jährige Radfahrerin praktisch erst in letzter Sekunde entdeckt hatte, hätte das Auto seinen Insassen schützen müssen und nicht die Radfahrerin. Es hätte ihr nicht so ausweichen dürfen, dass damit das Leben des Politikers gefährdet gewesen wäre.
Diese Bestimmung mag zwar absolut nicht ethisch klingen, aber sie war der einzig gangbare Weg, um die Entwicklung der selbstfahrenden Autos am Ende voranzutreiben. Wer kaufte schon einen Wagen, der einen umbringen könnte? Die Entwicklung wäre komplett im Sand versackt und nicht weiter voran getrieben worden. Gestoppt von Gesetzen.
Für so manch einen Autobauer war diese Regelung sowieso nicht ideal. Sie hatten schon längst Fahrzeuge in petto gehabt, die gänzlich ohne Lenkrad auskamen. Auch Noofle hatte den Flexus Alpha schon ohne Lenkrad angekündigt gehabt, und es hatte aufgrund der neuen Gesetze Verzögerungen gegeben.
Auch in Europa war diese Regelung bereits in Gesetzesentwürfe eingeflossen – allerdings wie es in der EU üblich war, je nach Nationalstaat ein bisschen unterschiedlich. Außerdem waren manche Staaten langsamer und schneller unterwegs. Österreich zählte neben Finnland, Deutschland und Norwegen zu den ersten Ländern, die ein entsprechendes Gesetz umgesetzt hatten. Österreich hatte sogar bereits an einem Alleingang gearbeitet, der in Kraft getreten wäre, wenn die EU-Regelung gescheitert wäre. Diese hätte vorgesehen, dass der Fahrer im Fall des Falles immer die Letztverantwortung hat. »Wir müssen Vorreiter sein«, hatte es dazu aus dem Mund von Wolfgang Steinrigl noch vor wenigen Monaten getönt und der Technologieminister hatte die Regelung widerwillig abgenickt. Welch Ironie, dachte sich Stefanie Laudon. Ausgerechnet Wolfgang Steinrigl hatte sich vehement für die flächendeckende Zulassung selbstfahrender Autos in Österreich eingesetzt. Und jetzt starb er in einem.
Das Argument für eine derart schnelle gesetzliche Regelung lautete, dass man damit die österreichische Wirtschaft weiter ankurbeln könne. »Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut«, war ein Leitspruch der Regierungspartei. Im Falle der selbstfahrenden Autos spielte Österreich aber tatsächlich eine wichtige Rolle am internationalen Markt. Sowohl der österreichische Leiterplatten-Hersteller AT&S, Infineon, als auch das österreichische Technologie-Unternnehmen TTTech mit Sitz in Wien lieferten nämlich wertvolle Bauteile für die selbstfahrenden Autos. Die Akzeptanz der autonomen Autos bei der Bevölkerung war daher von Anfang an sehr gut und die Technologie wurde als positiv und alternativlos wahrgenommen. All dies fasste Stefanie in einem Hintergrund-Beitrag, für den in der Printzeitung stolze zwei Seiten vorgesehen waren, zusammen. Sie musste nur wenige Fakten noch einmal überprüfen, das meiste davon hatte die Journalistin noch im Kopf, weil sie oft genug darüber berichtet hatte. Sie galt als Expertin auf diesem Gebiet.
Natürlich hatte es auch in Österreich die ethischen Diskussionen rund um die Rolle des Menschen am Steuer gegeben. Stefanie konnte sich noch zu gut an die Frage aller Fragen erinnern: »Ist der Mensch überhaupt in der Lage, sich im Verkehrsgeschehen zurechtzufinden, wenn er davor gerade etwas ganz anderes gemacht hatte wie telefonieren oder Videos ansehen?« Systeme zur Fahrerbeobachtung ergaben, dass die durchschnittliche Reaktionszeit in so einem Fall bei 15 Sekunden lag – zu lang, um Unfälle zu verhindern. Und damit wäre eine derartige Regelung, dass der Fahrer am Ende immer die Verantwortung habe, eigentlich fahrlässig gewesen. Gott sei Dank hat man sich hier dank den Vorgaben der EU noch anders entschieden, dachte die Journalistin. Stefanie hatte das oft genug kritisiert, doch die Wirtschaftslobby mit ihrem »Österreich muss Vorreiter sein« war stärker als eine einzelne Journalistin. Die anderen Medien hatten diesen Aspekt in ihrer Berichterstattung großteils vernachlässigt, weil von Seiten des Wirtschaftsministeriums regelmäßig Gelder aus Inseraten flossen. Und das war in diesen für Medienhäuser seit Jahren wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer wichtiger.
Zahlreiche internationale Wissenschaftler hatten in der Debatte argumentiert, dass man regelkonforme Verkehrsteilnehmer immer bevorzugen müsse. Andere hatten dafür plädiert, dass jegliche Gewichtung von Menschenleben strengstens verboten gehört – außer es betraf den Insassen. Stefanie dachte an die 13-jährige Radfahrerin und das Auto. War dieses ausgewichen, obwohl die Sensoren eigentlich anzeigen hätten müssen, dass es glatt und die Fahrbahn nass war? Hätte der Flexus Alpha nicht wissen müssen, dass er damit die Sicherheit seines Insassen gefährdete? Oder hatte das Auto lediglich den Radius falsch bemessen und beim Ausweichen einen Fehler gemacht? Das alles würde darauf hindeuten, dass sie selbst am Ende absolut gar nichts mit dem Tod Steinrigls zu tun gehabt hätte. So ein Algorithmus ließe sich sicherlich auch nicht ändern, wenn man in das Steuersystem eingedrungen war. Oder? Stefanie beschäftigte noch immer sehr, dass sie nur wenige Tage vor dem Tod des Ministers dessen Flexus Alpha aus der Ferne hätte steuern können.
Zehn Minuten vor dem Print-Redaktionsschluss war sie mit ihrer Analyse fertig: »Autonomes Auto: Rad wichtiger als Insasse?« Sie lehnte sich in ihrem Bürosessel zurück, ließ die Arme fallen und atmete tief durch. Dann schrieb sie Paul eine verschlüsselte Nachricht: »Ich glaube, ich weiß, warum Steinrigls Auto verunglückt ist.«
Paul antwortete zügig: »*Gespannt bin*.«
Stefanie hatte aber jetzt keine Energie mehr, um ihm noch einmal zu antworten. Sie war fertig für heute. Heim und ab in die Badewanne. Gerade wenn es draußen kalt und nebelig war, half ihr am ehesten ein Entspannungsbad beim Abschalten und Loslassen vom Alltagsstress. Ausgepackt hatte sie ihren Koffer aus Barcelona auch noch nicht. Aber das würde sie auf morgen verschieben. Jetzt hatte sie sich ihren Feierabend verdient!
Kapitel 5
»Ich hab’s dir ja gesagt, Miro. Das mit der Zulassung in Österreich, das war ein Fehler. Wir hätten warten müssen. Das Land ist zu klein und die Absätze bei weitem zu niedrig, als dass wir uns jetzt deswegen unser Geschäft ruinieren lassen«, sagte Josef Brand am Telefon zum österreichischen Noofle-Geschäftsführer. Bei dem Autokonzern liefen die Telefone heiß, seit die ersten Medien – allen voran das Blatt »24 Stunden« – mit den Spekulationen begonnen hatten, dass die Sicherheit des Fahrzeuginsassen in dem Fall weniger wichtig gewesen sei als die einer 13-jährigen Radfahrerin. Der Todesfall des österreichischen Finanzministers hatte es auch weit über die Grenzen Österreichs hinaus in die Medien geschafft. Es wurde praktisch weltweit darüber berichtet. Und überall wurde die Marke Noofle genannt. Klar – schlechte Presse war gleichzeitig auch gute Presse –, und in Brasilien zum Beispiel, da konnte der Konzern sogar aufgrund des Vorfalls bereits leicht steigende Absatzzahlen des Flexus Alpha verzeichnen. Dort mochte man nämlich keine Finanzminister. Und in den Köpfen der Menschen dort blieb vor allem der Markenname »Noofle« hängen.
Aber in Österreich und im restlichen Europa, da versuchten nun viele Kunden, ihre Vorbestellungen zu stornieren. Gott sei Dank hatte man bei Noofle die Verträge allerdings so gestaltet, dass ein Rücktritt nur schwer möglich war. Das allerdings verärgerte die Kunden jetzt erst recht. Die drohten nun wiederum damit, an die Presse zu gehen. Irgendwie musste Brand also den Super-GAU verhindern.
»Weiß man schon Näheres? Habt ihr den Hergang des Vorfalls schon fertig analysiert?«, fragte Brand von der Unternehmenskommunikation.
»Noch nicht ganz. Wir warten da noch auf Informationen aus Kalifornien. Die Zeitverschiebung, du weißt. Aber es wird einige Überraschungen geben«, sagte Miro Slavic. »Es sieht so aus, als hätte es gar nichts mit dem Rad zu tun. Aber wir müssen noch abwarten.«
Abwarten. Hmm. Das war gar nicht das, was Brand hören wollte. »Warum hat das Auto eigentlich nicht von selbst den Notruf gewählt? Das hätte es doch beim Aufprall auf den Baum sofort tun müssen!«, forschte Brand.
»Ja, das ist ja das Merkwürdige. Ab 16.55 Uhr reagierte der Flexus Alpha scheinbar nicht mehr so, wie er es eigentlich hätte tun sollen. Um 17.10 Uhr kam es dann zum Crash. Das Mädchen am Rad, das war nur zufällig da auf der Straße vor unserem Wagen«, erklärte Slavic. Er erzählte damit eigentlich bereits mehr, als er offiziell sollte. Es galt in der Causa noch eine strikte Geheimhaltungspflicht, auferlegt von der Konzernzentrale in Kalifornien. Nichts durfte nach außen dringen. Und die Aufgabe eines Kommunikationschefs war es schließlich, zu kommunizieren. Slavic bereute daher sogleich auch wieder, was er ausgeplaudert hatte.
»Weiß die Polizei das schon?«, fragte Brand.
»Nein, weiß sie nicht. Wir haben ihr bisher nur den Zeitpunkt des Crashs übermittelt. Und das soll auch momentan so bleiben. Also erzähle auf keinen Fall etwas weiter!«
»Lass uns morgen wieder telefonieren, da haben wir hoffentlich schon mehr Informationen.«
Brand seufzte tief. Für ihn war dieser Wissensstand, also sowohl der offizielle als auch der inoffizielle, äußerst unbefriedigend. Er merkte aber, dass es aussichtslos war, weiter nachzufragen. Wenn da nicht diese Medien wären, die immer alles so drehten, wie es ihnen gerade passte. Von wegen das Auto war dem Mädchen ausgewichen und opferte das Leben des Insassen! Das war eine bodenlose Frechheit, so etwas ungeprüft zu behaupten. Absolute »Fake News« und pure Spekulation.
Zum Verkaufsstart des Flexus Alpha in Österreich war noch ein Jubelbericht nach dem anderen zu lesen gewesen über die große, goldene Zukunft des autonomen Fahrens. Jahrelang waren die Roboter-Autos als glorreicher Ausweg aus der Mobilitätskrise abgefeiert worden. Die Roboter-Autos, die die Welt retten.
Wenn die Sensoren der Fahrzeuge miteinander kommunizierten und man damit den Verkehrsfluss so optimieren könnte, dass es nie wieder zu Staus käme: Das wäre der Traum aller Autofahrer! Und wenn es keine Unfälle mehr gäbe, die von rücksichtslosen Fahrern verursacht wurden. Oder wenn die Roboter-Autos einen bequem auf Bestellung von Ort A nach Ort B brächten, ohne dass sie einem selbst gehörten. So viele Menschen hatten gejubelt, als Noofle – sowie auch die Konkurrenz – ihnen erzählt hatten, dass das in Österreich bald alles Realität werden würde.
Auch über die tolle Funktion, die vorsah, dass die Kameras der selbstfahrenden Autos als Überwachungskameras fungieren konnten, hatten sich viele bereits im Vorfeld gefreut. Nie wieder blieb Vandalismus an Fahrzeugen unbemerkt! Oder Fahrerflucht! Auch wenn das Wort künftig freilich eine andere Bedeutung erlangen müsste. Würde es schon mehr selbstfahrende Autos auf den Straßen geben, wäre dieser Vorfall auch aufgezeichnet worden und das Video dazu sofort von der nächsten Polizeistation abrufbar gewesen, dachte sich Brand. Die österreichische Datenschutzkommission hatte diese Funktion der Überwachungskameras hierzulande bereits vor dem Start der autonomen Autos genehmigt. Das war ganz einfach gewesen. Der Autokonzern hatte sich hier in seiner Argumentation an der Position der Wiener Verkehrsbetriebe orientiert, die ihre Videoüberwachungsanlage nach einem befristeten Probebetrieb ebenfalls genehmigt bekamen, weil sie einen »positiven Einfluss auf die Schadensverhütung im Bereich der U-Bahn-Garnituren« besitzen würde. Dadurch wurde eine unbegrenzte Registrierung der Kameras in der U-Bahn für »sachlich gerechtfertigt« angesehen. Genauso hatte auch Noofle argumentiert, als sie ihre Pläne zur Aufzeichnung von Kameras eingereicht hatten – und sie waren damit problemlos durchgekommen. War man bei sogenannten »Dashcams«, die Fahrer selbst im Auto montiert hatten, noch kritisch gewesen und hatte sie kategorisch abgelehnt, war das bei den Kameras der selbstfahrenden Autos von Noofle gar kein Problem mehr. Das hatte selbst Brand überrascht. Doch das brachte natürlich auch für den Konzern enorme Vorteile mit sich: Auch Noofle würde die Bilder aus den Kameras für seine Zwecke nutzen. Das konnte ihnen so schnell keiner nachweisen und die Gesetze waren diesbezüglich vor Jahren, als es den großen Big-Data-Hype gegeben hatte, erheblich aufgeweicht worden. Sie würden die Daten einerseits dazu nutzen, um damit die Algorithmen zu füttern, die sich ständig automatisch weiterbildeten und mit denen das Verkehrsflusssystem verbessert werden konnte, andererseits konnte man diese Daten sicher auch eines Tages an Versicherungen verkaufen. Selbst wenn die klassischen Versicherungen, die, seit es immer mehr vernetzte Cars auf den Straßen gab, fahrstilabhängig funktionierten und mit selbstfahrenden Autos praktisch obsolet wurden, sagte sich Brand, würden sich die Konzerne schon wieder etwas Neues einfallen lassen, das ihnen von Nutzen war. Oder aber man konnte die Daten direkt den Behörden für ihre »vorausschauenden Kriminalitätsanalysen« zur Verfügung stellen, die gerade immer beliebter wurden. Auch die würden sicherlich Geld dafür zahlen, schließlich ging es hier um »nationale Sicherheit«. Ja, die Behörden, die hätten diese Daten sicherlich gerne.
Doch nicht nur Brand dachte so. Bei der Bevölkerung selbst kam Videoüberwachung sowieso seit Jahren gut an. Das subjektive Gefühl von Sicherheit, das war den Menschen wichtig. Nur wenige Stimmen hatten sich kritisch dazu geäußert und durchschaut, dass Videokameras in der Praxis nichts weiter bewirkten, als sich sicherer zu fühlen. Verbrechen wurden damit freilich keine verhindert. Stefanie Laudon etwa, diese Journalistin von »24 Stunden«, wetterte seit Jahren gegen den Ausbau von Videoüberwachungssystemen. Brand hatte schon viel von dieser Journalistin gelesen – und ihren Social-Media-Account auf die »Watchlist« setzen lassen. Das bedeutete, dass es bei Noofle eine Datenbank gab, in der vermerkt war, wann, wie oft und mit wem Stefanie Laudon via Social Media kommunizierte. Der US-Geheimdienst NSA bezeichnete diese Daten als »Open Source«, schließlich waren sie jedem öffentlich zugänglich. Und Social Media Monitoring wurde seit Jahren von vielen Unternehmen eingesetzt. Noofle hatte ein derartiges System weltweit im Einsatz. Stefanie Laudon war allerdings die einzige Journalistin aus Österreich, die es bisher auf diese Liste geschafft hatte. Sonst war Brand noch niemand aufgefallen, der seinem Konzern wirklich gefährlich werden könnte.
Jetzt war diese Laudon auch noch die Erste gewesen, die Zweifel am Unfalltod des Politikers geäußert hatte und stattdessen das Auto verantwortlich machen wollte. Dieses Miststück, dachte Brand. Die hatte keine Ahnung, wovon sie schrieb. Fake News, absolute Fake News. Vielleicht war es jetzt an der Zeit, mal die gesammelten Social-Media-Daten auszuwerten und einzusetzen, dachte sich Brand.