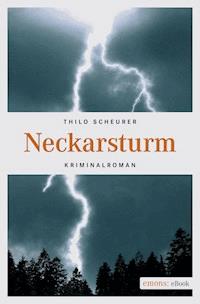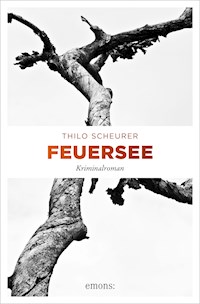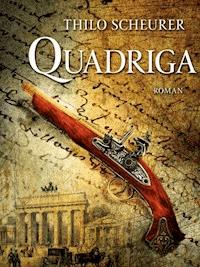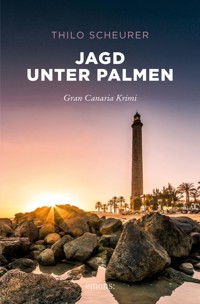
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Rasante Ermittlungen unter kanarischer Sonne. Nachdem Kriminalhauptkommissarin Sofia Bitter nur knapp eine schwere Schussverletzung überlebt hat, zieht sie sich in das alte Haus ihrer Großeltern auf Gran Canaria zurück. Aber statt der erhofften Ruhe erwartet sie dort der spektakulärste Raubüberfall, den das Urlaubsparadies je gesehen hat. Sofia kann es nicht lassen und stellt Nachforschungen an – sehr zum Ärger des spanischen Ermittlers Inspector Jefe García. Doch um den Fall zu lösen, müssen die beiden zusammenarbeiten, denn die Täter schrecken vor nichts zurück ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thilo Scheurer, Jahrgang 1964, lebt und schreibt in einer Kleinstadt am Rande des Schwarzwalds. Er ist Mitinhaber eines kleinen Softwareunternehmens. Aus seiner Feder stammen mehrere Abenteuer- und Kriminalromane. Der Autor ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2025 Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock/tb-photography
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-270-3
Gran Canaria Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Manche Leute glauben,Durchhalten macht uns stark.Doch manchmal stärkt unsgerade das Loslassen.
Hermann Hesse
Prolog
Zweifellos ist die Erfahrung, von einem Projektil getroffen zu werden, äußerst intensiv. Zwar handelt es sich lediglich um einen eher kleinen, acht Gramm leichten Metallklumpen. Doch dieser Metallklumpen verlässt mit vierhundertfünfzig Metern pro Sekunde die Mündung einer Pistole. Das ist schneller als der Schall. Noch bevor du den Knall hörst, dringt das Geschoss in deinen weichen, wehrlosen Körper und verrichtet sein zerstörerisches Werk.
Schusswunden bluten nicht. Zuerst jedenfalls. Solange kein großes Blutgefäß oder Organ getroffen wird, gibt es nur ein Loch, aus dem irgendwann Blut sickert. Verhängnisvoller sind vielmehr zerfetztes Gewebe, zersplitterte Knochen oder durchtrennte Nervenstränge und Sehnen entlang des Schusskanals. Die hohe Geschwindigkeit des Projektils hinterlässt im Körper eine Verwüstung, die so absolut ist, als hätte jemand eine Stahlstange hindurchgerammt. Es gibt kein Entkommen. Außer – du drückst zuerst ab.
Ich hatte in jener Nacht nie eine Chance gehabt, zuerst abzudrücken. Ich war einem Verdächtigen auf die Spur gekommen und verfolgte ihn. Doch der Mann, zu dem es weder einen Namen noch ein Gesicht gab, hatte mich längst bemerkt. Sein Arm schwang herum, Mündungsfeuer blitzte auf. Als erster Ermittler überhaupt konnte ich in diesem winzigen Moment einen Blick auf das Gesicht unter der Kapuze erhaschen. Für mich war es da bereits zu spät. Erstarrt zu völliger Bewegungsunfähigkeit, glaubte ich, im Zentrum einer Explosion zu stehen, als das Geschoss in meiner Schulter einschlug. Ich hätte nicht sagen können, was mich mehr überraschte, die ausbleibenden Schmerzen oder diese unglaubliche Wucht, die mich jäh von den Füßen riss.
Da lag ich nun auf der Straße mit dem Gefühl der völligen Schwäche. Ich spürte, dass sich jemand näherte und mich begaffte wie einen zertretenen Käfer. Mit dem nächsten Atemzug verließ die Zeit ihren linearen Pfad. Sie schien stillzustehen, sogar rückwärtszulaufen. Dann ein schockierend lauter Knall, der sich in mein Gehirn bohrte, und ich meinte, abermals die unglaubliche Wucht des Einschlags zu spüren.
Der Schmerz kündigte sich mit kribbelnder Hitze an. Es folgte ein Brennen wie von heißem Wasser, das sich schnell ins Unerträgliche steigerte. Und dieses Unerträgliche breitete sich von der rechten Schulter den Arm hinunter und auf der anderen Seite bis zur Brust aus. Zum Glück hatte die menschliche Natur eine phänomenale Lösung dafür parat: Ohnmacht. Eine Ohnmacht, die auch meine Erinnerung an das Gesicht unter der Kapuze verblassen ließ.
Schon oft habe ich mich gefragt, an welcher Stelle ich anders entscheiden würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Denn ich glaube, dass all unsere Entscheidungen, ob richtig oder falsch, uns nicht nur weiter in die Zukunft bringen. Die falschen können zudem Lawinen auslösen, die den Abhang hinunterstürzen, immer mächtiger werden und uns zu zermalmen drohen. Und ich hatte in jener Nacht eine gewaltige Lawine losgetreten.
1
Die mondlose Nacht würde ihr Vorhaben begünstigen. Ein ebenso kühnes wie dreistes Vorhaben, wie es die Welt bisher nur ein Mal gesehen hatte. Und bei diesem einen Mal, Ende der siebziger Jahre des vorherigen Jahrhunderts, war freilich alles viel einfacher gewesen: kaum Zugangskontrollen, keine Kameras und nur ein Wachmann. Dennoch währte die Freude über den Erfolg damals nur kurz. Die meisten Beteiligten starben eines gewaltsamen Todes, der Rest landete im Gefängnis. Dass es diesmal nicht so endete, dafür war Sito, der Mann im Hintergrund, zuständig.
Noch dreihundert Meter bis zur Ausfahrt. Der weiße Peugeot-Transporter mit den bunten Iberia-Logos verlangsamte die Geschwindigkeit, der rechte Blinker flammte auf. Das zuckende gelbe Licht spiegelte sich auf dem pechschwarzen Asphalt der GC-1, der Autopista del Sur, Gran Canarias Hauptverkehrsader. Der Transporter bog auf die Zufahrtsstraße zum Flughafen Las Palmas, passierte Parkhaus und Terminal. Exakt um fünf Minuten vor drei kam er vor dem geschlossenen Gittertor des Vorfeldes zum Stehen.
Zu dieser frühen Stunde gab es nur selten Anlieferungen für die Luftfracht. Aber manchmal eben doch. Und so interessierte sich der Sicherheitsmann, der diese Zufahrt auf einem seiner Monitore im nahen Flughafengebäude überwachte, nicht weiter für den Transporter. Zumal gleich darauf das massive Gittertor wie von Geisterhand zur Seite glitt und die Einfahrt freigab. Dafür sorgte der Transponder an der Frontscheibe, der ähnlich wie bei elektronischen Mautsystemen ein Signal zum Öffnen sendete. Alle Fahrzeuge der Iberia waren mit solchen Transpondern ausgestattet.
Selbst wenn der Sicherheitsmann den Transporter genauer betrachtet hätte, wäre ihm nichts aufgefallen. Er konnte nicht ahnen, dass in dem stickig-schwülen Laderaum keine Luftfracht transportiert wurde. Sondern drei schwarz gekleidete Männer mit bis zur Stirn aufgerollten Sturmhauben. Und so wandte er sich wieder seinem Tablet zu. Dort lief die Netflix-Serie »Las Chicas del Cable«. Vielleicht schaffte er noch eine weitere Folge. Zeit dafür hatte er genug. Der Wochenplan für diese Nacht sah die nächste Kontrolle erst wieder gegen vier Uhr vor.
Die drei Männer auf der Ladefläche des Transporters und der Fahrer kannten sich erst seit ein paar Wochen, ihre richtigen Namen überhaupt nicht. Und damit das so blieb, sprachen sie sich untereinander nur mit dem Monatsnamen ihres Geburtstages an.
Januar, ein bärtiger Galicier aus Betanzos, hatte auf den Verzicht der Realnamen und aller privaten Fragen bestanden. Er saß mit dem Rücken zur Fahrerkabine und schwitzte unaufhörlich. Mit seiner ständigen Geheimnistuerei ging er den drei anderen des Quartetts auf die Nerven. Dafür besaß Januar reichlich Erfahrung bei der Planung von Überfällen. Und, was noch viel wichtiger war, wie man sich dabei nicht erwischen ließ. Für die spanische Polizei stellte er trotz seiner fast fünfzig Lebensjahre ein unbeschriebenes Blatt dar – keine Verurteilung, keine Verhaftung, eine vollkommen weiße Weste. Sein Know-how war für Sito, den Auftraggeber, unverzichtbar.
Neben ihm kauerte November, der Mann fürs Grobe. Der drahtige Glatzkopf, Anfang dreißig, stammte aus Espelette, einem kleinen Dorf im französischen Teil des Baskenlandes. Vielleicht aber auch aus Spanien. Je nachdem, wie man seine Zeit im Großgefängnis Madrid V in Soto del Real gewichtete. Dort, nördlich der spanischen Hauptstadt, zwischen saftigen Weiden, wo die iberischen Kampfstiere gezüchtet wurden, landeten alle ausländischen Straftäter. Und November gleich dreimal. Bisher hatte er es noch nie geschafft, das Ende seiner Bewährungszeit abzuwarten, bevor er wieder straffällig wurde.
Juni, der Dritte auf der Ladefläche, war ein Madrilene mit der Figur eines Kunstturners und einem Strafregister von der Länge einer Tapetenrolle. Wahrscheinlich wusste nicht einmal er selbst, wie oft er in seinen jungen Jahren bereits von der Polizei verhört worden war. Seine erste Verurteilung wegen Einbruchdiebstahls hatte er mit vierzehn Jahren kassiert, nur wenige Monate nach Erreichen der Strafmündigkeit. Ins Quartett brachten ihn seine akrobatischen Fähigkeiten. Es gab kaum etwas, das er nicht erklimmen konnte – und kaum etwas, das er nicht stehlen konnte.
April, der junge Fahrer und einzige Canario im Quartett, betrieb auf der Insel seit Jahren eine Art Transportgeschäft für spezielle Kunden. Wer etwas sicher und vor allem diskret transportieren lassen wollte, beauftragte ihn. Sein Geschäft brachte es mit sich, dass er Fahrzeuge stehlen und für immer verschwinden lassen konnte. Er kannte jede noch so kleine Straße auf der Insel, jeden Unterschlupf und wusste um alle von der Polizei genutzten Kontrollstellen. In Verbindung mit den teils halsbrecherischen Fahrkünsten verfügte er über die besten Voraussetzungen als Fluchtwagenfahrer.
Auch den Lageplan des Flughafens hätte er problemlos aus dem Kopf zeichnen können. April kannte alle Rollwege auf dem Vorfeld, die Positionen der Gates und Ausgänge des Terminals sowie die Lage der Frachthallen. Und natürlich den Weg zur Halle mit der Nummer drei. Achthundert Meter geradeaus, dort scharf links abbiegen, weitere zweihundert Meter, dann rechts über einen Vorplatz zum Tor. Dabei musste er genau darauf achten, dass er innerhalb der eingezeichneten Fahrspuren blieb und die vorgeschriebene Geschwindigkeit von zwanzig Stundenkilometern einhielt. Schließlich sollte der weiße Iberia-Transporter auf den nachts kaum genutzten Rollwegen nicht sofort auffallen.
Drei Minuten und zwölf Sekunden später und somit einige Sekunden früher als geplant erreichten sie die Frachthalle drei. April stieß den Transporter rückwärts an die hinterste Rampe, schaltete den Motor und die Scheinwerfer aus.
***
Januar starrte auf seine Armbanduhr, sah dem Sekundenzeiger zu, wie er vorankroch. Eine Minute noch würden sie im Laderaum ausharren, um zu beobachten, ob sie Aufsehen erregt hatten. Seine Erfahrung sagte, dass neben schlechter Planung meist Ungeduld an fehlgeschlagenen Überfällen schuld war.
Wohl schon zum dritten Mal in dieser Nacht tastete er in seiner Hosentasche nach der Zugangskarte. Obwohl Januar die dazugehörige PIN längst auswendig kannte, murmelte er sie erneut vor sich hin: siebzehn-zweiunddreißig-zwölf-null-eins. Acht Ziffern, die morgen um diese Zeit bereits wertlos sein würden. Und die darüber entschieden, ob er sich nach über zwanzig Jahren und Dutzenden von Überfällen mit genug Geld für ein sorgenfreies Leben zur Ruhe setzen konnte.
Neben ihm lud November seine Walther PP mit Perlmuttgriff durch. Eine Sonderanfertigung, die er vor einigen Monaten im französischen Biarritz in Auftrag gegeben hatte. Auch Juni überprüfte seine weniger auffällige Luger und steckte sie wieder zurück in den Hosenbund. Januar hingegen blieb einfach sitzen. Jede weitere Bewegung auf der stickigen, heißen Ladefläche würde ihm noch mehr Schweiß aus allen Poren treiben. Bereits jetzt klebte sein Unterhemd wie eine zweite Haut am Körper.
Nach einem weiteren Blick auf seine Armbanduhr klopfte Januar an die Trennwand hinter sich. Er hörte, wie sich die Fahrertür öffnete und April aus dem Transporter stieg. Juni, der ganz hinten saß, kam von der Ladefläche hoch und griff nach seinem Rucksack. Er setzte ihn auf und öffnete eine der Hecktüren. Die vibrierende Wärme der kanarischen Nacht strömte herein und verdrängte die stickig-schwüle Hitze aus dem Laderaum.
Lautlos und behände wie eine Katze sprang Juni auf den Asphalt. Januar und November folgten.
Das Geräusch der Tür, als November sie hinter sich zuschlug, hallte laut wie ein Donnerschlag durch die nachfolgende Stille.
»¡Mierda!«, raunte April. »Geht das auch leiser, oder willst du den Wachleuten gleich noch zurufen, dass wir da sind?«
November rümpfte die Nase. »Halt deine Fresse und kümmere dich ums Fahren.« Weiß wie Milch schimmerte der Perlmuttgriff seiner Pistole im Halbdunkel.
»Ruhe!«, rief Januar mit gedämpfter Stimme und zog sich die Sturmhaube über das schweißnasse Gesicht. »Runter mit den verdammten Masken!«
»Ihr könnt mich beide mal«, sagte November immer noch in streitsüchtigem Tonfall. Dennoch zog auch er jetzt seine Sturmhaube bis zum Kinn herunter.
April, inzwischen ebenfalls mit aufgesetzter Sturmhaube und Waffe in der Hand, zeigte ihm den ausgestreckten Mittelfinger.
Januar wandte sich dem Nebeneingang zu und hielt die Zugangskarte vor das Lesegerät. Es klackte, der magnetische Öffner gab die Tür frei, und er trat hindurch.
Den Beginn des Überfalls hatte er nicht ohne Grund für drei Uhr geplant. Zu diesem Zeitpunkt begann für die fünf Iberia-Mitarbeiter der Nachtschicht und den Sicherheitsmann eine dreißigminütige Arbeitspause, die sie in der Regel oben im Aufenthaltsraum verbrachten. Und erst eine weitere halbe Stunde nach Pausenende, gegen vier Uhr, würde dieser Sicherheitsmann sich routinemäßig bei seinen Kollegen im Flughafengebäude melden.
Mit einiger Genugtuung stellte Januar fest, dass sein Plan offenbar aufging. In der Halle herrschte Totenstille, niemand war zu sehen. Die Gabelstapler und Hubwagen standen verlassen auf ihren Stellplätzen. Auch der Sicherheitsmann neben dem Haupttor war nicht an seinem Platz.
Er ging voraus. So wie April die Strecke über das Vorfeld zur Frachthalle drei auswendig kannte, wusste Januar um die Positionen der Überwachungskameras und wie sie unbemerkt daran vorbeikamen. Vorerst gab es nur eine kritische Stelle. Die lag direkt vor der Stahltreppe, die seitlich an der Wand entlang nach oben zu den Büros und dem Aufenthaltsraum führte. Erst später mussten sie an einer anderen Stelle ein weiteres Mal aufpassen. Aber dafür war Juni mit seinen akrobatischen Fähigkeiten zuständig.
Januar führte die Männer durch die Frachthalle bis etwa fünf Meter vor den Treppenaufgang. Dort pressten sie sich mit dem Rücken an die Wand und schoben sich seitwärts der Treppe entgegen. Nach den ersten beiden Stufen hatten sie das Sichtfeld der Kamera bereits wieder verlassen und schlichen hintereinander die Metallstufen hinauf.
Oben breitete sich ein Flur aus, von dem eine Handvoll Türen abging. Noch bevor sie an dessen Ende den Aufenthaltsraum erreichten, entdeckten sie in einem Büro den ersten Iberia-Mitarbeiter. Der Mann lag mit dem Kopf auf seinem Schreibtisch, hatte die Arme von sich gestreckt und war augenscheinlich eingeschlafen.
November trat hinter ihn und drückte ihm den Lauf seiner Walther an den Kopf. »Aufstehen!«
Der Mann fuhr hoch und schaute verwirrt um sich. Es dauerte einen Moment, bis er realisierte, dass ihn vier maskierte und schwarz gekleidete Männer mit Schusswaffen bedrohten. Schlagartig ließ das Entsetzen darüber seine Gesichtszüge erstarren.
»Aufstehen!«, wiederholte November.
Der Mann, ein jüngerer mit beginnender Halbglatze und pickligem Gesicht, erhob sich langsam.
November fuchtelte mit seiner Waffe vor dem Gesicht des Mannes herum.
»Ich verstehe nicht«, gab Pickelgesicht mit flatternder Stimme zurück.
»Los, vorwärts.« November rammte ihm den Lauf seiner Waffe in den Rücken. Er bugsierte ihn zur Tür hinaus und weiter den Gang entlang bis zum Ende. Dort stieß April die nur angelehnte Tür zum Aufenthaltsraum auf.
An einem der vier Tische saßen drei Iberia-Mitarbeiter sowie, mit dem Rücken zur Tür, der Sicherheitsmann. Und damit fehlte eine Person.
Die Männer unterhielten sich lautstark und bemerkten nicht, dass vier Maskierte mit einer Geisel den Raum betreten hatten.
November fackelte nicht lange und rief: »Alle mal herhören!«
Reihum weiteten sich drei Augenpaare. Einem der Iberia-Mitarbeiter fiel das Käsesandwich aus der Hand, eine Tomate rollte über die Tischplatte. Den beiden anderen blieb beim Kauen der Mund offen stehen.
Im nächsten Moment riss der Sicherheitsmann seinen Kopf herum. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, bis er die Gefahr erkannte. Er tastete nach seinem Holster, wollte die Waffe ziehen.
November kam ihm zuvor, zeigte mit der Pistole auf seinen Kopf. »Lass stecken, oder du bist tot.«
Wie nach einem Stromschlag zog der Sicherheitsmann seine Hand wieder zurück.
»Wo ist euer Kollege?«, fragte Januar.
Niemand antwortete.
»Hört ihr schlecht?« November schwenkte seine Walther durch den Raum. »Wo ist euer Kollege?«
»Unten in der Halle«, stammelte Käsesandwich.
»Warum?«
»Er sucht drei Kisten aus Guadalajara.«
Januar sah auf seine Armbanduhr. Noch etwas mehr als fünfzig Minuten. »Wie lange dauert das?«
Käsesandwich zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.«
Januar wechselte einen raschen Blick mit November. Wenn sie nicht alle Mitarbeiter unter Kontrolle hatten, war ihr Plan zum Scheitern verurteilt. »Ihr legt jetzt alle eure Telefone und die Funkgeräte auf den Tisch. Und zwar flott, wir haben nicht die ganze Nacht Zeit.«
Die drei Iberia-Mitarbeiter kramten in ihren Taschen. Nur Sekunden später lagen drei Mobiltelefone und drei Funkgeräte auf dem Tisch. Januar schnappte sich eines der Funkgeräte. April sammelte den Rest ein und reichte alles an Juni weiter, der die Geräte in seinem Rucksack verstaute.
Januar trat vor Pickelgesicht. »Ich geb dir jetzt das Funkgerät. Du rufst deinen Kollegen unten in der Halle und sagst ihm, er soll Pause machen.«
Pickelgesicht runzelte die Stirn. »Das wird er nicht tun. Die Kisten müssen noch vor sechs Uhr verladen sein.«
»Dann lass dir was einfallen.« Er drückte ihm das Funkgerät in die Hand.
Pickelgesicht traten die ersten Schweißtropfen auf die Stirn. Sein Blick wanderte zur Decke, zu Januar, zum Funkgerät. Schließich betätigte er die Senden-Taste. »Miguel, hörst du mich?« Er ließ die Taste wieder los.
Es rauschte, dann krächzte eine helle Stimme aus dem Lautsprecher: »Was gibt’s, Jefe?«
Pickelgesicht drückte erneut die Senden-Taste und begann mit seiner Lügengeschichte. »Du kannst Pause machen. Die drei Kisten aus Guadalajara stehen nicht auf den Papieren für IB-127. Das muss ich vorhin falsch gelesen haben, tut mir leid.«
Nach einem kurzen Rauschen drang erneut Miguels Stimme aus dem Gerät. »Darauf hättest du auch früher kommen können. ¡Mierda! Die Viertelstunde hänge ich an meine Pause dran.«
»Kein Problem«, erwiderte Pickelgesicht und reichte das Funkgerät zurück.
»Damit wäre das auch geklärt«, sagte Januar und wandte sich wieder an die anderen. »Und ihr stellt euch jetzt alle hier neben euren Kollegen.«
Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schwenkte November seine Walther zwischen den Iberia-Mitarbeitern hin und her. Die Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht. Einer nach dem anderen stellte sich neben Pickelgesicht.
»Umdrehen. Hände auf den Rücken«, befahl November.
Die vier drehten sich um, und Juni zurrte jedem von ihnen einen Kabelbinder um die Handgelenke.
»Ich hab dich nicht vergessen«, wandte November sich an den Sicherheitsmann. »Funkgerät, Telefon und Waffe.«
Demonstrativ verschränkte der die Arme vor der Brust.
November machte einen Schritt auf ihn zu und richtete seine Walther auf ihn. »Bist du taub?«
Der Sicherheitsmann presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen, legte dann wortlos ein Funkgerät und eine Pistole auf die Tischplatte.
November deutete kurz mit dem Lauf seiner Waffe auf den Tisch. »Ich sehe da kein Telefon.«
»Hab keins.«
»Das glaub ich dir nicht. Leg dein Telefon hier auf den Tisch.« November spannte den Hahn der Walther. »Und ich sag’s nicht noch mal.«
Der Sicherheitsmann kramte in seiner rechten Beintasche, förderte ein Mobiltelefon zutage und legte es auf den Tisch. »Damit kommt ihr nicht durch.«
»Fresse halten! Aufstehen!«
Nur widerwillig kam der Sicherheitsmann der Aufforderung nach, ließ sich dann aber widerstandslos die Handgelenke mit einem Kabelbinder auf dem Rücken fesseln. Juni packte Telefon, Funkgerät und Waffe vom Tisch in seinen Rucksack.
Draußen auf dem Flur ertönten Schritte. Miguel, der letzte der fünf Iberia-Mitarbeiter, näherte sich dem Aufenthaltsraum.
Auf ein Zeichen von Januar positionierte April sich neben der Tür. Sekunden später ging sie auf, und ein jüngerer Mann mit rotem Lockenkopf trat ein.
»Was zum Teufel …?« Der Rest des Satzes blieb ihm im Hals stecken. Sein Blick pendelte zwischen dem Sicherheitsmann, seinen gefesselten Arbeitskollegen und den schwarz gekleideten Männern. Schock und Ungläubigkeit mischten sich in seinem Gesichtsausdruck. Einen Atemzug später wirbelte er herum, um zu flüchten. Doch er hatte nicht mit April gerechnet, der nun direkt vor ihm stand und mit einer Pistole auf seine Brust zeigte.
»Das vergiss mal gleich wieder«, sagte der. »Stell dich neben die anderen.«
Nach kurzem Zögern drehte Miguel sich wieder um, erstarrte dann aber zur Salzsäule. Erst als April ihm den Lauf seiner Pistole in den Rücken drückte, machte er drei, vier bange Schritte und blieb neben Pickelgesicht stehen.
Auch ihn fesselte Juni mit Kabelbinder.
Mit einer gewissen Genugtuung betrachtete Januar die gefesselten Männer vor sich und sah dann auf seine Armbanduhr. Ihnen blieben noch knapp vierzig Minuten. Etwas weniger als geplant, aber immer noch ausreichend.
»Können wir jetzt endlich?«, vernahm er neben sich die ungeduldige Stimme von April.
»Eine Kleinigkeit noch.« Januar hielt seinen Mund ganz nah an das Ohr des Sicherheitsmannes. »Ich weiß nicht, was Maria davon halten würde, wenn du heute Nacht den Helden spielst. Wann wolltet ihr noch mal heiraten?«
Der Sicherheitsmann zuckte zusammen wie unter einem Peitschenhieb.
Januar musterte ihn. Aller Mut, Trotz und Widerwille waren aus seinem Gesicht gewichen. »Wo sind die Schlüssel für den Aufenthaltsraum?«
»Hier am Bund …«, seine Stimme versagte, er räusperte sich, dann noch einmal, »der Bund am Gürtel, der mit dem blauen Ring, ist ein Universalschlüssel für alle Türen hier oben auf dem Flur.«
November zog den Schlüsselbund ab und reichte ihn an Januar weiter. »Ihr bleibt alle hier. Ich will eine Stunde lang nichts von euch hören und nichts von euch sehen. Dann passiert niemandem was. Ansonsten …« Er sprach nicht weiter, machte stattdessen eine Kopf-ab-Geste.
Die fünf Iberia-Mitarbeiter und der Sicherheitsmann nickten fast zeitgleich. Januar war sich sicher, dass sie alle gehorchen würden. Er trat an die Wand und riss das Kabel des Festnetztelefons heraus. Nachdem die anderen drei des Quartetts den Aufenthaltsraum verlassen hatten, schloss er die Tür hinter sich ab und ging voran, die Treppe hinunter in die Frachthalle. Dort vermieden sie es ein weiteres Mal, ins Blickfeld der Kamera zu geraten. Und damit blieb nur noch eine letzte Herausforderung.
Jeden der sechs parallelen Hauptwege an den Lagerplätzen entlang überwachte eine Kamera, die in fünf Metern Höhe an den Betonpfeilern hing. Im Gegensatz zum Treppenaufgang gab es hier keine Möglichkeit, sich dem Sichtfeld der Kameras zu entziehen. Es blieben zwei andere Optionen: die Kamera unschädlich zu machen oder ihren Blickwinkel zu ändern.
Januar wusste, dass die Aufnahmen aller sechs Kameras im Split-Screen-Verfahren auf einem Monitor im Büro der Flughafensicherheit landeten. Damit verringerte sich die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass die geänderte Perspektive jemandem auffiel. Zumal er den schlecht ausgeleuchteten linken Gang auswählen würde. Ein Risiko, das er als gering einschätzte.
Auf dem Weg dorthin schnappte April sich den nächstbesten Hubwagen und zog ihn hinter sich her, quer durch die Halle bis zum Gang an der linken Außenwand. Vor dem zweiten Betonpfeiler blieb er neben den drei anderen stehen und blickte hoch zur Kamera über ihm.
Ohne ein Wort zu sagen, nahm Juni seinen Rucksack ab und förderte ein rotes Nylonseil zutage, wie es Bergsteiger benutzten. Statt eines Karabiners befand sich an einem Ende ein Wurfanker. Er stellte sich breitbeinig hin, schwang das Seil und schleuderte es aus der Hand in Richtung der Stahlkonstruktion. Der Wurfanker prallte von einer Metallstrebe ab und landete auf dem Boden. Beim zweiten Versuch das Gleiche, erst beim dritten Mal hatte sich der Anker endlich in der Stahlkonstruktion verhakt.
Juni sprang am Seil hoch, hielt sich mit beiden Händen daran fest. Er zog die Knie an, wickelte das Seil mit dem linken Fuß unter dem rechten hindurch und richtete sich auf. Mühelos schob er sich so die restlichen drei Meter bis zur Kamera hinauf. Mit einer Hand drückte er das Objektiv ein paar Zentimeter nach oben. Damit lag ein Bereich von rund zwei Metern im Gang neben dem Betonpfeiler außerhalb des Sichtbereichs. Er lockerte den rechten Fuß etwas und glitt am Seil zu Boden, als befände er sich in einem Paternoster. Kein Ächzen, kein Keuchen, die akrobatische Einlage hatte ihn nicht im Geringsten angestrengt.
Januar rollte seine Sturmhaube hoch, nickte Juni zu und ging voran. Das letzte Hindernis war beseitigt. Ihr Ziel lag jetzt zum Greifen nah.
2
Einige Tage zuvor
Die Stimme drang aus der Dunkelheit. Zuerst ein fernes Flüstern, das beständig anschwoll. Sie verstand kein Wort, wusste aber, dass die Stimme sie warnen wollte. Warnen vor dem Mann mit der Kapuze und einem Gesicht, das nur als schwarzer Fleck durch ihr Gedächtnis geisterte. Und sie wusste auch, dass ihr nur noch wenige Augenblicke blieben, um sich in Sicherheit zu bringen. Sonst würde diese gewaltige Wucht sie abermals von den Füßen reißen. Aber ihre Beine, nein ihr ganzer Körper gehorchte nicht. Es war wie immer. Sie hatte keine Chance. Sie hatte noch nie eine Chance gehabt.
Wie eine Spinne kroch die Stimme weiter auf sie zu und setzte sich in ihrem Kopf fest. Ihr Unterbewusstsein stürzte sich darauf, zerrte sie aus dem Schlaf.
Sofia Bitter riss die Augen auf. Ihr Blick fiel auf eine nicht mehr ganz so junge Stewardess mit blonder Betonfrisur und makellosem Lidstrich. »Bitte?«, brachte sie hervor. Es war mehr ein Krächzen.
»Sie müssen sich anschnallen.« Der ernste Tonfall und die Stirnfalten erinnerten sie an eine ehemalige Lehrerin.
Mit einem Blick zur Kabinendecke überzeugte Sofia sich, dass die Anschnallzeichen tatsächlich leuchteten. Sie hatte weder einen Warnton noch die Aufforderung aus den Lautsprechern mitbekommen. Verdammter Alptraum.
»Ja, natürlich.« Sofia setzte ein unschuldiges Lächeln auf und tastete nach der Gurtschnalle. Sie wollte danach greifen, realisierte aber erst jetzt, dass ihre Kraft nicht ausreichte, um die Metallschnalle überhaupt festhalten zu können. Ihr rechter Arm wollte nicht so wie sie. Und wie zur Bestätigung begann ihre Hand im nächsten Moment, unkontrolliert zu zittern.
»Soll ich Ihnen helfen?«, fragte die Stewardess und betonte mit ihren rot geschminkten Lippen jeden Buchstaben, als ob sie zu einer Schwerhörigen sprach.
»Nein!«, rief Sofia schärfer als beabsichtigt.
Ihr Gegenüber hob beschwichtigend die Hände.
»Tut mir leid, ich hab’s nicht so gemeint«, sagte Sofia schnell und versuchte, ihren Ärger hinunterzuschlucken.
Die Stewardess schien etwas erwidern zu wollen, überlegte es sich dann aber anders. Stattdessen blickte sie etwas verlegen an sich herunter und kratzte mit den Fingernägeln an einem imaginären Fleck auf ihrem perfekt sauberen Uniformrock.
»Ich krieg das selbst hin.« Mit der linken Hand packte Sofia den Gurt und versuchte, ihn im Schloss einrasten zu lassen. Ein schwieriges Unterfangen für einen Rechtshänder. Doch sie schaffte es. Endlich erklang das erlösende Klicken, der Gurt vor ihrem Bauch war geschlossen.
Die Stewardess nickte ihr wortlos zu und setzte ihren Kontrollgang fort.
Sofia spähte zu ihrem Sitznachbarn, einem älteren Mann mit weißem Haarkranz und ebenso weißem Vollbart. Er schien vertieft in seine Stuttgarter Zeitung.
Sie tastete nach der Narbe an ihrer rechten Schulter, rieb über den fingerlangen, knorpeligen Wulst. Drei Monate war es jetzt her, dass das Projektil ihr Schultergelenk und die Achselarterie durchschlagen hatte. An jenem Abend hatte sie viel Blut verloren. Glücklicherweise jedoch wenig genug, um die nächsten zwei Stunden zu überleben, bis sie gefunden worden war. Sofia nahm all ihre Kraft zusammen und versuchte ein weiteres Mal, eine Faust zu ballen. Es gelang ihr nicht. Natürlich nicht. Denn als weit schlimmer als die Narbe erwiesen sich die Verletzungen im Muskelgewebe. Die Kugel hatte eine axonale Nervenschädigung im Schultergelenk verursacht. Und wie lange sie ihren rechten Arm nur mit Einschränkung benutzen konnte, wusste niemand. Sie müsse der Verletzung einfach Zeit zur Heilung geben. So der einhellige, aber zutiefst frustrierende Ratschlag der Ärzte in der Stuttgarter Rehaklinik.
Sanft neigte sich die Boeing 737 nach rechts, und wie von selbst wanderte Sofias Blick hinaus in die Tiefe. Im endlosen dunklen Meer, umgeben von einem schmalen, bräunlichen Sockel, tauchte der Pico del Teide auf. Wie eine weiße Kapuze ragte der schneebedeckte Gipfel in den Himmel.
Träge richtete sich das Flugzeug wieder auf, und Sofia konnte direkt unter sich die andere Insel sehen.
»Fühlen Sie sich nicht gut?« Die Stimme ihres Sitznachbarn klang besorgt.
Sofia wandte ihm den Kopf zu. Der Mann hatte die Zeitung zusammengefaltet und auf seinen Schoß gelegt. »Wie kommen Sie darauf?«, fragte sie, obwohl ihm kaum entgangen sein konnte, dass sie Schwierigkeiten hatte, ihren rechten Arm zu benutzen.
Der zuckte mit den Schultern. »Nun ja, Sie haben fast den ganzen Flug verschlafen. Wenn Sie nicht ab und zu im Schlaf gesprochen hätten, hätte ich Ihren Puls gefühlt, um nachzusehen, ob Sie noch leben. Und – Sie zittern.«
Unwillkürlich schielte Sofia auf ihren Arm. Das Zittern ließ allmählich nach. Aber was zum Teufel hatte sie da wieder im Schlaf vor sich hin gestammelt?
»Entschuldigung, ich quatsche Sie voll und hab mich noch gar nicht vorgestellt.« Er klang verlegen. »Seifert, Heribert Seifert mein Name. Ich komme aus Schorndorf.«
Sollte sie sich auch vorstellen? Erst jetzt fiel ihr auf, dass dieser Seifert nach wie vor den beigefarbenen Trenchcoat trug, mit dem er vor über vier Stunden ins Flugzeug gestiegen war.
»Alles in Ordnung?«, fragte er, und zwei tiefe Falten standen senkrecht zwischen seinen weißen Augenbrauen.
»Natürlich«, antwortete Sofia schnell.
Seifert musterte sie weiter, als prüfe er ihre Antwort auf Glaubwürdigkeit. »Zum ersten Mal auf Gran Canaria?«
»Das erste Mal seit fast vierzig Jahren.« Sofia spürte einen Anflug von Melancholie in ihrem Herzen, als sie an die vielen Ferienwochen in ihrer Kindheit dachte. Früher, als sie mit ihren spanischen Großeltern wohl ein gutes Dutzend Mal Urlaub auf der Insel gemacht hatte.
»Vierzig Jahre?«, erwiderte Seifert, und ihr entging nicht die gespielte Skepsis in seiner Frage. Erst recht nicht, als er ein spitzbübisches Lächeln folgen ließ. »Sind Sie überhaupt schon so alt?«
Auch Sofia kam nicht umhin, jetzt ebenfalls zu lächeln, und spielte mit. »Knapp darüber.«
»Dann geht’s Ihnen wie mir«, sagte er, und Sofia schloss nicht aus, dass er trotz seines Alters mit ihr flirten wollte. »Aber Spaß beiseite, machen Sie Urlaub?«
Seine Frage war nicht ganz einfach zu beantworten. »So was Ähnliches.«
»So was Ähnliches?«
Sofia suchte nach einer unverfänglichen Antwort, die nicht abweisend klang. »Ich ziehe für eine Weile in das Ferienhaus meiner Großeltern.«
Vermutlich war die Bezeichnung »Ferienhaus« zu hoch gegriffen für das kleine Häuschen südwestlich von Las Palmas und abseits der Touristenzentren. Auch wenn es einige Jahre nach dem Tod ihrer Großeltern tatsächlich an Feriengäste vermietet worden war. Doch seit die Renovierungskosten die Mieteinnahmen überstiegen, stand es leer.
»Wie reizvoll. Ein eigenes Häuschen auf der Insel.« Er nickte anerkennend. »Das hätte ich auch gern.«
Wie reizvoll es werden würde, mussten freilich die nächsten Wochen zeigen. Immerhin war ein befreundetes Ehepaar über die Jahre bereit gewesen, ab und zu nach dem Rechten zu sehen. Als Sofia vor einigen Wochen zum ersten Mal mit dem Gedanken gespielt hatte, das Ferienhaus zu beziehen, hatte sie die beiden kontaktiert. Seither wusste sie zweierlei: Sowohl der Zustand des Hauses als auch ihre Spanischkenntnisse schienen in einem weit weniger schlimmen Zustand zu sein, als sie angenommen hatte.
»Ich jedenfalls mache drei Wochen All-inclusive in Maspalomas.« Er hielt einen Moment inne. »Das erste Mal ohne meine Frau.«
»Oh.« Sie musterte ihn kurz. Lag da ein trauriger Zug um seinen Mund? »Das tut mir leid.«
»Warum?«, sagte er schnell. »Mir nicht.«
Sofia spürte, wie sie errötete.
»Wir haben uns letztes Jahr getrennt.«
»Ah«, gab sie knapp zurück und hoffte, dass sie sich aufgrund der Kürze ihrer Antwort keine Einzelheiten über eine gescheiterte Ehe anhören musste.
Sofia wandte sich wieder dem Fenster zu. Am Boden konnte sie inzwischen erste Details ausmachen. Rechtwinklige Areale und Ansiedlungen kamen in Sicht, noch zu klein, als dass sie sich genauer bestimmen ließen. Ansonsten präsentierte sich die Landschaft in allen denkbaren Nuancen einer einzigen Farbe: Braun. Aus dem allgegenwärtigen Braun schälten sich die geometrischen Foliendächer von Plantagen, dann Felder und später Straßen sowie weitere Gebäude heraus. Dazwischen, meist auf Anhöhen, drehten sich immer wieder in Reih und Glied aufgestellte weiße Windräder.
Sie hatte ihre Erwartungen weit heruntergeschraubt. Nicht nur an den Zustand des Ferienhauses, sondern auch an das Leben auf der Insel. Trotz aller Schwierigkeiten, mit denen sie rechnete, war ihr Entschluss unumkehrbar, zumindest eine Zeit lang nach Gran Canaria umzusiedeln. Seit sie sich nach der Schussverletzung bis zur Pension in acht Jahren hatte beurlauben lassen, gehörte ihre Dienstzeit beim LKA Stuttgart der Vergangenheit an. Und bisher bereute sie ihren Entschluss nicht.
Oft war sie von den Vorgesetzten und Kollegen gefragt worden, warum sie einen derart endgültigen Schritt machen wolle. Stets war ihre Antwort gewesen, dass mit fünfzig die beste Zeit des Lebens wohl hinter ihr liege und sie die restlichen Jahre einfach nur leben wolle. In Anbetracht des Umstandes, dass sie in jener verhängnisvollen Nacht dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen war, stellte keiner ihre Entscheidung in Frage.
Niemand auf ihrer Dienststelle ahnte, dass ein anderer Grund eine weitaus größere Rolle gespielt hatte. In dieser Nacht zwischen Leben und Tod war ihr das erste Mal die Kontrolle über ihr Leben entglitten. Und viel zu lange hatte sie sich anschließend eingeredet, dass sie nur etwas Abstand brauchte, um sich wieder in den Griff zu bekommen. Nur langsam war ihr bewusst geworden, dass sie sich in Wirklichkeit auf der Flucht befand. Einer Flucht vor der nächsten Kugel, die mit dieser unbeschreiblichen Wucht in ihren Körper eindrang und sie von den Füßen riss. Und einer Flucht vor dem Gefühl der Schwäche, diesem elenden Gefühl, am Boden zu liegen, zertreten wie ein unnützer Käfer.
Wie durch eine dicke Schicht Watte vernahm Sofia das leise Surren der Elektromotoren, die die Landeklappen in Position brachten.
Ihre medizinische Diagnose ließ sich auf zwei folgenschwere Wörter reduzieren: posttraumatische Belastungsstörung. So stand es in ihrer Personalakte. Unvereinbar mit dem Außendienst beim LKA. Und für einen Job am Schreibtisch war sie nun mal die falsche Frau. Doch das war immer noch nicht alles. Falls sie irgendwann ihre psychischen Probleme in den Griff bekam, blieb die körperliche Beeinträchtigung.
Das mechanische Geräusch des ausfahrenden Fahrwerks holte Sofia endgültig in die Gegenwart zurück. Gleich würde Condor-Flug DE 1481 auf dem Aeropuerto de Gran Canaria aufsetzen.
Vor ihrem Fenster tauchten die Flughafengebäude auf. Ein leichter Ruck, dann das Rumpeln der Räder auf dem Asphalt der Landebahn. Unüberhörbar heulten die Triebwerke für den Rückschub auf. Die Boeing 737 verzögerte stark, und kaum hatte sie Rollgeschwindigkeit erreicht, applaudierten einige der Passagiere.
»Dämliche Touris«, hörte sie Seifert neben sich sagen.
Sofia wandte ihm den Kopf zu, verkniff sich aber die Bemerkung, dass auch er als Tourist galt.
Wie zur Entschuldigung zuckte Seifert mit den Schultern. »Ich hab auch nie Applaus bekommen, wenn ich meinen Job gemacht habe.«
Damit hatte er natürlich recht. Wer außer Künstlern erhielt schon Applaus für seine berufliche Tätigkeit? Sie lächelte. »Das Privileg der Piloten von Ferienfliegern.«
Sofia hätte nicht sagen können, wann ihr der dunkelhäutige Mann am Gepäckband zum ersten Mal aufgefallen war. Was sie allerdings mit Sicherheit sagen konnte, war, dass er nicht zu den Passagieren des Condor-Flugs DE 1481 von Stuttgart nach Gran Canaria gehörte. Auch dass der Mann das Gepäckband verwechselt hatte, schloss sie aus. Der einzige andere Flug, dessen Passagiere derzeit auf ihr Gepäck warteten, war Finnair AY 1721 aus Helsinki. Und nur mit Sandalen, olivgrünen Bermudas und einem ehemals weißen Fußballtrikot mit Fly-Emirates-Aufdruck bekleidet, war er sicher nicht im Winter in Finnland abgeflogen.
Dann war da noch dieser Blick, mit dem sich der Mann ständig umschaute. Er wirkte so fehl am Platz wie ein Pinguin in der Wüste. Jedenfalls auf Sofia. Alle anderen Passagiere hingegen achteten nur auf das Gepäckband, das seit ein paar Minuten einen Koffer nach dem anderen ausspuckte. War es womöglich nur ein Bauchgefühl, das sie nach dreißig Jahren Dienstzeit nicht einfach ablegen konnte? Sofia zwang sich, den Blick abzuwenden und nach ihren zwei grellgrünen Koffern Ausschau zu halten. Mit der ungewöhnlichen Farbe sollten sie auch in der Masse schnell auffallen.
Und da kamen sie auch schon, nebeneinander wie eineiige Zwillinge. Sie packte den ersten Koffer, und gerade als sie den zweiten Koffer einfangen wollte, gellte ein Schrei durch die Halle.
»Halt, das ist meiner!«, rief jemand. Die Stimme kam ihr bekannt vor.
Sofia ließ den ersten Koffer wieder los. Der rutschte über den anderen und fiel zu Boden. Sie sah auf und versuchte, die Stimme zu lokalisieren. Seifert, ihr Sitznachbar von 14 B. Er fuchtelte wie wild und setzte dem Dunkelhäutigen im Fußballtrikot nach, der mit einem braunen Koffer viel zu schnell Richtung Ausgang strebte. Die vierzig bis fünfzig Jahre Altersunterschied ließen ihm keine Chance. Mit jedem Schritt verlor er fast einen Meter auf den Mann, der sprintete wie Usain Bolt beim Hundertmeterlauf. Und niemand würde ihn aufhalten. Der Schalter am Ausgang war unbesetzt. Spanien, Deutschland und Finnland gehörten zum Schengenraum.
Schlimmer noch als Seiferts fehlende Geschwindigkeit war, dass er seinen Gepäckwagen stehen gelassen hatte. Schon schnappte sich eine jüngere, weiße Frau mit armlangen Rastalocken den Rucksack, der unbeaufsichtigt auf dem Gepäckwagen lag. Auch sie machte sich jetzt auf den Weg. Freilich in aller Ruhe und in Richtung des anderen Ausgangs. Ihr Pech. Um diesen Ausgang zu erreichen, musste sie an Sofia vorbei.
Mit einer schnellen Körperbewegung stellte sie sich Rastalocke in den Weg. Die versuchte auszuweichen, doch Sofia machte einen weiteren Ausfallschritt und versperrte ihr erneut den Weg.
»Eh, was soll das?« Rastalocke musterte sie, als wolle sie ihr Gewicht abschätzen.
»Das weißt du ganz genau.«
»Du verpisst dich jetzt besser, puta«, zischte Rastalocke. Das Schimpfwort konnte mit »Nutte« oder in der etwas milderen Form auch mit »Schlampe« übersetzt werden.
Sofia gab sich unbeeindruckt. »Vergiss es.«
Rastalocke schwang den Rucksack über ihre Schulter, senkte den Kopf und blickte sie kampfeslustig an.
Aus den Augenwinkeln sah Sofia, wie drei uniformierte Beamte den Dunkelhäutigen zu Fall brachten. Im Grunde war der Trick der beiden nicht schwer zu durchschauen. Während er mit dem Kofferdiebstahl die Aufmerksamkeit auf sich zog, schnappte Rastalocke sich unbeaufsichtigtes Handgepäck und machte sich damit aus dem Staub.
Die hielt inzwischen ihre Fäuste vor sich hin.
Sofia konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Schon an der Art, wie Rastalocke ihre Fäuste ballte, erkannte sie, dass kein Profi vor ihr stand, sondern eher eine Gelegenheitsdiebin mit großer Klappe.
»Was willst du?« Rastalocke ließ das gleiche Schimpfwort folgen wie zuvor.
»Dass du den Rucksack wieder zurücklegst.«
»Das ist meiner.«
Sofia schüttelte den Kopf. »Ich weiß, dass er nicht dir gehört. Und du weißt das auch. Also nochmals: Leg ihn zurück.«
»Nee. Aber du kannst ja versuchen, ihn dir zu holen.« Ob die Reaktion von Rastalocke genauso ausgefallen wäre, hätte sie gewusst, wer da vor ihr stand?
Sofia wollte die rechte Hand zur Faust ballen, spürte aber sofort, dass ihr die Kraft dazu fehlte. Egal, für Rastalocke würde auch die linke Hand reichen. »Du bist wohl eine von den ganz harten Mädels.«
»Bin ich. Und du?«
»Härter.« Sofia ließ ihr keine Zeit, etwas darauf zu erwidern. Der leichte Schlag mit der Handkante traf Rastalocke am Kehlkopf. Die fasste sich kurz an den Hals und sackte dann gurgelnd in sich zusammen, wie eine Marionette, der jemand die Fäden durchgeschnitten hatte. Mit einem dumpfen Klatschen landete sie auf dem Boden.
Sofia nahm den Rucksack an sich, hängte ihn um und blickte wieder auf. Wie eine Mauer standen die drei uniformierten Beamten vor ihr. Zwei hielten den Dunkelhäutigen fest, dessen Hände mit Kabelbindern vor dem Bauch gefesselt waren. Mehr noch als die rasche Festnahme irritierte sie der dritte, dickliche Beamte. Er presste die Lippen fest aufeinander, sodass sein Mund beinahe unter dem bürstenartigen Schnauzbart verschwand. Die Augen zu schmalen Schlitzen verengt, zielte er mit einem Elektroschocker auf sie.
»Was soll das?«, rief Sofia aus.
»Bleiben Sie genau dort stehen«, sagte Schnauzbart, obwohl sie keine Anstalten machte, sich zu bewegen.
»Hier?« Sie deutete auf den Boden vor ihr.
Schnauzbart nickte.
»Aber ich wollte überhaupt nicht weglaufen.« Sofia wählte ihre Worte mit Bedacht, sprach ruhig und freundlich. Schließlich hatte sie kein Interesse daran, wegen eines falsch verstandenen Wortes getasert zu werden. Und allzu sicher fühlte sie sich im Spanischen noch nicht.
»Danke!«, hörte sie Seifert sagen. Im nächsten Moment tauchte er neben ihr auf und schnaufte wie ein Blasebalg. »Danke, dass Sie die Frau aufgehalten haben. Ohne den Rucksack wäre mein Urlaub jetzt wohl schon zu Ende.«
Schnauzbart blickte einigermaßen ratlos zu seinen Kollegen, als brauchte er deren Zustimmung für sein weiteres Vorgehen. Doch die schwiegen, und so wandte er sich zuerst an Seifert: »Gehen Sie beiseite.« Dann an Sofia: »Und Sie legen den Rucksack ab. Aber ganz langsam.« Es klang, als vermute er darin eine Bombe.
Sofia hob beschwichtigend die Hände. »Ganz ruhig, ich gehöre zu den Guten. Die kleine Diebin hier«, sie deutete auf Rastalocke, die sich inzwischen aufgesetzt hatte und stöhnend ihren Hals massierte, »hat ihm die Tasche gestohlen. Ich hab sie nur an der Flucht gehindert.«
Seifert runzelte die Stirn, offenbar verstand er kein Spanisch.
Schnauzbart gab sich unbeeindruckt. »Das sagen sie alle. Wir gehen jetzt in mein Büro und warten auf die Beamten vom Comisaría Las Palmas.«
Sofia seufzte, als ihr in den Sinn kam, was sie heute noch alles vorhatte. »Und wie lange wird das dauern? Ich hab eigentlich keine Zeit.«
»Fünf bis zehn Minuten«, gab er zurück und nahm den Elektroschocker herunter. »Die können Sie sicherlich in Ihrer kostbaren Zeit noch unterbringen.«
Von Gehen konnte bei Schnauzbart allerdings nicht die Rede sein. Erst jetzt entdeckte Sofia einen Segway, auf den er sich sogleich schwang und losfuhr, während seine Kollegen und sie ihm folgten wie die Küken ihrer Mutter.
Die besagten fünf bis zehn Minuten dehnten sich bereits auf eine gute Viertelstunde aus, in der sie sich in einem viel zu kleinen Büro der Flughafenpolizei drängten. Schon auf dem Weg dorthin hatte Rastalocke Sofia mit allen erdenklichen und erfundenen Schimpfwörtern bedacht.
Sie saß jetzt auf einem Stuhl neben ihrem Komplizen und tuschelte mit ihm. Auch dem ignorantesten Polizisten musste inzwischen klar sein, dass die beiden unter einer Decke steckten.
Schnauzbarts Kollegen hatten das Büro verlassen, ohne Seifert und ihr Kabelbinder anzulegen. Vermutlich, weil sie sich im Gegensatz zu den beiden anderen ausweisen konnten. Auch ihr restliches Gepäck hatten sie zu sich nehmen dürfen. Bis auf das Corpus Delicti. Darin kramte Schnauzbart nun schon eine ganze Weile und förderte dabei zwar allerlei, aber harmlose Gegenstände zutage. Den Inhalt von Seiferts Rucksack deponierte er neben seinem Elektroschocker auf dem Schreibtisch. Dort lagen inzwischen dessen Brieftasche mit einem dicken Bündel Geldscheinen, ein Mobiltelefon, ein Heftchen mit Flugtickets und anderen Vouchern, eine weiße Feinripp-Unterhose samt zugehörigem Unterhemd, ein Waschbeutel sowie eine kleine Flasche Wasser.
Schließlich kippte Schnauzbart den Rucksack und schüttelte ihn, wohl um zu überprüfen, ob sich noch etwas darin befand. Ein Pack Papiertaschentücher purzelte über den Schreibtisch. Sichtlich enttäuscht ließ er sich auf seinen Bürostuhl sinken, griff nach der Brieftasche und blätterte durch die Geldscheine. Es mussten weit über tausend Euro sein. Für Rastalocke und ihren Komplizen hätte es ein wahrer Glückstag werden können.
Sofia setzte ein weiteres Mal an, um Schnauzbart zu erklären, was vorgefallen war. Zumal er mit den Flugtickets und Seiferts Ausweis schnell den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage hätte klären können.
Statt jedoch darauf einzugehen, legte er nur die Brieftasche auf den Schreibtisch zurück und schwieg. Er schien weiterhin resistent gegen jeden Einwand oder Erklärungsversuch. Und so blieb ihr nichts anderes übrig, als in dem stickigen kleinen Raum auf das Eintreffen der Polizei aus Las Palmas zu warten.
Schnauzbart hingegen schien die Zeit bis dahin so angenehm wie möglich hinter sich bringen zu wollen. Aus einer Schublade förderte er eine Papiertüte zutage und hielt gleich darauf ein Sandwich in der Hand. Er lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück, nahm einen ersten Riesenbissen, und wie in einem Rechen verfingen sich in seinen Barthaaren die Krümel. Bei jeder Kaubewegung landeten einige auf seinem dunklen Uniformhemd, das bald aussah, als wäre es weiß gesprenkelt.
Während Seifert auf dem letzten der drei Besucherstühle Platz nahm, lehnte Sofia sich mangels einer weiteren Sitzgelegenheit an die rückwärtige Wand. Immerhin hatte sie so einen guten Blick durch die einseitig verspiegelten Fenster auf das Treiben draußen in der Halle. Inzwischen kreisten die Koffer anderer Flüge auf den Bändern. Dutzende Menschen drängten sich mit ihren Gepäckwagen davor. Einige Glückliche, die ihre Koffer gefunden und aufgeladen hatten, versuchten, sich so schnell wie möglich aus dem Gedränge zu kämpfen. Wieder andere telefonierten oder riefen ihre ungeduldig umhertobenden Kinder zur Ruhe.
Da lösten sich zwei Männer aus dem Durcheinander und steuerten auf das Büro der Flughafenpolizei zu. Trotz ihrer Zivilkleidung waren sie unschwer als Kriminalbeamte zu erkennen. Und das lag in erster Linie am jüngeren der beiden. Seine Haare waren fraglos blondiert, und aus welchem Grund er im Halbdunkel des Gebäudes eine gelb verspiegelte Sonnenbrille trug, erschloss sich Sofia nicht. Belustigend hingegen fand sie seinen breitbeinigen Gang, als wäre er nicht mit dem Dienstwagen, sondern auf einem Pferd zum Flughafen gekommen. Unter seiner braunen Lederjacke, etwa in Höhe der Achselhöhlen, zeichnete sich eine verräterische Beule ab, die nur von einer Waffe, vermutlich seiner Dienstpistole, stammen konnte.
Einen Schritt hinter ihm und in Sofias Augen kaum weniger auffällig folgte ein Mann mit kantigen Gesichtszügen und grau meliertem Haar. Er mochte Anfang bis Mitte fünfzig sein und trug zu schwarzen Jeans ein blau kariertes Sakko, das dringend gebügelt werden sollte. Genau wie das weiße Hemd darunter, das eine Handbreit offen stand. Seinen Beruf verriet er durch jenen wachen und zuweilen rastlosen Blick, den manche auch als Polizistenblick bezeichneten. Entweder hatte das Comisaría Las Palmas die auffälligsten Ermittler geschickt, oder es gab keine anderen.
Die Tür schwang auf. Der jüngere, blondierte Beamte trat beiseite, ließ seinem älteren Kollegen den Vortritt und schloss die Tür wieder.
Endlich kam Bewegung in die Sache und in Schnauzbart, der das halb aufgegessene Sandwich beiseitelegte und sich unerwartet schnell aus seinem Stuhl erhob. Schließlich versuchte er, eine stramme Körperhaltung einzunehmen, was nicht nur durch das unter seinem Bauch heraushängende Unterhemd eher amüsant als respektvoll wirkte. »Buenos días, Inspector Jefe García.«
Noch ehe der etwas erwidern konnte, sprang Rastalocke von ihrem Stuhl auf und stieß ihren Zeigefinger in Richtung Sofia. »Die da hat mich zu Boden geschlagen. Ich will diese puta anzeigen, Körperverletzung und so.«
3
García hasste Touristen. Natürlich nicht alle und auch nicht nur Touristen. Sondern alle, die seine Geduld bereits vor dem Frühstück auf die Probe stellten. Und dazu gehörten seit heute Morgen auch Flughafenpolizisten wie der dicke Vargas. Im Grunde war Gepäckdiebstahl nur ein einfaches Vergehen und fiel schon deshalb nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Inspector Jefe vom Comisaría Las Palmas Norte. Zumal jeden Monat Hunderte von Touristen nach Gran Canaria kamen und sich ihr Gepäck stehlen ließen, noch bevor sie überhaupt einen Fuß auf die Insel gesetzt hatten. Allein mit den vielen Formularen für die Diebstahlsanzeigen könnte die Flughafenpolizei Monat für Monat ihr Büro neu tapezieren. Er würde nie verstehen, warum Touristen nicht imstande waren, die letzte halbe Stunde, bevor sie im Hotel eincheckten, auf ihr Zeug aufzupassen.
Was jedoch in den Zuständigkeitsbereich eines Inspector Jefe fiel, war Diebstahl in Verbindung mit Körperverletzung. In diesem Fall galt Diebstahl als Raub. Eigentlich. Denn dieser Tathergang klang ungewöhnlich. Die Körperverletzung soll nicht vom Dieb begangen worden sein. Auch nicht vom Opfer, sondern von einer dritten Person.
Gleichwohl wäre das allein noch kein Grund für García gewesen, sein Büro vor dem Frühstück zu verlassen. Es gab noch eine zweite eigenartige Meldung an diesem Morgen, die ebenfalls den Flughafen betraf. Genauer gesagt, die kanarische Niederlassung der Iberia, der größten spanischen Fluglinie. Die hatte gemeldet, dass einem ihrer Mitarbeiter vor der eigenen Haustür ein Transporter gestohlen worden war. Und genau das kam García eigenartig vor. Wer zum Teufel war so blöd, einen Transporter zu stehlen, der mit diesen riesigen Iberia-Logos auf der Karosserie auffiel wie der sprichwörtliche bunte Hund? Aber vielleicht war der Fahrer schlicht betrunken gewesen und wusste nur nicht mehr, wo er den Wagen am Abend zuvor abgestellt hatte.
Da Vargas die Beteiligten weiterhin festhalten wollte, blieb García kaum eine Wahl. Zuerst musste er sich um den angeblichen Raub kümmern. Als er nach der halbstündigen Anfahrt endlich das Büro der Flughafenpolizei betrat, schienen sich all seine Befürchtungen zu bestätigen. Es würde nicht nur kompliziert werden, sondern vermutlich auch viel Zeit in Anspruch nehmen.
Inmitten einer Handvoll Personen gestikulierte eine junge Frau mit armlangen, verfilzten Haarsträhnen und plärrte lauthals auf ihn ein. Er verstand lediglich zwei Wörter: Körperverletzung und puta. Und damit wusste García, dass er jäh im Mittelpunkt eines handfesten Streites stand, der ihm viel Geduld abverlangen würde. Womöglich zu viel vor dem Frühstück.
»Sie setzen sich hin und halten den Mund«, rief García in Richtung der Frau. Er bemühte sich um einen entschlossenen Tonfall, um keinerlei Zweifel an seiner Autorität aufkommen zu lassen.
Wider Erwarten ließ die Frau sich wieder auf ihren Stuhl fallen und rutschte ganz nach vorne. Leise schimpfend fuchtelte sie weiter und gewährte ihm so einen Blick auf ihre Unterarme. Auf beiden Seiten prangte ein halbes Dutzend Tattoos mit chinesischen Schriftzeichen.
Ob sich Chinesen auch spanische Lebensweisheiten tätowieren ließen? García schüttelte den Gedanken ab und wandte sich an den Mann, der ihm die Suppe eingebrockt hatte. »Buenos días, Señor Vargas.«
Der nickte stumm und nestelte an seinem Uniformhemd herum, das aus der Hose ragte. Seit García ihn vor ein paar Wochen das letzte Mal gesehen hatte, wog Vargas gefühlte zehn Kilo mehr. Das lag entweder an den vielen Sandwiches, von denen schon wieder eines angebissen vor ihm lag, oder an dem Segway, mit dem er sich seit einiger Zeit im Flughafengebäude fortbewegte.
»Dann lassen Sie mal hören«, sagte García, während Vargas sich weiter mit seinem Hemd abmühte. »Und wenn möglich, in kurzen Sätzen.« Er sah auf seine Armbanduhr. Noch hatte er die Hoffnung nicht aufgegeben, dem stickigen Büro mit den viel zu vielen Leuten schnell wieder zu entfliehen.
Vargas schaffte es tatsächlich, das Uniformhemd in die Hose zu stopfen, schnaufte dann aber, als hätte er soeben einen unmenschlichen Kraftakt hinter sich gebracht. Ein paar hektische Atemzüge später räusperte er sich, schien noch nicht zu wissen, wie er anfangen sollte. »Da gibt es zwei Versionen«, begann er vage und sah mit seinem knallroten Kopf in die Runde.
»Zwei Versionen, soso.« Auch García ließ nun seinen Blick über die anderen Personen im Raum schweifen. »Dann fangen Sie am besten gleich mit der ersten an. Ich hab noch etwas anderes zu erledigen.«
Außer seinem Assistenten, Subinspector Francisco Sánchez, der – aus welchem Grund auch immer – noch seine Sonnenbrille trug, zählte er neben Vargas noch vier weitere Personen. Auf dem hintersten der drei Stühle lümmelte ein dunkelhäutiger, muskulöser Hüne, die Hände mit Kabelbindern gefesselt im Schoß. Über seinem massigen Oberkörper spannte sich ein bereits ergrautes Trikot von Real Madrid. Bisher hatte er nicht aufgeschaut, sondern starrte nur auf das Stück Fußboden zwischen seinen Füßen. In der Regel ein untrügliches Zeichen, dass er bei etwas Verbotenem ertappt worden war.