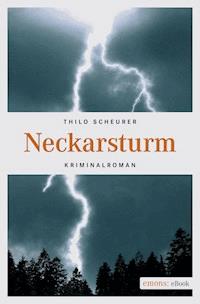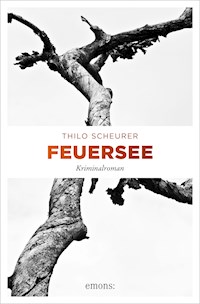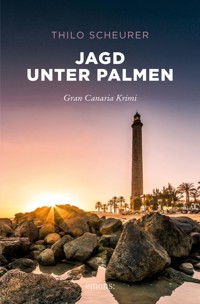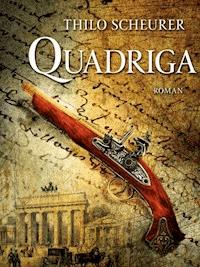
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Aglaia
- Sprache: Deutsch
Frankfurt 1813: Nach Napoléons Niederlage bei der Völkerschlacht von Leipzig werden die preußischen Agenten Leopold Berend und Carl von Starnenberg mit der Zerstörung der französischen Telegrafenlinie beauftragt. Ihr geheimer Zusatzbefehl lautet: Findet die Quadriga! Denn das Wahrzeichen des Brandenburger Tors wurde 1806 von den Franzosen als Kriegsbeute beschlagnahmt. Die Operation hinter den feindlichen Linien entwickelt sich schnell zu einem tödlichen Unterfangen. Auf tragische Weise kreuzt sich der Weg der Preußen mit dem der Tochter eines französischen Generals. Die junge Frau gewährt den fremden Soldaten Zuflucht. Doch Gut und Böse sind schon lange nicht mehr zu unterscheiden … Die schwierige Frage von Schuld und Sühne … ein spannender und vielschichtiger Roman, der die napoleonischen Kriege mit berührenden Einzelschicksalen verknüpft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Thilo Scheurer
Q u a d r i g a
Roman
Bookspot Verlag
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.
Alle Akteure dieses Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2013 byEdition Aglaia, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH
1. Auflage März 2013
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München
Lektorat: Dr. Christine Laudahn
Layout: Mirjam Hecht
ISBN 978-3-937357-89-8 (epub), 978-3-937357-89-8 (mobi)
In der Silvesternacht 1813 zogen Abertausende Soldaten
vieler Herren Länder über den Rhein nach Westen.
Sie trafen auf Ihresgleichen: junge Männer, manchmal mutig, meist ängstlich, die wie sie selten etwas anderes zu erwarten hatten als unsägliche Entbehrungen. Auf beiden Seiten bezahlten viele den Hochmut und Größenwahn ihrer Führer mit dem einzig wertvollen, das sie besaßen: ihrem Leben.
Diese Männer sind die wahren Helden der Geschichte.
Ihnen ist dieses Buch gewidmet.
Wer die Grausamkeit der Natur und der Menschen einmal erkannt hat, der bemüht sich, selbst in kleinen Dingen wie dem Niedertreten des Grases schonungsvoll zu sein.
Christian Morgenstern
Prolog
Tagelang schon hatten die Soldaten in Strauchhütten vor den Toren Berlins campiert, als sie auf der neuen Staatschaussee aus Potsdam anrückten. Der Aufmarsch des französischen Corps wirkte machtvoll und endgültig wie der Gnadenstoß für ein halbtotes Tier. Im Grunde hatte jeder in der Stadt damit gerechnet. Dennoch waren die meisten überrascht, viele auch bestürzt, als in den letzten Oktobertagen des Jahres 1806 die Soldaten schließlich vorrückten. Tausende von Bajonetten blitzten in den Staubschwaden vor der Stadt. Sie wehten herüber und lösten sich nur langsam über den Dächern der hohen Häuser auf - jenen majestätischen Gebäuden, Residenzen und Kasernen, die durch ihre schiere Größe und Eleganz bewiesen, dass Berlin ebenso viel Geschmack besaß wie andere Metropolen. Gleichwohl würden die prunkvollen Bauten heute Zeuge der größten Schmach Preußens werden.
Beständig nahm auch der Lärm zu, bis das alte Stadttor nachmittags gegen vier zuerst wenige, dann aber massenhaft und ununterbrochen Soldaten ausspuckte. Noch bevor der erste französische Grenadier die schnurgerade Leipziger Straße betrat, begannen die Glocken der umliegenden Kirchen zu läuten. Kaum eine menschliche Stimme schien mächtig genug, gegen diese schallende Verlautbarung anzukommen. Erst nachdem das minutenlange Geläut verstummte, dröhnten dumpf die Stiefel auf dem Pflaster. Die Fassaden aus hellbraunem Sandstein warfen den Schall zurück. Zaghaft wehte Musik heran und bald erfüllte sie alle Straßen und Plätze der Stadt. Die alten Lieder der Revolution legten sich über den monotonen Klang der Stiefelschritte. Trotzdem gelang es den Tambouren und Hornisten nicht, das allgegenwärtige Gefühl der Unsicherheit zu vertreiben.
Geschickt schlüpfte die junge Frau durch die Massen von Menschen, die sich innerhalb kürzester Zeit versammelten. Sie liebte Marschmusik. Früher, als kleines Mädchen, hatte sie oft mit ihrem Vater am Straßenrand gestanden und den preußischen Soldaten zugewinkt, wenn sie in hübschen Uniformen und begleitet von zackiger Musik vorbeimarschierten. Doch deren siegreiche Tage gehörten lange der Vergangenheit an. Schon seit Jahren spielten andere die Musik.
Als sie endlich vorne am Straßenrand die Franzosen zu Gesicht bekam, schrak sie zusammen. Die Männer - bestimmt die hässlichsten, die sie je gesehen hatte - glichen mehr einer Räuberbande als den Angehörigen der Grande Armée. Viele hatten ihre Köpfe oder Gliedmaßen verbunden. So recht konnte sich niemand erklären, wie die kleinen, abgemagerten Männer die großen und stolzen Krieger Preußens besiegen konnten. Meist trugen sie ausgeblichene Caputröcke und Beinkleider, übersät mit Flecken in allen Formen und Farben. Der Stoff ähnelte ungefärbtem Leinen, nur in den Falten und Nähten hatte sich etwas Farbe erhalten. Das vormals weiße Lederzeug der Patronentaschen und Säbelscheiden baumelte ungepflegt an den Schultern herunter. Durch die Brandlöcher in den Schuhen und Gamaschen schimmerte ihre nackte, schmutzige Haut. Zerdrückte oder zerrissene Czakots hingen schief auf den Köpfen und ließen die Soldaten endgültig zu einer Karikatur ihrer selbst verkommen. Mit bleichen, ausgehungerten Gesichtern blickten einige der Männer müde in die Menschenmenge, die überwiegend schweigend dem Treiben zuschaute. Bisweilen drang das »Vive l'Empereur« einzelner Passanten zu ihnen, doch niemand reagierte. Stumpf setzten sie einen Fuß vor den anderen, kaum fähig, die befohlene Ordnung einzuhalten.
Der Aufmarsch brachte einen ungeheuerlichen Gestank mit sich. Nicht einmal eine Horde Schweine würde derart üble Gerüche verströmen, dachte sie. Gleichwohl konnten die Passanten noch froh sein, denn der eher winterliche Herbst in diesem Jahr bescherte um diese Uhrzeit bereits kühle Stunden. An einem heißen Tag wäre der Gestank nach verbranntem Fleisch in Verbindung mit dem alten, muffigen Schweiß freilich unerträglich gewesen.
Zwischen den Soldaten wimmelte es von Marketenderinnen, die an diesem Tag ebenfalls nach Berlin wollten; die klapprigen Wagen oftmals völlig überladen mit nützlichem und unnützem Zeug, das sie toten Soldaten auf dem Feld abgenommen hatten, um es weiterzuverkaufen. Zwischen dem Gerümpel verloren sich hie und da weinende Kleinkinder mit verdreckten Gesichtern. Fraglos kannten die wenigsten ihren Vater. Vermutlich wussten sie nicht einmal, wann es das nächste Mal wieder etwas zu essen gab. Die Frauen trugen über ihren weiten, vor Schmutz starrenden Rockschichten die zerrissenen und oftmals blutverschmierten Reste von Uniformen. Kaum eine besaß eigene Schuhe. Wenn sie nicht viel zu große Soldatenstiefel anhatten, umschlossen Füße und Unterschenkel meist zusammengenähte Lederreste. Nur ihre Kopfbedeckungen wollten nicht zum erbärmlichen Rest passen. Mit allem Möglichen versuchten sie, die ungepflegten Haare zu verstecken, häufig verziert mit farbigen Bändern oder Federn. Doch darunter blickten verzweifelte Gesichter aus leeren Augen starr vor sich hin. Das Elend, das von diesen Frauen ausging, war schier unerträglich.
Westfälische Händler hatten in den letzten Wochen die wildesten Schauermärchen über die französischen Soldaten verbreitet. Man erzählte sich, sie würden junge Frauen einfach mitnehmen – und auch die Kinder, die sie dann als Kugelfänger vor sich ins Feld schickten. Sie gab nichts auf solche Geschichten. Trotzdem hatte sie die Nachrichten über die herannahende Armee mit einer Mischung aus Misstrauen und Neugier verfolgt.
Als ob Napoléon unendliche Ressourcen zur Verfügung standen, rückten in den darauffolgenden Tagen laufend neue Truppen ein. Nachdem die Stadt in den Monaten bisher von Kampfhandlungen verschont geblieben war, traf sie der Krieg jetzt mit großer Härte. Berlin entwickelte sich immer mehr zu einem Heerlager. Die Staatsmacht verweilte nahezu vollständig im fernen Ostpreußen und außer einigen überforderten Gendarmen gab es keine Ordnungsmacht mehr. Bald zogen viele der Soldaten marodierend durch die Straßen. Dabei hatten sich die Besatzer in den ersten Tagen noch durchaus von ihrer harmlosen Seite gezeigt. Sie plünderten vorwiegend Wirtshäuser und Kaufläden und interessierten sich dabei nur für Alkohol. Meist gossen sie so viel davon in sich hinein, dass etliche der Grenadiere und Füsiliere auf der Straße liegen blieben, um ihren Rausch auszuschlafen. Und dies trotz unangenehmer Temperaturen, die nachts dem Gefrierpunkt schon recht nahe kamen. Jeden Morgen fuhren Pferdekarren durch die Straßen, um die immer noch betrunkenen Männer aufzulesen und in ihre Quartiere zu bringen.
Bereits kurz nach dem Einmarsch der Franzosen gab es eines jener Quartiere auch im kleinen Hinterhof des Hauses, wo die junge Frau wohnte. Mit ihren Eltern und dem kleinen Bruder lebte sie in einer bescheidenen Parterrewohnung, die direkt zum Innenhof lag. Besonders nachts waren das Geschrei und Gelächter der betrunkenen Soldaten überall zu hören. Auch tagsüber ging es nicht leiser zu. Entweder brüllten die Männer unverständliche Befehle, die in den engen Häuserschluchten widerhallten, oder sie putzten lärmend ihre Ausrüstung. Zwanzig Soldaten und ein Dutzend Armeegäule drängten sich zeitweise in dem kleinen Innenhof. Und wenn sie ein Hoffenster öffnete, schaute nicht selten ein großer Pferdekopf herein. Ob der penetrante Uringeruch von den Tieren oder den Soldaten kam, war im Grunde nicht zu unterscheiden. Es stank bestialisch. Der Mief breitete sich durch Fenster und Treppenhäuser im gesamten Gebäude aus. Nicht einmal der strenge Geruch von Kohl und Kartoffeln konnte ihn überdecken.
Noch schwerer zu ertragen als die drangvolle Enge und der Gestank, waren die hohen Ansprüche der Besatzer. Fiel es schon unter normalen Umständen dem Vater nicht besonders leicht, den Lebensunterhalt für seine Familie zu bestreiten, mussten sie nun die einquartierten Soldaten durchfüttern. Und gab es an der Verpflegung etwas auszusetzen, so wurde sie kurzerhand zurückgeschickt.
Eines Tages,als die junge Frau die Soldaten durch das geschlossene Küchenfenster beim Putzen der Sättel beobachtete, fiel ihr ein jüngerer Mann auf, der erst seit dem Morgen im Quartier lagerte. Durch seine bunte, luftige Bekleidung und die seltsame Kopfbedeckung unterschied er sich von den anderen. Gesicht und Hände standen vor Dreck, sodass seine Haut fast durchgängig bräunlich schimmerte. Offensichtlich hatte er sich mehrere Wochen nicht mehr gewaschen.
Sie schüttelte den Kopf. Es widersprach ihrem Sinn nach Reinlichkeit, dass jemand derart schmutzig herumlief. Besonders in dem Haus, in dem auch sie ein und aus ging. Kurzerhand füllte sie eine Schüssel mit warmem Wasser, nahm ein Stück Seife und trat auf den Hinterhof.
Da sie kein Französisch sprach, versuchte sie, sich dem jungen Mann mit Gesten verständlich zu machen; doch er schien sie nicht zu verstehen. Schon wollte sie aufgeben, als ein zweiter Soldat hinzutrat und auf den Jüngeren einredete. Sofort brach lautes Gelächter los und sie blickte irritiert von einem zum anderen. Der junge Soldat nahm grinsend die angebotene Seife, tauchte sie in das Wasser und rieb sich damit übertrieben stark das Gesicht. Nichts geschah, der Dreck wollte nicht abgehen. Sie schaute verblüfft in seine dunklen Augen und begriff jäh, was es mit dem jungen Mann auf sich hatte - er war nicht schmutzig, sondern besaß einfach nur eine dunklere Hautfarbe als seine Kameraden.
Sie spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Mit schnellen Schritten verschwand sie im Haus und knallte die Hoftür zu. Noch drinnen konnte sie das tosende Gelächter und den Hohn der Soldaten hören. Nie wieder würde sie sich bei den Männern draußen im Hof blicken lassen.
Doch schon am Nachmittag des folgenden Tages musste sie sich erneut den Blicken der Männer aussetzen. Ihre Mutter hatte sie angewiesen, die Uniformhosen der Soldaten einige Häuser weiter in die Bataillonswäscherei zu bringen. Mit hochrotem Kopf trat sie auf den Hof und wäre am liebsten im Boden versunken. Kaum hatten die Männer sie bemerkt, begann ein Feixen und Lachen. Das Einsammeln der Wäsche wurde zum Spießrutenlauf. Als sie schließlich vom Hof auf die Straße trat, empfand sie unendliche Erleichterung. Diesen Blicken wollte sie so schnell wie möglich entkommen. Doch schon wenige Stunden später würde sie bereuen, das Haus verlassen zu haben. Dieser Tag sollte ihr Leben für immer verändern.
In der Wäscherei bot ihr ein charmanter Soldat in gebrochenem Deutsch und mit schelmischem Grinsen an, gemeinsam mit ihr auf die Wäsche zu warten. Die Uniformhosen wären in einer Stunde fertig und so könne sie sich einen zweiten Gang ersparen. Sie willigte ein, schien denn seine Gegenwart allemal angenehmer als das Gelächter der Soldaten, das sie zuhause erwartete. Obwohl sie bestenfalls die Hälfte vom dem verstand, was ihr der Soldat erzählte, unterhielt sie sich während der Wartezeit blendend. Durch das Geplauder verstrichen fast zwei Stunden wie im Nu.
Als sie mit dem Korb voller dampfender Uniformhosen den Heimweg antrat, neigte sich der Tag dem Ende. Falls sie bei Einbruch der Dunkelheit zuhause sein wollte, musste sie sich beeilen. Jetzt, im Halbdunkel, wirkten die Gassen nicht nur eng und schmutzig wie tagsüber, sondern geradezu bedrohlich. Hinzu kam der modrige, fast faulige Geruch, der schwer wie Blei über den Häusern hing. Sie blickte nach oben, um das Zeitgefühl nicht gänzlich zu verlieren. Aber die düsteren Wolken, die stürmische Böen über den dunkelblauen Himmel jagten, verstärkten ihr unbehagliches Gefühl noch weiter. Der eisige Wind kündigte eine weitere kalte Nacht an. Sie fröstelte und schlug den Kragen ihres Umhanges bis zum Kinn.
Als sie an der nächsten Hausecke in einen schmalen Verbindungsweg einbog, wurde ihr Unbehagen greifbar. Mehrmals warf sie einen Blick zurück, um nachzusehen, ob ihr jemand folgte. Nichts. Wenig später meinte sie, hinter sich leise Schritte auf den Pflastersteinen zu hören. Sie blieb stehen und schaute sich erneut um. Doch sie sah nur die finstere und verlassene Gasse, die in die Dunkelheit führte. Trotzdem spürte sie, dass ihr jemand folgte.
Urplötzlich löste sich eine männliche Gestalt aus den Schatten der Nacht. Nackte Angst kroch in ihr hoch. Mit pochendem Herzen stierte sie in die Dunkelheit. Sie hatte sich also nicht getäuscht. Ganz deutlich setzte sich jetzt eine helle Hose vom Hintergrund ab. Sie schrie auf. Der längliche Gegenstand in seiner Hand sah aus wie ein Gewehr – es war ein Soldat.
Die junge Frau bemühte sich, so ruhig wie möglich weiterzugehen. Doch unwillkürlich wurden ihre Schritte hastiger. Zugleich kam es ihr vor, als ob auch der Soldat schneller ging. Bald vertrieb die Gewissheit den letzten Funken Hoffnung: Hinter sich hörte sie jetzt keuchende Atemzüge und der Gestank von Alkohol, vermischt mit altem Schweiß, holte sie ein. Panik befiel sie.
Abermals beschleunigte sie ihren Gang. Warum befand sich heute Abend niemand auf diesem Weg? Sie musste versuchen, eine andere Straße zu erreichen, schoss es ihr durch den Kopf. Dorthin gehen, wo sich andere Menschen aufhielten. In dem Moment, als sie loslaufen wollte, spürte sie einen harten Schlag auf ihrer Schulter. Eine mächtige Hand hielt sie fest. Vor Schreck ließ sie den Wäschekorb fallen und versuchte, der Umklammerung zu entkommen. Doch dieser ungeheuerlichen Kraft hatte sie nichts entgegenzusetzen.
»Crie – et tu es mort!«, hörte sie eine gedämpfte Stimme, ganz nah an ihrem Ohr.
An ihrer Schulter löste sich der Griff, allerdings nur um sogleich ihren Leib zu umklammern. Der Unbekannte zog sie ruckartig nach hinten. Sie flog durch die Luft, als ob ihr Körper kein Gewicht hätte. Dann spürte sie kaltes Metall in ihrem Nacken. Augenblicke später drang der penetrante Geruch von Waffenöl in ihre Nase. Der Mann schlang blitzartig den Gewehrriemen um ihren Hals und zog daran, bis sie fast keine Luft mehr bekam.
Hundertachtzig-Eff-Dreiundvierzig.
»Un seul mot ... ich dich werden töten!«, wiederholte er. Der Tonfall ließ keinen Zweifel an seiner Absicht aufkommen.
Sie nickte schwach, soweit es der Riemen um ihren Hals zuließ. Bei jeder noch so kleinen Bewegung schnitt die scharfe Kante des Leders in ihre Haut und verursachte höllische Schmerzen. Sie dachte an ihre Familie, an ihre Mutter, den Vater und natürlich den kleinen Bruder, ein Quälgeist, den sie aber dennoch so unendlich lieb hatte.
Unerwartet löste sich die Umklammerung um ihren Körper, bis der Soldat den Arm gänzlich wegzog. Gleichzeitig lockerte er auch den Gewehrriemen um ihren Hals.
Hundertachtzig-Eff-Dreiundvierzig.
Sie begann zu husten und sog begierig Luft ein. Im gleichen Augenblick nahm sie wieder den Geruch von Alkohol und Schweiß wahr. Feuchter, heißer Atem strömte an ihrer Wange entlang und drang ihr in die Nase. Sie fasste wieder Mut und schlug um sich. Plötzlich bekam sie den Aufschlag am Uniformrock zu fassen und zog daran. Doch der Mann hinter ihr war zu stark. Schlimmer noch, er zog den Gewehrriemen wieder enger und nahm ihr so jede Möglichkeit der Gegenwehr.
Hundertachtzig-Eff-Dreiundvierzig.
Mit beiden Händen versuchte sie, den Riemen zu lockern, der wie ein Stahlseil ihren Hals zuschnürte. Sie musste würgen und drohte ohnmächtig zu werden. Jede Faser ihres Körpers schrie jetzt nach Sauerstoff.
Der Soldat lockerte seinen Griff etwas und drohte grimmig: »Compris? Du verstehen ...?«
Sie schnappte verzweifelt nach Luft. Doch der Atem in ihren Lungen wollte nicht ausreichen, um sprechen oder gar schreien zu können. Stattdessen vernahm sie sein höhnisches Gelächter, das immer mehr in ein lüsternes Stöhnen überging. In wilden Schüben entströmte seinem Rachen der stinkende Atem. Ihr Martyrium hatte gerade erst begonnen.
Der Soldat begann, sie anzufassen. Grob betatschten seine mächtigen Hände sie überall am Körper. Er stöhnte gierig. Erstarrt und völlig empfindungslos ließ sie es geschehen. Sie stürzte vornüber auf die Pflastersteine und schlug sich das Gesicht blutig. Sie spürte noch den bestialischen Schmerz zwischen ihren Schenkeln, während alles um sie herum in undurchdringlicher Schwärze versank.
Hundertachtzig-Eff-Dreiundvierzig.
Erster Teil Frankfurt am Main — Paris
Eins
Niemand hätte behaupten wollen, Secondelieutenant Leopold Johann Berend wäre klein oder gar zu klein, wenngleich es in seiner Abteilung kaum jemanden gab, der ihn nicht zumindest um einen halben Kopf überragte. Dies lag vor allem daran, dass Leo - wie ihn jeder seit seiner Kindheit nannte - ein Bulle von einem Mann war. Seine Schultern maßen die Breite mancher Türrahmen, und um seine Oberarme zu umfassen, reichten zwei Hände nicht annähernd aus. Die schulterlangen Haare schimmerten in blonden bis bräunlichen Schattierungen. Meist trug er sie zu einem kurzen Zopf gebunden, den er unter seiner Kopfbedeckung verbarg.
Auf den ersten Blick flößten die kantigen, beinahe groben Gesichtszüge Ehrfurcht ein. Schaute man aber in die hellen Augen unter den buschigen Brauen, weckte der oftmals sanfte Blick sofort Vertrauen und Neugier. Wenngleich Leopold noch keine zwanzig Lebensjahre zählte, lag schon ein dunkler Schatten über ihm. Etwas hielt sein Herz fest umklammert, ohne Aussicht, es jemals wieder freizugeben. Niemanden ließ er daran teilhaben; er sprach zu keiner Zeit darüber. Oft umgab ihn eine Art Düsterkeit wie ein finsterer Schleier. Dann loderte in diesen sonst so leuchtenden Augen der blanke Hass und die Unversöhnlichkeit in seiner Stimme mahnte jeden zur Vorsicht.
Leopold stammte aus bürgerlichen Familienverhältnissen. Ein Umstand, der vor gar nicht allzu langer Zeit den einfachen Soldatendienst bedeutet hätte. Erst mit der Heeresreform hatte die Kommission von General Scharnhorst das Adelsprivileg abgeschafft. Für die preußische Militärtradition ein geradezu unerhörtes Vorgehen, das in den Reihen der altgedienten Truppenführer immer noch viele Gegner hatte. Bis zuletzt stemmten sie sich besonders bei den königlichen Garden gegen bürgerliche Offiziere. Doch auch die letzte Bastion adeliger Befehlsgeber bröckelte. In seiner Einheit, der Gardeabteilung drei, stand die Abstammung eines Mannes nicht mehr im Vordergrund. Im Grunde hätte es dieses Detachement im Garde-Jäger-Bataillon nicht geben dürfen, denn offiziell bestand das Bataillon lediglich aus zwei Kompanien.
Vor wenigen Wochen hatte ihm Generalfeldmarschall von Möllendorff das Offizierspatent in Breslau verliehen. Secondelieutenant - ein Dienstgrad, den er gewiss nie angestrebt hatte. Bei der Verleihung hatten sie gesagt, wegen heldenhafter Verdienste für König und Vaterland. Auch das interessierte ihn nicht. Schon als kleiner Junge gab er nichts auf Soldaten, Uniformen und Orden. Das unterschied ihn schon früh von anderen Kindern. Während die mit Holzgewehren in der Gegend herumliefen, wollte Leopold den Beruf seines Vaters ergreifen: Beamter beim preußischen Kartenamt. Oft hatte er ihn bei der Arbeit besucht. Meist zur Mittagszeit, um das Essen vorbeizubringen. Landkarten faszinierten Leopold und er bewunderte den Vater, wie er es fertigbrachte, die große Welt auf so kleinen Papierstücken darzustellen. Auch sein Vater dachte wohl, dass Leopold irgendwann den gleichen Berufsweg einschlagen würde. Immerzu betonte er, dass diese Laufbahn kein wohlhabendes Elternhaus voraussetzte und trotzdem die große Sicherheit einer späteren Anstellung versprach.
Doch das Leben hatte andere Pläne mit Leopold. Ein einziger Augenblick hatte genügt, um sein Dasein in andere Bahnen zu lenken. Was wäre wohl aus ihm geworden, wenn das Schicksal es gnädiger mit ihm gemeint hätte? Würde er dann ebenfalls als Soldat auf dem Feld stehen und ohne Schuldgefühle Männer töten, die er nicht kannte? Leopold hatte diese Frage noch nie beantworten können – und letztlich wollte er es auch nicht wissen.
Er atmete tief durch. Das Stechen in seinem Unterarm hatte endlich nachgelassen. Dennoch rieb er die vernarbte Stelle, um auch den letzten Rest des Schmerzes zu vertreiben. Er ließ seinen Blick ziellos durch den Raum schweifen, der seit ein paar Wochen seine neue Unterkunft darstellte. Die kleine Stube mit dem grob gezimmerten Fußboden maß höchstens vier mal vier Schritt. Es gab lediglich ein Fenster mit winzigen Kassettenscheiben, das nur wenig Licht in den Raum ließ. Jetzt im Winter, bei der tief stehenden Sonne, konnte er ohne zusätzliche Beleuchtung auch tagsüber kaum lesen. Für die Umschreibung der Einrichtung reichte ein einziges Wort: karg. Außer Bett, Schrank, Schreibtisch und Stuhl - jeweils in zweifacher Ausfertigung - verschönerte kein anderes Möbelstück das Zimmer.
Sein Blick blieb an dem schwarzen Pompon hängen, der aus seinem Czakot ragte, einem Büschel Gerste gleich. Er trat näher an den Tisch. Obwohl die Kopfbedeckung einen guten Teil der kleinen Tischplatte einnahm, forderte ein anderer Gegenstand seine ganze Aufmerksamkeit: die Pistole daneben. Zögernd ergriff er die fabrikneue Waffe. Sofort stieg ihm öliger Geruch in die Nase. Ein vertrauter Geruch, wie er fand. Leopold spannte den Hahn und überprüfte, ob der Feuerstein ein Stück hervorragte. Nie wieder wollte er den Fehler begehen, den Stein zu tief im Hahn zu verschrauben. Aus Unerfahrenheit hätte ihn das fast das Leben gekostet, als die obere Hahnlippe und nicht der Feuerstein auf dem Batteriestahl aufschlug. Es gab keine Funken, um das Schwarzpulver für die Treibladung der Kugel zu zünden. Und die Pistole versagte im unpassendsten Augenblick, als ein Trupp französischer Grenadiere mit gezücktem Säbel direkt auf seine Einheit zugaloppierte. Mit der unbrauchbaren Waffe in der Hand hatte er sich nicht verteidigen können. Nur der Treffsicherheit seiner Kameraden war es zu verdanken, dass die Grenadiere damals nicht bis zu ihren Linien vordringen konnten. Jetzt jedoch steckte der Feuerstein an der richtigen Position. Die Spitze ragte bestimmt zwei Strich über die Hahnlippen. Leopold klappte den Pfannendeckel zu und zog langsam am Abzugsbügel der ungeladenen Waffe, um den Druckpunkt zu finden. Dieser früher so vertraute Punkt, an dem die Feder den Hahn freigab, lag bei der neuen Waffe nicht nur an völlig anderer Stelle, sondern der gesamte Abzugsmechanismus funktionierte eigentümlich. Viel zu früh spürte er den Widerstand und zog nur etwas stärker daran. Sofort schrammte der Flint an der Schlagfläche vorbei und öffnete den Pfannendeckel mit einem hellen Klicken. Ein Funkenregen sprühte auf die leere Pfanne.
Bedächtig legte er die Waffe wieder zurück und griff nach dem Czakot. Die Kopfbedeckung aus feinem Filzmaterial bedeckte an Rand und Deckel schwarzes, geschmeidiges Leder. Unterhalb des schwarzen Pompons glänzte der achtzackige Gardestern mit dem preußischen Adler. Darüber schimmerte in goldenen Buchstaben das Motto der Garde: »SUUM CUIQUE« – Jedem das Seine.
So angenehm sich der Alltag in seinem neuen Quartier auch darstellte, an das Anziehen der Offiziersuniform würde er sich nie gewöhnen. Mannschaften und Unteroffiziere taten sich deutlich leichter. Obwohl die Uniform aus unvergleichbar feinerem und sicherlich wertvollerem Tuch bestand, strapazierten besonders die zahlreichen Knöpfe, Häkchen und Verzierungen seine Nerven. Dann gab es noch diese in seinen Augen unnötig langen Beinkleider. Sie reichten schon bei größeren Männern bis hinunter zum Fuß und wiesen Lederriemen auf, um sie unter der Sohle zu befestigen. Er hingegen konnte sich die Riemen problemlos um die Zehen wickeln. An der Außenseite der Hose, die es je nach Verwendungszweck in Schiefergrau für Feldeinsätze oder Lilienweiß für Paraden gab, glänzten versilberte Knöpfe. Die Knopfkante umschloss ein rubinroter Tuchvorstoß. An Oberschenkel und Wade engte die Hose seine kräftigen Beine nahezu unerträglich ein. Leopold wunderte sich regelmäßig, wie es andere Offiziere aushielten, den ganzen Tag über Beinkleider zu tragen, die die Blutzirkulation derart hemmten.
Elegant fand er zunächst die neuen Uniformröcke aus dunkelgrünem Tuch. Doch die Jacke passte nicht über seine Schultern, ohne dass die Nähte unter den Achseln bedenkliche Geräusche von sich gaben. Nach endlosen Tauschversuchen hatte er diesen Morgen schließlich eine passende Jacke bekommen und sie anprobiert. Zwar spannte sich jetzt das Tuch immer noch über die mächtigen Schultern, doch wenigstens knisterten die Nähte nicht bei jeder Armbewegung.
Er trat an den Kleiderschrank und zerrte den schweren Uniformrock vom Bügel. Kritisch beäugte er den schmalen Schnitt der Jacke. Mit dem niedrigen, unverschlossenen Kragen und den offenen Ärmeln sah sie fast aus wie eine Kopie des französischen Pendants. Lediglich das Seidentuch unter den sichtbaren Aufschlägen schimmerte nicht in Weiß, sondern in Rubinrot, wie die anderen Tuchvorstöße. Doch noch bevor der Uniformrock gänzlich übergezogen war, bereute er seine anfängliche Zuversicht. Um die Knöpfe auf Brusthöhe zu schließen, musste er zuerst die gesamte Luft aus den Lungen pressen. Vielleicht würde sich der Stoff im Laufe der Zeit noch etwas dehnen, hoffte er.
Sein Blick streifte das schlichte Türchen am Wertfach des Kleiderschranks. Es stand halb offen und die Schatulle dahinter forderte plötzlich seine ganze Aufmerksamkeit. Binnen eines Augenblickes änderte sich sein Gesichtsausdruck, und ein harter Zug erschien um seinen Mund. Er riss seinen Blick los und zog die Halsbinde aus schwarzem Samt von der Stuhllehne, um sie umzubinden. Begleitet von leisen Flüchen benötigte er für die ungewohnten Handgriffe gewiss mehrere Minuten. Unzweifelhaft waren weder seine mächtigen Hände noch die kräftigen Finger für solch filigrane Tätigkeiten geschaffen. Erst nach einigen Versuchen umschloss die Schleife zu seiner Zufriedenheit den Kragen. Kritisch beäugte er sein Werk in dem handtellergroßen Spiegel, der in der Schranktüre hing.
Das Gesicht, das ihn daraus anstarrte, erschreckte ihn. Dunkle Ringe drängten seine Augen in tiefe Höhlen zurück und er entdeckte Falten, die er nie zuvor bemerkt hatte. Seine Faust ballte sich wie von selbst, und noch bevor er einen weiteren Gedanken fassen konnte, landete sie mit einem lauten Krachen auf dem Spiegel. Doch dort gab es kein Glas, das splittern konnte. Der Spiegel bestand lediglich aus einem blanken Stück Metall. Er unterdrückte einen Schmerzensschrei und stöhnte stattdessen laut auf. Schadenfroh hielt ihm sein Spiegelbild eine Grimasse entgegen. Er verfluchte seine Unbeherrschtheit und drehte sich weg.
»Fini, mon ami?«, riss ihn die Stimme seines Kameraden aus den Gedanken. Leopold hatte ihn nicht bemerkt, als er eingetreten war.
»Sprich deutsch mit mir, wenn du willst, dass ich dir antworte!«, erwiderte er, ohne ihn dabei anzusehen.
Eigentlich beachtete Leopold Menschen, die in französischer Manier mit ihm sprachen, entweder überhaupt nicht oder er ließ sie sofort spüren, dass sie es besser unterlassen hätten. Doch bei Carl Eugen von Starnenberg machte er eine Ausnahme. Der baumlange, schmächtige Ostpreuße bekleidete ebenfalls den Rang eines Secondelieutenants. Doch damit erschöpften sich schon ihre Gemeinsamkeiten. Im Grunde stellte Carl das totale Gegenteil von Leopold dar. Dichte, dunkle, fast schwarze Haare bedeckten sein Haupt und ein schmaler, modischer Bart zierte seine Oberlippe, die er ständig mit der Zungenspitze anfeuchtete. Noch schmaler als der Bart zogen sich dünne Brauen wie scharf nach oben gezogene, schräge Striche über seine ausdrucksvollen tiefbraunen Augen. Auf der blassen Haut bildete die dunkle Behaarung einen starken Kontrast, was ihn für die meisten Frauen begehrenswert machte.
Carl spitzte seine Lippen und erwiderte: »Was soll ich denken, wenn du wie ein eitles Frauenzimmer in den Spiegel starrst.« Auf seinen feinen Gesichtszügen zeigte sich ein ironisches Grinsen. »Allerdings zertrümmert die Damenwelt danach nicht den Spiegel - jedenfalls nicht die Frauen, die ich kenne.«
Leopold hob die Augenbrauen und warf seinem Kameraden einen tadelnden Blick zu, bevor er ebenso spöttisch erwiderte: »Offensichtlich kennst du noch nicht genug Frauenzimmer.«
Leopold wusste sehr wohl, dass eher das Gegenteil zutraf. Es gab eine bemerkenswerte Anzahl von Frauen, die Carl anhimmelten und er vermochte sich vor Liebesbezeugungen kaum zu retten. Viele Stunden verbrachte er damit, auf ihre Briefe zu antworten. Und durch seine zahlreichen Termine kam er oft in arge Bedrängnis. Besonders dann, wenn er sich seine Zeit wieder auf dem nahen Schießplatz vertrieb. Obwohl er Schießübungen überhaupt nicht nötig hatte. Denn Leopold hörte, dass Carl von klein auf schießen konnte. Schon als Kind hatte er seinen Vater, einen angesehenen Offizier, auf der Jagd in den familieneigenen Wäldern begleitet.
Zu Recht trug Carl unter den anderen Offizieren in der Kaserne den Ruf eines Schöngeistes. Jederzeit trat er zuvorkommend und kultiviert auf. Dabei stellte er keinesfalls den geltungssüchtigen jungen Adeligen dar, der mit übertriebener Eleganz um Aufmerksamkeit heischte. Als belesener und gebildeter Mann glänzte er während einer Konversation mit Allgemeinbildung und Fachwissen, was sich auf seine hervorragende Ausbildung an einer ostpreußischen Offiziersschule zurückführen ließ. Er sprach bestimmt so gut Französisch wie Deutsch und Polnisch.
»Sei nicht so unhöflich zu mir, Leo. Es schien mir gerade so, als ob du nur vor dich hin träumst.« Er fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. »Reitest du in Gedanken immer noch mit den Lützower Jägern durch den Thüringer Wald? Du musst wissen, weit über die Grenzen Preußens gilt dein altes Corps als verwegener Haufen voller Hasardeure und Abenteurer. Ich würde viel dafür gegeben, um dabei zu sein.« Anerkennend nickte Carl.
»Dazu hättest du dich nur letzten Februar im Goldenen Szepter in Breslau einfinden müssen«, antwortete Leopold. »Damals diente das Wirtshaus Major von Lützow als Werbebüro für freiwillige Rekruten.«
Er konnte sich noch genau an jenen trüben Wintertag erinnern, an dem er dort eintraf. Außer den Kleidern, die er am Leib trug, besaß er nur noch seine kleine, hölzerne Schatulle mit etwas Geld. »Schon das Banner aus schwarzer und roter Seide, das über der Tür hing, wäre nach deinem Geschmack gewesen. In golden eingestickter Schrift stand dort: ‚Mit Gott fürs Vaterland‘. Und die meinten damit nicht nur Preußen, sondern ganz Deutschland. Die Befreiung vom Franzosenmob und die Vereinigung aller Deutschen in einem Reich – das waren die Gründe, warum sich die meisten dort eingefunden haben.«
»Du etwa nicht?«, warf Carl ein.
Leopold stieß einen verächtlichen Laut aus und knurrte: »Nicht nur.« Freilich hasste auch Leopold die Besatzer. Und lieber heute als morgen würde er die Froschfresser über den Rhein, ja bis nach Paris jagen. Doch an ein vereinigtes Reich aller Deutschen verschwendete er keinen Gedanken. Im Grunde interessierten ihn die zerstrittenen Länder nicht.
»Ja - das wäre wohl was für mich gewesen«, wiederholte Carl und seine Augen begannen zu glänzen.
Diesmal konnte sich Leopold ein Grinsen nicht verkneifen. »Auf einen hageren Ostpreußen wie dich wäre es in diesem Gedränge wohl nicht mehr angekommen. Bauernburschen, Handwerksgesellen, Studenten, auch Adlige, einfach alles war vertreten. Ich habe die vielfältigsten Dialekte gehört, sogar welche, die mir bis dahin gänzlich unbekannt waren. Ja, die hätten auch dich genommen.«
Carl schien die Ironie in Leopolds Stimme überhört zu haben: »Stimmt es, dass ihr anfangs nicht einmal Uniformen erhalten habt?«
Leopold nickte knapp. »Viele hatten sich zwar mit Säbeln, Pistolen und Musketen aller Herren Länder bewaffnet. Und wer keine Waffe hatte, der hat einen schweren Kavalleriesäbel mit beledertem Handgriff erhalten. Doch Uniformen oder Geld haben wir nicht bekommen. Nur Verpflegung und Unterkunft. Wir haben das angezogen, was die meisten von uns besaßen: schwarze Hosen und schwarze Mäntel. Wer kein schwarzes Gewand sein Eigen nannte, dessen Alltagskleidung wurde kurzerhand in einem Sud aus Rinde und Wurzeln schwarz gefärbt. Erst später hat das Königshaus passende schwarze Czakots mit vergoldeten Schuppenketten beigesteuert.«
»Auch das hätte ich über mich ergehen lassen.«
»Bist du dir da so sicher? Unendlich viele Nächte haben wir mitsamt den Offizieren unter freiem Himmel geschlafen oder Unterschlupf in zugigen Scheunen gefunden. Wegen der schwarzen Uniform, die wir Monate später gegen unsere Zivilkleidung getauscht haben, nannten uns die Franzmänner bald brigands noirs.«
»Schwarze Räuber«, übersetzte Carl ehrfürchtig.
»Bei Gefangennahme hat uns nicht das Kriegsrecht und Gefängnis gedroht, wie den anderen Soldaten, sondern die Galeere.«
Carl atmete hörbar aus und hing weiterhin an Leopolds Lippen.
»Monatelang haben wir die große Militärstraße vom Westen über Erfurt bis nach Leipzig unsicher gemacht«, fuhr Leopold fort. »Nicht, dass wir tagsüber eine Chance gegen die gut ausgebildeten Soldaten gehabt hätten. Aber nachts haben sich die Machtverhältnisse dann umgekehrt. In kleinen Gruppen haben wir französische Einheiten hinter deren Linien überfallen. Das hat den überraschten Froschfressern empfindliche Verluste eingebracht ...« Er verstummte und dachte an die Genugtuung, die er dabei zuerst verspürt hatte. Doch irgendwann reichte das nicht mehr. Es reichte nicht mehr, dass sie siegten, es reichte nicht mehr, dass die anderen starben. Es musste einfach noch mehr geben.
»Man erzählt sich, dass die gebildetsten Köpfe Deutschlands bei den Lützowern sind«, unterbrach Carl seine Gedanken.
Leopold nickte. »Ja. Dichter, Schriftsteller und Komponisten gehörten dazu. Trotzdem waren wir innerhalb kürzester Zeit eine verschworene Gemeinschaft. Es hat keine Unterschiede des Standes, der Ausbildung, des Vermögens oder der Staatszugehörigkeit gegeben. Viele von uns waren einfach nur stolz, in dieser Truppe gegen die Franzmänner zu kämpfen. Und wohin wir auch kamen, die Bevölkerung hat uns verpflegt, Nachtquartiere angeboten und uns mit wichtigen Nachrichten über die Bewegungen des Gegners versorgt.« Leopold hielt inne und begann vor sich hin zu lächeln.
»Was ist los?«, wollte Carl wissen.
»Wir haben nicht einmal vor diesen verfluchten Franzosenfreunden, diesen Rheinbundfürsten haltgemacht. In Wendelstein haben wir eine Koppel wertvoller königlich-sächsischer Trakehner erbeutet. Bestimmt zwei Dutzend edelster Rösser - welch willkommener Fang für eine berittene Truppe wie wir. Noch heute denke ich gerne an jenen sonnigen Frühlingstag zurück.« Leopold lachte kurz auf, bevor er etwas leiser weiterredete: »Vor einem kleinen sächsischen Städtchen hat uns ein Bauer verraten, dass sich auf dem Marktplatz ein paar Hundert Männer aus Thüringen versammelt hätten. Sie sollten Soldaten Napoléons werden.«
»Ihr habt sie gefangen genommen!«, rief Carl ungeduldig aus.
»Nein – viel besser«, Leopold schüttelte vehement den Kopf. »Major Lützow fasste einen kühnen Entschluss. Mit einer Handvoll Reiter sind wir in die Stadt gesprengt und auf den Marktplatz geritten. Direkt vor der Front der Rekruten haben wir dann haltgemacht. Der Major schrie über den Platz: ‚Alles hört auf mein Kommando!‘. Die Männer haben sofort auf ihn gehört und ihre Gewehre abgestellt. Kaum hatte er seine Ansprache beendet, traten beinahe alle in das Freicorps ein. Und die wenigen anderen haben sich sofort verzogen.«
»Gern hätte ich das Gesicht des französischen Rekrutierungsoffiziers gesehen, als er den Verlust seiner mühsam zusammengestellten Truppe bemerkte«, amüsierte sich Carl.
»Doch es hat nicht nur siegreiche Tage gegeben«, fuhr Leopold mit bitterer Stimme fort. »Einen schon bis ins Detail geplanten Schlag gegen eine Nachschubkolonne konnten wir nicht mehr ausführen. Als wir im Juni Plauen erreichten, haben wir überraschend erfahren, dass es einen Waffenstillstand gibt. Und das Abkommen enthielt für uns eine fatale Festlegung: Alle militärischen Einheiten der Verbündeten, die im Hinterland der französischen Armee operierten, verpflichteten sich innerhalb von zwei Tagen zum Rückzug über die Elbe. Doch wir hatten nicht die geringste Chance, den Termin einzuhalten. Zu diesem Zeitpunkt befanden wir uns noch Dutzende Meilen entfernt.«
»Was geschah weiter?«
Leopold zuckte mit den Schultern. »Es kam, wie es kommen musste. Auf dem Rückmarsch zur Elbe hat uns vor einem Dorf, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, eine berittene Übermacht angegriffen. Der französische Kommandeur verhöhnte uns: ‚Waffenstillstand? Für alle Welt, aber Ihr seid ausgenommen!‘ Auch ein württembergischer General schnauzte uns an: ‚Begehrt Pardon, Ihr preußischen Hunde!‘«
»Daher stammt deine Verletzung am Arm, oder? Du hast noch nie davon erzählt.«
Statt einer Antwort wanderte Leopolds Blick hinaus zum Fenster. Erst nach einer Weile redete er weiter: »Bevor wir uns ergeben oder zur Gegenwehr formieren konnten, haben die Angreifer rücksichtslos auf uns eingeschlagen.«
»Welch feige Tat!«, rief Carl entrüstet aus.
»Sofort haben mich württembergische Dragoner eingekeilt. Und ich habe den Säbel nicht mehr aus der Scheide gebracht. Innerhalb weniger Sekunden trafen mich zwei Hiebe an Arm und Schulter. Plötzlich hat mein sonst so zuverlässiger Trakehner Hengst gescheut und ich fiel herunter. Zum Glück muss ich heute sagen. So hat mich ein dritter Hieb knapp verfehlt.« Leopold ließ erneut einen Augenblick verstreichen, bevor er fortfuhr: »Doch es sollte noch schlimmer kommen. - Denk immer daran, auf dem Boden gibt es keinen Schutz vor Dragonern. Bald brach eine riesige, schwarze Wand aus Muskeln, Sehnen und Knochen über mich herein. Dutzende Zentner Fleisch haben mich von den Füßen gerissen und durch die Luft geschleudert, wie einen losen Strohhalm im Wind. Weißt du, wie sich das anfühlt? Du bist auf einmal so klein, so machtlos. Auf Knien und im Liegen habe ich versucht, den massigen Pferdeleibern auszuweichen. Ein Huftritt hat genau den Ellenbogen meines verletzten Arms getroffen. Ich habe förmlich den Knochen im Gelenk krachen gehört und es schien mir, als ob ich vor Schmerz ohnmächtig werden würde. Aber wie durch ein Wunder haben mich die Pferde nicht zerquetscht, und ich schaffte es, mich aus dem Kampfgewühl zu schleppen. Schwer verletzt und ohne Ausrüstung konnte ich mit einer kleinen Schar flüchten.«
»Ihr habt es trotzdem bis zur Elbe geschafft, oder?«
»Ja, auf Umwegen haben wir noch am selben Tag das linke Ufer erreicht und uns im Ried versteckt. Ich habe damals viel Blut verloren. Aber glücklicherweise bin ich dann an Verbandsmaterial gekommen.« Er zögerte. Carl musste nicht wissen, dass es ein paar französische Deserteure waren, die damals bereitwillig ihr gesamtes Verbandsmaterial opferten. Auch sie wollten sich über die Elbe absetzen. Ohne ihre Hilfe hätte er womöglich die folgende Nacht nicht überlebt. Wenn er jetzt auf jene Tage zurückblickte, die er schwer verletzt im Schilf zugebracht hatte, erkannte Leopold, dass er in den Monaten zuvor vieles falsch gemacht hatte. Es waren nicht die französischen Soldaten, die Besatzer, die ihm das ganze Leid angetan hatten. Nicht sie sollten seine Rache spüren, sondern es galt diesen einen Mann, die Bestie zu finden. Nur er musste seine Schuld abtragen – und zwar bei ihm.
»Wie konntest du mit solch einer schweren Verletzung über den Fluss entkommen?« Fieberhafte Ungeduld schien jetzt ein fester Bestandteil von Carls Stimme zu werden.
»Während wir im Ried ausharrten, haben etwa achtzig meiner Kameraden eine Bresche mitten durch die Angriffslinien gekämpft und in den Morgenstunden des nächsten Tages ebenfalls das Ufer erreicht. Mit Unterstützung hilfsbereiter Bürger, die inzwischen Kähne besorgt hatten, konnten wir schließlich den Strom überqueren und haben auf der anderen Seite Schutz gefunden.«
»Hat man dir schon erzählt, was mit dem Rest deiner Kameraden geschehen ist?«, warf Carl ein.
Leopold schüttelte den Kopf.
»Aber ich kenne die Geschichte«, begann Carl mit einem Nicken. »Unter strenger Bewachung haben die Franzosen etwa dreihundert davon in ein Leipziger Gefängnis verschleppt. Doch sie hatten nicht mit der Solidarität der Leipziger Bürger gerechnet. Ärzten, die Verwundete versorgten, Geistlichen und auch Frauen mit Lebensmittelkörben ist der Zutritt nicht verwehrt worden. Und die schmuggelten Kleidungsstücke ins Gefängnis. Verkleidet als Arzthelfer und Geistliche, ja sogar als Krankenschwestern und Stubenmädchen ist vielen die Flucht gelungen. Und nach wenigen Tagen haben kaum noch hundert von euch in den Zellen gesessen.« Carl setzte kurz ab. »Damit hatte allerdings auch die Großzügigkeit der Franzosen ein Ende. Ihr Kommandant hat den Belagerungszustand über die ganze Stadt verhängt. Ohne wichtigen Grund durfte niemand mehr hinaus noch hinein.«
»Wo sind die Männer jetzt?«
»Die restlichen Gefangenen wurden vermutlich in eine entlegene Alpenfestung in Savoyen gebracht.« Carl hielt inne und deutete mit dem Kinn auf Leopolds Arm. »Damals hat es dich wohl schwer erwischt.«
»Ich fürchte ja.« Leopold nickte. »Mein Arm hing tagelang völlig taub herunter. Der Pferdetritt hatte das Gelenk zertrümmert.« Bei dem Gedanken daran spürte Leopold wieder den sengenden Schmerz. Erneut rieb er sich die wulstige Narbe, die sich vom Ellenbogen abwärts bis fast zum Handgelenk über seine Haut zog. Sie würde ihn sein ganzes Leben lang an den heimtückischen Angriff erinnern. Und die Ungewissheit, ob er seinen linken Arm jemals wieder ganz durchstrecken könnte, bedrückte ihn.
»Warum bist du nicht einfach bei den schwarzen Räubern geblieben?«
»Mit dem unbrauchbaren Arm?« Leopold seufzte wehmütig. »Außerdem gibt es das Corps so nicht mehr. Im Oktober, nach der großen Schlacht von Leipzig war alles vorbei. Napoléon hat sich mit den Resten seiner Armee über den Rhein zurückgezogen und wir wurden der regulären preußischen Armee einverleibt. Den Rest kennst du.«
»Ja«, Carl nickte nachdenklich. »Jetzt sind wir im Hauptquartier der Verbündeten, weit weg von zuhause.« Ein melancholischer Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Unverkennbar hing er mit ganzem Herzen an seiner ostpreußischen Heimat.
»Was denn? Jetzt schon Heimweh?«
Carl schüttelte den Kopf, aber seine Gedanken schienen weit entfernt, als er weiterredete: »Weißt du, dass man vom Engelsberg das weite Mündungsdelta der Memel ganz überblicken kann? Bis hinaus zur Ostsee, in der sich abends stundenlang die Sonne spiegelt. Sogar im Winter. Und wenn du nach Norden schaust, siehst du, so weit das Auge reicht, bewaldete Höhen. Meilenweit nichts anderes als dunkelgrüne saftige Wälder.«
»Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht einmal, wo dein Engelsberg liegt.«
»In meiner Heimatstadt, in Tilsit.« Carl zögerte. »Erfüllt es dich nicht mit Stolz, deinem Land zu dienen?«
»Meinem Land dienen?«, fuhr Leopold auf. »Blödsinn ... ich habe kein Land.«
»Du bist doch Preuße ... wie ich, oder ...?«
»Ich bitte dich! Ich stamme aus einem beschissenen Hinterhof. Da gibt es kein Land, nur eine Mietwohnung im Erdgeschoss. Nicht einmal die Sonne kann man dort sehen.« Leopold verzog das Gesicht zu einer bitteren Grimasse. »Dafür umso mehr die Gosse, mit dem fauligen Geruch nach Schweiß und Pisse. Das kriegst du nie mehr aus der Nase.«
Carl schluckte. Ganz offensichtlich konnte er sich solche Verhältnisse nicht vorstellen und wechselte das Thema: »Heimat hin oder her, dafür sind wir jetzt Agenten der preußischen Geheimpolizei.«
»Die es gerade mal ein paar Wochen gibt«, fügte Leopold mit einem spöttischen Unterton hinzu. Er ließ sich auf den Stuhl fallen und nahm einen der frisch polierten Stiefel zur Hand. Selbst das wenige Licht im Zimmer reichte aus, um die frische Fettschicht auf dem schwarzen Leder zum Glänzen zu bringen. Doch den Geruch empfand er noch als gewöhnungsbedürftig.
»Wie geht es jetzt weiter?«, wollte Carl wissen.
Leopold zuckte mit den Achseln. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was er Carl darauf antworten sollte. Aber dafür kannte er seine eigenen Pläne umso besser. Seit jenen Tagen im Schilf stand sein Entschluss fest. Es gab kein Zurück mehr. Die Bestie - er musste sie finden. Bald sehnte sich jede Faser seines Körpers danach und niemand würde ihn davon abbringen. Inzwischen war es das Erste, an was er dachte, wenn er morgens aufwachte, und der letzte Gedanke, mit dem er abends einschlief. Hier in Frankfurt allerdings sollte niemand seine wahre Absicht erfahren. Vorerst nicht.
»Alors. Fini, mon ami?« Ein breites Grinsen zog sich wieder über Carls Gesicht, als er mit betont unschuldiger Miene sein Gegenüber anblickte.
Ergeben schüttelte Leopold den Kopf. Er konnte seinem Kameraden einfach nicht böse sein. Doch da war mehr: Er mochte ihn. Dessen Unbeschwertheit und die fast kindliche Freude standen für etwas, das er nicht erst in den letzten Monaten schmerzlich vermisst hatte. Gleichwohl war ihm jetzt nicht nach Späßen zumute und so erwiderte er knapp: »Ja, wir können gehen.« Er zog den zweiten Stiefel über und stand auf. Es war so weit.
Zwei
Isabelle lehnte am metallenen Handlauf vor dem Spiegel und blickte gleichgültig zu den anderen Mädchen hinüber, die den immer gleichen Tanzschritt übten. Sie mochte das Gehüpfe nicht. Mehr noch, sie konnte es nicht ausstehen, wenn fremde Leute sie dabei anstarrten. Obwohl viele der Meinung waren, sie hätte ein bezauberndes Äußeres. Zweifellos trafen die feinen Gesichtszüge den Geschmack vieler Männer. Wenngleich sie ihren Teint an den hochliegenden Wangen schon fast als zu rosig empfand. Es dauerte nie lange, bis die Farbe in ein erregtes Rot überging. Dann begann ein schier unerträglicher Zustand, der minutenlang andauern konnte. In solchen Fällen würde sie am liebsten im Boden versinken und erst wieder auftauchen, wenn sich die Gesichtsfarbe normalisiert hatte.
Ihr dunkelblondes, gewelltes Haar fiel bis weit auf den Rücken. Widerspenstige Strähnen, noch ausgeblichen vom vergangenen Sommer, umrahmten das zierliche Gesicht. Zahllose Sommersprossen tummelten sich um und auf ihrer Stupsnase. Isabelle hätte viel dafür gegeben, sie loszuwerden. Nicht nur weil sie die Pünktchen abstoßend fand, sondern um älter zu wirken. Freilich wies ihr Antlitz kaum noch mädchenhafte Züge auf. Schon die leicht angehobenen Brauen über den dunklen, fast schwarzen Augen und die spitzen Mundwinkel signalisierten Entschlossenheit.
Seit Monaten probte sie zweimal die Woche, immer früh am Morgen, diesen dümmlichen Tanz. Damit würden ihre Chancen steigen, beim kommenden Silvesterball, in knapp zwei Wochen, einen Mann zu erobern. So jedenfalls hatte sich ihre Mutter ausgedrückt. Wie sie diese Formulierung schon hasste. Überhaupt hasste sie alles hier in derGrande École de Danceim Pariser Norden. Den muffigen Gestank des abgewetzten Holzbodens, der bei jedem Schritt knarrte, als ob er durchbrechen würde. Oder die anderen Mädchen, die fast pausenlos kicherten, ohne einen Grund dafür zu haben. Und zu allem Übel gab es noch Louis, den Tanzlehrer. Mit seinen weit mehr als sechzig Lebensjahren, bewegte er sich ständig in Trippelschritten vorwärts. Nur die Zehenspitzen berührten dabei den Boden. Fast schon grotesk muteten die Drehbewegungen seines Oberkörpers beim Gehen an. Fortwährend stützte er seine linke Hand in die Hüfte, während der andere Arm eng am Körper anlag und ab dem Ellenbogen fast senkrecht nach oben zeigte. Gleichzeitig formten Daumen und Zeigefinger einen kleinen Kreis. Warum, konnte sich Isabelle nicht erklären. Womöglich hafteten Finger im vorgeschrittenen Alter einfach aneinander, wenn sie über längere Zeit nicht genug bewegt wurden.
Als sie das erste Mal seine Fistelstimme gehört hatte, konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Louis in Frauenkleidern mehr hermachen würde als in seiner abgewetzten dunklen Hose. Das blütenweiße Hemd mit den vielen Rüschen und die unglaubliche Parfümwolke, die ihn wie eine Hülle umgab, stellten bereits einen guten Anfang dar. Dringend sollte ihm jemand klarmachen, dass Perücken und weiß gepuderte Gesichter zumindest bei Männern zur Mode des letzten Jahrhunderts gehörten. Und wenn das geklärt wäre, könnte man ihm sagen, dass heutzutage die Quadrille getanzt wird und nicht dieses öde Gehüpfe aus den Zeiten vor der Revolution.
»Doucement, doucement, doucement!«, kreischte Louis. Er klatsche die flachen Hände aneinander, ohne dabei die Oberarme nennenswert vom Körper zu nehmen. Mit seinem weit nach hinten gedrückten Gesäß sah er jetzt einem Pfau nicht unähnlich, dem die Federn zum Radschlagen fehlten.
Die Musik verstummte und die Mädchen verharrten artig. Louis' Kreischen wurde noch eine Nuance schriller: »Der Contredanse ist kein Bauerntanz. Nehmt Eure Arme nach oben, so wie ich, und denkt dabei an den Partner, der Euch zum anderen Paar hinüberführt. Mit jeder Phrase der Musik ändern sich die Bewegungen und die Schrittform. Stampft dabei nicht so auf dem Boden herum. Das ist keine Weinlese, bei der Ihr mit Euren Füßen Trauben auspresst.« Er untermalte seine Belehrungen, indem er mehrmals mit beiden Füßen auf den Boden trat. Bei ihm sah es aus, als ob er vergeblich versuchte, seine Schuhe auszuziehen.
Mit gespielter Empörung ließ er seinen Blick über die Köpfe der Mädchen schweifen. Dann am Spiegel entlang, wo er schließlich an Isabelle hängen blieb. Auch das noch - jetzt würde sie ihr Fett abbekommen, dachte sie und verschränkte demonstrativ die Arme vor der Brust. Böse funkelte sie zurück.
»Und Ihr, Mademoiselle Isabelle?« Die beiden letzten Silben betonte er so affektiert, dass es sich fast nach einem Liedertext oder Gedicht anhörte. »Wollt Ihr uns nicht an Eurem unendlichen Leid teilhaben lassen. Vielleicht können wir gemeinsam herausfinden, warum Ihr nicht mit uns die Schritte übt? Tanzen ist unersetzbar, falls man einen gebildeten Mann erobern will.«
Da war es wieder, einen Mann erobern. Warum dachten alle, dass sie in den nächsten Wochen einen Mann benötigte? Würden die Männer danach knapp werden oder gar ausgehen? Nein – mit ihren zwanzig Jahren sollte sie noch genügend Zeit haben, den Mann fürs Leben zu finden. Und außerdem ging es diesen geschlechtslosen, verdorrten Wurm in Rüschen überhaupt nichts an, wann sie wen kennenlernen wollte.
Ihre Laune hatte einen Tiefpunkt erreicht. Offensichtlich bemerkte das sogar Louis, denn er hielt ihrem Blick nicht mehr stand und schaute auf den Boden. Die anderen Mädchen begannen zu kichern und verdeckten hastig ihren Mund. Die gleichzeitige Handbewegung glich dem einstudierten Teil einer Ballettaufführung. Genau so, wie es sich für adelige Mädchen gehörte, wenn sie lachten und Männer - oder eben Menschen, die Gott als solche erschaffen hatte - anwesend waren.
Isabelle spürte, wie ihr plötzlich die Röte ins Gesicht schoss. Doch nicht aus Scham, sondern vielmehr aus Zorn. Sie hasste Louis. »Lasst mich einfach nur in Ruhe!«, fuhr sie ihn an und rannte zum Ausgang.
Während sie den Saal durchquerte, spürte Isabelle die Blicke der anderen Mädchen, die sich in ihren Rücken bohrten. Sie wagte kaum, zu atmen. Erst nachdem die Türe mit einem lauten Knall hinter ihr ins Schloss gefallen war, holte sie tief Luft.
Niemand befand sich auf dem Gang – es herrschte Stille. Sie lief einfach weiter. Erst auf der Treppe vor dem Haus hielt sie inne. Viel besser als drinnen ging es ihr jetzt freilich nicht. Hinzu kam die Kälte und dummerweise lag ihr Mantel auf einem der Stühle im Saal. Trotzdem würden sie keine zehn Pferde mehr in dieses Gebäude bringen. Und für den nächsten Dienstagmorgen musste sie sich eben etwas einfallen lassen - vielleicht einfach nur Bauchweh oder Kopfschmerzen.
Isabelle begann zu zittern. Die Kälte schien immer mehr nach ihr zu greifen. Nein, sie würde nicht nachgeben, obwohl es bestimmt noch eine Viertelstunde dauerte, bis die Tanzstunde offiziell endete und die Kutsche kam. Fort von diesem Haus, diesem frauenhaften Tanzlehrer und diesen kichernden Mädchen. Einfach nur nach Hause, nach Belleville, dem eleganten Vorort östlich von Paris, wo sie im Frühling mit ihren Freunden Eduard und Pauline in den Weinbergen schlendern konnte. Dort oben, auf den Hügeln, lag ihnen die halbe Stadt zu Füßen; und besonders bei Sonnenuntergang eröffnete sich eine herrliche Aussicht über das Häusermeer. Hoffentlich würde es bald wieder Frühling werden.
***
Mit einer Hand schloss Leopold den obersten Knopf am Uniformrock, griff den Czakot vom Tisch und klemmte die Kopfbedeckung unter den Arm. Oberflächlich prüfte er ein letztes Mal den Sitz der Uniform, bevor er mit Carl aus dem Zimmer trat und auf dem frisch gebohnerten Holzboden den endlosen Flur entlangschritt. Wie jeden Tag empfing ihn auch heute wieder dieser unangenehme Geruch. Obwohl die Fenster weit offen standen und die eisige Winterluft hereinströmte, roch es penetrant nach Wachsseife und Harz vom täglichen Bohnern der Flure und Räume.
Sein Blick schweifte hinaus über die flachen und schneebedeckten Hügel, deren Silhouette im Dunst undeutlich, wie hinter Schleiern wirkte. Die vereisten Flockenschichten sorgten dafür, dass die gesamte Landschaft einheitlich erschien. Ackerland, Grünflächen oder Weideland waren schlicht nicht zu unterscheiden und bildeten eine durchgehende Fläche. Nur ganz im Osten zog sich vielleicht eine halbe Meile weit ein dunkler Waldsaum dahin, der allmählich hinter den Hügeln verschwand. Die milchige Sonnenscheibe hing nur wenig über dem Horizont. Noch besaßen ihre Strahlen nicht genügend Kraft, um den morgendlichen Nebel zu durchdringen und die Luft zu erwärmen. Es schien wieder einer dieser kalten Wintertage zu werden, die für den Landstrich hier typisch waren: Sie begannen und endeten frostig, während es dazwischen kaum wärmer wurde. Doch was interessierten schon in diesen Tagen so gewöhnliche Dinge wie Landschaftseindrücke oder das Wetter.
Abrupt stockte Leopold mitten in der Bewegung, drehte sich auf dem Absatz um und ließ den verdutzten Carl auf dem Gang stehen.
»Warte«, bedeutete er ihm knapp und lief mit schnellen Schritten den Weg zurück, den sie gekommen waren.
Carl schüttelte den Kopf. Immer wieder gab es Momente, in denen Leopold abwesend wirkte oder wie jetzt ohne ersichtlichen Grund verschwand. Obwohl diese Eigenart so deutlich hervortrat, verbat Carls Erziehung, auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren.
Sie befand sich noch genau dort, wo er sie hingelegt hatte. Erleichtert atmete Leopold aus und nahm seine Pistole vom Tisch. Schon vorhin hatte er sie im Schrank verstauen wollen, doch Carl war dazwischengekommen. Er öffnete das Innenschränkchen und steckte die Pistole hinter eine kleine Schatulle. Als er die Klappe wieder schließen wollte, blieb sein Blick an den kunstvollen Schnitzereien auf dem Deckel des Kästchens hängen. Unwillkürlich trat er näher und strich vorsichtig, als ob er etwas zerbrechen könnte, über die Unebenheiten. Ein Geschenk seiner Mutter, als er damals nach Breslau aufgebrochen war. Erst einige Tagesreisen von zuhause entfernt hatte er das Kästchen geöffnet und fand neben ein paar Talern - zweifellos die gesamten Ersparnisse der Familie - sowie etwas Schmuck auch diesen unheilvollen Gegenstand. Leopold hob langsam den Deckel an und kramte darin. Von dem Geld war nur noch wenig übrig. Monat für Monat hatte er seiner Mutter wieder zwölf Groschen davon zurückgesandt. In seinen Briefen ließ er sie wissen, dass es sich dabei um den Teil seines Soldes handelte, den er nicht benötigte.
Als er die dicke, bronzene Scheibe von knapp einem Zoll Durchmesser erblickte, versteinerte sich sein Gesichtsausdruck. Er presste seine Lippen zu einem schmalen Strich zusammen und fischte sie mit zwei Fingern zwischen den Geldstücken heraus. Befände sich auf der Rückseite nicht eine dicke Öse, könnte man den kreisrunden Gegenstand auf den ersten Blick für eine fremde Münze halten. Das Metall schien alt zu sein, davon zeugte schon der grünliche Belag, der an manchen Stellen die Oberfläche überzog. Gleichwohl konnte man noch gut die Zahl zweiundzwanzig in verschnörkelten Ziffern erkennen. Die Zahl umgab ein Kranz, der oben geöffnet war und dessen Enden stilisierte Blätter formten.
Leopold verstaute den bronzenen Knopf in seiner Hosentasche und die Schatulle wieder im Schränkchen. Nachdem er die Klappe abgeschlossen hatte, rannte er im Laufschritt zurück zu Carl, der inzwischen ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden tippte. Schon bevor er ihn erreicht hatte, hob Carl vorwurfsvoll die Augenbrauen, folgte ihm dann aber wortlos.
Zackig schlugen beide die Hacken zusammen und grüßten, als sie wenig später in das Dienstzimmer von Hauptmann von Hayden traten. Die Einrichtung des kleinen Raumes bestand lediglich aus einem Schreibtisch und wenigen Stühlen sowie einem riesigen Holzregal, in dem sich zahllose Aktenmappen türmten. Die Zimmerdecke stützten mächtige, ungehobelte Balken und ließen den Raum noch kleiner, fast erdrückend wirken.
Ihr Kompaniechef zählte nur wenige Lebensjahre mehr als sie. Trotzdem bekleidete er schon einen Kommandeursposten. Doch sein kühnes Auftreten bei der großen Schlacht von Leipzig hatte nicht nur diese ungewöhnliche Beförderung mit sich gebracht, sondern auch sein Aussehen auf schreckliche Weise verändert. In seinem Gesicht hatten die Franzosensäbel deutliche Spuren hinterlassen, und er konnte sich zudem nur noch hinkend fortbewegen. Er sprach selten darüber, und wenn, dann scherzte er lediglich. Vordergründig schienen ihm die scheußlichen Verletzungen nichts auszumachen. Doch niemand wollte ihm so recht Glauben schenken. Gleichwohl bewahrte er seit der Beförderung seine Bodenständigkeit. Nie sprach er seine Untergebenen in der distanzierten Form an, als ob er von einer dritten Person reden würde. Diese althergebrachte Anrede benutzten nur noch wenige. Miteinander Vertraute verwendeten das umgängliche Du und als Höflichkeitsform Ihr oder - wie Hauptmann von Hayden - das moderne Sie. Daneben gab es jedoch einige, hauptsächlich Adelige und Vorgesetzte, die Mitglieder eines niederen Standes grundsätzlich nur mit Er anredeten. Natürlich nur, um keinerlei Zweifel an ihrem höheren gesellschaftlichen Status aufkommen zu lassen.
Neben Haydens Schreibtisch saß ein weiterer, deutlich älterer Offizier, der sie keines Blickes würdigte. Während er in einem Stapel Dokumente auf dem Schreibtisch kramte, kniff er sein linkes Auge fest zusammen, damit das winzige Monokel nicht herausfiel. Die Tressen auf den Ärmeln seines kunterbunten Waffenrocks wiesen ihn als Oberstlieutenant aus. Zwar konnte Leopold von der hellen Paradehose nur den kleinen Teil zwischen Rocksaum und Reitstiefeln sehen, doch sicherlich hatte sie noch nie Kontakt mit Schmutz gehabt. Mit der maßgeschneiderten Uniform sah der Mann aus, als ob er gleich an einer Militärmodenschau teilnehmen würde.
Beim Anblick des geckenhaften Uniformrockes musste Leopold sofort an jenen französischen Husarenoffizier denken, mit dem er vor Jahren Bekanntschaft gemacht hatte. Einen putenhaften Angeber, der in seinem nach Schweiß stinkenden Büro drohend vor ihm stand. Er konnte sich noch an alle Details dieses heißen Augusttages erinnern. Das Büro des Offiziers war kaum groß genug, um den anwesenden vier Personen Platz zu bieten. Dennoch schlossen die Männer die Tür. Leopold bekam es mit der Angst zu tun. Zwei Mitglieder der Bürgergarde hatten ihn beim Stehlen erwischt. Nichts Besonderes, nur Blechgeschirr, das er später verkaufen wollte. Und eben die Süßigkeiten. Er war damals vielleicht vierzehn Jahre alt. Auf Französisch fragte der Offizier ihn immer wieder nach seinem Namen und dem genauen Wohnort. Obwohl er den Mann sehr gut verstand, stellte er sich dumm. So musste jedes Wort von den beiden Gardisten übersetzt werden, die selbst weniger Französisch verstanden als er. Die beiden hatten ihn aus reinem Geltungsbedürfnis in die Büros des Gouvernements geschleift. Schon beim Eintritt hatten sie militärisch gegrüßt und man sah ihnen an, dass sie sich ungemein wichtig dabei vorkamen, als sie mit ihm im Schlepptau ankamen.
Irgendwann war es dem französischen Offizier dann doch zu bunt und er packte ihn am Kragen. Leopold nahm all seinen Mut zusammen und spuckte dem Mann kurzerhand auf den Rock. Wie damals sah er den Speichel in einer schmalen Spur an der bunten Uniformjacke herunterfließen. Noch schwarz von der Lakritze, die er als Teil des Diebesguts längst vertilgt hatte. Doch das Beste daran war nicht die Speichelspur gewesen, sondern das Gesicht des französischen Offiziers. Immerzu pendelte es zwischen seinem Uniformrock und Leopolds Gesicht hin und her. Wahrscheinlich hatte er bis heute noch nicht verdaut, wie ein kleiner Bengel so unverschämt sein konnte, ihn, den edlen französischen Offizier, einfach anzuspucken. Jedenfalls waren der Mann und die beiden Gardisten so perplex, dass er die Situation ausnutzen konnte, um aus dem Büro auf die Straße zu flüchten. Niemals wurde er wegen des Diebstahls belangt. Es blieb auch bei diesem einen Mal, dass sie ihn erwischten. Schon bald konnte er schneller rennen, als die dicken Spießer der Bürgergarde. Und als er schließlich Gelegenheitsarbeiten annahm, hatte er die Stehlerei nicht mehr nötig.
Leopold musterte weiter den alten Offizier in der bunten Uniform. Obwohl der Mann saß, fiel ihm seine massige Statur ins Auge. Wie ein schmaler Kranz umschloss kurzgeschnittenes, graues Haar die umfangreiche kahle Stelle auf seinem Haupt. Das wenige Licht, das durch die kleinen Fenster hinter dem Schreibtisch drang, spiegelte sich darauf. Der mächtige Schnurrbart unter seiner Nase zwirbelte sich bis fast an die Ohren und ließ den Mann gemütlicher wirken, als er zweifellos war.
»Stehen Sie bequem!«, rief ihnen Hayden zu. Beide taten, wie ihnen geheißen und deuteten einen Ausfallschritt an. Erwartungsvoll blickten sie zu ihrem Kompaniechef.
»Meine Herren, darf ich Ihnen Oberstlieutenant von Broneck vorstellen? Er ist Mitglied des Generalstabes, den Feldmarschall von Blücher führt«, begann er in zwanghaftem Tonfall.
Die Angesprochenen nickten knapp.
Der Oberstlieutenant ließ keine Zweifel aufkommen, dass ihn das Gespräch bislang nicht interessierte. Obwohl er vorgestellt wurde, zeigte sein Gesicht keinerlei Regung. Gleichgültig studierte er weiter seine Unterlagen.
»Bevor wir beginnen, Lieutenants«, fuhr ihr Kompaniechef fort, »werde ich Ihnen zuerst eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Kriegsgeschehens geben.« Hayden räusperte sich und erklärte dann in sachlichem Tonfall: »Die derzeitige Lage der alliierten Truppen stellt sich wie folgt dar: Wellington hat schon im Sommer die französische Grenze an den Pyrenäen überschritten und sich in der Nähe von Lyon mit seinem englisch-spanischen Heer festgesetzt. Die österreichischen Truppen der böhmischen Armee werden wohl demnächst bei Basel die Grenze zur Schweiz überschreiten. Ihr Kommandeur, Feldmarschall Fürst Schwarzenberg, führt noch Verhandlungen über den Durchmarsch nach Frankreich. Die verschiedenen Corps der schlesischen Armee unter Feldmarschall von Blücher planen ihren Rheinübergang Anfang Januar. Generallieutenant Ferdinand von Wintzingerode steht mit den russischen Truppen der Nordarmee im Ruhrgebiet. Auch deren Rheinübergang wird in den nächsten Tagen in der Nähe von Düsseldorf beginnen. Nachdem sie über Holland und Belgien marschiert sind, wollen sie sich mit einem englischen Corps und später mit Blüchers rechtem Flügel vereinigen. Der linke Flügel der schlesischen Armee soll weiter durch Lothringen vordringen und sich voraussichtlich mit den aus Süden kommenden Österreichern in der Champagne an der Marne vereinigen.«
Obwohl Carl und Leopold die militärische Lage der Verbündeten durchaus kannten, nickten sie anerkennend.
»So weit der erfreuliche Teil der Ereignisse. Doch leider mussten wir feststellen, dass Napoléons Truppen regelmäßig über unsere Bewegungen im Voraus informiert sind. Kleine Trupps überfallen nachts die Biwaks unserer Vorauskommandos entlang des Mains und fügen den tapferen preußischen Soldaten erhebliche Verluste zu. Dann wieder stehen sie in ausreichender Stärke an der richtigen Stelle und verwickeln wichtige Truppenteile, wie die Pontoniere, in Kämpfe. Aber nicht, um sie zu vernichten, dafür sind die Einheiten viel zu schwach, sondern den Vormarsch der Alliierten zu verzögern. Wir glauben, dass diese Scharmützel Napoléon nur genügend Zeit verschaffen sollen, um seine Truppen erneut zu formieren und einen Landsturm aufzustellen.«
»Vermuten Sie etwa französische Spione in unseren Reihen?«, fragte Carl ehrlich entrüstet.
»Nein.« Hayden schüttelte vehement den Kopf. »Es sind die Telegrafen.«
»Telegrafen?«, echote Leopold und zog die Augenbrauen hoch, sodass sich seine Stirn in tiefe Falten legte.
»Ja.« Hayden machte eine vielsagende Pause. »Im Mai dieses Jahres hat Napoléon zur Nachrichtenübermittlung eine Telegrafenlinie von Mainz nach Metz errichten lassen. Die Bedeutung dieser Linie unterstreicht bereits die erstaunlich kurze Bauzeit von kaum mehr als drei Wochen – für die gesamte Strecke, wohlgemerkt.«
Immer noch runzelte Leopold die Augenbrauen. Inzwischen prangte mitten auf seiner Stirn eine einzige senkrechte Falte.