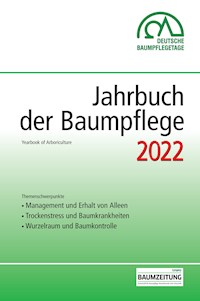
Jahrbuch der Baumpflege 2022 E-Book
35,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymarket Media
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Jahrbuch der Baumpflege
- Sprache: Deutsch
Das „Jahrbuch der Baumpflege 2022“ enthält die Fachvorträge, die auf den Deutschen Baumpflegetagen 2022 in Augsburg gehalten werden. In dieser Ausgabe sind Fachartikel zu den folgenden Themenschwerpunkten enthalten: - Management und Erhalt von Alleen - Trockenstress und Baumkrankheiten - Wurzelraum und Baumkontrolle Außerdem im Jahrbuch der Baumpflege 2022 zu finden sind: - Adressen von Verbänden und Forschungseinrichtungen - Adressverzeichnis Baumpflege - Gesamtregister 1997 bis 2022 mit Autoren- und Stichwortverzeichnis umfasst über 800 Fachartikel Das Jahrbuch der Baumpflege ist Nachschlagewerk und Fachbuch in einem. Hier findet der Leser aktuelles Fachwissen zum Thema Baumpflege – wissenschaftlich korrekt und zugleich verständlich und plausibel aufbereitet. Das Buch wird von erfahrenen Praktikern, Arboristen, Sachverständigen und Wissenschaftlern gleichermaßen als Informationsquelle genutzt. Das Jahrbuch der Baumpflege erscheint 2022 in der 26. Ausgabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Herausgeber: Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Veranstalter der Deutschen Baumpflegetage
Redaktionelle Betreuung: Dipl.-Ing. Agrar Martina Borowski, Braunschweig
Herausgeber-Beirat 2022:
Dipl.-Ing. Thomas Amtage, Landschaftsarchitektur Sachverständigenbüro, Berlin
Dr. Susanne Böll, Bayer. Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Veitshöchheim
Dipl.-Ing. Tanja Büttner, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL), Bonn
Prof. Dr. Thorsten Gaertig, HAWK Göttingen, Studiengang Arboristik
Dipl.-Biol. Gerhard Doobe, Redaktion der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz, Hamburg
Prof. Dr. Rolf Kehr, HAWK Göttingen, Studiengang Arboristik
Prof. Rudolf Klingshirn, Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V., München
Dipl.-Ing. Gudrun Kloos, Baureferat Gartenbau der Landeshauptstadt München
Dipl.-Biol. Thomas Kowol, Institut für Baumpflege Hamburg
Prof. Dr. Klaus Richter, Dr. Michael Risse, Holzforschung München, TU München
Dr. Axel Schneidewind, Hamersleben
M. Eng. Martin Schreiner, Pflanzenschutzamt Berlin
Dr. Thomas Schröder, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Bonn
Dr. Markus Streckenbach, Sachverständigenbüro für urbane Vegetation, Bochum
Dipl.-Biol. Anette Vedder, Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen, Stadt Augsburg
Dr. Katharina Weltecke, Boden & Baum, Bad Arolsen
Die Deutsche Bibliothek – CIP Einheitsaufnahme
Jahrbuch der Baumpflege … :
Yearbook of Arboriculture
Braunschweig: Haymarket Media
Erscheint jährlich – Aufnahme nach 1997
ISSN 1432–5020
ISBN 978–3–87815–279–8
Haymarket Media GmbH
Postfach 83 64, 38133 Braunschweig
Telefon: +49 531 38 00 4–0, Fax: –25
www.baumzeitung.de
Satz und Umbruch: Sigert GmbH, Braunschweig
E-Book: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Die Veröffentlichungen erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Für Fehler und Unrichtig keiten kann Schadenersatz nicht geleistet werden. Alle Rechte vorbehalten. Für die namentlich gekennzeichneten Beiträge zeichnen die jeweiligen Autoren verantwortlich.
Redaktionsschluss: März 2022
© 2022 Haymarket Media GmbH, Braunschweig
26. Jahrgang
Das „Jahrbuch der Baumpflege 2022“ ist auch als E-Book erhältlich:
ISBN 978-3-87815-280-4 im PDF-Format
ISBN 978-3-87815-281-1 im ePub-Format
Auf www.united-kiosk.de/kiosk-haymarket/ steht das „Jahrbuch der Baumpflege 2022“ ebenfalls zum Download bereit und kann hier erworben werden.
Das Buch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine anderweitige Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Mit der vorliegenden Ausgabe 2022 halten Sie das 26. Jahrbuch der Baumpflege in den Händen. 2021, im Jahr des 25. Jubiläums dieses Fachbuches, fielen die Deutschen Baumpflegetage leider aus. Wir hatten daraufhin ein Jahrbuch ohne Tagung konzipiert, und zwar zum Thema: Baumschutz auf Baustellen. Hierfür hatten wir verschiedene Artikel der vergangenen Jahre mit aktuellen Beiträgen zusammengefasst. Dadurch entstand ein umfassendes Fachbuch zu diesem wichtigen Thema und es wurden zugleich viele, inzwischen vergriffene Beiträge aus dem Jahrbuch wieder verfügbar.
Das Jahrbuch der Baumpflege 2022 enthält wieder die Inhalte der aktuellen Fachvorträge in Augsburg. Die Themen der drei Veranstaltungstage finden sich jeweils in den Kapiteln 1, 2 und 3. Da es durch die Neuorganisation der Deutschen Baumpflegetage keine wissenschaftliche Posterausstellung mehr gibt, entfallen damit die wissenschaftlichen Kurzberichte in diesem Buch. Ab 2023 soll es anstelle einer Posterausstellung im Tagungsprogramm wissenschaftliche Kurzvorträge geben. Wie bei der bisherigen Posterausstellung kann man hierfür Themenvorschläge einreichen. Der Fachbeirat der Tagung berät dann über den Programmablauf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.deutsche-baumpflegetage.de.
Ich danke allen Autorinnen und Autoren für die hochwertigen Fachbeiträge sowie dem Herausgeber-Beirat für die gewissenhafte Prüfung der Manuskripte. Weiterhin danke ich Martina Borowski und dem Verlag für die langjährige gute Zusammenarbeit an diesem Werk.
Hamburg, im März 2022
DIRK DUJESIEFKEN
Für Ihren Terminkalender:
Die nächsten Deutschen Baumpflegetage finden statt vom 25.–27. April 2023.
Kontaktanschrift: Forum Baumpflege GmbH & Co. KG, Geschäftsstelle: Brookkehre 60, 21029 Hamburg Tel.: +49 (0)40 55 26 07 07, Fax: +49 (0)40 55 26 07 28, www.Deutsche-Baumpflegetage.de
Redaktionsschluss für das Jahrbuch der Baumpflege 2023 ist der 1. Dezember 2022.
Dear reader,
With this 2022 edition, you are holding in your hands the 26th Yearbook of Arboriculture. The year 2021, the 25th anniversary of this reference book, the German Tree Care Conference did not take place, and a Yearbook was developed and issued without a conference on the topic of Tree Protection on Construction Sites. For the publication we selected various articles from previous years combined with current contributions and the resultant Yearbook formed a comprehensive reference book on this important topic, at the same time making available many articles that had been out of print.
This Yearbook of Arboriculture comprises the contents of the current lectures in Augsburg. The topics covering the three days of events can be found in chapters 1, 2 and 3 respectively. As there is no longer a scientific poster session due to the reorganization of the German Tree Care Conference, the scientific short communications in this book are thus omitted. Starting in 2023, there will be series of short scientific lectures in the conference program instead of a poster session. As with the previous poster session, proposals for topics can be submitted for inclusion. The advisory board of the conference will then discuss the program. For more information, please visit www.wetree.de.
I would like to thank all authors for their high-quality contributions and the editorial board for their careful review of the papers. Furthermore, I would like to thank Martina Borowski and the publisher for the many years of collaboration on this work.
Hamburg, March 2022
DIRK DUJESIEFKEN
Inhalt
Baum des Jahres 2022: die Rot-Buche (Fagus sylvatica) – ihre Eigenschaften und BesonderheitenA. ROLOFF
1Management und Erhalt von Alleen
Alleenschutz in Mecklenburg-Vorpommern – Erfolge und ProblemeK. DUJESIEFKEN
Artenschutz an Alleen im Betriebsdienst in Mecklenburg-Vorpommern – die Handlungsempfehlung ABiBB. SCHLOTTKE
Neu- und Nachpflanzungen von Alleen in Haute-Garonne: Ein Umdenken über Alleen in FrankreichE. CONSTENSOU, C. PRADINES
Allee-Neupflanzungen außerorts – im Spannungsfeld zwischen Funktionalität und NaturschutzA. PLIETZSCH
Langzeitprojekt „Stadtgrün 2021“: Regional differenzierte Ergebnisse und Empfehlungen für „Stadtklimabaumarten“S. BÖLL
2Trockenstress und Baumkrankheiten
Auswirkungen der Dürrephasen ab 2018 auf Bäume in DeutschlandR. KEHR
Anpassungsstrategien von Stadtklimabaumarten an Dürre- und HitzeperiodenS. BÖLL, A. ROLOFF, K. BAUER, H. PAETH, M. MELZER
Neue Erkenntnisse zu Viruserkrankungen an Bäumen und Konsequenzen für die Baumpflege
M. BANDTE, S. VON BARGEN, M. LANDGRAF, M. RYBAK, C. BÜTTNER
Beseitigung akut abgestorbener Bäume – Unfallverhütung, Auftraggeberpflichten, LösungsansätzeA. DETTER, C. BEINHOFF, T. AMTAGE
Stellt das Diplodia-Triebsterben der Kiefern (Erreger: Sphaeropsis sapinea) einen beeinträchtigenden Faktor für die zukünftige Baumartenwahl im Klimawandel dar?J. SCHUMACHER, J. BUßKAMP, G. J. LANGER
Die Gepunktete Laternenträgerzikade – ein potenzieller Schädling auch für Bäume in Deutschland und der EU?T. SCHRÖDER
Bewässerungsempfehlungen für StadtbäumeM. SCHREINER, B. JÄCKEL, F. BÖTTCHER, J. MÜLLER, A. BLOCK, A. KÜNZEL
Baumarten-Verwendung im Klimawandel: KlimaArtenMatrix 2021 (KLAM 2.0) und Empfehlungen zu Baumgrößen, -pflanzungen und -umfeldA. ROLOFF, U. PIETZARKA, S. GILLNER
3Wurzelraum und Baumkontrolle
Setzungsschäden an Gebäuden durch Bäume – Baumbiologische GrundlagenM. STRECKENBACH
Setzungsschäden an Gebäuden durch Bäume – Diagnosemöglichkeiten und praktische BeispieleK. WELTECKE
Winterdienst und Baumschutz – ein unlösbarer Widerspruch?W. LIEBETON
Baumkontrollen fachgerecht ausschreiben auf Basis der FLL-BaumkontrollrichtlinienT. AMTAGE
Sachgerechter Einsatz von Zugversuchen: Anforderungen an Messverfahren, Auswertungsmethoden und GutachtenA. DETTER, P. MUIR, L. PRAUS, S. RUST
4Verbände und Forschungseinrichtungen
Institute, Forschung und LehreVerbändeWeitere Organisationen und VereinePflanzenschutzdienste
5Adressverzeichnis Baumpflege
Hinweise zur Benutzung5.1 Baumpflegefirmen5.2 Sachverständige5.3 Produkte und DienstleistungenInserenten-Verzeichnis
6Gesamtregister 1997-2022
Hinweise zur BenutzungAutorenverzeichnisStichwortverzeichnis
Content
Tree of the year 2022: European Beech (Fagus sylvatica) – Features and Characteristics
A. ROLOFF
1Street Trees and Avenues – Management and Preservation
Tree Avenue Protection in Mecklenburg-Western Pomerania – Successes and Problems
K. DUJESIEFKEN
Species Protection in Avenues in the Operational Service in Mecklenburg-Western Pomerania – the Recommendation for Action „ABiB“
B. SCHLOTTKE
New Planting and Replanting of Avenues in Haute-Garonne – A Rethinking of Avenues in France
E. CONSTENSOU, C. PRADINES
Planting of Trees along Roadsides – Conflicts between Functionality and Nature Conservation
A. PLIETZSCH
Long term project „Urban Green 2021“: Regionally differentiated results and recommendations for tree species for urban climate
S. BÖLL
2Drought stress and tree diseases
Effects of the Drought Periods since 2018 on Trees in Germany
R. KEHR
Adaptation Strategies of Urban Climate Tree Species to Periods of Drought and Heat
S. BÖLL, A. ROLOFF, K. BAUER, H. PAETH, M. MELZER
New insights into virus diseases of trees and consequences for tree care
M. BANDTE, S. VON BARGEN, M. LANDGRAF, M. RYBAK, C. BÜTTNER
The Removal of Hazardous Dead Trees – Accident Prevention, Client Obligations, Towards Solutions
A. DETTER, C. BEINHOFF, T. AMTAGE
Does Diplodia blight of pines (causal agent: Sphaeropsis sapinea) represent an interfering factor in future tree species selection under conditions of climate change?
J. SCHUMACHER, J. BUßKAMP, G. J. LANGER
The spotted lanternfly Lycorma delicatula, a potential pest also for tree species in Germany and the EU?
T. SCHRÖDER
Irrigation Recommendations for City Trees
M. SCHREINER, B. JÄCKEL, F. BÖTTCHER, J. MÜLLER, A. BLOCK, A. KÜNZEL
Tree species use under climate change: ClimateSpeciesMatrix 2021 (CSM 2.0) and suggestions for tree size, planting and ambient conditions
A. ROLOFF, U. PIETZARKA, S. GILLNER
3Root zones and tree inspection
Settlement damage to buildings caused by trees – the basics in tree biology
M. STRECKENBACH
Settlement Damage to Buildings by Trees – Diagnostic Options and Practical Examples
K. WELTECKE
Winter road maintenance and tree preservation – an unsolvable contradiction?
W. LIEBETON
Tendering Professional Tree Inspections in Accordance with the FLL-Tree Inspection Guidelines
T. AMTAGE
Proper Application of Pulling Tests – Requirements for Measurement Procedures, Evaluation Methods and Expert Reports
A. DETTER, P. MUIR, L. PRAUS, S. RUST
4Associations and Research Institutes
Institutes, research and teaching
Professional associations
Other organisations and associations
Plant protection services
5Address register for tree care
Reference for use
5.1 Tree care companies
5.2 Experts
5.3 Products and services
Index of advertisers
6Overall Index 1997–2022
Reference for use
Register of authors
Register of catchwords
Baum des Jahres 2022: die Rot-Buche (Fagus sylvatica) – ihre Eigenschaften und Besonderheiten
Tree of the Year 2022: European Beech (Fagus sylvatica) – Features and Characteristics
von Andreas Roloff
Zusammenfassung
Die Rot-Buche, Baum des Jahres 2022, ist charakterisiert durch im Alter große, dunkle und gewölbte Kronen, eine glatte silbergraue Rinde mit lange erhalten bleibenden Narben früherer Äste und ausgeprägte Wurzelanläufe. Sie dominiert das Konkurrenzgeschehen im Wald, da sie über 300 Jahre alt werden kann und so schattenwerfend ist, dass unter ihrem geschlossenen Kronendach fast alle anderen Baum arten nicht dauerhaft überleben können. In Parkanlagen sind rotblättrige Blut-Buchen sehr beliebt. Wie die Buche mit der zukünftig erwarteten häufigeren Trockenheit zurechtkommt, wird kontrovers diskutiert.
Summary
European beech, Germany‘s tree of the year 2022, is characterized in old trees by its large, dark and dome shape crown, the smooth silvery grey bark with well-preserved scars of former branches and its impressive root collars. The species dominates the competition development (succession) in natural forests, because of its maximum age of more than 300 years and its shading intensity, so that under the dense beech canopy almost no other tree species can survive for longer times. In parks red-leaved cultivars are very popular. There are different appraisals of its drought tolerance in respect to future climate change.
1Charakteristika und Erkennungsmerkmale
Eine große gewölbte, dunkle Krone und ein glatter silbergrauer Stamm (Abbildung 1) mit einem Bilderbuch der Baum-Körpersprache, da alle Narben sehr lange erhalten bleiben: Das kann nur die Rot-Buche sein. Zudem ist der Stammfuß oft mit eindrucksvollen Wurzelanläufen entwickelt. Im Wald bildet sie sog. „Hallenwälder“ fast ohne Unterwuchs. Am eindrucksvollsten kann man das im Gespensterwald bei Warnemünde erleben. Weitere Highlights sind das Austreiben der hellgrünen Blätter im April und die Herbstfärbung im Oktober mit allen Gelb- und Brauntönen, bevor es dann hell unter den Buchen wird. Mit ihrem starken Kronenschatten im Sommer kommt sie selbst gut zurecht: Wo sie wächst, bestimmt sie daher das Konkurrenzgeschehen.
Abbildung 1: Charakter der Rot-Buche als starker Solitär in Parkanlage mit „Rindenbotschaften“
Zum Habitus wurde schon das Wichtigste genannt. Die Kronen alter Rot-Buchen (im Folgenden immer als Buche bezeichnet) sind sehr raumgreifend ausgebreitet, mit einer fächerartigen Aststellung nach schräg oben. Dies hat zur Folge, dass ihre Beschattungs- und Verdrängungswirkung noch dominanter wird.
Der Wipfeltrieb von Buchen wächst zunächst waagerecht und richtet sich erst auf, wenn es genügend Licht gibt. An den Zweigen fallen im Winter die relativ langen, schlanken und braunen Knospen auf, auch daran kann man die Buche gut erkennen. Die Knospenschuppen werden dabei wie bei vielen anderen Baumarten von den Nebenblättern gebildet, welche dafür spezialisiert sind und die zarten embryonalen Sprossanlagen für die nächste Saison eng umschlossen schützen. Beim Austreiben fallen diese Knospenschuppen dann ab und liegen in Massen auf dem Boden unter den Buchen. Das kann etwas merkwürdig aussehen, und manche haben sich vielleicht schon gefragt, woher diese vielen braunen Schuppen stammen.
Die Kurztriebe der Buche sind in besonderer Weise in der Lage, bei ungünstigen Bedingungen (z. B. Schatten, Wassermangel) bis zu 15 Jahre lang als Kurztriebketten (Abbildung 2) in „Wartestellung“ mit extrem kurzen Jahrestrieben zu verharren, um dann ggf. bei Verbesserung der Bedingungen auch wieder Langtriebe bilden zu können. An Buchenzweigen kann man zudem besonders gut und einfach die Jahrestriebgrenzen erkennen: Nach dem Abfallen beim Austreiben hinterlassen die Knospenschuppen auf der Trieboberfläche Narben, die als Querrillen viele Jahre erhalten bleiben. So kann man die Jahresgrenzen anhand dieser „Triebbasisnarben“ 10 bis 20 Jahre zurück rekonstruieren und erfährt – ohne für Jahrringzählungen Zweige abzusägen –, wie der Zweig in diesem Zeitraum Jahr für Jahr gewachsen ist. Dies wird in der Baumbiologie-Forschung für Klima-/Wachstums-Analysen genutzt, um z. B. die Auswirkungen von Trockenjahren auf den Triebzuwachs zu untersuchen und die Trockenstress-Empfindlichkeit der Baumarten zu beurteilen.
Abbildung 2: Sechs Jahre alte unverzweigte Kurztriebkette (linker Zweigabschnitt) und am Ende Langtrieb (rechts oben)
Die silbergraue Rinde (Typ Glattrinde) ist wohl das auffälligste Charakteristikum der Buche und hat zur Folge, dass sich die Lebensgeschichte jedes Baumes sehr gut rekonstruieren lässt: Alte Astnarben, Verletzungen und innere Defekte am Stamm bleiben Jahrzehnte sichtbar. Bei den Astnarben gibt es zum einen die Zentralnarbe (das sog. Siegel) der früheren Äste: Sie zeigt die Astansatzstelle und ihren Durchmesser (= Höhe des Siegels) beim Absterben. Links und rechts davon schräg nach unten verlaufen Streifen (die sog. Chinesenbärte, Abbildung 3): Sie geben Hinweise auf den Winkel des Astes, wie er vom Baum abzweigte.
Abbildung 3: Glatter, silbergrauer Stamm mit „Chinesenbärten“ an den Astnarben von früheren Ästen
Außerdem haben die grauen Stämme große Wirkung bei ganz bestimmten Lichtverhältnissen. Besonders ausgeprägt ist dies im sog. Gespensterwald bei Nienhagen westlich von Warnemünde an der Ostseeküste, wenn dort im Hochsommer die im Nordwesten untergehende Abendsonne fast waagerecht in den Bestand scheint und es tatsächlich gespenstisch aussieht: die dann rötlichen glatten, astfreien Stämme vor tiefschwarzem Hintergrund (Abbildung 4). Falls man dort einen Abend bis zum Sonnenuntergang verbringt, wird man ein wunderschönes unvergessliches Naturschauspiel erleben. Stämme und Äste der Buche verwachsen häufiger mit Nachbarbäumen und -ästen, da die dünne Glattrinde dies erleichtert. So können ausgeprägte Baumskulpturen entstehen, deren Physiologie mit mehreren Kronen oder Wurzelsystemen spannend ist (Abbildung 5).
Abbildung 4: Gespensterwald bei Nienhagen (westlich Warnemünde) im Abendlicht bei Sonnenuntergang
Abbildung 5: Buchenskulptur aus zwei verwachsenen Bäumen mit drei Stämmen im Nationalpark Darß
Die dünne glatte Rinde der Buche hat den Nachteil, dass sie sich bei plötzlicher Freistellung auf der Südseite des Stammes so erhitzt, dass sie und das darunterliegende Kambium absterben können. Große Stammschäden („Sonnenbrand“) und Holzfäule sind dann die Folge. Bei solchem vorhersehbaren Risiko werden die Stämme z. B. in Parkanlagen daher zuvor mit weißer Stammschutzfarbe angestrichen, Jungbäume rundherum, bei Altbäumen nur die Süd- bis Westseite des Stammes. Dann überschreitet die Rindentemperatur nicht den kritischen Wert von 45 °C.
Als Höchstalter der Buche werden 300-400 Jahre erreicht, bei Stammumfängen von fast 4-6 m (selten 7-8 m) und Baumhöhen von 30-40 m. Die beiden stärksten Buchen Deutschlands mit fast 9 m Stammumfang wachsen in Hoppenrade (Brandenburg) und Dobbin (Mecklenburg-Vorpommern, www.championtrees.de), einige der fünf Champions sind derzeit leider am Absterben.
Die Anordnung der Blätter an den Zweigen in der Unterkrone ist streng zweizeilig und dadurch einschichtig, d. h. sie bilden relative geschlossene flächige Strukturen aus, die das Restlicht im Schatten optimal ausnutzen können, ohne sich an demselben Zweig dabei noch gegenseitig zu beschatten. Die Blätter entwickeln im Oktober eine wunderschöne Herbstfärbung: braungelbe und rötlichbraune, später rein braune Farbtöne, die bei einfallender Herbstsonne traumhafte Stimmungen erzeugen können (Abbildung 6).
Abbildung 6: Schöne braungelbe Herbstfärbung im Oktober
Die Blüten erscheinen erst mit 50 Jahren, zusammen mit den Blättern beim Austreiben, männliche und weibliche getrennt, aber am selben Baum. Sie werden windbestäubt und sind daher unauffällig, die großen Pollenmengen können nach Regenschauern Pfützen bedecken. Wenn alle Buchen eines Bestandes in bestimmten Jahren gleichzeitig intensiv blühen und fruktifizieren, spricht man von Mastjahren. Diese treten etwa alle drei-fünf Jahre auf, früher alle fünf-sieben Jahre – der Abstand hat sich in den letzten 20 Jahren durch die hohen Stickstoffgehalte in der Luft (Düngereffekt) und den Klimawandel (Erwärmung) verkürzt. Mastjahre haben zur Folge, dass die Bäume einen erheblichen Teil ihrer Ressourcen für die Fruchtentwicklung investieren. So werden im Mastjahr und in den zwei bis drei Folgejahren dann sogar die Blätter kleiner und die Kronenverlichtung kann demzufolge um bis zu 30 % zunehmen, was nicht als Schädigung zu interpretieren ist.
Die Bucheckern-Früchte sitzen am Baum in einem auffällig stachligen Fruchtbecher (Abbildung 7), welcher Familienkennzeichen der Buchengewächse ist (auch bei Eichen und Maronen) und nicht als Fruchtbestandteil gilt, daher sind die Früchte Nüsse. Viele haben sie als Kind schon probiert: Sie schmecken angenehm nussig. Wenn die Bucheckern auf den Boden fallen, keimen sie im nächsten Frühjahr und bilden eine Naturverjüngung, die in der Forstwirtschaft heutzutage hoch im Kurs steht. Denn diese Buchenkeimlinge tragen die Gene der am Standort optimal angepassten Buchen(eltern) und bringen sie in neuer Durchmischung in die nächste Baumgeneration. Wenn Förster dabei in die Zukunft schauen und die erwarteten Klimaveränderungen berücksichtigen möchten, pflanzen sie in die Naturverjüngung zusätzlich junge Buchen anderer Herkünfte hinein (z. B. aus Südosteuropa), sodass deren Gene auch mit am Standort erprobt werden können. Die Selektion wird dann die bestgeeigneten herausfiltern.
Abbildung 7: Aufgeklappter Fruchtbecher, aus dem die reifen Früchte herausgefallen sind.
Das herzförmige Wurzelsystem sorgt für eine gute Verankerung, allerdings reagiert die Buche auf Bodenverdichtung und -vernässung sehr empfindlich und bleibt dann mit ihren Wurzeln oberhalb des Stauhorizontes, was sie in solchen Standortsituationen trockenheitsempfindlich und windwurfanfällig machen kann.
Die Buche gehört gemeinsam mit den Ess-Kastanien und Eichen zur Familie der Buchengewächse (Fagaceae), für die der genannte Fruchtbecher charakteristisch ist.
2Vorkommen und Ökologie
Das große natürliche Areal der Buche erstreckt sich über fast ganz Europa, mit Ausnahme des Nordens und Nordostens. Sie wird verbreitet auch als „Mutter des Waldes“ bezeichnet. Man müsste sie aber wohl treffender Herrscherin der Wälder nennen, denn sie bestimmt mit ihrer Beschattung großflächig die Baumartenzusammensetzung in Wäldern. Allerdings gehen die Meinungen unter den Experten darüber auseinander, auf wie viel Prozent der Waldfläche sie so zur Dominanz gelangen würde: Die Variationsbreite reicht von 65 bis 90 %. Letzteres ist nach meiner Einschätzung gut möglich, denn die Buche kann viel weiter in nasse und trockene Standortsbereiche hinein wachsen als gemeinhin angenommen wird. Die heutige Buchenverbreitung ist dabei weitgehend durch den Menschen verringert (ähnlich wie bei allen anderen Baumarten außer Fichte und Kiefer), sodass man sie nur theoretisch herleiten kann aus der Standortsamplitude der Baumart.
Die Buche ist jedenfalls die einzige Baumart hierzulande, die großflächig dort auch zur Vorherrschaft gelangt, wo sie wachsen kann. Fast alle anderen Baumarten hingegen werden auf ihren Optimalstandorten von der Buche verdrängt und kommen dann oft nur auf Sonder- oder Extremstandorten zum Zuge. Es handelt sich damit bei der Buche um das eindrucksvollste Beispiel einer Klimaxbaumart.
Dafür ist ihre Schattenstrategie sehr bedeutsam:
• Ihre dichte Belaubung und Krone, die nur 1 % der Freilandstrahlung durchlässt.
• Ihre zweizeilige Blattstellung bei waagerechtem Zweigwachstum (selbst des Wipfeltriebes), die eine optimale Ausnutzung des geringen Restlichtes am Bestandesboden und ihr damit das Überleben im eigenen Schatten ermöglicht.
• Ihre Blattanatomie-Differenzierung in Licht- und Schattenblätter, die am jeweiligen Ort in der Krone eine optimale Lichtnutzung ermöglicht.
Junge Buchen können so extrem an Schatten angepasst sein, dass sie Jahrzehnte in waagerechter Wartestellung verharren (Abbildung 8) – bis schließlich durch Absterben oder Beseitigen von Nachbarbäumen Licht zu den kleinen Bäumchen durchkommt, dann richten sie sich auf und wachsen los. Ähnlich schattentolerant sind bei uns nur Eibe, Ilex und Weiß-Tanne.
Abbildung 8: Waagerechte Wartestellung einer etwa 30 Jahre alten Buche im Tiefschatten
Etwas sehr Interessantes ist die sog. Belaubungsregel der Buche: Die Kronen ergrünen allmählich von unten nach oben, Naturverjüngung und die unteren Äste treiben als erste aus. Dies ist für das Überleben der Schattenzweige existenziell, denn nur so erhalten sie noch bis zu fünf Wochen Licht durch die Oberkronen, bevor diese dann auch austreiben und es für den Rest der Saison unten stockfinster wird.
Die steile Aststellung und glatte Rinde bewirken, dass größere Anteile des Niederschlages aus der Krone an den Ästen zum Stamm und an diesem hinunterlaufen, der sog. Stammablauf der Buche. Dadurch versorgt sich die Buche mit einem größeren Anteil des Niederschlages und verschafft sich so weitere Konkurrenzvorteile, andere Pflanzen unter der Krone auf dem Waldboden hingegen erhalten weniger Niederschlag.
Gegenüber Trockenheit wird die Buche überwiegend als empfindlich eingestuft, dies gilt allerdings nur für plötzliche Trockenheit wie in Extremsommern. Hat sie sich dagegen in ihrem Leben an trockenere Standorte angepasst, kommt sie damit relativ gut klar – darüber gehen die Meinungen aber auseinander, je nachdem, ob es sich um Experimente mit Jungpflanzen oder Erhebungen im Freiland handelt. Aktuellen Trockenstress erkennt man an Buchenblättern, -zweigen und -kronenbereichen sehr gut an der sog. „Schiffchenbildung“: Die Blätter rollen sich etwas nach oben ein (Abbildung 9). Verbessert sich die Wasserversorgung dann, werden sie wieder glatt.
Abbildung 9: Schiffchenbildung (Einrollen) der Blätter bei Trockenstress
Besser wächst die Buche natürlich wie jeder Baum bei guter Wasserversorgung, am besten mit häufigem Landregen und feuchter Luft, wie in Küstennähe z. B. in Nordwest-Deutschland und Großbritannien. Im Osten ihres Areals machen ihr die häufigeren Spätfröste im Mai zu schaffen. Gegenüber Überflutung ist sie so empfindlich, dass sie bereits nach einer Woche im Wasser anfängt abzusterben und daher in natürlichen Auenwäldern keine Chance hat.
Buchen sind Lebensraum für viele Tierarten und Pilze, unter letzteren sicher am bekanntesten und am häufigsten der Zunderschwamm. Die Bucheckern werden gerne von Vögeln und Säugetieren verzehrt und versteckt, und diese tragen so auch zur Verbreitung über einige Kilometer bei, wenn sie ihre Verstecke vergessen und die Früchte keimen. Die Früchte selbst würden solche Distanzen nicht schaffen, da sie zu schwer sind.
3Nutzung, Verwendung, Heilkunde, Mythologie
Die Buche ist für die Forstwirtschaft attraktiv durch ihr hartes Holz mit rötlichem Farbton. Es werden Möbel und Gebrauchsgegenstände daraus hergestellt, neuerdings wird es auch für tragende witterungsgeschützte Konstruktionen im Hausbau verwendet. Auch ihr guter Heizwert für Brennholz und ihre günstigen Eigenschaften für Holzkohle sind bekannt.
Aus Bucheckern kann man Speiseöl gewinnen. Schweine trieb man früher zur Buchenmast in den Wald. Junge Buchenblätter lassen sich für Salate verwenden, die Holzasche diente zur Seifen- und Zahnpasta-Herstellung.
Als Stadtbaum ist die Buche bedingt geeignet: In Parkanlagen kommt sie wegen der waldähnlichen Situation bestens klar, als Straßenbaum hingegen zeigt sie Probleme, da ihr dann Bodenverdichtung und Streusalz zusetzen. Viele Varietäten der Buche sind in Parkanlagen beliebt, z. B. Blut-Buchen: Das sind Rot-Buchen mit rötlichen Blättern (Abbildung 10). Bei einigen Sorten werden die Blätter im Laufe des Sommers immer grüner, bei anderen immer rötlicher. Grünen Blattfarbstoff enthalten sie aber trotzdem für die Photosynthese, nur der Rotanteil ist etwas höher als sonst.
Abbildung 10: Blut-Buche mit tiefdunkelroten Blättern in Parkanlage
In der Heilkunde wurden Buchenblätter früher als kühlende Wundauflage verwendet, sie sind glatt und weich.
Die eindrucksvolle Erscheinungsform und frühere Häufigkeit der Buche haben zu einer gewissen Bedeutung in der Mythologie geführt. Allerdings sollte man den Spruch bei Gewitter „Vor den Eichen sollst du weichen, die Buchen sollst du suchen“ mit Vorsicht anwenden, denn als Ursache für die häufigeren Blitzeinschläge in Eichen spielt auch eine Rolle, dass Blitze an Buchen oft außen auf der nassen Rinde herablaufen – also evtl. genau dort, wohin man sich schutzsuchend gestellt oder gesetzt hat! Sie schlagen dann nicht in den Baum ein, sodass das Ereignis anschließend nicht mehr sichtbar ist, im Gegensatz zu zerborstenen Eichen.
4Sonstiges Interessantes
Die Buche ist bereits 1990 zum Baum des Jahres ernannt worden und nun die erste Baumart, welche diese Auszeichnung für 2022 zum 2. Mal erhält.
Das Wort Buchstabe stammt von Buchenholzstäben, die man früher zum Schnitzen für erste Botschaften mit Runen verwendete. Orts- und Familiennamen mit den Silben büch, puch u. a. deuten auf die früher größere Verbreitung der Buche hin, z. B. Hammbüchen und Buchholz.
Verwendete Literatur
BARTELS, H., 1993: Gehölzkunde. Ulmer Verlag, Stuttgart.
BÄRTELS, A.; SCHMIDT, P. A., 2014: Enzyklopädie der Gartengehölze. 2. Aufl., Ulmer Verlag, Stuttgart.
BUTIN, H., 2019: Krankheiten der Wald- und Parkbäume. 3. Aufl., Ulmer Verlag, Stuttgart.
BUTIN, H.; HARTMANN, G., 2017: Farbatlas Waldschäden: Diagnose von Baumkrankheiten. 4. Aufl., Ulmer Verlag, Stuttgart.
ELLENBERG, H.; LEUSCHNER, C., 2010: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. 6. Aufl., Ulmer Verlag, Stuttgart.
FELBERMEIER, B., 1993: Der Einfluß von Klimaänderungen auf die Areale von Baumarten: Methodenstudie und regionale Abschätzung für die Rotbuche (Fagus sylvatica L.) in Bayern. Forstliche Forschungsberichte München Nr. 134, München.
FELBERMEIER, B.; MOSANDL, R., 2002: Fagus sylvatica L. (Rot-Buche). Enzyklopädie der Holzgewächse 27, 1-20.
FENNER, R., 2020: Die Rot-Buche – Baum des Jahres 2022. www.baum-des-jahres.de
FIRBAS, F., 1949: Waldgeschichte Mitteleuropas: Erster Band. Fischer, Jena.
GROSSER, D., 1977: Die Hölzer Mitteleuropas. Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
KORPEL, S., 1995: Die Urwälder der Westkarpaten. Fischer, Stuttgart, Jena, New York.
KÖSTLER, J. N.; BRÜCKNER, E.; BIBELRIETHER, H., 1968: Die Wurzeln der Waldbäume. Parey, Hamburg, Berlin.
PACKHAM, J. R.; THOMA, P.; ATKINSON, M. D.; DEGEN, T., 2012: Biological Flora of the British Isles: Fagus sylvatica. Journal of Ecology 100, 1557-1608.
RECHINGER, K.-H., 1958: Fagus sylvatica L. In: HEGI, G. (Begr.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. III/1., 2. Aufl., Hanser, München.
ROLOFF, A., 1985: Morphologie der Kronenentwicklung von Fagus sylvatica L. (Rotbuche) unter besonderer Berücksichtigung möglicherweise neuartiger Veränderungen. Diss., Univ. Göttingen.
ROLOFF, A., 1989: Kronenentwicklung und Vitalitätsbeurteilung ausgewählter Baumarten der gemäßigten Breiten. Sauerländer, Frankfurt/M.
ROLOFF, A., 2013: Bäume in der Stadt – Besonderheiten, Funktion, Nutzen, Arten, Risiken. Ulmer Verlag, Stuttgart.
ROLOFF, A., 2017: Der Charakter unserer Bäume – ihre Eigenschaften und Besonderheiten. Ulmer Verlag, Stuttgart.
ROLOFF, A., 2018: Vitalitätsbeurteilung von Bäumen – Aktueller Stand und Weiterentwicklung. Haymarket Media, Braunschweig.
ROLOFF, A. (Hrsg.), 2021: Trockenstress bei Bäumen – Ursachen, Strategien, Praxis. Quelle & Meyer, Wiebelsheim.
ROLOFF, A.; BÄRTELS, A., 2018: Flora der Gehölze – Bestimmung, Eigenschaften, Verwendung. 5. Aufl., Ulmer Verlag, Stuttgart.
SCHÜTT, P.; SCHUCK, H. J.; STIMM, B. (Hrsg.), 1992: Lexikon der Forstbotanik. ecomed, Landsberg/Lech.
WILLMANNS, O., 1989: Die Buchen und ihre Lebensräume. Ber. Reinhold Tüxen-Gesellschaft, Bd. 1, Hannover.
www.championtrees.de: Rekordbäume. Gehölzdatenbank der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft [Zugriff 1.12.2021].
Autor
Prof. Dr. Andreas Roloff leitet das Institut für Forstbotanik und Forstzoologie sowie den Forstbotanischen Garten der TU Dresden in Tharandt, ist Inhaber des Lehrstuhls für Forstbotanik und beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Fragen der Baumbiologie, Gehölzverwendung und Baumpflege. Er ist Fachreferent für Parks, Gärten und städtisches Grün im Rat der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft und Leiter des Kuratoriums Nationalerbe-Bäume.
Institut für Forstbotanik und Forstzoologie
Pienner Str. 7
01737 Tharandt
Tel. (0351) 463 31202
Management und Erhalt von Alleen
Alleenschutz in Mecklenburg-Vorpommern – Erfolge und Probleme
Tree Avenue Protection in Mecklenburg-Western Pomerania – Successes and Problems
von Katharina Dujesiefken
Zusammenfassung
Alleen sind für die Landschaft des heutigen Mecklenburg-Vorpommern seit Jahrhunderten prägend. Sie sind zugleich Zeugnisse der wechselvollen Landes- und Landschaftsgeschichte, Kulturgut und zudem bedeutsam für den Naturschutz. Der vorliegende Beitrag beschreibt zunächst die wechselvolle Geschichte der Alleen der vergangenen acht Jahrhunderte. Anschließend werden die Gesetze und Verordnungen zum Baum- und Alleenschutz aus den verschiedenen Epochen umfassend vorgestellt. Ohne diese Schutzmaßnahmen gäbe es nicht die landestypischen und prägenden Alleen, mit denen heute das Land Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung gebracht wird. Das abschließende Kapitel beschreibt Perspektiven und Probleme für den Erhalt und die Nachpflanzung von Bäumen an Straßen und geht speziell auf die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit ein.
Summary
Tree Avenues have been a characteristic of the landscape of today‘s federal state of Mecklenburg-Western Pomerania for centuries. The tree-lined roads are also evidence of the changing history of the state and its landscape. Today they are cultural assets and at the same time important for nature conservation. This article first describes the eventful history of avenues of the past eight centuries. Subsequently, the laws and regulations on tree and avenue protection from the different eras are presented comprehensively. Without these protective measures, the typical and characteristic avenues with which the state of Mecklenburg-Western Pomerania is associated today would not exist. The concluding chapter describes perspectives and problems for the preservation and replanting of trees along roads and specifically addresses the importance of public relations work.
1Einleitung
Mecklenburg-Vorpommern ist bekannt als ein Bundesland mit vielen schönen Alleen. Besondere Aufmerksamkeit hat dieser landschaftsprägende Baumbestand nach dem Mauerfall bekommen. Die ersten Reisenden aus dem Westen bestaunten die grünen Tunnel und selbst der ADAC wurde zu einem Befürworter des Alleenschutzes. In dieser Zeit entstand auch die Idee, eine Deutsche Alleenstraße auszurufen1. Unter der Schirmherrschaft der damaligen Bundestagspräsidentin RITA SÜSSMUTH wurde 1993 der erste Abschnitt eingeweiht, und zwar in Sellin auf Rügen. In den folgenden Jahren konnte sie von Mecklenburg-Vorpommern bis zum Bodensee verlängert werden und ist heute die längste Kulturstraße Deutschlands. Für den Begriff „Allee“ gibt es in Deutschland keine einheitliche Definition. Das Wort stammt aus dem Französischen. Das „Dictionnaire des deux Nations“ (1762) beschreibt eine „allée“ als Spaziergang im Garten oder anderswo. Der Weg konnte auch mit Blumentöpfen, Sträuchern oder etwas anderem gesäumt sein. Eine Allee hatte also ursprünglich nicht unbedingt etwas mit Bäumen zu tun. Das Wort Allee kam erst während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) als Lehnwort aus dem Französischen nach Deutschland. Seitdem beschreibt es eine Straße oder einen Weg mit Bäumen auf beiden Seiten (HOFMANN 2016). Für die heutigen Bundes- und Landesstraßen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es die folgende Definition: Beidseitig an Straßen gegenüberliegende Baumreihen bilden eine Allee. Sie sind mindestens 100 m lang und bestehen aus mindestens drei Bäumen pro Seite (Alleenerlass 2015). Im untergeordneten Straßennetz gibt es keine Angabe für eine erforderliche Mindestlänge (Baumschutzkompensationserlass 2007).
Für die Landschaft des heutigen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern sind bereits seit Jahrhunderten baumbestandene Straßen und Wege prägend. Alleen sind zugleich Zeugnis der wechselvollen Landes- und Landschaftsgeschichte, sind heute Kulturgut und bedeutsam für den Naturschutz. Der vorliegende Beitrag beschreibt die lange Geschichte der Alleen in diesem Bundesland. Von Anfang an spielte auch der Schutz dieser Bäume eine große Rolle. Die verschiedenen Gesetze und Verordnungen sowie die Umsetzungen haben sich jedoch mehrfach geändert.
2Zur Geschichte der Alleen in Mecklenburg-Vorpommern
2.112. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges
Die Geschichte von Mecklenburg-Vorpommern als politischer Einheit beginnt erst 1945 durch die Vereinigung des Landes Mecklenburg (die historischen Landesteile Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz) mit dem in der DDR verbliebenen Teil Vorpommerns. Im Zuge einer Verwaltungsreform in der DDR wurde das Land 1952 aufgelöst und auf die drei Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg aufgeteilt. Mit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 erfolgte die Neugründung des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus diesen Bezirken ohne die Landkreise Perleberg, Prenzlau und Templin. Damit entspricht die territoriale Ausdehnung in etwa jener, die Mecklenburg bei der Auflösung 1952 gehabt hatte2. Der folgende Beitrag bezieht sich auf das Territorium des heutigen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern.
Ende des 12. Jahrhunderts hatte sich innerhalb von 50 Jahren ein dichtes Netz von Dörfern gebildet und Wälder wurden gerodet. Um den Holz- und Obstbedarf zu decken, wurden an Wegen ein- oder beidseitig Weiden, Obstbäume, Pappeln, Ulmen und auch Walnussbäume gepflanzt. Der Holzmangel nahm in den folgenden Jahrhunderten noch zu. 1572 gab es eine Polizei- und Landesverordnung mit der Anweisung „nach Gelegenheit Weiden, Mast, Obst u. a. fruchtbare und nützliche Bäume“ zu setzen und zu pflanzen. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wurden in mehreren Edikten „Holzverwüstungen“ verboten und bei Fällung eines Baumes sogar Ersatzpflanzungen im Verhältnis von bis zu 1:6 mit Eiche, Buche oder Weide verordnet (LEHMANN 2006).
Die Bedeutung der Straßenbäume für die Holzgewinnung hielt bis in die 1980er Jahre an. So hieß es in der TGL 12097 02–1984: „Im Rahmen der Holzerzeugung außerhalb des Waldes hat auch die Straßenbepflanzung nach wie vor große Bedeutung. Besonders auf Böschungen, an Waldrändern und auf Nebenflächen von Knotenpunkten außerhalb der Sichtfelder sind schnellwachsende Holzarten, insbesondere Wirtschaftspappeln, zu pflanzen.“
Die Blütezeit der Alleen begann in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Gepflanzt wurden sie zunächst in Park- und Schlossanlagen und an den Zufahrten zu Herrenhäusern. Seit dem 18. Jahrhundert führten Alleen in die freie Landschaft hinaus. Es bildeten sich lokale Alleenlandschaften heraus, nicht nur im norddeutschen Raum, sondern in allen Ländern Europas.
Verschiedene Gründe machten die Baumpflanzungen entlang der Straßen attraktiv oder sogar notwendig. Vom 18. Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Nachfrage der Industrie nach Holz genauso wie der Bedarf der Haushalte nach Brennholz stark zu. Aber die Nutzung war noch vielfältiger. Beispielsweise wurden Blätter als Einstreu und Futter für das Vieh verwendet, Maulbeerbäume für die Seidenraupenzucht, Weidenzweige als Material zur Möbel- und Korbherstellung und Früchte für den Verzehr durch Mensch und Vieh. Durch die Gründung des Deutschen Reiches (1871) und die Förderung des Handels nahm das Reisen mit der Postkutsche zu, neue Wege entstanden, die vorhandenen wurden stärker genutzt und Chausseen neu gebaut. Das Wort Chaussee kam auch als Lehnwort aus dem Französischen. Als Chausseen wurden befestigte, meist gepflasterte und ingenieurtechnisch ausgebaute Straßen bezeichnet. Sie waren gewölbt und von Chausseegräben begleitet, damit das Wasser abfließen konnte (HOFMANN 2016). Um die Chausseen und bestehende Wege zu entwässern und zu stabilisieren und vor Bodenerosion zu schützen, wurden sie mit Bäumen bepflanzt. Die Pflanzung wurde in die Planung der Chausseen integriert (Abbildung 1).
Abbildung 1: Königliche Überbaudirektion zu Berlin, 1814: Anweisung zur Anlegung, Unterhaltung und Instandsetzung der Kunststraßen (LEHMANN & ROHDE 2006)
Die Bäume führten auch Reisende und Truppen bei verschneitem oder nebligem Wetter, schützten vor Wind und spendeten Schatten. Als Wegbepflanzung waren die Alleen also ein wichtiges Element der „Verkehrssicherheit“ (BRÜCKMANN 2017). Auch rein ästhetische Gründe, beispielsweise ein Pflanzen „bloß der Aussicht“ wegen, waren nicht selten. Ein Beispiel hierfür ist die Allee von Bad Doberan zum Seeheilbad Heiligendamm, die 1793 durch Mecklenburgs Landesherrn Großherzog Paul Friedrich angelegt und in den Jahren 1849-1850 bepflanzt wurde.
Friedrich Schiller richtete an die Fürsten und Gewaltigen der Erde die Worte: „Lasset euch zur Stiftung eines Denkmals bewegen, daß dereinst noch von der Größe eurer wohltätigen Unternehmungen und von eurem rühmlichen Dasein auf der Welt zeugen wird. Die Erde ist gleichsam ein Stoff, die euch die Vorsehung ausgeteilt und unter eure Hände gegeben hat; Sie soll nicht nur auf die würdigste Art zum Nutzen der Menschen gebraucht, sie soll auch verschönert werden. Dem niederen Landmann sind eure Lusthäuser, eure Gärten verschlossen; entschädigt ihn mit dem Anschauen und Genuß von tausend Baumalleen, und seine Enkel werden euch dafür segnen“ (LYON 1909).
Die lange und vielfältige Geschichte der Alleen erreichte ihren Höhepunkt im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, als in einigen Regionen Europas und auch im Norden Deutschlands fast jede Landstraße mit Bäumen gesäumt war. Dieser Trend setzte sich bis zum Zweiten Weltkrieg fort. Die verschiedenen Gründe für eine solche Pflanzung und vielfältige regionale Aspekte wie Geographie, Klima, Bodenart und Mode führten zu einer großen Palette an Baumarten, die verwendet wurden. Es ist eine Form lebendiger Architektur. Der Bogen, der sich bildet, wenn sich die Äste der Baumkronen über der Straße treffen, wird oft als „grüner Tunnel“ oder „Torbogen“ bezeichnet. Der Begriff „Kathedrale“ wird in diesem Zusammenhang bereits im Jahre 1794 verwendet (PRADINES 2009).
Bis Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Begriff „Allee“ in Mecklenburg-Vorpommern nicht verwendet, sondern entweder von „Baum-Gärten“ gesprochen oder, wie in der Verordnung aus dem Jahr 1768 für die Umgebung der Residenzstadt Schwerin, von „Bäumen an Straßen und Wegen“. In der Verordnung hieß es: „…wer die … muthwillig verletzt oder gar abhauet; soll … mit einer schweren Geld-Busse, mit Gefängnis, harter Leibesstrafe oder dem Hals-Eisen … bestraft werden…“.
Seit dieser Zeit sind auch im heutigen Mecklenburg-Vorpommern Beispiele für Alleen an Landstraßen außerhalb von Gutshöfen und Schlössern überliefert. Das Pflanzen von Straßenbäumen wurde besonders von den deutschen Herzögen intensiviert. Die Landesherren hatten ein großes Interesse, diese zu schützen und richtig zu pflegen. So hat der gesetzliche Schutz der Alleen auf dem heutigen Territorium von Mecklenburg-Vorpommern eine lange Tradition. Hauswirte und Gewerbetreibende wurden zum jährlichen Pflanzen von Eichen an Landwegen verpflichtet.
Der heutige Bestand vieler alter Eichenalleen war eine Konsequenz des Befehls von Friedrich Herzog zu Mecklenburg, der 1773 festlegte, dass „jeder Hauswirth 5 … jeder Büdener 3 junge Eichen jährlich … an den Land-Wegen … zu verpflanzen … und die ausgehenden aber durch andere zu ersetzen hat“ (LEHMANN 2006, Abbildung 2).
Abbildung 2: Die Schildfelder Eichen-Allee im Landkreis Ludwigslust-Parchim entstand wahrscheinlich auf Befehl von Friedrich Herzog zu Mecklenburg 1773.
Eine flächendeckende Alleenlandschaft entstand jedoch nicht vor 1840.
Dass Alleen und nicht Hecken an Straßen landschaftsprägend wurden, ist auch Oberbaurat Bartning zu verdanken, der für die Staats-Chausseen in Mecklenburg-Schwerin zuständig war. Die 1840 verfasste „Circular-Verordnung an sämmtliche Wege Besichtigungs-Behörden“ im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin legte folgendes fest: „… Wenn die Sicherstellung einer in gerader Richtung fortlaufenden Straße für nothwendig erkannt wird, so ist eine Baumpflanzung in der Entfernung von einer Rute rheinländisch, mit – zwischen je zwei Bäumen – eingelassenen Steinen 3 bis 4 Fuß über der Erde hoch, anzuordnen … Hecken sind aber zur Befriedung gefahrdrohender Stellen an Kunststraßen überall nicht anzuordnen“. Eine rheinländische Rute entspricht 3,767 Meter (LEHMANN 2006; KARGE & GRESSMANN 2007).
Sobald Alleen in großem Maße gepflanzt wurden, begannen auch die Interessenkonflikte. Alleen wurden lange vor allem von der Landbevölkerung als eine Angelegenheit des Adels angesehen. Sie verachteten die Alleen als Denkmäler des aristokratischen Regimes mit all den auferlegten Belastungen und Abgaben, die es mit sich brachte. So manche hundertjährige schattige Allee wurde daher während der Deutschen Revolution in den Jahren 1848 und 1849 zum Opfer der Bevölkerung. Trotzdem wurden im 19. Jahrhundert die meisten Straßen und Wege mit Bäumen bepflanzt (RIEHL 1857).
In den Jahren 1866 bis 1880 erscheinen für Mecklenburg mehrere Anweisungen zur Behandlung der Bäume an Staats-Chausseen, Behandlung der Pappelanpflanzungen sowie zu den Abständen zwischen den Bäumen. Die häufigsten Baumarten waren Ahorn, Linde, Kastanie, Eiche sowie Obst, Weiden, Pappeln und Ulme. Anweisungen und Erlasse sollten dafür sorgen, dass der Baumbestand an den Straßen erhalten bleibt und mehr gepflanzt wird. Die „Anweisung für die Behandlung der Baumpflanzungen an den Landes-Chausseen“ durch die Großherzogliche Chaussee-Verwaltungs-Kommission vom 8. Oktober 1908 war so ein Versuch, die Alleen flächendeckend zu schützen. Darüber hinaus enthielten sie Anweisungen zu fachgerechten Schnittmaßnahmen und zur Berücksichtigung der Bodenverhältnisse bei der Neuanlage von Alleen, zur Verwendung von Baumarten und -sorten sowie Beschränkungen für das Anpflanzen der Pappeln:
„Fortlaufend sind gleichartige Alleen für längere Strecken herzustellen. Mithin sind abgängige Bäume durch eine gleiche Art zu ersetzen … Eine Abwechslung in den Baumsorten nach längeren Strecken ist für die Alleen aus Schönheitsrücksichten zu empfehlen.“
„Streng muß darauf geachtet werden, dass nur solche Bäume zu kaufen sind, welche als Fortsetzung des Stammes einen geraden nicht gegabelten Mitteltrieb haben.“
„Die Fahrstraße ist von überhängenden Zweigen gleichmäßig bis zu einer Höhe von 5-6 m durchaus freizuhalten ... Zur Schönheit des Baumes trägt es bei, wenn in gerader Fortsetzung des Stammes die Krone bis zur äußersten Spitze einen geraden Mittelstamm erhält, auf dessen Erhaltung größter Wert zu legen ist“ (KARGE & GRESSMANN 2007).
Mit Gründung eines deutschen Bundes Heimatschutz 1904 in Dresden und im Januar 1906 für Mecklenburg in Schwerin entwickelte sich erstmals ein von einer breiten Öffentlichkeit getragenes Engagement zum Schutz der Alleen. Im Jahr 1904 rief der Dresdener „Bund Heimatschutz” angesichts der Auswirkungen durch die Industrialisierung zum Erhalt der Natur auf:
„Heide und Anger, Moor und Wiese, Busch und Hecke verschwinden, wo irgend ihr Vorhandensein mit einem sogenannten rationellen Nutzungsprinzip in Widerstreit gerät. Und mit ihnen verschwindet eine ebenso eigenartige als poetische Tier- und niedere Pflanzenwelt. In der Forstwirtschaft gilt […] vielfach ausschließlich der Gesichtspunkt, hohe Erträge zu erzielen. […] Bäche und Flüsse werden zugunsten praktischer Zwecke so völlig umgestaltet, daß in ihrer natürlichen Schönheit nichts mehr übrigbleibt. Der Baum, der seit Jahrhunderten Schatten gespendet, wird den Theorien der Wegebaukommission zuliebe gefällt; das alte Tor, das vorspringende Haus wird niedergerissen, weil der enge Durchgang, die krumme Straße angeblich nicht mehr den Forderungen des Verkehrs entspricht; dies aber nicht nur in den Städten mit einigen hunderttausend Einwohnern, sondern in jeder Mittel- und Kleinstadt bis zum winzigsten Flecken herab, weil sie alle von der Sucht geplagt werden, großstädtisch scheinen zu wollen. […] Wir haben nicht die törichte Absicht, die außerordentlichen Errungenschaften der Gegenwart auf praktischem Gebiet zurückdrängen zu wollen. Wohl aber dürfen wir einen Ausgleich anstreben zwischen jener herzlosen Ausbeutung des Heimatbodens und den Forderungen des Gemüts, dessen Wurzeln keine Lebensnahrung mehr finden werden, wenn wir in gleichem Maße fortfahren, die Schönheiten des deutschen Landes achtlos zu vernichten“ (FISCHER 2004; 3).
In den 1930er Jahren setzt sich der Heimatbund dafür ein, dass Alleen unter Denkmalschutz gestellt werden. Das gelang teilweise mit dem 1935 eingeführten Reichsnaturschutzgesetz (RNG). Das RNG regelte den Naturschutz in der von Besiedlung „freien“ Landschaft (im Außenbereich). Es enthielt die Schutzgegenstände „Naturdenkmäler“ und „Naturschutzgebiete“, „sonstige Landschaftsteile in der freien Natur“, „Artenschutz“ und „allgemeinen Landschaftsschutz“ (RNG §§ 5, 19 und 20). Alleen konnten als „sonstige Landschaftsteile“ im Einzelfall unter Schutz gestellt werden. Eine weitere Neuerung war die Aufnahme der Pflege des Landschaftsbildes (§§ 19 und 20 RNG). Die Schutzwürdigkeit von Objekten und Gebieten orientierte sich an den Kriterien Seltenheit, Schönheit, Zier- oder Schmuckwert, Eigenart sowie Interesse für Wissenschaft, Heimatkunde, Volkskunde und Geschichte4.
2.2Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1990
Es ist bemerkenswert, dass weder vor noch während des Zweiten Weltkrieges gesunde Alleebäume gefällt wurden. Wenn überhaupt, wurde jeder zweite Baum aus einer eng bestandenen Baumreihe entfernt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Alleen im westlichen und östlichen Teil Deutschlands unterschiedlich entwickelt. Im westlichen Teil Deutschlands kam es zu einem rasanten Anstieg der Mobilität. Die ökologischen Vorteile von baumgesäumten Straßen wurden nicht mehr gesehen. Nach 1945 wurden in Westdeutschland 70 % aller Landesstraßen und 30 % aller Bundesstraßen, insgesamt etwa 50.000 km, auf mindestens 5,50 m verbreitert. Das ging mit einer großen Kampagne gegen die Alleen einher. Es wird geschätzt, dass etwa 12.500 km Baumreihen an diesen Straßen verlorengingen. Diese Schätzung bezieht sich aber nur auf die Straßenverbreiterung, nicht auf die Fällungen, weil man meinte, auf diese Weise die Verkehrssicherheit zu erhöhen (LEHMANN & MÜHLE 2006; SCHULZ 2006).
Sicherer war da das Leben der Straßenbäume in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Es gab wesentlich weniger Straßenverkehr und die finanziellen Mittel für Straßenverbesserungen und Baumpflege waren begrenzt. Ohne Schäden durch die Baumaßnahmen entwickelten sich die Straßenbäume gut. Darüber hinaus war es nicht nötig, Straßenbäume zu fällen. Allerdings gab es während der 40-jährigen Existenz der DDR auch keine bedeutenden Pflanzungen, obwohl die landeskulturelle Bedeutung erkannt wurde. Nennenswert sind lediglich Pflanzungen von Obstbaum- und Pappel-Alleen, also Baumarten, die auch der Versorgung dienten. Andere Baumarten wurden kaum gepflanzt. Das ist der Grund, warum im Osten eine ganze Generation von Bäumen fehlt.
Im August 1954 wurde das Reichsnaturschutzgesetz durch das „Gesetz zur Erhaltung und Pflege der heimatlichen Natur“ (Naturschutzgesetz) abgelöst. Zu den Schutzobjekten Naturdenkmale (ND), Naturschutzgebiete (NSG) und ausgewählten Tier- und Pflanzenarten kamen neu die Landschaftsschutzgebiete (LSG) und auch Flächennaturdenkmale (FND) bis 1 ha Größe hinzu. Somit konnten Alleen als Flächennaturdenkmale geschützt werden. Auch mit dem ab 1970 geltenden Landeskulturgesetz waren Flächennaturdenkmale weiterhin gesetzlich geschützt7.
Viel wirksamer für den Schutz der Straßenbäume aber war die DDR-weit geltende Baumschutzverordnung über die Erhaltung, die Pflege und den Schutz der Bäume (BSVO) vom 28. Mai 1981. Die BSVO galt außerhalb des Waldes an öffentlichen Straßen, Wegen und Gewässern, auf öffentlichen Plätzen und auf Flächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften einschließlich Wohn- und Erholungsgrundstücken, also praktisch überall. Geschützt waren alle stammbildenden Gehölze mit einem Stammdurchmesser ab 10 cm gemessen in 1,30 m Höhe vom Erdboden aus, aus heutiger Sicht ein unvorstellbar umfassender Schutz von Bäumen.
Wurden begründet Bäume außerhalb des Waldes gefällt, erforderte das einen Ersatz. Die BSVO galt auch nach der Wiedervereinigung einige Jahre fort, wurde dann aber nach und nach in optionale Einzelverordnungen und Baumschutzsatzungen einzelner Kreise und Landkreise im Rahmen der Landesnaturschutzgesetze überführt. Nach Einführung des bundesdeutschen Naturschutzrechtes wurde und wird der Baumschutz, auch der Alleenschutz, in den Landesnaturschutzgesetzen der neuen Bundesländer und vereinzelt in Baumschutzsatzungen geregelt.
Wichtig im Zusammenhang mit Straßenbäumen in dieser Zeit ist auch die TGL 12097. Dieses Regelwerk mit dem Titel „Anlagen des Straßenverkehrs. Gehölzpflanzungen an Landstraßen“ wurde im Februar 1984 durch das Ministerium für Verkehrswesen der DDR herausgegeben. Es legte den Schutz der Straßenbäume fest und beschrieb, wie eine Neuanlage von Alleen auszusehen hatte.
Danach sollten gesunde, landeskulturell wertvolle Baumbestände bei Investitionen und der Instandhaltung vorhandener Straßen erhalten bleiben, wenn die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt war. Ausfälle in Gehölzpflanzungen sollten bis zum 10. Standjahr, bei Obstbäumen bis zum 5. Standjahr, in gleicher Art nachgepflanzt werden. Ausfälle bei Neupflanzungen von Straßengehölzen waren in der nächsten Pflanzperiode projektgerecht zu ergänzen. Die Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern an Straßen wurden empfohlen, insbesondere das Pflanzen mit Obstgehölzen war erwünscht. Dabei war besonderer Wert auf die Anpflanzung von Wirtschaftsobst zu legen. Die Erweiterung der Bienenweide sollte durch Pflanzung von Bienenweidegehölzen an allen Straßen berücksichtigt werden.
Wegen möglicher Gefährdung und Behinderung des Straßenverkehrs durch Bäume und weil sie die maschinelle Randstreifen- und Grabenreinigung erschweren und das Schneeräumen behindern, waren Neuanpflanzungen auf Randstreifen (Bankette) von der Straßenverwaltung nicht gern gesehen. Auch zum Schutz der Bäume sollte daher bei geplanten Neupflanzungen an Straßen die Freistreifenpflanzung angestrebt werden, da dies für den Straßenverkehr, die Umwelt und nicht zuletzt für den Baum selbst die beste Lösung darstelle. Wo keine Einigung hinsichtlich der Freistreifenpflanzung erzielt werden konnte, sollte der Randstreifen weiterhin bepflanzt werden (TGL 12097 S.1).
Aufgrund dieser geschichtlichen Entwicklung gab es bei der Deutschen Wiedervereinigung 1990 nach wie vor einen schönen alten Alleebaum-Bestand. Damit brachte die ehemalige DDR einen ästhetischen Landschaftsschatz in die neue, größere Bundesrepublik ein.
2.3Von 1990 bis in die Gegenwart
Nach 1990 gerieten die Alleen durch den Anspruch an eine modernere Infrastruktur und die damit verbundenen baulichen Veränderungen zunehmend in Gefahr. Sie wurden als Hemmnis des Fortschritts betrachtet und standen der Verkehrssicherheit im Wege. Durch Modernisierungsarbeiten an den alten Straßen und Versorgungsleitungen kam es zu schwerwiegenden Schäden an Stämmen, Kronen und Wurzeln.
Die tiefe Beastung und der dichte Stand zur Straßenkante schränkte das von der Straßenverkehrsordnung (StVO) geforderte Lichtraumprofil ein (Abbildung 3). Diese Notwendigkeit wurde durch den sehr dichten Stand der Bäume zum Fahrbahnrand noch verstärkt. Nach damaligen Schätzungen standen allein im Zuständigkeitsbereich des Straßenbauamtes Schwerin etwa 20.000 Bäume näher als 0,5 m an der Fahrbahn, das waren ca. 20 % des gesamten Straßenbaumbestandes (PAWLAK, mündl. Mitteilung). Die Ergebnisse der landesweiten Alleenkartierung in Mecklenburg-Vorpommern von 1992-1996 belegen dieses Problem (Abbildung 4).
Abbildung 3: Das Besondere an den Alleen Ostdeutschlands war nicht nur die weitgehende Vollständigkeit des Baumbestandes, sondern auch die häufig noch erhalten gebliebene tiefe Beastung über der Fahrbahn, die in besonderem Maße einen tunnelartigen Effekt verursachte.
Abbildung 4: Abstand der Straßenbäume in Mecklenburg-Vorpommern vom Straßenrand nach Straßenklassen (LEHMANN & SCHREIBER 1997)
Abbildung 5: Das Fehlen einer mittelalten Alleengeneration für alle typischen Alleebaumarten in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich an der Verteilung der Stammdurchmesser (LEHMANN & SCHREIBER 1997)
Zwischen 10 und 15 % aller Bestände in Mecklenburg-Vorpommern waren durch ihren Standort im Lichtraumprofil gefährdet (Stand 1996). Außer der Totholzbeseitigung musste also zunächst an den Bundes- und Landesstraßen sowie an allen anderen Straßen das Lichtraumprofil hergestellt werden. Dadurch wurde zwar den Anforderungen der Verkehrssicherheit genügt, die alten Bäume wurden aber durch die entstandenen großen Schnittwunden stark geschädigt (DUJESIEFKEN & LEHMANN 1993). Die Folgen dieser Schädigungen sind noch heute deutlich an den zum Teil großen Lücken in den Alt-Alleen und dem teils schlechten Zustand der älteren Straßenbäume erkennbar (Abbildung 6). Nachpflanzungen als eine Alternative zu Neupflanzungen und eine fachgerechte Kronenpflege als eine Alternative zur Fällung wurden angemahnt (LEHMANN 2013).
Tabelle 1: Historischer Abriss zum Schutz von Alleen bis 1945 (aus: ROCHER 2017, mit Ergänzungen und Änderungen durch die Autorin)
Epoche/JahrErlass, Verordnung, Gesetz, Ereignis/Inhalt 17. Jahrhundert Div. Schutzvorschriften gegen „Holzverwüstung“ in Wäldern und an Straßen und Wegen: Verordnete Ersatzpflanzung von 1:6 1768 Verordnung „Bäumen an Straßen und Wegen“ für die Umgebung der Residenzstadt Schwerin (bei mutwilliger Beschädigung Geldstrafe, Gefängnis, Halseisen) 18. Jahrhundert Intensivierung der ländlichen Wegbepflanzung durch den fürstlichen Adel 1773 Friedrich Herzog zu Mecklenburg: Verordnung über die Pflicht des jährlichen Pflanzens von Eichen für bestimmte Gewerbetreibende und Hausbesitzer 1840 „Circular-Verordnung an sämmtliche Wege Besichtigungs-Behörden“ im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1866-1880 „Anweisungen zur Behandlung der Bäume an Staats-Chausseen“ 1904 Mit der Gründung eines deutschen Bundes Heimatschutz in Dresden gelang es erstmals, ein von der breiten Öffentlichkeit getragenes Engagement zum Alleenschutz aufzubauen5. 1908 Rundschreiben des Großherzoglichen Ministeriums des Innern an die Chaussee-Verwaltungskommission und Wegebesichtigungsbehörde, 29. Mai 1908: „Anweisung für die Behandlung der Baumpflanzungen an den Landes-Chausseen“ (Inhalte s. Text) 1935 Reichsnaturschutzgesetz vom 26.06.1935 und die Verordnungen (VO) zur Durchführung des RNG vom 31.10.1935 (Alleen können als sonstige Landschaftsteile geschützt werden6) 1940 und 1944 Erlass des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen, 27.01.1940: Schutz von Waldalleen, bekräftigt mit Erlass vom 29.06.1944, dass „ ... ein gänzliches Beseitigen guter Alleen unter allen Umständen vermieden ...“ werden muss (LEHMANN & ROHDE 2006).3Gesetzlicher Schutz der Alleen in Mecklenburg-Vorpommern
3.1Gesetzlicher Schutz von 1990-2000
Seit 1992 stehen in Mecklenburg-Vorpommern Alleen, später auch einseitige Baumreihen, im Landesnaturschutzgesetz unter spezialgesetzlichem Schutz. Kurze Zeit danach wurde deren Schutz und Pflege in der Landesverfassung, und zwar unabhängig von Länge, Stammumfang und Baumart, verankert. So heißt es in der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Mai 1993 im Artikel 12 Absatz 2: „Land, Gemeinden und Kreise schützen und pflegen die Landschaft mit ihren Naturschönheiten, Wäldern, Fluren und Alleen [...]“.
Die Landesverfassung schuf so die Grundlage dafür, dass Neuanpflanzungen von Alleen gesetzlich vorgeschrieben werden konnten. Dies war gerade wegen der zum Teil stark überalterten Alleebestände notwendig, um den Bestand nachhaltig zu sichern. Diesem Anspruch konnte die Landesregierung durch den ergänzenden Alleenerlass gerecht werden (LEHMANN & DUJESIEFKEN 1993).
Doch damit war der Fortbestand der Alleen noch lange nicht gesichert. Für den zukünftigen Alleenschutz war zunächst eine Bestandskartierung aller Alleen in Mecklenburg-Vorpommern notwendig. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichte für die Bäume an Bundes- und Landesstraßen 1992 schon eine Alleenkarte. Für zukunftsweisende regionale Konzepte zur Alleenentwicklung war jedoch eine genaue Bestandsanalyse notwendig.
Von 1992 bis 1996 wurde über das Umweltministerium des Landes eine Alleenkartierung durchgeführt. Auf dieser Grundlage sollten ein Verkehrskonzept unter Berücksichtigung des Alleenschutzes und regionale Alleenentwicklungskonzepte erarbeitet werden. Auch alte und neue Rad- und Wanderwege sollten in diese Konzepte einfließen, um die Alleenlandschaft auch touristisch zu nutzen. Der Bestand an Alleen an Bundes- und Landesstraßen von Mecklenburg-Vorpommern umfasste 1992 ca. 2300 km. Nicht erfasst war die große Zahl baumbestandener Kreis- und Gemeindestraßen sowie ländlicher Wege. Im Ergebnis der Alleenkartierungen wurden 2588,8 km Alleen, 1012,6 km einseitige Baumreihen und 772,6 km Neuanpflanzungen erfasst. 980 km davon sind besonders schützenswert. Der finanzielle Aufwand für die Erfassung betrug 2,13 Millionen DM (LEHMANN 2006; Abbildung 6).
Abbildung 6: Baumartenverteilung in Mecklenburg-Vorpommern (LEHMANN & SCHREIBER 1997).
Bereits wenige Jahre nach der Wiedervereinigung wiesen viele Bäume eine geschwächte Vitalität auf. Beurteilt wurden die Belaubungsdichte sowie die Kronenstruktur. Danach waren 23,9 % der Alleen in Mecklenburg-Vorpommern bereits 1996 „deutlich geschädigt“ (LEHMANN & SCHREIBER 1997). Die Landesregierung stimmt daraufhin Maßnahmen zu, die die Erhaltung und Vergrößerung des Bestandes an gesunden Alleen, den konsequenten Schutz besonders wertvoller Alleen, den Ausbau des Alleenfonds sowie Anlage und Pflege weiterer Neuanpflanzungen beinhalten (Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau MUTH, Fraktion der PDS 1995).
Tabelle 2: Historischer Abriss zum Schutz von Alleen 1945-1990 auf dem Gebiet der DDR
Epoche/JahrErlass, Verordnung, Gesetz, Ereignis/Inhalt ab 1945 Reichsnaturschutzgesetz (RNG): kein speziellgesetzlicher Schutz der Alleen, Alleen können als sonstige Landschaftsteile geschützt werden8 1954 „Gesetz zur Erhaltung und Pflege der heimatlichen Natur“ (Naturschutzgesetz): kein speziell gesetzlicher Schutz der Alleen, in Einzelfällen Schutz als Flächennaturdenkmale (FND) 1981 Verordnung vom 28.05.1981 über die Erhaltung, die Pflege und den Schutz der Bäume – Baumschutzverordnung (BSVO GBI. 1 Nr. 22 Seite 273): Geschützt waren alle stammbildenden Gehölze außerhalb des Waldes mit einem Stammdurchmesser ab 10 cm gemessen in 1,30 m Höhe vom Erdboden aus. 1984 TGL 12097 „Anlagen des Straßenverkehrs. Gehölzpflanzungen an Landstraßen“ des Ministeriums für Verkehrswesen der DDR: Festlegungen für Neuanpflanzungen, Abstandsregelungen 1990 Deutsche Wiedervereinigung, Neugründung des Landes Mecklenburg-Vorpommern3.1.1Alleenerlass
Der Wille zum Schutz der Alleen war in den Jahren nach der Wende stark. Das beweist auch der gemeinsame Erlass des Umweltministers und des Wirtschaftsministers („Alleenerlass“) zum „Schutz, Erhalt und zur Pflege der Alleen in Mecklenburg-Vorpommern“ vom 20.10.1992 für Bundes- und Landesstraßen im Land. Mit dem Alleenerlass wurde auch das „Merkblatt Alleen“, herausgegeben durch den Bundesminister für Verkehr, verbindlich eingeführt. 1994 erschien ein weiterer Alleenerlass der beiden Ministerien für die Neupflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen an Bundes- und Landesstraßen in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser enthielt die Alleendefinition. In Deutschland gibt es für den Begriff „Allee“ keine einheitliche Definition. Für die heutigen Bundes- und Landesstraßen in Mecklenburg-Vorpommern gilt: Beidseitig an Straßen gegenüberliegende Baumreihen bilden eine Allee. Sie sind mindestens 100 m lang und bestehen aus mindestens drei Bäumen pro Seite (Alleenerlass 2015). Im untergeordneten Straßennetz gibt es keine Angabe für eine erforderliche Mindestlänge (Baumschutzkompensationserlass 2007).
Der Erlass erklärte die notwendige Höhe von Ausgleich und Ersatz bei Fällungen von Straßenbäumen, Qualitätsmerkmale für Neu- und Nachpflanzung sowie Pflegegrundsätze und legte die Bildung eines Alleenfonds fest. Ziel dieses Erlasses war es außerdem, durch Baumschauen den Handlungsbedarf in Alleen festzulegen und dadurch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Straßenbaulast und den für Alleen zuständigen Kreisnaturschutzbehörden zu erreichen. Den Kreisen und Gemeinden wurde die Anwendung dieses Erlasses empfohlen.
Der Alleenerlass wurde 2002 modifiziert und 2015 neu überarbeitet und an bestehende Richtlinien angepasst. Er hat bis heute Bestand.
3.1.2Baumschutzkompensationserlass
Im Oktober 2007 wurde der Baumschutzkompensationserlass, eine Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, erlassen. Er bildet die Basis für eine landesweit einheitliche Regelung zur Berechnung des Umfanges von Kompensationsmaßnahmen bei der Beseitigung und Schädigung geschützter Einzelbäume, Alleen, Baumreihen sowie Baumgruppen. In Anlehnung an den o. g. Alleenerlass konkretisiert dieser Erlass den Alleenschutz für alle Alleen und Baumreihen einschließlich solcher unter 100 Metern Länge, die ihren Standort nicht an Bundes- und Landesstraßen haben. Dabei wurden maßgeblich die für Alleen und einseitige Baumreihen an Bundes- und Landesstraßen seit 1994 geltenden Regelungen z. B. für Ausgleich und Ersatz als Basis herangezogen beziehungsweise übernommen.
Neu war, dass nun auch eine Kompensation bei unsachgemäßen Schnittmaßnahmen oder bei sonstigen Schädigungen sowie beim Wurzelverlust zu leisten war. Unsachgemäß sind dabei alle Schnittmaßnahmen, die nicht der jeweils aktuellen Fassung der ZTV-Baumpflege entsprechen. Sonstige Schädigungen können zum Beispiel durch das Pflügen im Wurzelbereich verbunden mit Wurzelverlust verursacht werden. Auch dafür wurde eine Kompensationshöhe angegeben.
Neben den einheimischen und standortgerechten Baumarten sollten auch wegen des Klimawandels verstärkt Baumarten, die besser Trockenheit vertragen und weniger salzempfindlich sind, angepflanzt werden. Die Pflanzpflicht wurde mit einem Verhältnis von 1:1 festgelegt. Ein darüber hinausgehendes Kompensationserfordernis kann durch Einzahlung in den Alleenfonds oder Pflanzung ausgeglichen werden. Die Zahlung ist zweckgebunden für die Pflanzung oder Pflege von Straßenbäumen einzusetzen. Der Kompensationsbedarf bei Fällung richtet sich in diesem Erlass nach dem Durchmesser des Stammes oder dem Grad der Schädigung (LEHMANN et al. 2007).
3.2Gesetzlicher Schutz von 2000-2010
Im November 2005 legte das Wirtschaftsministerium des Landes ein Alleenentwicklungsprogramm vor, das für die nächsten 20 Jahre einen konkreten Handlungsrahmen zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Alleennetzes an Bundes- und Landesstraßen in Mecklenburg-Vorpommern vorgeben sollte. So weist dieses fachlich durch die agrar- und umweltwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock begleitete Programm potenzielle Pflanzbereiche für Alleen und Baumreihen in einer Größenordnung von insgesamt 1.092 Straßenkilometern Länge aus. Konzeptionell wurden Kriterien zur Neupflanzung von Alleen an Bundes- und Landesstraßen entwickelt und Vorgaben für deren Realisierung festgelegt. Mit dem Alleenentwicklungsprogramm vermittelt das Land zwischen den Anforderungen an ein modernes, leistungsfähiges und dabei verkehrssicheres Straßennetz einerseits und den ökologischen und landschaftsgestalterischen Werten der durch Alleen und Baumreihen geprägten Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns andererseits.
Grundlage war ein ausführliches Baumkataster. Die statistische und kartographische Auswertung ermöglichte eine vorausschauende Planung für die Entwicklung der Alleen ebenso wie eine gut organisierte Kontrolle und Pflege der Straßenbäume.
3.3Gesetzlicher Schutz von 2010 bis in die Gegenwart
Die „fehlerverzeihende Straße“ ist das Ziel des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) und des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR): Niemand soll durch einen Verkehrsunfall getötet oder schwer verletzt werden. Die RPS (2009) sieht dafür als Möglichkeiten die Beseitigung von Hindernissen (nach RPS sind Bäume ein „unverformbares Einzelhindernis“), die Einhaltung größerer Abstände von mindestens 7,50 Meter zum Straßenrand und/oder Schutzeinrichtungen vor. Um die Alleenlandschaft zu erhalten, müssen jedoch Lücken geschlossen und kontinuierlich neue Alleen angepflanzt werden. Forderungen der RPS (2009) erschweren dies jedoch sehr (DUJESIEFKEN 2020).
Andererseits ist in Deutschland der Schutz von Alleen als geschützten Landschaftsbestandteilen ins Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) aufgenommen worden. In § 29 Absatz (1) heißt es: „Geschützte Landschaftsbestandteile sind rechtsverbindlich festgesetzte Teile von Natur und Landschaft, deren besonderer Schutz erforderlich ist (…) Der Schutz kann sich für den Bereich eines Landes oder für Teile des Landes auf den gesamten Bestand an Alleen, einseitigen Baumreihen, Bäumen, Hecken oder anderen Landschaftsbestandteilen erstrecken.“ Weiter heißt es in Absatz (2): „Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Landschaftsbestandteils führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Für den Fall der Bestandsminderung kann die Verpflichtung zu einer angemessenen und zumutbaren Ersatzpflanzung oder zur Leistung von Ersatz in Geld vorgesehen werden.“ Die Vorschriften des Landesrechts über den gesetzlichen Schutz von Alleen bleiben unberührt.
4Entwicklung der Alleen an Bundes- und Landesstraßen
Von 1996 bis 2020 wurden in Mecklenburg-Vorpommern an Bundes- und Landesstraßen 91.307 Straßenbäume gefällt und 125.125 Bäume gepflanzt. Dieses Plus von 33.818 Straßenbäumen ist der Tatsache geschuldet, dass es bis 2010 einen Alleenerlass (2002) gab, der eine Kompensation für jeden gefällten Alleebaum in einer geschlossenen Allee im Verhältnis 1:3 vorsah und auch geringere Pflanzabstände zwischen Baum und Straßenrand zuließ. Seit 2010 halten sich Fällungen (39.328) und Pflanzungen (39.323) an diesen Straßen knapp die Waage (DUJESIEFKEN 2021;9). Mit der Einführung des überarbeiteten Alleenerlasses 2015, müssen Straßenbäume bei Fällungen mindestens im Verhältnis 1:1 ersetzt werden. Geht das Kompensationserfordernis darüber hinaus, beispielsweise bei Fällungen aufgrund von Baumaßnahmen, wo eine Kompensation von 1:3 gefordert ist, kann der Ausgleich über eine Zahlung in den Alleenfonds mit 400 € pro Baum erfolgen. Dieses Geld wird zur Pflanzung von neuen Alleen und Pflege von älteren Alleebäumen verwendet. Positiv ist, dass für alle gepflanzten Bäume gemäß gültigem Alleenerlass (2015) die Straßenbauverwaltung durch geeignete Pflegemaßnahmen sicherstellen muss, dass die gepflanzten Straßenbäume anwachsen. Sollte dennoch ein Baum innerhalb der ersten 20 Jahre abgängig sein, wird dieser außerhalb der Pflanzstatistiken 1:1 ersetzt.





























