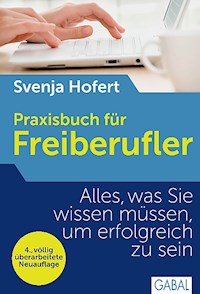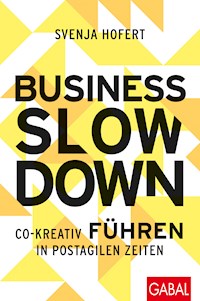19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wer trickst wen aus? Wie rücksichtslos Unternehmen heute wirklich geführt werden - und was Mitarbeiter in Wahrheit von ihren Brötchengebern halten ... Das Management sauge die arbeitende Klasse im Interesse der Gewinnmaximierung aus - klagen die einen. Arbeitnehmer machten Dienst nach Vorschrift, warteten faul auf ihre Frührente und ließen sich fürstlich entlohnen, beschweren sich die anderen. Stimmt beides, sagt Svenja Hofert. Ist sogar noch schlimmer! In ihrem Buch zeigt sie die Praktiken und gesammelten Geschmacklosigkeiten beider Seiten. Vom Abzocken übers Ausbeuten bis zum Mobbing. Fazit: Der neue Klassenkampf tobt. Wege aus der Misere? Die finden sich nicht bei Marx und Engels. Wir brauchen neue Helden, Vorbilder und Werte. Damit in den Unternehmen wieder Vertrauen, Loyalität und Menschlichkeit herrschen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Svenja Hofert
Jeder gegen jeden
Svenja Hofert
Jeder gegen jeden
Der neue Klassenkampf in den Unternehmen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-636-01379-8 | Print-Ausgabe
ISBN: 978-3-86881-172-8 | E-Book-Ausgabe (PDF)
E-Book-Ausgabe (PDF): © 2009 by Redline Verlag, FinanzBuch Verlag GmbH, München.www.redline-verlag.de
Print-Ausgabe: © 2006 by Redline Wirtschaft, Redline GmbH, Heidelberg. Ein Unternehmen von Süddeutscher Verlag | Mediengruppe.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: www.coverdesign.net Satz: M. Zech, Redline GmbH Printed in Netherlande
Für meinen Großvater, Guido Leibel
Inhalt
Inhalt
Vorwort
Prolog
Der neue Klassenkampf
Überlebenskampf im Konzern: Warum Größe die Konkurrenz fördert
Zu groß für unser Großhirn
Der Klassenkampf in Krisenzeiten
Großunternehmen erzeugen Dauerstress
Promiskuität an der Unternehmensspitze
Keine Shared Values, null Identifikation
Der Fisch stinkt vom Kopf: Von psychopathischen Top-Managern und cholerischen Mittelstandschefs
Corporate Psychopaths
Der Mittelstand: Cholerische Chefs und halbverrückte Inhaber
Territrorialkämpfe und Budgetturniere: Wie Schauspieler und Statisten Karriere machen
Karrieremachen selbst ist Schauspiel
Dulde niemanden auf deinem Territorium!
Nur Schauspieler und Unfähige kommen vorwärts
Hauen und Stechen: Wie Mitarbeiter mit miesen Methoden nur um ihren Vorteil kämpfen
Die Einstiegstrickser
Die Statushungrigen
Die Blockierer
Die Chef-Treter
Die Pattex-Angestellten
Die Beutezieher
Alle sind „Darwiportunisten“
Offene Liste der Konfliktursachen in Unternehmen
Der Mitarbeiter will aufsteigen – in Unternehmen, die keinen Platz für so viele Aufsteiger haben
Der Mitarbeiter braucht Halt und Sicherheit – das Unternehmen kann ihm dies nicht mehr bieten
Der Mitarbeiter sucht seinen Traumjob – das Unternehmen bietet schnöde Realität oder Alptraum
Der Mitarbeiter möchte Pausen und auch mal Zickzackfahren – das Unternehmen liebt nur gerade Linien
Der Mitarbeiter möchte seinen eigenen Bereich – das Unternehmen kann Insellösungen nicht gebrauchen
Der Mitarbeiter will Qualität – das Unternehmen kann oft nur Quantität wirklich schätzen
Der Mitarbeiter liebt Networking – aber Filz schadet dem Unternehmen .
Die Perfekt AG gibt es nicht – Warum gute Unternehmen trotzdem besser sind
Wie sieht ein „gutes“ Unternehmen aus?
Ein „gutes“ Unternehmen kann leichter erfolgreich sein
„Gutsein“ zehrt an den Kräften
Nicht jeder kann „gut“ sein
Vision 2015 – Wie Unternehmen gut werden und warum Arbeit demnächst weniger mit Geldverdienen zu tun haben sollte
Drama ohne Ausweg: Arbeitslosigkeit
Die neue Idee: Grundeinkommen gegen den Klassenkampf
Lebensabschnittsjob: Wie neue Vereinbarungen zwischen Mitarbeitern und Unternehmern den Jeder-gegen-jeden-Faktor senken
Der geheime Kodex und der psychologische Vertrag
Beschäftigung auf Zeit bringt allen Freiheit
Gegen das Jeder-gegen-jeden: Die offene Liste praktischer Lösungen
Einstellungspolitik mit Charakter
Werte mit System
Ethik in der Bilanz
Top- oder Flop-Unternehmen: Warum echte Transparenz gefragt ist
Was jeder tun kann
Anhang I – Branchenbarometer: Jeder-gegen-jeden-Faktor
Anhang II – Die Jeder-gegen-jeden-Kuriositätensammlung
Dank
Anmerkungen
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
„So schlimm ist es doch in Wirklichkeit gar nicht!“ Einige Verlage, denen mein Agent dieses Buch angeboten hat, wollten nicht glauben, dass es das „Jeder-gegen-jeden“, den neuen Klassenkampf wirklich gibt. Schon gar nicht wollten sie wahrhaben, dass Mitarbeiter nicht nur die armen Opfer von „Nieten in Nadelstreifen“ sind, sondern dass viele von ihnen selbst intensiv am Hauen und Stechen in den Unternehmen beteiligt sind. Ich verstehe diese Reaktion durchaus: Gern trennt sich wohl niemand von der Vorstellung einer schönen heilen Welt. Mag sein, dass es diese in dem einen oder anderen Verlag tatsächlich noch gibt. Aber in den meisten Unternehmen ist oft nichts mehr heil.
Mehr als 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in verschiedenen Firmen habe ich für dieses Buch interviewt. Die meisten haben meinen Eindruck bestätigt: „Ja, das ‚Hauen und Stechen’ kenne ich!“ Manche machten mir Mut: „Endlich schreibt einmal jemand darüber!“ Ob bei großen Konzernen, bei vermeintlichen Top-Arbeitgebern oder im Mittelstand: Das Klima in den Betrieben ist angespannter als je zuvor. Auf einer Skala von 1 bis 5 stuften fast alle der von mir Befragten ihre Unternehmenskultur als schlecht oder sehr schlecht (4 bis 5) ein.
Wenig wird offen ausgetragen. Das Hauen und Stechen spielt sich im Hinterhalt ab. Die einen vergraben sich dort, um nicht gesehen, bemerkt und als überflüssiger „Ballast“ identifiziert zu werden. Die anderen preschen gezielt daraus hervor, gerade um Beachtung zu finden; sie drängen dorthin, wo sie die „kampfentscheidenen“ Personen orten. Dabei geht es nie um das Unternehmensziel, selten um die Aufgabe als solche. Entscheidend ist nur eines: Wie schaffe ich es, auf dem Arbeitsmarkt zu überleben und das Beste für mich selbst herauszuholen? Wie bleibe ich im Besitz von Arbeit und gewinne die Auseinandersetzung um Jobs und Aufstieg?
Ich habe jahrelang meine eigene Karriere in einem großen Unternehmen vorangetrieben, den hier beschriebenen Kampf selbst erlebt und mich zeitweise auch daran beteiligt, bis ich schließlich in die Selbstständigkeit ausgestiegen bin. Inzwischen bin ich Inhaberin meines Büros für „Karriere & Entwicklung“ und arbeite als Trainerin, Beraterin und Coach im Bereich der beruflichen Neuorientierung, Gründung und Karriereentwicklung. In dieser Funktion habe ich mit Unternehmen zu tun, die mich beauftragen, wenn sie Mitarbeitern in der eigenen Firma keine Perspektive mehr bieten können. Meine Aufgabe liegt dann darin, neue Perspektiven zu entwickeln. Meine Auftraggeber sind aber auch Privatkunden, die auf der Suche nach neuen beruflichen Wegen zu mir kommen. Sehr oft geht es dabei vor allem um eins: um die Suche nach einem erfüllenderen und menschlicheren Arbeitsumfeld, das ich zu finden helfe.
Von meinen Kunden höre ich immer wieder etwas über die brutalen Seiten unserer Arbeitswelt, über den Klassenkampf und das ewige Streben nach dem eigenen Vorteil auf Kosten der anderen. Ich höre aber auch von Menschen, die sich am Jeder-gegen-jeden nicht beteiligen, sich ihm geradezu entgegenstellen. Und ich spreche mit Managern und Firmenchefs, die das Jeder-gegen-jeden gar nicht aufkommen lassen. Auch davon gibt es viele, doch leider sind diese (noch) in der Minderzahl.
Dass ich neben den Interviews auch einige Fallbeispiele einbinden durfte – selbstverständlich anonym –, dafür danke ich jenen, die mir gerne grünes Licht gegeben haben, herzlich. Ebenso wie für die offenen Interviews und das Vertrauen, dass ich alle Informationen sorgsam und anonym behandeln werde.
Der in meinem Buch beschriebene Kampf ist der neue Klassenkampf, die Auseinandersetzung um Arbeit in einer egoistischen Wissensgesellschaft. Es ist der Kampf um den Besitz von Jobs, den diejenigen gewinnen, die über Wissen verfügen oder dies zumindest vortäuschen können. Nicht um Produktionsmittel dreht sich dieser Kampf, nicht um das Kapital der „Ausbeuter“, sondern um die Wegbegleiter des Wissens, um Macht und Einfluss. Im Zentrum steht eine Auseinandersetzung zwischen den Job-Gewinnern und den Job-Verlierern, die so hart ist, dass sie letztendlich jeden mit jedem konfrontiert.
Dieses Jeder-gegen-jeden findet auf allen Ebenen statt. Chef gegen Chef, Mitarbeiter gegen Mitarbeiter, Vorgesetzter gegen Untergebenen, Aufsichtsrat gegen Vorstand, Arbeitslos gegen Arbeitbesitzend, Bewerber gegen Bewerber, Politik gegen Bürger, Führungskraft gegen Führungskraft. Im Geheimen tüfteln die Gegner ihre Strategien und ihre Guerillataktik aus, die Wissens-Macht-Einfluss-Basis zu nähren und das eigene Überleben am Arbeitsmarkt zu sichern.
„Ich hätte nie für möglich gehalten, dass es wirklich so ist“, sagte eine junge Führungskraft im Interview. „Du musst jeden Schritt planen und immer damit rechnen, dass jemand aus dem Hinterhalt vorprescht, um dich aufzuhalten. Die Fallensteller lauern überall.“ Das Unausgesprochene ist das wirklich Brutale in diesem Kampf. Jeder gibt vor, etwas anderes zu meinen, niemand spricht offen aus, wie es wirklich ist, wie es in Zukunft sein wird und welche simplen Mechanismen die Arbeitswelt und damit uns alle beherrschen …
„Es muss endlich einmal jemand sagen, wie es wirklich ist.“ Diesen Satz habe ich oft gehört, und Besserwisser-Ethiken mit rein theoretischen Fallbetrachtungen gäbe es bereits genug. Das finde ich auch: Deshalb beschreibe ich das Jeder-gegen-jeden mit vielen Beispielen, die sich tatsächlich so zugetragen haben. Ich nähere mich zunächst dem System Unternehmen, um dann auf das nicht immer förderliche Wirken der Unternehmensköpfe (der Manager), auf die Krankheit des Karrieremachens an sich und auf die bisweilen peinliche Unkultur im Umgang der Mitarbeiter untereinander zu sprechen zu kommen. Ich analysiere Ursachen und (er-)finde irgendwann das ideale Unternehmen, das vielleicht nicht von dieser Welt ist, es aber sein könnte. Schließlich beschreibe ich eine einfache gesellschaftliche Lösung, die antikapitalistisch erscheint, es aber nicht ist – und komme dann auf viele flankierende Maßnahmen und Konsequenzen, die jedes Unternehmen, jeder Manager und vor allem auch jeder Mensch im Interesse eines faireren und effizienteren Berufsalltags aus dem neuen Klassenkampf ziehen kann.
Denn Kämpfe gibt es auf dieser Welt schon genug.
Svenja Hofert im August 2006
Prolog
Vor sechs Jahren habe ich das Schlachtfeld „Konzern“ verlassen. Nur eine einzige durchwachte Nacht benötigte ich für meine Entscheidung. Dann wusste ich, was ich wollte: auf meinen Arbeitsplatzanspruch und auf all die staatlichen Zuckerstückchen wie Arbeitslosengeld und Überbrückungsgeld verzichten und selbst Unternehmerin werden. Auf alle die nicht hören, die mir nahestanden, und nur meinem inneren Kompass folgen.
Zu diesem Zeitpunkt war ich schwanger und ausnahmslos jeder hielt mich für verrückt. Den Säbelrasslern warf ich die Kündigung auf den Tisch, freute mich über das verdutzte Lächeln und wusste sofort, dass alle mich an nur einem Ort sahen: im Kinderzimmer beim Babyschaukeln. Und dass sie nebenbei richtig erleichtert waren: So kostengünstig waren sie andere Mitarbeiter und speziell Führungsnachwuchsmütter nicht losgeworden. Zudem hatte sich die Schlachtordnung für die Nachfolge auf den in Kürze vakanten Posten meines Chefs damit en passant verschoben. Ich müsste nicht berücksichtigt werden.
So konnte ich beobachten, was anschließend geschah: Nach einigen Wochen Suche führte der designierte Nachfolger meines Chefs – nennen wir ihn Peter X. – mit dem Marketingleiter (Meik M.) hinter verschlossenen Türen eine kriegerische Auseinandersetzung. Es ging um die Größe seines künftigen Machtbereichs. Gerne hätte er die bisherige Machtbasis übernommen, das wollte der Marketingleiter aber nicht.
Die Rollen waren ungerecht verteilt. Der designierte Nachfolger war ein eher langweiliger Ingenieur mit eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten und völlig ohne Lobby im Unternehmen. Mir war sofort klar, dass er allein schon wegen seiner unbeeindruckenden Art gegen den Marketingleiter den Kürzeren ziehen musste. Ein junger Vorstand aus dem achtköpfigen Board, von dem ich bereits geahnt hatte, dass er sich einst dank seiner flexiblen Cleverness irgendwann als Vorstandsvorsitzender über alle anderen erheben würde, stand hinter dem Marketingleiter. Beide hatten sich entschieden, die Macht der ehemals einflussreichen Abteilung mit einem kräftigen und entschiedenen Griff an sich zu ziehen.
Das wahrscheinlich stille Abkommen dahinter: Wenn er, der junge Vorstand, dem Marketingleiter Meik M. helfen würde, die eigene Machtbasis auszubauen, wäre er damit sein Karrierebeschleuniger. Aus Dankbarkeit würde Meik M. dem jungen Vorstand gegenüber loyal sein und bei den eigenen Vorhaben unterstützen. Solche Abkommen sind in der Managerwelt üblich. Lange habe ich deren Zustandekommen in Kneipen und Nachtlokalen vermutet. Letztendlich ist es so: Einer hilft dem anderen, die eigenen Karriereziele zu erreichen und der mit den besseren Verbindungen gewinnt – all das geschieht ohne viele Worte.
Eine interessante Beobachtung für mich war, dass Machtkämpfe im Unternehmen nicht selten Stellvertreterkriege sind. In vielen Fällen stehen nicht die Initiatoren an der Front, sondern „Spielfiguren“ wie Vorstandssekretärinnen oder das mittlere Management. Es gewinnt meist der, der die stärksten Vertreter an höherer Stelle hinter sich stehen hat.
Der Ingenieur, der zur Nachfolge meines Chefs ausersehen war, war auch ein Stellvertreter – vermutlich, ohne es selbst zu wissen. Er war bestenfalls für eine Stabsstelle geeignet; seine Persönlichkeit vereinfachte die Entmachtung einer ehedem einflussreichen Abteilung.
Bei dieser – wie vermutlich bei vielen anderen Entscheidungen tagein tagaus – waren keine Sekunde lang inhaltliche Fragen relevant, noch stand je zur Debatte, wie sinnvoll die eine oder andere organisatorische Lösung für das Unternehmen und für dessen Ziele sein könnte. Die Auseinandersetzung kreiste einzig und allein um persönliche Machtinteressen. Wie stark die machtorientierte Prägung in diesem Unternehmen war, wurde mir im Nachhinein anhand der Parkplatzordnung und der Autotypen ganz anschaulich bewusst. Mit etwas zeitlichem Abstand konnte ich verstehen, warum der eine Manager einen Mercedes, der nächste einen BMW und der dritte einen Audi fuhr. Plötzlich wusste ich, was anderen schon von Anfang an klar war: dass das Auto für den Status in einem Unternehmen mehr bedeutet als der Titel (der Vertriebsleiter fuhr Mercedes). Und da verstand ich plötzlich, dass meine Vorliebe für grüne Rover mit cremefarbenen Ledersitzen meine Vorliebe zum Querdenken spiegelte und Vorbote meines Ausstiegs war. Ein komisches „Spiel“...
Ähnliches hatte ich bereits in zurückliegenden Arbeitszusammenhängen erlebt, einige Jahre war ich in einem mittelständischen Unternehmen, modern wirkend, aber nicht minder machtgeprägt. Konkurrenz wurde, wie in solchen Firmen üblich, geduldet, Kompetenzüberschneidungen waren unausgesprochen erwünscht.
Im Wettlauf um den eigenen Einfluss spielten sich fast comictaugliche Szenen ab. Jung und angestachelt von einer schnellen ersten Beförderung spielte ich mit. Täglich rannte ich Schulter an Schulter mit meinem ärgsten Konkurrenten zum Chef, bemüht den nächsten klugen Schachzug zu tun, der meinen Wettbewerber aus dem Rennen werfen würde. Das führte in einen Nervenkrieg, denn niemand von uns konnte sich seines Einflusses je sicher sein – dafür sorgten die Marionettenspieler ganz oben. So beobachtete ich jede Regung meines Konkurrenten. Bewegte er sich von seinem Stuhl im Nachbarbüro durch den Flur nach unten, sah ich ihn und schoss hinterher – umgekehrt genauso. Das sorgte für stetige Adrenalinstöße, bei ihm wie bei mir. Ich dachte mir gemeine Strategien aus und heckte Kriegspläne aus. Ausgerechnet ich – humanistisch geprägt und gegen Karriere und Krieg eingestelltes Produkt der so gar nicht leistungsfixierten „Generation X“.1 Ich erlag dem Charme der Einflussnahme. Es war faszinierend Macht zu haben, Führungsseminare zu absolvieren und in Besprechungen gehört zu werden. Es war spannend, selbst zu erfahren, wie Unternehmen ticken und wie man in ihnen Karriere macht.
Aber das Strickmuster für die erstrebte Karriere entpuppte sich als so schlicht, dass ich Gewissensbisse bekam. Ich saß da und konnte nicht fassen, dass man zwölf Stunden nichts tat (außer Sekretärin, Praktikanten und Mitarbeiter mit Arbeit zu versorgen), und dafür bei Jahresgesprächen mit Lob und Gehaltssteigerungen überschüttet wurde. Das Geheimrezept waren die Meetings. Ich lernte: Für die Karriereförderung reicht die Teilnahme an ein, zwei Meetings am Tag. Bei diesen musste ich am besten energisch auf den Tisch hauen, Zähne zeigen und Ideen möglichst wirksam und selbstbewusst präsentieren. Sehr wichtig war es, regelmäßig eigene Erfolgsgeschichten zu lancieren, am besten per E-Mail mit strategisch gewählten CCs.
Ich entdeckte die Macht der Rede und mein Talent, andere mit Worten zu „besiegen“. Karrieremachen war eine große Show. Mit Arbeit hatte das wenig zu tun, es ging primär um das Verfolgen persönlicher Interessen. Dafür ließ ich auch um 20 Uhr noch mein Licht brennen. Zeitgleich wurde eine Kollegin, die nach der Geburt ihres Babys zwar um sieben Uhr morgens kam, dann ohne Mittagspause ackerte, aber schon um 17 Uhr ging, von der Geschäftsführung aus dem Unternehmen gemobbt.
Mein persönliches Fazit nach einigen Jahren als leitende Angestellte gipfelte in einem simplen Karriererezept: Man nehme einen machthungrigen Menschen, gebe ihm einen Hauch von Kompetenz und kombiniere diese mit einem gerüttelt Maß an Selbstdarstellung. In diesem Buch möchte ich diese provokante These durch die Erfahrungen anderer und Beispiele untermauern. Aus zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass alles noch viel schlimmer sein kann, und dass ich selbst nur eher harmlose Varianten des Jeder-gegen-jeden erlebt habe. Ich weiß aber auch, dass nicht alles schlecht ist und was in guten Unternehmen anders läuft.
Meine eigene Neuorientierung gipfelte in der Erkenntnis, dass ich lieber selbst entscheiden und eigene Risiken eingehen will als die Entscheidungen anderer durchzusetzen, wenn ich sie für falsch halte. Ich möchte Autos fahren, die mir gefallen und lege auf Status keinen Wert. Es bedeutet mir viel, anderen dabei zu helfen, einen eigenen Weg finden, der zu der Persönlichkeit passt und vielleicht nicht immer der klassische Schritt auf der Karriereleiter ist. Das ist für mich persönlich sinnvoller als eine eigene Angestelltenkarriere – es muss aber ganz sicher nicht jedermanns Fazit sein. Es soll es auch gar nicht. Gebraucht sind schließlich Menschen, die im Jeder-gegen-jeden nicht mitspielen und in den Unternehmen dafür sorgen, dass sich die Verhältnisse wieder zum Besseren kehren.
Der neue Klassenkampf
Wir schreiben das Jahr 2015 und zählen sieben Millionen Arbeitslose. Rund drei Millionen Personen ohne Arbeit (POAs) sind nicht bei der Bundesagentur gemeldet. Sie bewohnen leerstehende Häuser in abgelegenen Dörfern von Ostdeutschland und erwirtschaften in Kommunen Lebensmittel für den Eigenbedarf. Die Regierung fördert die alternativen Lebensformen im Osten, spart sie so doch die Kosten für das längst auf 200 Euro pro Person gekürzte Hartz-IV, das inzwischen die Hälfte des Bundeshaushalts auffrisst.
Seit dem Jahr 2004, seit über einem Jahrzehnt schon, schreiben Konzerne immer größere Gewinne. Alle zwei Jahre entlassen die Großen mehrere Hunderte und teilweise Tausende von Mitarbeitern. So schützen sich die Unternehmen vor dem Zugriff von Heuschrecken und vor der Übernahme durch zahlungskräftige und kauflustige Konkurrenten. Die abgebauten Mitarbeiter finden nur zu einem geringen Prozentsatz neue Vollbeschäftigung. Immer mehr wandern in Ostkommunen ab.
Wer Arbeit hat, ist meist unter 45 Jahre alt und arbeitet durchschnittlich 12 Stunden am Tag. Mehr als 50 Prozent aller Arbeitslosen sind gering qualifiziert. Als Langzeitarbeitslose haben diese kaum mehr eine Chance, je einen normalen Arbeitsplatz zu finden. Ein Kombilohnmodell hat sich als Bumerang entpuppt: Unternehmen senkten die Löhne weiter, die Zeche des Staates stieg stetig. Inzwischen haben es auch die Politiker erkannt: Es kostet mehr Geld, Menschen zu beschäftigen, als diese nach Hause zu schicken. Erste Aufstände in den ghettoisierten Vorstädten wurden blutig niedergeschlagen. Deshalb hat ein Politiker der CDU in der letzten Woche vorgeschlagen, diesen einmal täglich Beruhigungsmittel ohne Rezept zu verpassen. Gleichzeitig äußerte er den Vorschlag, Frauen in Ghettos zwangsweise zu sterilisieren. Diese bekämen zu viele Kinder, was den Staat wiederum zu viel Geld koste. Dafür steckte er viel Kritik ein, bekam aber auch Zustimmung.
Science Fiction oder Zukunftsmusik? Ich bin sicher: Zukunftsmusik. Noch ist es ruhig, geht es uns gut genug, schlafen die Arbeitslosen vor ihren Fernsehern. Noch tobt der Klassenkampf nicht als offene Konfrontation, sondern findet verdeckt statt – mit den Waffen der Unkultur in den Unternehmen. Der Klassenkampf konfrontiert nicht mehr in marxistischer Manier Arbeiter und Arbeitgeber, sondern jeden mit jedem. Nicht mehr der Besitz der Produktionsmittel steht im Zentrum, sondern der Besitz von Wissen. Wissen lässt sich nicht fassen, ist flüchtig, kann vorgetäuscht werden: Aus diesem Grund ist der Kampf subtil und hinterhältig. Wissen ist zunehmend mehr an den Besitz des Arbeitsplatzes gekoppelt. Wer etwas weiß, das ein Unternehmen braucht, um im globalen Wettbewerb erfolgreich zu sein, der hat den Klassenkampf gewonnen. Zugleich muss er aufpassen, dass sein Wissen nicht veraltet oder von anderen abgeschöpft wird. Die Verlierer in diesem Klassenkampf sind all diejenigen, deren Wissen nicht für einen Vorsprung ausreicht, die durch Maschinen ersetzbar sind. Diese Verlierer sind die Proletarier von heute – und sie werden früher oder später auf die Barrikaden gehen.
Was dann passieren kann, bringt der ehemalige SPD-Generalsekretär Peter Glotz auf den Punkt. „Aber wenn irgendwo 200 empörte Arbeiter, die entlassen werden sollen, obwohl der Konzern insgesamt schwarze Zahlen schreibt, alles kurz und klein schlagen, kann ein einziger Gewaltausbruch dieser Art einen Flächenbrand auslösen (…).“2
Glotz hatte schon vor mehr als zwanzig Jahren gesehen, auf welche Entwicklung wir zusteuern. „Wir stehen vor einer neuen massiven Verschiebung der Gewichte in der Produktionsfunktion: Der Faktor menschliche Arbeit tritt mehr und mehr in den Hintergrund und das Produktionsergebnis verdankt sich in den hochproduktiven Bereichen fast ausschließlich dem Faktor Kapital, das in der Maschinerie verkörpert ist. Der technologische Prozess, der in gewaltigen Produktivitäts- und Rationalisierungsschüben menschliche Arbeit überflüssig macht, verlagert immer mehr Arbeitsfunktionen vom Menschen auf die Maschine. Das nun in der Tat ist zwar kein jäher, aber ein epochaler Wandel: Nicht länger ist die Arbeit die Hauptquelle gesellschaftlichen Reichtums, sondern die Technik.“3
Arbeit wird zum Luxusgut, das nur noch die Besten haben können. Das Arbeiten in den Unternehmen wird zum Überlebenskampf.
Überlebenskampf im Konzern: Warum Größe die Konkurrenz fördert
„Große Unternehmen sind oft böse Unternehmen, die gut spielen“, vertraute mir einst ein Managementtrainer an. Damals war ich mir nicht sicher, wie er dies meinte. Zehn Jahre später und um diverse Erfahrungen reicher, bin ich fest davon überzeugt: Große Unternehmen fördern das Jeder-gegen-jeden – allein durch ihre Größe. Sie sind Demokratien ohne Gesetzbücher und ohne dauerhafte Regierung. Sie können weder feste Regeln noch Kontinuität bieten und verhindern deshalb Identität. Sie locken charakterliche Wendehälse an, Opportunisten, die sich schnell auf unterschiedliche Strömungen einstellen können. Sie dürfen sich im Zweifel nicht allzu sehr durch feste eigene Wertvorstellungen aufhalten lassen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Langfristig töten große Unternehmen die Leistungsbereitschaft des Einzelnen, sie lassen Starrsinn wachsen. Sich regelmäßig wiederholende Personal-Abbaumaßnahmen legen das Fundament zu einem dauerhaften Überlebenskampf, der Mitarbeiter geradezu verführt, mit Guerilla-Methoden um den eigenen Stand und Status zu kämpfen.
Warum das System „großes Unternehmen“ vor allem dann nicht funktionieren kann, wenn es börsennotiert ist, möchte ich in diesem Kapitel erklären.
Zur Einstimmung eine kleine wahre Geschichte, die einerseits Normalität spiegelt, andererseits zeigt, wie mühelos selbst leitende Angestellte im großen Unternehmen ein egoistisches Eigenleben führen können.
Wir befinden uns in einem der größten und am stärksten wachsenden europäischen Konzerne. Es ist ein Tag wie jeder andere: Schon vor acht Uhr kleben gelbe, grüne und blaue Zettelchen an den Bildschirmrändern. Darauf stehen Arbeitsanweisungen für die Mitarbeiter von Herrn X. Die Mitarbeiter arbeiten Zettel für Zettel ab. Der Chef liest derweil wie jedenMorgen Zeitung, die Beine auf dem Tisch, er telefoniert privat. Zwischendurch besucht er das eine oder andere Meeting. Was dort besprochen wird, erfährt kein Mitarbeiter. Dieser Chef kennt nur Befehle. Abends kontrolliert er, ob alles erledigt ist. Er spricht kaum ein Wort mit den Mitarbeitern, lediglich „Warum geht das nicht?“ rutscht ihm zwischendurch einmal raus. Herr X, nennen wir ihn Post-It-Manager, besucht seit acht Jahren einmal im Jahr ein Führungskräftetraining. Er kennt die Methoden modernen Managements, er propagiert sie auch vor seinem Chef, aber selbst umsetzen will er sie lieber nicht. Er befürchtet, Macht und Privilegien zu verlieren, verrät er dem externen Führungskräftetrainer einmal unbedacht nach einem Glas Wein.
Führungskräftetrainings sind nichts anderes als gehobene Betriebsausflüge, das bestätigt auch ein Kollege von mir – er selbst führt diese Trainings seit zwei Jahrzehnten durch. Die Teilnehmer geben dem Trainer im Feedbackbogen gute Noten, wenn er sie angeregt unterhalten hat und sie im Nebenprogramm – abends im Restaurant und auf der Piste – bei Laune gehalten wurden. Da der Trainer im nächsten Jahr wiederkommen darf, wenn er überall „gut“ und „sehr gut“ bekommen hat, geht es auch ihm vor allem um eine gute Evaluierung. Anders ausgedrückt: Ihn interessiert eine hohe Zustimmungsquote. Und die kommt nicht von ungefähr, sondern entfaltet sich am besten vor dem Hintergrund einer besonders netten Atmosphäre.
Die Mitarbeiter des Post-It-Managers leiden nicht unter ihrem Chef. Er ist ihnen gleichgültig, sie nehmen ihn sowieso nicht ernst. „Der Chef“ ist jemand, der niemandem gerade in die Augen sieht. Offenheit macht ihm Angst; deshalb liebt er die kurzen Absprachen und Info-Gespräche auf dem dunklen Flur. Ihm ist völlig gleich, dass seine Sekretärin die Post der neuen Mitarbeiterin verschwinden lässt. Als diese ihn weinend darauf anspricht und um Hilfe bittet, murmelt er: „Macht das unter euch aus“. Es wundert in diesem Unternehmen niemanden, dass ein solcher Mann ohne Führungspersönlichkeit Chef werden konnte. Jeder weiß hier, dass es die Berufserfahrung in Jahren, die Lobbyarbeit und der Draht nach oben sind, die zählen. Gute Chefs gibt es auch; aber die sind Zufallsprodukte.
In einer anderen Abteilung desselben Unternehmens arbeitet ein Ingenieur, der mir stolz erzählt, dass er für seine immerhin 7 000 Euro Gehalt nur ein paar Planungen durchführen und ansonsten die Zeit bis 17 Uhr weitgehend unbehelligt von seinem Vorgesetzten absitzen würde. Er arbeitet in dem Unternehmen, weil es ihm maximale Sicherheit bei minimalem Einsatz bietet. Er behauptet feixend, nie arbeitslos werden zu können, und lästert über Menschen, die so dumm waren, das Falsche zu studieren. Geschichte zum Beispiel, wie ich. Unter Historikern herrsche eine Arbeitslosenquote von 30 Prozent, triumphiert er und meint, dass ich Glück gehabt hätte, einen Einstieg in einen Job gefunden zu haben, der sonst nur Betriebswirten vorbehalten ist.
Er hat durchaus Interesse am Erfolg seines Konzerns – so lange dieser Erfolg seinen persönlichen Frieden nicht stört und nicht zu mehr Arbeit verpflichtet.
Die Produktivität der Abteilung mit dem Post-It-Manager sei gering, verrät mir ein Controller, der mein Beratungskunde ist. Das fällt derzeit nicht auf, denn das Unternehmen schafft Arbeitsplätze. Manche Leute, so der Controller, schleppe man einfach mit. Die Gewinne sind groß und die Aktionäre zufrieden. Dass die Kommunikation in einigen Abteilungen lausig ist, manche Manager grausig, die Abläufe stümperhaft sind, dass Arbeiten doppelt und dreifach verrichtet werden – dies und auch die Geldverschwendung interessiert nur sehr wenige, meist Zeitarbeiter, die sich als Zweite-Klasse-Angestellten begreifen, die Erste Klasse arbeiten müssen. Sie sehen wie jeder gegen den anderen agiert, dabei Geld, Zeit und Energie verschwendet wird, schütteln den Kopf und schweigen in Sorge um ihre eigene Übernahme und das, was im Zeugnis stehen wird.
Zu gut geht es jedem Einzelnen in seinem Mikrokosmos, zu leicht ertragbar sind die Unzulänglichkeiten der Chefs, zu ungemütlich scheinen die Welt und die Jobs da draußen. Das stumpft ab; was interessieren einen da noch die anderen? Unternehmensziele – wie bitte? Der Klassenkampf tobt noch nicht; es ist eine Vorstufe.
Zu groß für unser Großhirn
Die wahre Geschichte vom Post-It-Manager ist ein typisches, sehr normales und unspektakuläres Beispiel für Geschehnisse und Führungsstile, die in großen Unternehmen fast zwangsläufig und in kleinen Unternehmen bei schlechter Firmenleitung an der Tagesordnung sind. Und mir geht es zunächst um die normal-banalen Zustände des Unternehmensalltags, denn dort keimt das „Jeder-gegen-jeden“.
Normal und banal ist unter anderem das: Es entstehen individuelle Einflussbereiche, bündeln sich persönliche Interessengebiete, erheben sich Inseln im Unternehmensmeer. Das Unternehmen wird so nach und nach ein unübersichtliches und deshalb nicht mehr zu kontrollierendes Gebilde. Irgendwann ist es ein gewachsener Mikrokosmos, in dem verschiedene Evolutionsstufen aufeinandertreffen: alte Bereiche und sehr junge, fortschrittliche und rückständige. Ein Artenreichtum, geprägt von verschiedenen Herrschafts- und auch historischen Epochen, wechselnden unternehmerischen Zielsetzungen, individuellen Vorstellungen der Führungskräfte und ganz sicher auch vom Zufall. Die Sünden der Vergangenheit prägen etablierte Unternehmen: Die Sünden, die in Phasen zu schnellen Wachstums begangen worden sind, als zu schnell und unbedacht eingestellt worden ist. Die Sünden des Abbaus, die Löcher in den Arbeitsabläufen hinterlassen und Wunden in der Seele.
Durch Fusionen wachsen große Unternehmen zuerst, bevor sie schrumpfen. Sie erhalten neue Schichten, die mit den alten zusammenwachsen sollen. Sie erben die Sünden, die verschiedene „Regentschaften“ unterschiedlicher Abteilungsleiter und Top-Manager hinterlassen haben. Deren Führungsstil schwankt mitunter in ein und demselben Unternehmen zwischen dem Terrorregime eines Ivan dem Schrecklichen, dem tapferen Edelmut eines Richard Löwenherz und der Dummheit eines König Midas. Ingesamt scheint es ein wenig so, als würden Steinzeit, Mittelalter und Moderne zeitgleich existieren.
Je größer ein Unternehmen, desto unübersichtlicher wird es. Niemand kann mehr in alle Ecken sehen. Aus genau diesem Grund können ganze Abteilungen gut in diesen Ecken verschwinden. Das macht es einem Kapitän schwer, das Schiff insgesamt in eine Richtung zu steuern. Wenn es in der einen Kabine brennt, sieht es der Kapitän vielleicht nicht. Die, die auf einem anderen Deck arbeiten, interessieren sich zudem nicht für das Deck unter oder über ihnen. Brände bleiben so durch ihren lokalen Charakter begrenzt. Defekte können schnell vertuscht werden. Es bilden sich Gruppen, Bünde und Gefüge, die viel stärker sind als das lose Band des Unternehmensnamens. Sie führen einen ewigen „Jeder-gegen-jeden“-Kampf um die im neuen Klassenkampf wichtigsten Besitztümer: um Macht und Einfluss, die aus dem Mehr-Wissen oder Mehr-zu-wissen-scheinen resultieren. Nur dies garantiert das Überleben auf dem Arbeitsmarkt. Nur diese verspricht den Sieg der Job-Besitzer über die jetzt schon oder künftig arbeitslose Klasse.
Da mit der Größe des Unternehmens auch die Distanz der einzelnen Mitarbeiter zueinander steigt, wächst in guten Zeiten Gleichgültigkeit, in schlechten aber auch die Härte der „Jeder-gegen-jeden“-Auseinandersetzung mit der Zahl der Mitarbeiter. Aus dem Tierreich wissen Anthropologen, dass es einen Zusammenhang zwischen der entwicklungsgeschichtlich jungen Großhirnrinde und der Herdengröße gibt. So hat der britische Wissenschaftler Robin Dunbar festgestellt, dass Säugetiere in Verbünden leben, die dem Volumen ihres Großhirns ganz genau entsprechen. Je kleiner es ist, desto kleiner ist die Herde; je größer – desto größer.
Die natürliche Größe einer „menschlichen Herde“ liegt laut Dunbar bei 148,4 Exemplaren Mensch. Afrikanische Dorfgemeinschaften und australische Ureinwohner leben oft in Einheiten von nicht mehr als 150 Personen zusammen. In größeren Verbünden lässt sich das soziale Gefüge nicht auf natürliche Art und Weise aufrechterhalten, Hierarchien müssen eingezogen werden und für Ordnung sorgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Chaos entsteht und das soziale Gefüge auseinander bricht, wächst. Die daraus ableitbare These: Das Sozialleben in Unternehmen, die eine bestimmte Größe überschreiten, ist aus rein biologischem Blickwinkel betrachtet gefährdet. Die Wahrscheinlichkeit einer Störung steigt analog zur Größe.
Die Forschungsergebnisse von Robin Dunbar hat die Boston Consulting Group für ihre Zwecke entdeckt: Eine Zusammenfassung seiner Ergebnisse findet sich auf den US-amerikanischen Strategieseiten des Beratungsunternehmens im Web. Dass die Unternehmensberatung diese in ihre praktische Arbeit einbezieht, mochte die Deutschlandfiliale von BCG allerdings nicht bestätigen.
Unabhängig von diesen Erkenntnissen besteht weltweit schon seit langem ein Trend, große in kleine Einheiten zu zerlegen. So spalten sich die meisten Unternehmen in organisatorische Selbstverwaltungseinheiten, so genannte Profit Center, die ökonomisch besser kontrollierbar sind. Was für das kleine soziale Gefüge ein Vorteil ist, ist teilweise ein Nachteil für das Unternehmen insgesamt. Die zahlreichen Überschneidungen, die durch die Ansprache oft gleicher Kundengruppen logische Konsequenz ist, erhöht parallel zum internen Zusammenhalt den Konkurrenzdruck mit den anderen Sparten. Trotz der dezentralen Organisation sind Unternehmen gezwungen, als Gesamtorganisationen zu handeln – ein ewiger Widerspruch.
Ob mit Sparten und Profit Centern oder ohne: Konzerne überschreiten die natürliche Herdengröße regelmäßig bei weitem, soziale Gefüge driften auch deshalb mehr als anderswo auseinander. Kein Wunder also, dass sich in fast jedem größeren Unternehmen krasse Missstände zeigen und sich über kurz oder lang sogar kriminelle Gruppen bilden.
Individuelle Gruppenregeln – Voraussetzung für kriminelles Verhalten
Korruptions- und Schmiergeldinseln in den Konzernen und großen Unternehmen entstehen durch den Zusammenschluss von sozialen oder bei diesem Beispiel vielleicht treffender „asozialen“ Gruppen. Karstadt, BMW, Intel, sogar Siemens – kaum ein größeres Unternehmen blieb von den korrupten Gruppierungen der White-Collar-Kriminellen4 vorschont, die sich oft an der Geschäftsführung vorbei abteilungs- und manchmal sogar hierarchieübergreifend bilden.
Die Ermittlungen im Fall Ikea betrafen zuletzt 30 Verdächtige, die im Jahr 2005 Gelder in Millionenhöhe veruntreut haben sollen. Der Fall zeigt eben auch, dass die Mittelstandsregel „wie der Herr so sein G‘scherr“ in den Großfirmen nicht die einzige zentrale Losung ist und als Erklärungsmodell für Missstände nicht ausreicht. Ikeas Gründer und Inhaber Ingvar Kamprad hat das schlitzohrige Sparen und den Geiz vorgelebt, nicht aber das Betrügen.
Klare Regeln, die Bestechung, Vorteilsnahme, Geldwäsche, Schmieren, Mobbing et cetera explizit und unmissverständlich untersagen, existieren laut meiner Recherche bei vielen Unternehmen nicht. Ein so deutlicher und unmissverständlicher Verhaltenskodex „Code of Conduct“ wie jener der Hypovereinsbank5 ist eine positive Ausnahme. Dass aber auch Regeln keine Rettung sind, zeigt beispielsweise der BMW-Konzern, der auch allerlei Schutzmechanismen eingebaut hat – Schmiergeld floss trotzdem. Damit kalkulieren Unternehmen. „Zu 100 Prozent wasserdicht werden Sie solch ein System nie bekommen“, sagte Audi-Finanzchef Stadler in der Financial Times Deutschland.6
Mit und erst recht ohne klare Vorgaben von oben verteilt sich Führung in den großen Unternehmen selbstständig und Regeln werden von Gruppen interpretiert und neu definiert. Schlimm und ein schlechtes Vorbild für alle anderen, wenn die individuelle Regelfindung schon auf der Vorstandsebene beginnt – doch leider ist genau das die Tagesordnung. Das beginnt bei scheinbaren Kleinigkeiten: So soll es absolut üblich sein, dass die normalen IT-Regularien für das Board nicht gelten. Das sind Regularien, die vorschreiben, was im IT-Bereich erlaubt und was – zum Beispiel auch aus Sicherheitsgründen – verboten ist. Aus diesem Grund existieren in vielen großen Unternehmen eigene Board-IT-Abteilungen, die sich nur um die speziellen Bedürfnisse der oberen Herren kümmern. Marschrichtung in fast allen diesen Konzernen: Realisiert, was die Herren wünschen, schaut dabei nicht auf Bestimmungen und kümmert euch nicht um das, was anderen untersagt ist.