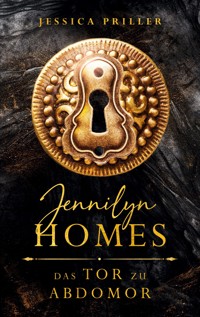
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: JENNILYN HOMES
- Sprache: Deutsch
Von einem Alltag voller Trübseligkeit und Armut, in ein gefährliches und anspruchsvolles Abenteuer zu rutschen, ist nicht gerade die Wendung, die der junge Diabar sich gewünscht hatte. Eine skrupellose Verfolgungsjagd katapultiert ihn in eine Welt, die weit weg von seinen Vorstellungen zu sein mag. Dunkle schattenartige Wesen lauern an allen Ecken und jeder von ihnen scheint es auf den Jungen abgesehen zu haben. Um diesem Mysterium auf den Grund zu gehen, benötigt er Unterstützung und das von einer Frau, die selbst keine Grenzen kennt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Täglich grüßt das Murmeltier
Das Haus der alten Dame
Gefühlschaos
Schlupfwinkel
Eine ungewöhnliche Begegnung
Schicksalsschlag
Zwischen Phiolen und Einmachgläsern
Der geheimnisvolle Korridor
Eine angeregte Unterhaltung
Die Wahrheit
Die verwahrloste Schenke
Ein unheilvolles Zusammentreffen
Die Rückkehr eines Verräters
Mitgehangen, Mitgefangen
Lasset die Spiele beginnen
Cedratha
Überkopf
Der geplante Hinterhalt
Ein rätselhafter Hinweis
Vergeben und Vergessen
Ein unerwünschtes Mitglied
Die Kraft des Giganten
Das Glitzern in der Dunkelheit
In letzter Sekunde
Der mysteriöse Eindringling
Wer nicht hören will, muss fühlen
Zur haarigen Kralle
Eine neue Spur
Wie gewonnen, so zerronnen
Zwei auf einen Streich
Geschwisterliebe
Ein Ort, der alle Türen öffnet
Eine Hand, wäscht die andere
Der letzte Hoffnungsschimmer
Im Schatten des Lichts
Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere
Spieglein, Spieglein
Sinneswandel
Die Qual der Wahl
Ein schleifendes Geräusch riss den zerlumpten Mann, der dort inmitten jenes Durchganges weilte, aus seinen Gedanken,
Schritte, so leise wie die schleichenden Schatten, die ihn begleiteten, ertönten in der Ewigkeit der Finsternis,
Er öffnete die Augen, als das Rasseln in der Fern von Sekunde Zu Sekunde lauter wurde,
»Es wird Zeit Meister. «
Er drehte sich um,
»Das Flüstern der Dunkelheit ist schon ganz nah.«
Täglich grüßt das Murmeltier
ES WAR WIEDER EINMAL ein trostloser Tag, an dem der junge Diabar abwesend und in Gedanken versunken am Esstisch saß. Den Kopf hielt er auf seinen Arm gestützt während ihm die Sonnenstrahlen, welche durch die Jalousien des Küchenfensters hindurchbrachen, bei seinem traurigen Frühstück Gesellschaft leisteten.
Schon seit einer halben Stunde versuchte er den ungenießbaren Haferbrei unter sich anzurühren. Mit angespannten Gliedern und ohne zu blinzeln hielt er seinen starren Blick darauf gerichtet, doch obwohl sein Magenknurren ihn unerträglich quälte, gelang es ihm nicht. Stattdessen schlug er mit dem Löffel taktvoll gegen die Porzellanschüssel, was ihm den Start in den Tag nicht gerade schmackhaft machte.
Da er es nach weiteren Anläufen nicht zustande brachte, gab er auf und schmetterte grummelnd das Besteck auf die Tischplatte. Der klapprige Stuhl, welcher unerklärlicherweise noch stand, knarzte, als er sich erhob und auf die Küchentheke zusteuerte. Sein Bauch rebellierte erneut, was ihm etwas Hoffnung auf einen Happen aus dem Kühlschrank machte. Ungeduldig öffnete er die Tür, doch der Inhalt, der ihn dort erwartete, stürzte diesen Lichtblick in tiefste Finsternis.
Die grelle Neonröhre flackerte, während er enttäuscht auf die Regale glotzte, die bloß seine hagere Gestalt widerspiegelten.
Einen halb verrotteten Apfel, eine Dose Thunfisch, einen Liter abgelaufene Milch und eine tote Fliege in der Ecke konnte er ausmachen, was ihm jedoch nicht vielversprechend vorkam. Insbesondere, wenn ihn die Not nach etwas Essbarem in den Wahnsinn trieb.
»Wie sollte es auch anders sein?«, dachte er sich, wandte den Blick von diesem traurigen Schauspiel ab und stapfte in dem Apartment herum.
Jeden Morgen dasselbe Spiel.
Ein metallischer Knall erregte die Aufmerksamkeit des Jungen, wobei er zu der Standuhr in der Ecke des Raumes hinüber stierte. Obwohl das Pendel aufgrund der verrosteten Zahnräder keine Kraft mehr zum Schwingen besaß, konnte sie dafür tadellos singen, worauf Diabar hingegen verzichten würde.
Schon seit Anbeginn ihres Einzuges fragte er sich, warum sie dieses potthässliche Stück überhaupt behalten hatten, da es in der Wohnung keinen Platz dafür gab. Sie wirkte viel zu kitschig mit den goldenen Ranken, die sich um das protzige Uhrwerk schlängelten und dennoch war es das wertvollste Stück, das sie besaßen.
Er zuckte zusammen, als der Zeiger in diesem Augenblick auf kurz vor neun Uhr sprang, was bedeutete, dass seine Mutter bald von der Arbeit kommen würde. Flüchtig spielte er mit dem Gedanken, dass sie ihm eine Kleinigkeit vom Bäcker nebenan mitgebracht hätte, doch diese Vermutung verwarf er sofort wieder. Er nahm es ihr nicht übel, denn mit ihren zwei unterbezahlten Jobs schaffte sie es, gerade einmal so, die beiden über die Runden zu bringen. Dabei gehörte der Kampf mit dem täglichen Hunger für ihn quasi dazu.
Um ihr wenigstens so ein wenig unter die Arme zu greifen, schnappte er sich die Schüssel, versenkte sie in der Spüle und versuchte die Räumlichkeiten in Schuss zu bringen. Sein erster Weg führte ihn dabei zur Haustür, um dort die tägliche Post abzuholen. Pünktlich kamen ihm die vielen Umschläge aus dem Schlitz entgegen geflattert, welche er geschickt auffing und zurück in die Wohnküche brachte.
Die zerfledderte Ledercouch heulte unsäglich auf, als er sich darauf niederließ. Mit besorgten Blicken überflog er die rot unterzeichneten Briefe, die an seine Mutter adressiert waren. Wenig überrascht wusste er, was diese bedeuteten und selbst wenn sie jedes Mal eine Ausrede dafür fand, konnte Diabar eins und eins zusammenzählen. Mit seinen vierzehn Jahren war er Schlussendlich kein Kind mehr, egal wie sehr er es sich wünschte. Denn damals erschien ihm die Welt noch erfreulich und unkompliziert, ohne diese Sorgen und Ängste, die heute zu seinem traurigen Alltag geworden sind.
Das Rasseln des Schlüsselbundes an der Haustür hob Diabar unmittelbar aus dem Sitz. Fast wäre er über seine ausgeleierte Hose gestolpert, als er die Briefe, so schnell es ging, wieder vor der Tür platzierte. Er wollte nicht, dass sie von seinen Befürchtungen Wind bekam, da sie bereits genug um die Ohren hatte.
»Ich bin zuhause, Diabar!«, tönte jene gebrochene Stimme durch das Apartment, während seine Mutter ausgelaugt und vollbepackt in den Hausflur trat. Wie immer sah sie furchtbar aus. Die lockig braunen Haare, welche sie zu einem Zopf gebunden hatte, standen in allen Richtungen von ihrem Kopf ab. Die Augenringe reichten ihr bis zu den Wangenknochen hinunter, wobei die verlaufene Schminke sie noch erschöpfter aussehen ließ, als sie es schon war.
Der Junge schüttelte den Kopf, während ihr die Tasche von den Schultern glitt und sie sich hektisch die Kochschürze auszog. Scheinbar hatte sie nicht einmal die Zeit gefunden, ihre Arbeitskleidung abzulegen, doch er riss sich zusammen und schluckte seine Beanstandung hinunter. Wie oft hatte er sie schon dazu ermutigt, sich nicht alles gefallen zu lassen, aber sie wollte es nicht wahrhaben.
»Wenn es nur nicht ums Geld ginge«, meinte sie ständig, doch das glaubte er ihr nicht. Denn wenn es so wäre, müsste er sich nicht Tag für Tag durch diesen Teufelskreis quälen.
»Na los, auf was wartest du, wir sind schon spät dran!«, erinnerte sie ihn und er zwängte sich widerwillig in seine enge Jacke hinein. Während er sich die zertretenen Schuhe band, entging es ihm nicht, wie sie sich die Briefe schnappte und ohne einen Blick darauf zu werfen in den Kamin schleuderte. Sein kratziges Räuspern sollte sie auf die Mahnungen aufmerksam machen, aber das bekam seine Mutter nicht mehr mit, da sie ohne Weiteres im Treppenhaus verschwand. Mit einem letzten Seufzer schloss Diabar die Tür und konnte diesem grauenhaften Ort zum Glück für ein paar wenige Stunden entfliehen.
Grelle Sonnenstrahlen blendeten den armen Jungen, als sie auf die alte befahrene Straße hinaustraten. Obwohl seine Haare das Licht etwas abschirmten, brauchten seine Augen eine Weile, um sich daran zu gewöhnen. Seine Mutter hingegen hatte keine Zeit, um darauf Rücksicht zu nehmen und zog ihn deshalb am Ärmel im Eilschntt hinter sich her. Sehr zum Nachteil seines Pullis, der, aufgrund seines Alters, bereits genug ausgeleiert war.
Auch wenn Diabar alles andere lieber wollte als in dem Apartment zu versauern, verbesserte das Stadtgeschehen seine miese Laune nicht.
Er stolperte zurück, da ihn das schiefe Geplärre der angetrunkenen Straßenmusikanten, die sie passierten, beinahe zu Tode erschreckte. Es war laut. Fast schon zu laut für ihn, denn diese unterschiedlichen Geräusche benebelten seine Sinne. Selbst das Atmen fiel ihm schwer, da die vielen Abgase der Fabriken die Luft unerträglich verpesteten. Der kraftvolle Zugwind der vorbeifahrenden Autos jagte ihm stets einen Schauer über den Rücken und behinderte ihn umso mehr. Dazu kamen noch die gehäuften Müllberge am Rand des Gehweges, deren Spuren bis in die zugebaute Kleinstadt führten.
Puros war seiner Auffassung nach ein sonderbarer Ort.
Unordentlich, penetrant und befremdlich würde es dabei am besten beschreiben. Das Wetter gab sich zwar beständig, doch dafür bereitete ihm jener tobende Verkehr Kopfschmerzen. Auch die Menschen, die hier lebten, verhielten sich alle auf ihre eigene Art und Weise ungewöhnlich. Kein Wunder also, dass er ihr dabei unfreiwillig hinterher trottete.
Der kurze, genervte Seufzer seiner Mutter brachte ihn wieder dazu, mit ihr Schntt zu halten. Obwohl sie schon genug von ihrer Müdigkeit geplagt wurde, musste sie sich mit der geistigen Abwesenheit ihres Sohnes herumschlagen, was ihr in Momenten wie diesen so gar nicht zusagte. Ständig stolperte er ihr nach, blieb an ungünstigen Stellen stehen und machte ihr das Vorankommen deutlich schwerer. Sein Verhalten zerrte an ihren Nerven, und das blieb keinesfalls unbemerkt.
Spitze Fingernägel gruben sich durch Stoff hindurch, was Diabar die Zähne zusammenbeißen ließ. Dies brachte ihn jedoch schon zur Weißglut. Jedes Mal war es dasselbe Prozedere: Sie schrie und es blieb ihm nichts anderes übrig als die kritisierenden Blicke der Passanten hinzunehmen. Es war ihm peinlich, immer wie ein Hund an der Leine durch die Gassen gezogen zu werden, doch egal wie sehr er sich dagegen sträubte, es blieb ihm nichts anderes übrig
»Mach schon, Tante Imelda wartet nicht gern!« Grummelnd verdrehte Diabar die Augen. Wie oft hatte seine Mutter ihm diesen Satz an den Kopf geworfen.
Es verging kein einziger Tag an dem er pünktlich durch die alte morsche Tür in das kleine Häuschen am Stadtrand trat. Das lag jedoch nicht daran, dass er auf dem Weg dorthin gerne trödelte, sondern eher an den unregelmäßigen Arbeitsstunden seiner Mutter. Ihn dabei mit dem Bus in die naheliegende Schule zu bringen, wäre doch so viel bequemer für beide, aber sie bestand ausnahmslos darauf, ihn privat unterrichten zu lassen. Jedoch nicht, weil es für seine Aufmerksamkeits schwäche das Beste war, sondern weil sie es sich nicht leisten konnte. Dabei kam ihr die gratis Ausbildung und zusätzliche Tagesbetreuung wesentlich günstiger, was Diabar überhaupt nicht glücklich machte. Das Einzige, was der Junge brauchte, waren soziale Kontakte, mit denen er endlich dieser Einsamkeit entfliehen könnte.
Das Haus der alten Dame
TANTE IMELDA, WIE SEINE Mutter sie liebevoll nannte, war eine gebrechliche, vergessliche Frau. Zwar kannte Diabar sie schon seit seinem dritten Lebensjahr, jedoch sträubten sich seine Nackenhaare stets, wenn er seinen Tag bei ihr verbringen musste.
Er sah sie vor sich, wie sie jeden Vormittag in ihrer Küche umherirrte und völlig verzweifelt nach etwas Ausschau hielt, was niemals dagewesen war. In ihren weißen langen Haaren, welche sie immer zu einem Knoten band, klebten allerlei Speisereste, wobei er es sich zum Hobby gemacht hatte, dadurch das anstehende Mittagessen zu erraten. Die wuchtige Brille auf ihrer Nase vergrößerte ihre milchigen Augen um das Doppelte, was Diabar oft Angst einjagte. Noch dazu trug sie Morgen für Morgen dasselbe zu kurze Kleid, das ihre mit Krampfadern übersäten Beine unschön in Szene setzte.
Trotz allem versorgte sie ihn seit einigen Jahren dementsprechend gut, dass er sich im Großen und Ganzen nicht beschweren durfte.
Das bescheidene Häuschen der alten Frau war bereits von Weitem kaum zu übersehen. Gewaltige Efeuranken, so dick wie die Stämme von Bäumen, schlängelten sich an der Hausmauer bis zum Dach hinauf. Seitdem Tante Imeldas Mann vor einigen Jahren verstorben war, hatte sie ihre Leidenschaft für die Botanik entdeckt.
Einerseits freute sich der Junge, dass sie etwas gefunden hatte, um die ewige Zeit totzuschlagen, doch seit Kurzem schien sie es zu übertreiben. Denn nicht nur in ihrem Vorgarten sprossen jegliche Pflanzen in die Höhe, sondern auch im Inneren des Hauses. Das Wohnzimmer, in dem er die meiste Zeit verbrachte, war zu einem undurchschaubaren Urwald mutiert. Es fühlte sich so an, als würde er jeden Tag an einer Expedition im Regenwald teilnehmen, wo er sich hindurchkämpfen musste. Aber von den Dornen, in denen er sich ständig verhedderte und den großen Blättern, die ihm dabei ins Gesicht klatschten, hatte er die Nase voll.
Das rostige Gartentor quietschte, als Mutter und Sohn sich durch das Gestrüpp rangen, um die Treppen zur Veranda hinaufzusteigen. Mit der Faust klopfte sie hurtig an die Tür, worauf die alte Frau ihnen unverzüglich öffnete. »Magnolia, meine Teure!«, prustete sie mit ihrer gebrechlichen Stimme los, während seine Mutter versuchte, ihr em warmes, begrüßendes Lächeln zu schenken.
Tante Imeldas Blick fiel sofort auf den Jungen, dessen Eintreffen sie bereits entgegengefiebert hatte. Mit ihren knochigen Fingern quetschte sie seine linke Wange, wobei er sich zusammenreißen musste, um ihre Hand nicht wegzuschlagen. Er hasste es, wenn sie das tat, doch er ließ es über sich ergehen. Seiner Mutter zuliebe.
»In sechs Stunden komme ich ihn wieder abholen«, gab Magnolia kurz und prägnant von sich, um währenddessen hektisch in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel zu graben.
»Willst du uns nicht für eine Weile Gesellschaft leisten? Das Essen reicht für mehr als zwei!«, versuchte sie seine Mutter zu überzeugen, doch zu Diabars Bedauern, schüttelte sie den Kopf.
»Nein, vielen Dank, ich habe es eilig. Ein anderes Mal, ja?«
Tante Imelda setzte zu einem Widerspruch an, aber sie ließ sich davon nicht beirren und wandte ihnen den Rücken zu. Kurz winkte sie den beiden noch nach, als sie sich auf den Weg machte und den Jungen widerwillig in die Obhut der alten Dame übergab.
Die Zeit bei Tante Imelda verging relativ schnell. Auf den Unterricht hatte sie völlig vergessen, da sie eine gefühlte Ewigkeit auf der Suche nach ihrer Lesebrille war.
Diabar wusste, dass sie diese schon die ganze Zeit über ihrer Nase trug, aber er beließ es dabei, da er froh darüber war, nicht zum x-tausendsten Mal dieselbe Matheaufgabe zu lösen.
Hoffnungslos gab sie schließlich auf und musste sich erst einmal von diesem Ereignis erholen, weswegen sie nach dem Mittagessen ein zweistündiges Schläfchen hielt. Sehr zum Vorteil des Jungen, der die restlichen Stunden ungestört auf dem Fernseher ein paar Cartoons schauen konnte. Ein wahrer Luxus für ihn, da das alte Gerät von zuhause seit langer Zeit verkauft werden musste.
Die hörbaren Selbstgespräche seiner Mutter ereilten ihn schon lange, bevor sie an die Tür hämmern konnte, wobei er sich vorweg in Jacke und Schuhe warf.
»Willst du dich nicht von ihr verabschieden?«, hakte sie nach und deutete auf den schlafenden Leib der alten Frau. Diabar, der bereits das Gartentor erreicht hatte, schüttelte auf ihre Frage bloß den Kopf. Es schlicht und einfach so zu belassen, wäre für alle Beteiligten das Beste. Außerdem würde sie sich nach ihrem Erwachen sowieso an nichts mehr erinnern.
Der Weg zurück ins Apartment brachte den beiden zum Glück keine Unannehmlichkeiten, doch auch wenn es im ersten Moment beschaulich zuging, zerstörte das Klingeln ihres Telefons den angenehmen Frieden.
Mit zitternden Händen fasste seine Mutter in die Tasche, wobei durch den Blick auf das Display jegliche Farbe aus ihrem Gesicht wich. Ihre Reaktion blieb bei dem Jungen nicht unbemerkt, doch bevor er sie darauf ansprechen konnte, lehnte sie den Anruf ab und schenkte ihm ein falsches Lächeln.
»Oh, fast hätte ich es vergessen!«, hob sie plötzlich ihre Stimme und schob Diabar in Richtung Küche. Leicht irritiert nahm der Junge am runden Eichentisch Platz, wie eine Mutter ein Plastikgeschirr in die Mikrowelle legte. Erfreut darüber, dass sie ihm ein Abendessen zur Verfügung stellte, schnappte er sich das Besteck aus einer der Küchenschubladen. Selbst wenn es nicht das nahrhafteste Mahl werden würde, war er froh, zumindest seinen beißenden Hunger stillen zu können.
Grinsend kehrte er zurück, aber jenes nervtötende Gebimmel ließ den Glücks schimmer in seinen Augen erlöschen. Emeut war ihr die Angst ins Gesicht geschrieben und Diabar ahnte, dass mehr als nur ein kleines Problem dahintersteckte.
Dieses Mal unterdrückte sie die Nummer jedoch nicht und verschwand stattdessen im Badezimmer. Er brauchte ihr dabei nicht zu folgen, denn das angespannte Gewimmer erreichte ihn auch von diesem Standort aus.
»Ich weiß, es tut mir leid«, hörte er ihre bebende Stimme, in der sich deutlich die Panik und Ratlosigkeit abzeichnete. »Ich werde die Schulden begleichen, sobald ich kann. Machen Sie sich keine Sorgen!«
Diabar jagte es einen kalten Schauer über den Rücken, während er all dies zu hören bekam. Er ballte seine Hände zu Fäusten, worauf sogar seine Fingerknöchel weiß wurden. Am liebsten würde er sich die Ohren zuhalten, aber was sollte es ihm schon bringen? Er war genauso in diese ganze Sache verwickelt, ob sie es nun zugeben wollte oder nicht.
Das Gespräch endete mit einem Knall und sie kam schweigend zurück in die Wohnküche. Ihre Augen wirkten geröttet und die Nase triefte, wobei der Junge sofort wusste, dass sie ihre Tränen unterdrückte.
Die Mikrowelle sprang auf und seine Mutter servierte ihm das Gericht, bevor sie sich zu ihm gesellte. Als Diabar den halbwarmen Auflauf vor sich liegen sah, verging ihm der Appetit und er verschränkte seufzend die Arme vor der Brust. Dies war jedoch nicht der einzige Grund, warum er das Essen nicht anrühren wollte. Es gab noch etwas anderes, was ihm schwer im Magen lag und selbst wenn er es die ganze Zeit über schon versucht hatte, konnte er sich nicht mehr zurückhalten.
»Wer hat dich angerufen?« Seme Mutter verschluckte sich fast an ihrem Kaffee, als er ihr diese Frage in einem besorgten Tonfall stellte.
»Ach niemand!«, kam es wie aus der Pistole geschossen, was den Jungen die Stirn runzeln ließ.
»Eine Arbeitskollegin hat mich gebeten, ein paar Stunden für sie einzuspringen. Nichts weiter.«
Diabars Griff um die Gabel wurde fester. Wie lange wollte sie ihn noch anlügen?
Schnaufend sah er zu ihr hinüber, wie sie dort zusammengekauert auf dem Stuhl lehnte. Ihre Lider waren geschlossen und sie döste so unschuldig dahin, dass der Zorn im Inneren des Jungen Stück für Stück wieder abklang. Was brachte es ihm schon, sich darüber zu beschweren, denn er wusste es ja selbst nicht zu ändern.
Noch eine ganze Weile beobachtete er sie, wie sie friedlich am Esstisch schlief, obwohl er erkannte, dass dem nicht so war. Auch wenn er dieser Realität nicht entfliehen konnte, träumte er zumindest von einem normalen Leben, indem sie sich eines Tages sorgenfrei gegenüberstehen würden.
Gefühlschaos
DER NÄCHSTE MORGEN BEGANN leider ebenso deprimierend, wie auch der letzte. Seine Mutter war längst zur Arbeit aufgebrochen, als Diabar aus seinem unruhigen Schlaf erwachte. Der problematische Anruf von gestern Abend hatte ihn die ganze Nacht über begleitet, worauf er müde und erschöpft in die verwüstete Küche gestolpert kam.
Wie immer stand der verkochte Haferbrei auf dem Tisch, doch an diesem Morgen machte er sich nicht einmal die Mühe, auf das Hungerspiel einzusteigen.
Ohne einen Blick darauf zu werfen, entsorgte er den ungenießbaren Fraß und erwischte den Postboten an der Tür, der ihm diesmal die Briefe persönlich übergab.
Er zögerte kurz, als er den Stapel an Umschlägen in seinen Händen umherjonglierte. Nervös knabberte er an seiner Unterlippe und kämpfte gegen den Drang an, die Mahnbriefe aufzureißen. Er fuhr herum und starrte dabei auf die tickende Standuhr, die ihm noch genug Zeit versprach, bis er sich auf den Weg zu Tante Imelda machen musste.
Nach dem gestrigen Gespräch brannte der Wunsch nach Klarheit in ihm. Jene Klarheit, die seine Mutter ihm nicht geben wollte.
Der Junge packte die Gelegenheit am Schopf, huschte in die Küche und machte sich daran, einen Umschlag nach dem anderen durchzugehen. So viele Namen und Adressen kreisten um seinen Kopf, wobei ihn der Schwindel überkam. Bei jeder Summe, welche in roter Tinte getränkt war, begann Diabars Herz schneller gegen seine Brust zu hämmern. Ein flaues Gefühl breitete sich in ihm aus und er konnte es gar nicht glauben. Er ahnte zwar, dass sie sich mit ihren Zahlungen im Rückstand befand, doch dieses Ausmaß an Schulden hätte er sich niemals erwartet.
Diabar schluckte und versuchte, nicht vom Stuhl zu fallen.
War das etwa der Beginn für ein Leben auf der Straße?
Mit ordentlicher Wucht schlug er auf den Tisch, was den Briefstapel zum Einsturz brachte. Ein Gemisch aus Panik, Angst und Wut durchflutete seinen Körper. Er wusste nicht, was er in diesem Moment davon halten sollte und vor allem:
Welche Erklärung hatte seine Mutter ihm für all das zu bieten?
Gedankenverloren sackte er auf dem Stuhl zusammen und ließ seinen Blick über die zerstreuten Dokumente gleiten, als ihm plötzlich etwas anderes ins Auge stach. Ein weiterer Brief, den er wohl übersehen haben musste.
Mit zittrigen Fingern fasste er nach dem weinroten Umschlag, auf dessen Briefrücken ein goldenes Wachssiegel gesetzt wurde. Verwundert hob der Junge eine Augenbraue, da er so etwas Außergewöhnliches noch nie zu Gesicht bekommen hatte.
Vorsichtig drehte er ihn um und versuchte, die geschwungene Handschrift zu entziffern:
»Empfänger: Magnolia Salvator.«
Den Namen seiner Mutter konnte er gerade noch erkennen, aber bei dem Absender fiel es ihm um einiges schwerer. Konzentriert zwängte er seine Augenlider zusammen, bis die verschnörkelten Buchstaben endlich einen Sinn ergaben:
»Sarastro A.«
Verwirrt legte Diabar den Kopf schief, weil ihm dieser Name kein bisschen bekannt vorkam. Da er vermutete, dass es sich um eine weitere Schuldensumme handelte, versuchte er das Siegel zu brechen, doch egal wie viel Kraft er auch aufwandte, es ließ sich nicht öffnen.
»Was zum...«, fluchte er ächzend, aber scheinbar klebte das Wachs so fest auf dem Umschlag, dass er es mit seinen mickrigen Armen nicht aufbekam. Nach ein paar weiteren Versuchen gab er schließlich auf und schmiss die Briefe allesamt in den Kaminofen. Er hatte es einfach schon satt, wobei es diese eine Mahnung auch nicht mehr ausmachte.
»Diabar!«
Aufgewühlt betrat seine Mutter das Apartment, doch er wagte es nicht, sie anzusehen. »Ich bin spät dran, na los, wir müssen uns beeilen!«
Der Junge reagierte nicht. Zu tief saß der Schmerz über ihre Lügen und die Geheimnisse, für die er noch nicht bereit war. Sie hingegen hatte keine Geduld und packte ihn am Handgelenk, um ihn danach unsanft aus der Wohnung zu zerren.
Gröber als es ihm lieb war, hetzte sie ihn durch die Gassen von Puros. Da er jedoch keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte, stolperte er ihr unbeholfen nach und ignorierte dabei alles, was um ihn herum geschah.
»Pass auf!«, ermahnte sie ihn mit erboster Stimmlage und zog ihn zurück, da er beinahe in einen Passanten gekracht wäre.
Als er auch noch knapp dem Lenkrad eines vorbeifahrenden Fahrrads entrang, riss seiner Mutter endgültig der Geduldsfaden.
Abrupt blieb sie stehen und hielt dem Jungen eine saftige Standpauke, doch er hörte sie nicht. Die Gedanken in seinem Kopf waren viel zu laut, um ihren Worten folgen zu können.
»Diabar, hörst du mir überhaupt zu? Ich habe keine Zeit für deine Spielchen!«
»Spielchen?« Seine rohe, mit Wut gefüllte Stimme übertönte alles, was in der Gegend Geräusche von sich gab. Es kam ihm so vor, als würde in diesem Moment die Zeit stehen bleiben. Der Motor der vielen Fahrzeuge war kaum wahrnehmbar während das schrille Hupen nur mehr in der Feme widerhallte.
»Du bist doch diejenige, die hier die Spielchen treibt!«
Knurrend riss er sich von ihr los, wodurch sie geschockt zurückwankte. Ihre müden Augen wurden unerwartet groß, da sie mit dieser Konfrontation scheinbar nicht gerechnet hatte.
»Wieviel Zeit bleibt uns noch?« Seme Mutter runzelte verwirrt die Stirn, als er diese Frage an sie achtete.
»Was meinst du damit?«
Er ballte die Hände zu Fäusten, da sie genau verstand, was er mit dieser Aussage meinte.
»Sie werfen uns raus, nicht wahr?« Sie schluckte und erhob den Kopf, um ihr ins Gesicht zu blicken. Die Verzweiflung in ihren Augen war dabei kaum zu übersehen, doch anstatt Mitleid mit ihr zu haben, verspürte der Junge nur mehr Wut. Jene Wut, die das Gefühlschaos in ihm hemmungslos zum Vorschein brachte.
»Ich weiß von den Briefen und von den Schulden, die du nicht begleichen kannst!«
Mit diesem Satz zwang er seine Mutter buchstäblich in die Knie. Ihr klagendes Winseln machte ihm weis, dass er definitiv einen wunden Punkt getroffen hatte. Zu diesen Angelegenheiten war sie ihm seit jeher ausgewichen, doch dieses Mal schaffte sie es nicht, ihre Emotionen vor ihm geheim zu halten.
»Du hast keine Ahnung wovon du da sprichst«, flüsterte sie mit gebrochener Stimme, doch Diabar gab dem keinesfalls nach, im Gegenteil: Er machte alles nur schlimmer.
»Ich habe genug von deinen Lügen und davon, dass du mich wie einen Hund an der Leine hinter dir herziehst!«
Diabars Zorn wurde selbst für ihn unfassbar. Er verlor die Kontrolle über sich, was seine Sinne taub werden ließ. Sein Körper bebte im Rausch dieser Gefühle, während sein schlechtes Gewissen mit jeder Sekunde mehr verblasste. »Vielleicht bin ich ohne dich auch besser dran!«, waren die letzten Worte, welche er an sie achtete, bevor er mit Tränen in den Augen davonstürmte.
Schlupfwinkel
»DIABAR!« HÖRTE ER DUMPF in der Ferne widerhallen, doch daran, sich umzudrehen, dachte der Junge nicht eine Sekunde.
Für ihn gab es keinen Halt mehr.
Ein verzweifeltes Schluchzen drang tief aus seiner Kehle und er ließ sich von seinen Gefühlen leiten. Seine Haare peitschten ihm ins Gesicht, während er keuchend um die Ecke bog.
»Hey!« schimpfte ein älterer Herr, als er ihn fast umrannte, doch er hatte keine Zeit, ihn um Verzeihung zu bitten.
»Diabar, bleib stehen!«
Die Stimme seiner Mutter ertönte abgeschwächt aus der Weite, was ihn jedoch nicht zum Abbremsen brachte. In kurzen Abständen warf er flüchtige Blicke über die Schulter, doch je weiter er kam, desto winziger wurde jene Gestalt hinter ihm. Seine Füße brannten wie ein loderndes Feuer. Er war es nicht gewohnt, so schnell zu laufen, was er unmittelbar zu spüren bekam.
Sein Brustkorb hob und senkte sich in einem unnatürlichen Tempo und die stechenden Schmerzen in seiner Seite vereinfachten es ihm nicht. Obwohl sein Körper die Grenzen seiner Kräfte erreichte, war dies noch lange kein Grund für ihn, das Handtuch zu werfen.
Die erdrückende Kleinstadt kam immer näher, doch er zog es vor, dort nicht das Weite zu suchen. Die Chance, von Wohnansässigen entdeckt zu werden, lag zu hoch, weswegen er sich etwas anderes überlegen musste.
Völlig außer Atem hielt er an. Mit der letzten Willenskraft, die in ihm schlummerte, versuchte der Junge nachzudenken.
Keuchend sah er sich um. Das Tor zur Stadt prangte vor ihm gewaltig in die Höhe und er suchte in Eile nach einem Unterschlupf.
»Diabar!«
Mit verzerrtem Gesichtsausdruck hielt er sich die Ohren zu, da der Ruf seiner besorgten Mutter ihm nicht weiterhalf. Er sah zurück und merkte erst jetzt, wie schnell sie ihn eingeholt hatte. Seine Beine fingen an zu zittern. Planlos irrte er durch die Gegend und wäre fast gegen ein fahrendes Auto geknallt, wenn sein Instinkt ihm nicht das Leben gerettet hätte.
Das grelle Hupen drängte ihn zurück auf den Gehweg, als er gegen eine, mit Lumpen bedeckte, Hauswand stieß. Nur dass diese Wand keine Wand war und er rücklings in einen dunklen Durchgang stürzte.
»Aua!« grummelte er, als er sich unter Schmerzen das Rückgrat rieb und einige Minuten lang verdutzt auf die alten Tücher starrte.
»Merkwürdig«, dachte er sich. Dieser Ort kam ihm bekannt vor, doch wo genau seine Annahme herkam, wollte ihm in diesem Augenblick nicht einfallen.
Diabar legte den Kopf schief und richtete seinen Blick nur auf diese mysteriöse Stelle vor ihm.
Er überlegte. Überlegte seiner Meinung nach zu lange, doch bevor er sich in seinen eigenen Gedanken verlor, kam ihm eine zündende Idee.
Schnaufend rappelte er sich auf und stolperte direkt auf den Lumpenfriedhof zu. Verborgen hinter einem dicken Laken, versteckte er sich in der Dunkelheit, sodass sie ihn bloß nicht finden würde.
Nur wenige Augenblicke später hörte er ihre dumpfen Schritte herbeistürmen, die vor dem großen Tor abrupt abklangen.
»Diabar!«
Ihre verzweifelte Stimmlage brachte sein Herz dazu, schneller zu schlagen.
Durch einen kleinen Schlitz hindurch beobachtete er sie, wie sie hilflos und aufgewühlt nach ihm suchte. Ihren Kopf wandte sie dabei hin und her, während er gegen die Versuchung ankämpfte, ihr nicht schuldbewusst in die Arme zu laufen.
Zu oft in seinem Dasein hatte er schon nachgegeben, doch jetzt wurde es endlich Zeit, das Blatt zu wenden.
Kurz bevor Diabar seine Fassung verlor, entfernte sich seine Mutter von seinem Versteck und verschwand schluchzend hinter den Häusern der Kleinstadt.
Ein erleichterter Seufzer kam ihm über die trockenen rissigen Lippen und er sank erschöpft zu Boden. Er raufte sich die Haare und jammerte in sich hinein.
Was hatte er bloß getan? War es eine gute Idee?
Könnte er ihr je wieder unter die Augen treten?
Mit seinem rechten Handrücken putzte er sich die Nase und sah an sich herab. Er erinnerte sich an den letzten Satz, den er an sie gewandt hatte:
»Vielleicht bin ich ohne dich auch besser dran!«
Eine Gänsehaut überkam seinen Leib, da seine eigenen Worte ihm selbst Angst einjagten.
Er hatte es nicht so gemeint oder?
Ungeschickt rappelte er sich auf, doch bevor er aus seinem Versteck stürzen konnte, fiel es ihm wieder ein.
Nein, er wollte dieses elende Leben auf keinen Fall so weiterführen. Nicht, wenn ihm alle Türen noch offenstanden. Er war jung und jede Sekunde, die er so verbrachte, war eine zu viel.
Diabar drehte sich um. Vor lauter Aufregung hatte er die Größe des Durchganges gar nicht wahrgenommen, der sich bis in die Unendlichkeit erstreckte. Die Laterne neben ihm erhellte nur schwach die nassen Pflastersteine zu seinen Füßen, was ihm kaum einen Überblick gewährte.
Er machte einen Schritt zurück, da ihm diese Ungewissheit Angst einjagte, doch als der Stoff der Tücher seinen Rücken streifte, drängte ihn dieser Schreck ein paar Meter nach vorne.
Das Licht flackerte, während er daran vorbeischlich, doch zu seinem Glück zeigte sich eine weitere Lampe in der Feme, was ihn etwas beruhigte und neuen Mut schöpfen ließ.
Dunkle Schatten nahmen den mageren Leib des Jungen ein, da er immer tiefer in die verwinkelte Gasse vordrang.
Seine Schritte hallten dumpf in der trostlosen Leere wider und er wirkte überrascht, dass ihn sonst keine anderen Geräusche erreichten.
Er ließ seinen Blick durch die Gegend gleiten und blieb an ein paar Gesteinsruinen hängen, aus denen scheinbar ein Lager gebaut wurde.
Unmittelbar erstarrte er zu Eis.
Erst jetzt wurde dem Jungen klar, warum ihm jener Ort so bekannt vorkam.
Dieses Viertel wurde bewusst von den Bewohnern in Puros gemieden. Die Zwischengasse war die Heimat all jener Menschen, die sonst nirgendwo erwünscht waren. Obdachlose und Kleinverbrecher trieben hier ihr Unwesen, während der arme Junge sich in der Mitte dieses Schauplatzes befand.
Panisch riss er herum und hielt Ausschau nach jeder noch so kleinen Bewegung zwischen den Schatten, doch scheinbar war er alleine.
Denn auch, als er erneut Stein für Stein hinter sich ließ, kreuzte keine Menschenseele seinen Weg.
Diabar begann zu zittern. Er schlang seine mickrigen Arme um seine Gestalt, da es ihn ordentlich fröstelte. Kleine Wölkchen traten bei jedem Atemzug aus seinem Mund und er fragte sich, wo diese plötzliche Kälte herkam.
Der Weg wurde länger und es gab kein Ende in Sicht. Das Licht der Laternen schwächte ab, wobei es nicht mehr lange dauerte, bis die Umrisse seiner Umgebung in Dunkelheit getaucht werden würden.
Ein unangenehmes Gefühl wanderte dabei durch seine Fingerspitzen.
Ob er vielleicht gar nicht hier sein durfte?
Bevor aber all seine Erwartungen mit einem Male verblassten, erreichte ihn doch ein Funken Hoffnung.
»Endlich!«, jubelte er, als er an die hinterste Laterne gelangte, die ihm eine neue unbekannte Pforte offenbarte.
Eine kleine schmale Abzweigung führte ihn an eine Kreuzung, die er in dieser Form noch nicht gesehen hatte.
Diabar rieb sich die Lider, als ein kräftiges Licht seine Augen schmerzhaft blendete.
Die leblosen Laternen, die ihn zuvor begleitet hatten, wurden durch große, wuchtige Fackeln ersetzt, welche an den Seiten des brüchigen Mauerwerks fast bis zur Decke reichten. Das Knistern des Feuers war wie Musik in seinen Ohren, da ihm endlich mehr, als nur seine Gedanken, Gesellschaft leisteten.
Beruhigt trat er näher an die hellbeleuchtete Kammer heran. Ein verfallener Torbogen, von dem nicht mehr viel übriggeblieben war, erregte dabei seine Aufmerksamkeit.
Der Junge legte den Kopf schief. Wahrlich fasziniert von diesem antiken Gemäuer, bewegte er seine Hand darauf zu, doch als sich das Gestein nach der kleinsten Berührung löste, zog er sie schnell wieder zurück.
So brüchig wie der Bogen war, musste er bestimmt hunderte von Jahren alt sein. Genauso wie der angrenzende Tunnel, der in die Tiefen der Finsternis führte.
Diabar wurde es etwas flau im Magen und er hob sein Haupt zu der mit Moos bedeckten Decke. Wenn dieser Ort so lange schon bestand, war es zu riskant, sich hier weiter aufzuhalten. Falls dieser Platz zum Einsturz kommen sollte, würde er es bestimmt nicht rechtzeitig hinausschaffen.
Eine Gänsehaut überkam den armen Jungen, wenn er daran dachte, lebendig begraben zu werden.
Aus diesem Grund setzte er seinem kleinen Abenteuer hiermit ein Ende und schlug den Weg zurück zum Ursprungsort ein.
Er zuckte mit den Schultern und hielt den Blick gesenkt, wahrend er den Laternen zum Ausgang folgte.
Seine Gedanken wanderten zu seiner Mutter, wobei das schlechte Gewissen ihn fürchterlich quälte.
In Wahrheit wollte er sie nicht so hart verurteilen, doch die ganzen Gefühle gegenüber ihren Lügen und Geheimnissen hatten ihn zur Weißglut gebracht. Erst jetzt fiel ihm auf, dass die Idee, einfach abzuhauen, völlig bescheuert gewesen war. Von seinen Problemen wegzulaufen hatte ihn noch nie weitergebracht, weswegen er sich sicher war, dass sie gemeinsam eine Lösung dafür finden würden.
Das grelle Licht der Sonne zeigte sich endlich zu seinen Füßen und er schien froh darüber zu sein.
Mit einem schwachen Grinsen im Gesicht hob er den Kopf und wollte gerade auf die Straße hinaustreten, als er gegen ein Hindernis stieß und folglich zu Fall kam.
Genervt rieb er sich den Hinterkopf und ärgerte sich über seine Tollpatschigkeit, bis er wieder auf die Beine kam.
Seufzend sah er auf und versuchte sich zu konzentrieren, als er plötzlich in zwei dunkle Augen starrte, die ihn finster musterten.
Eine ungewöhnliche Begegnung
DIABAR ERSTARRTE ZU EIS, denn er hatte sich getäuscht.
Das Sonnenlicht, das er glaubte gesehen zu haben, ging stattdessen von einer Öllampe aus, die von einer dicken behandschuhten Hand umschlungen wurde.
»Was soll das?« grunzte der Unbekannte, der dort mit seiner gewaltigen Größe in die Höhe ragte.
»Verzeihung...« brabbelte der Junge ihm mit gebrochener Stimme entgegen, da seine mächtige Statur ihm deutlich Angst einjagte.
Rasch versuchte er sich aufzurappeln, doch die dicke Pratze des Fremden war schneller und hob ihn ohne Probleme an seiner Kapuze hoch.
Diabas Hand wanderte unmittelbar an seinen Hals, da er verzweifelt nach Luft rang. Jegliche Farbe wich aus seinem Gesicht und er strampelte wie verrückt über dem Boden herum.
»B-b-bitte, r-r-r-runter!« hechelte er, doch sein Kampf mit dem Ersticken schien den stämmigen Mann sogar zu amüsieren.
Sem tiefes raues Gelächter hallte im gesamten Durchgang wider, wobei das Echo schmerzhaft an Diabars Trommelfell abprallte.
Ächzend heulte er auf, als der Unbekannte ihm die Lampe gegen seine Wange drückte und dabei näher herankam.
Das flackernde Licht erhellte die Fratze des Fremden, was Diabar das Herz in die Hose rutschen ließ.
Ein gekrauster, ungepflegter Bart nahm die Hälfte seines Gesichtes ein, darunter blitzten gelbliche Zähne hervor. Falten durchzogen wie tiefe Flüsse seine Haut und reichten von dem Stirnansatz bis zu seinen Augenwinkeln hinunter.
Die zerzausten schwarzen Haare standen ihm wild zu Berge, doch was ihn am meisten irritierte, war die riesige Narbe an seinem Kinn, die sich bis zur Brust hinunterschlängelte.
Der Fremde öffnete den Mund, wobei der faulige Geruch den armen Jungen fast ins Koma katapultierte.
»Du frecher Bengel wagst es mich...« weiter kam er jedoch nicht, da er ihm in diesem Moment direkt in die Augen starrte. Sein abrupter Sinneswandel ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren und er bekam einen Schweißausbruch.
Was wollte er bloß von ihm?
Die Furchen auf seiner Stirn wurden tiefer, umso länger er ihn mit seinem Blick durchlöcherte.
Er spürte, wie sich der Druck um die Kapuze verstärkte, wobei der Zorn seinen Körper zur Gänze eingenommen hatte.
»Du...« hörte er den Unbekannten nur mehr Knurren, was ihn in Verwirrung stürzte.
Kannte er etwa diesen Mann?
»Du!« wiederholte er zum zweiten Mal, viel lauter und furchteinflößender als zuvor.
Diabar duckte sich schützend weg, während er ausholte und knapp seinen Pranken entkam. Geschickt schüttelte er sich aus dem weiten Pulli heraus und kam mit den Knien auf dem Boden auf. Frische Luft gelang endlich wieder in seine Lunge und er rieb sich die Druckstelle an seiner Kehle.
Mit verschwommener Sicht blickte er zu dem Koloss auf.
Dieser gaffte verdattert auf das leere Kleidungsstück und war für einen Moment abgelenkt, was in dem Jungen blitzschnell den Überlebensinstinkt erweckte.
Ohne weiter Zeit zu verschwenden, nutzte er die Chance, rappelte sich auf und sprintete los.
Das laute Grummeln des Unbekannten trieb ihn noch schneller voran, wobei er wie der Wind über die Pflastersteine hinweg sauste.
Das Licht der Lampen zog wie Blitze an ihm vorbei, doch er hetzte ungebremst weiter.
»Komm her, Bürschchen!« Jene durchdringende Stimme traf ihn wie ein Nebelhorn und seine Schritte brachten den Boden zum Beben.
Diabar wankte bei dieser Erschütterung hm und her. Er sah über seine Schulter und erschrak, als er ihn auf sich zukommen sah.
Er war schnell. Viel zu schnell für den armen Jungen, was in ihm die Panik auslöste.
Das Flackern der letzten Laterne erinnerte ihn wieder an den Ort, den er vorgehabt hatte zu meiden, aber was blieb ihm denn groß übrig?
Erneut warf er einen Blick zurück. Der Unbekannte war ihm dicht auf den Fersen. In seinen Augen spiegelte sich der blanke Zorn wider, was Diabars Furcht vor ihm nur verstärkte.
Was wollte er denn nur von ihm?
Ohne zu zögern, spurtete er an den Fackeln vorbei, durchquerte den Bogen und stieg in den Tunnel hinein.
Feuchte Luft klatschte ihm ins Gesicht, wobei er über etliche Pfützen hinwegsprang. Das Licht verblasste, umso tiefer er vordrang, bis er nach kurzer Zeit von der Dunkelheit verschluckt wurde.
Er verlor die Orientierung, weswegen er sicherheitshalber stehen blieb und sich dicht an die kalte Mauer presste.
Gespannt hielt er die Luft an und lauschte.
Der Untergrund vibrierte nicht mehr und selbst das grollende Knurren des Fremden konnte er nicht ausfindig machen. Hörbar schlug das Herz bis zum Hals.
Ob er ihm wohl entflohen war?
Für eine ganze Weile stand er nun da. Mucksmäuschenstill und ohne den kleinsten Muskel zu bewegen.
Je mehr Minuten verstrichen, desto sicherer wurde er, dass der Unbekannte den Geist aufgegeben hatte.
Da er wusste, dass der einzige Ausweg auf der anderen Seite auf ihn wartete, versuchte er den Moment nicht zu lange hinauszuzögern.
Seine Hände zitterten, als er sich am Rand langsam entlang tastete. Die Wasserlachen zu seinen Füßen tränkten seine Schuhe, was ihm das Vorankommen ein wenig erschwerte. Bei jedem Meter, den er hinter sich ließ, hielt er kurz inne, doch der Koloss schien sich tatsächlich davongemacht zu haben.
Mit stets gespitzten Ohren und gekrümmter Haltung huschte er an den vielen Laternen vorbei. Geschickt wich er den Lichtstrahlen aus, doch selbst wenn sein Plan anfangs gar nicht so miserabel durchdacht war, hatte er diese Rechnung ohne den Unbekannten gemacht.
Kurz bevor der Junge den Ausgang erreichte, brachte ein lauter Knall ihn zu Fall.
Das Licht neben ihm erlosch und etliche Glassplitter regneten auf ihn ein. Verwirrt und nervös zugleich tastete er sich über den feuchten Boden, doch von dem Koloss fehlte jede Spur.
Nur dieses hämische, tiefe Gelächter, welches von allen Seiten auf ihn zukam, verriet ihm, dass er sich in seiner Nähe aufhielt.
»Habe ich dich!« Diabar winselte um sein Leben, als jene Hände nach seinen Beinen schnappten und ihn erneut in die Höhe rissen. Wie verrückt boxte er um sich, doch die Finsternis, die ihn umgab, ließ seine Treffer bloß im Nichts landen. Der Unbekannte hingegen belächelte seine jämmerlichen Versuche, drehte sich mit reichlich Schwung und schleuderte den Jungen von sich weg.
Mit einer unmenschlichen Geschwindigkeit raste er auf die Mauer zu und prallte mit seinem Rücken an der steinernen Oberfläche ab.
Ächzend kam er auf den Pflastersteinen auf. Seine Glieder schmerzten bei jeder Bewegung, während das Licht der angehenden Öllampe ihn direkt vor seiner Nase blendete. Kurz davor erhaschte er den Fremden, wie er mit einer seiner gewaltigen Pratze ausholte.
»Nein!« warf Diabar ein, als er sich hechelnd die Augen rieb, um seinen Angriffen auszuweichen.
»Sie verwechseln mich mit jemandem!« versuchte er ihn zu besänftigen. Der Mann hörte ihn nicht und setzte zu einem weiteren Schlag an, dem er hilflos ausgeliefert war.
Schützend warf er die Hände vors Gesicht, wobei die wenigen Augenblicke seines Lebens wie ein Film vor dem geistigen Auge vorbeizogen. Diabar schloss die Lider und wartete auf den entscheidenden Gong von oben, doch stattdessen erreichte ihn bloß ein heftiger Gegenwind.
Schicksalsschlag
»DIABAR!« DIE BESORGTE STIMME seiner Mutter löste seine Starre und sie schleifte ihn aus dem Angriffsfeld des Unbekannten.
Geschockt riss er herum und sah ihr in die rot unterlaufenen Augen. Sofort bereute er alles, was er ihr zuvor an den Kopf geworfen hatte, doch für eine Entschuldigung blieb keine Zeit.
»Wir müssen hier weg!«
Das verärgerte Grummeln des Giganten holte ihn in die Realität zurück. Seine Mutter umfasste seine Handgelenke und zog ihn auf die Beine. Ungeschickt stolperte er in ihre Arme und entglitt dabei knapp einem weiteren Schlag. Der verwirrte Junge heftete sich an ihre Jacke, als sie mit ihm zurück in den Durchgang stürmte.
»W-wer ist das?« stotterte er völlig entgeistert und sie folgten den Laternen.
Seine Mutter war jedoch zu konzentriert, um auf seine Fragen einzugehen, aber er gab nicht auf und konfrontierte sie weiter damit: »Du musst ihn doch gekannt haben, schließlich wusste er, wer ich bin, oder?«
Mittlerweile wusste Diabar nicht mehr, was er noch glauben sollte, wobei ihr Schweigen dies nicht gerade verständlicher machte.
Da er aber keine Ruhe geben wollte, brachte sie ihren Sohn vom Pfad ab und drückte ihn gegen die feuchte, kühle Wand des Durchgangs. Die vibrierenden Schritte des Kolosses kreuzten ihren Weg, wobei sie eine Hand auf seinen Mund legte, um ihn ruhig zu stellen.
Diabar ging es dabei gar nicht gut. Seme Knie brannten wie Feuer, wobei ihm die stechenden Schmerzen in seinen Schläfen die Tränen in die Augen trieben. Er jaulte durch ihre Finger hindurch, während sie ihn mit ihrem verängstigten Blick anflehte, unter allen Umständen leise zu sein.
Obwohl er ihr die Angst anmerkte, schien sie trotzdem nervenstark zu bleiben, was Diabar sichtlich verwunderte. Normalerweise war sie nicht der Typ dafür, in angespannten Situationen Ruhe zu bewahren, vorausgesetzt, sie ahnte in etwa, was hier vor sich ging.
Sie hatten Glück. Der Fremde verlor ihre Spur und als er außer Sichtweite war, schlug Diabar aufgelöst ihre Hand weg.
»Was zum Teufel passiert hier?« flüsterte er ihr mit heiserer Stimme zu. »Wer ist er, woher kennt er mich und warum ist er hinter mir her?«
Seufzend ließ seine Mutter den Kopf sinken und er erkannte die Besorgnis in ihren Augen.
»Es tut mir leid« hauchte sie ihm entgegen, was dem Jungen als Antwort nicht ausreichte.
»Wovon sprichst du? Was tut dir leid?«
Fragen über Fragen türmten sich in seinem Gehirn auf und er verlor den Überblick.
Er hasste diese Geheimnistuerei, denn es war alles andere als der rechte Zeitpunkt, ihre schlechte Angewohnheit weiterzuführen.
»Ich dachte, ich könnte dich beschützen, aber es war dumm, von mir zu glauben, dass jemand wie ich dich davor bewahren würde.«
Sie sah ihn an. Ihre Augen wirkten im schwachen Licht der Laternen geschwollen, wobei sie nach seinen Händen schnappte.
»Beschützen, vor was denn? Jemand wie du, was meinst du damit?«
Diabar verstand die Welt nicht mehr. Sie sprach in Rätseln und umso ausführlicher sie erzählte, desto zerstreuter wurde er.
»Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie dich finden.«
Er zuckte mit den Schultern.»Wer sollte mich denn suchen?«





























