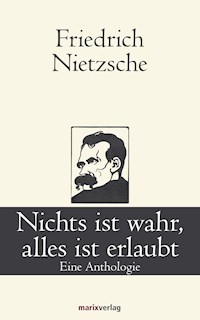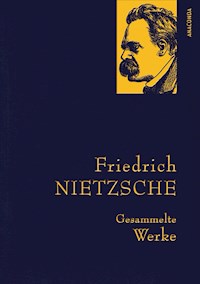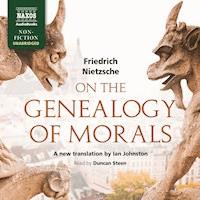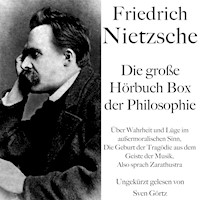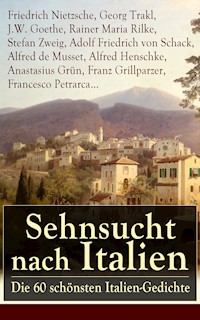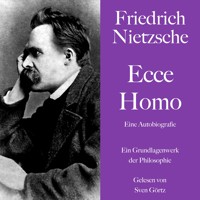Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jenseits von Gut und Böse Friedrich Nietzsches Werk "Jenseits von gut und böse" erschien 1886 und kritisierte althergebrachte Moralvorstellungen seiner Zeit. Friedrich Nietzsche schrieb über sein Buch "Jenseits von Gut und Böse": "Dies Buch (1886) ist in allem Wesentlichen eine Kritik der Modernität, die modernen Wissenschaften, die modernen Künste, selbst die moderne Politik nicht ausgeschlossen, nebst Fingerzeigen zu einem Gegensatz-Typus, der so wenig modern als möglich ist, einem vornehmen, einem jasagenden Typus. Im letzteren Sinne ist das Buch eine Schule des gentil homme, der Begriff geistiger und radikaler genommen als er je genommen worden ist. Man muss Muth im Leibe haben, ihn auch nur auszuhalten, man muss das Fürchten nicht gelernt haben (...)."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Erstes Hauptstück
Zweites Hauptstück
Drittes Hauptstück
Viertes Hauptstück
Fünftes Hauptstück
Sechstes Hauptstück
Siebtes Hauptstück
Achtes Hauptstück
Neuntes Hauptstück
Von hohen Bergen
Vorrede
Vorausgesetzt, daß die Wahrheit ein Weib ist –, wie? ist der Verdacht nicht gegründet, daß alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? daß der schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen? Gewiß ist, daß sie sich nicht hat einnehmen lassen – und jede Art Dogmatik steht heute mit betrübter und mutloser Haltung da. Wenn sie überhaupt noch steht! Denn es gibt Spötter, welche behaupten, sie sei gefallen, alle Dogmatik liege zu Boden, mehr noch, alle Dogmatik liege in den letzten Zügen. Ernstlich geredet, es gibt gute Gründe zu der Hoffnung, daß alles Dogmatisieren in der Philosophie, so feierlich, so end- und letztgültig es sich auch gebärdet hat, doch nur eine edle Kinderei und Anfängerei gewesen sein möge; und die Zeit ist vielleicht sehr nahe, wo man wieder und wieder begreifen wird, was eigentlich schon ausgereicht hat, um den Grundstein zu solchen erhabenen und unbedingten Philosophen-Bauwerken abzugeben, welche die Dogmatiker bisher aufbauten, – irgendein Volks-Aberglaube aus unvordenklicher Zeit (wie der Seelen- Aberglaube, der als Subjekt- und Ich-Aberglaube auch heute noch nicht aufgehört hat, Unfug zu stiften), irgendein Wortspiel vielleicht, eine Verführung von seiten der Grammatik her oder eine verwegne Verallgemeinerung von sehr engen, sehr persönlichen, sehr menschlich-allzumenschlichen Tatsachen. Die Philosophie der Dogmatiker war hoffentlich nur ein Versprechen über Jahrtausende hinweg: wie es in noch früherer Zeit die Astrologie war, für deren Dienst vielleicht mehr Arbeit, Geld, Scharfsinn, Geduld aufgewendet worden ist als bisher für irgendeine wirkliche Wissenschaft – man verdankt ihr und ihren »überirdischen« Ansprüchen in Asien und Ägypten den großen Stil der Baukunst. Es scheint, daß alle großen Dinge, um der Menschheit sich mit ewigen Forderungen in das Herz einzuschreiben, erst als ungeheure und furchteinflößende Fratzen über die Erde hinwandeln müssen: eine solche Fratze war die dogmatische Philosophie, zum Beispiel die Vedanta-Lehre in Asien, der Platonismus in Europa. Seien wir nicht undankbar gegen sie, so gewiß es auch zugestanden werden muß, daß der schlimmste, langwierigste und gefährlichste aller Irrtümer bisher ein Dogmatiker-Irrtum gewesen ist, nämlich Platos Erfindung vom reinen Geiste und vom Guten an sich. Aber nunmehr, wo er überwunden ist, wo Europa von diesem Alpdrucke aufatmet und zum mindesten eines gesunderen – Schlafs genießen darf, sind wir, deren Aufgabe das Wachsein selbst ist, die Erben von all der Kraft, welche der Kampf gegen diesen Irrtum großgezüchtet hat. Es hieß allerdings die Wahrheit auf den Kopf stellen und das Perspektivische, die Grundbedingung alles Lebens, selber verleugnen, so vom Geiste und vom Guten zu reden, wie Plato getan hat; ja man darf, als Arzt, fragen: »woher eine solche Krankheit am schönsten Gewächse des Altertums, an Plato? hat ihn doch der böse Sokrates verdorben? wäre Sokrates doch der Verderber der Jugend gewesen? und hätte seinen Schierling verdient?« – Aber der Kampf gegen Plato, oder, um es verständlicher und fürs »Volk« zu sagen, der Kampf gegen den christlich-kirchlichen Druck von Jahrtausenden – denn Christentum ist Platonismus fürs »Volk« – hat in Europa eine prachtvolle Spannung des Geistes geschaffen, wie sie auf Erden noch nicht da war: mit einem so gespannten Bogen kann man nunmehr nach den fernsten Zielen schießen. Freilich, der europäische Mensch empfindet diese Spannung als Notstand; und es ist schon zweimal im großen Stile versucht worden, den Bogen abzuspannen, einmal durch den Jesuitismus, zum zweiten Male durch die demokratische Aufklärung – als welche mit Hilfe der Preßfreiheit und des Zeitungslesens es in der Tat erreichen dürfte, daß der Geist sich selbst nicht mehr so leicht als »Not« empfindet! (Die Deutschen haben das Pulver erfunden – alle Achtung! aber sie haben es wieder quitt gemacht – sie erfanden die Presse.) Aber wir, die wir weder Jesuiten noch Demokraten, noch selbst Deutsche genug sind, wir guten Europäer und freien, sehr freien Geister – wir haben sie noch, die ganze Not des Geistes und die ganze Spannung seines Bogens! Und vielleicht auch den Pfeil, die Aufgabe, wer weiß? das Ziel...
Sils-Maria, Oberengadin im Juni 1885
Erstes Hauptstück
Von den Vorurteilen der Philosophen
1
Der Wille zur Wahrheit, der uns noch zu manchem Wagnisse verführen wird, jene berühmte Wahrhaftigkeit, von der alle Philosophen bisher mit Ehrerbietung geredet haben: was für Fragen hat dieser Wille zur Wahrheit uns schon vorgelegt! Welche wunderlichen schlimmen fragwürdigen Fragen! Das ist bereits eine lange Geschichte – und doch scheint es, daß sie kaum eben angefangen hat? Was Wunder, wenn wir endlich einmal mißtrauisch werden, die Geduld verlieren, uns ungeduldig umdrehn? Daß wir von dieser Sphinx auch unsrerseits das Fragen lernen? Wer ist das eigentlich, der uns hier Fragen stellt? Was in uns will eigentlich »zur Wahrheit«? – In der Tat, wir machten lange halt vor der Frage nach der Ursache dieses Willens – bis wir, zuletzt, vor einer noch gründlicheren Frage ganz und gar stehenblieben. Wir fragten nach dem Werte dieses Willens. Gesetzt, wir wollen Wahrheit: warum nicht lieber Unwahrheit? Und Ungewißheit? Selbst Unwissenheit? – Das Problem vom Werte der Wahrheit trat vor uns hin – oder waren wirs, die vor das Problem hintraten? Wer von uns ist hier Ödipus? Wer Sphinx? Es ist ein Stelldichein, wie es scheint, von Fragen und Fragezeichen. – Und sollte mans glauben, daß es uns schließlich bedünken will, als sei das Problem noch nie bisher gestellt – als sei es von uns zum ersten Male gesehn, ins Auge gefaßt, gewagt? Denn es ist ein Wagnis dabei und vielleicht gibt es kein größeres.
2
»Wie könnte etwas aus seinem Gegensatz entstehn? Zum Beispiel die Wahrheit aus dem Irrtum? Oder der Wille zur Wahrheit aus dem Willen zur Täuschung? Oder die selbstlose Handlung aus dem Eigennutze? Oder das reine sonnenhafte Schauen des Weisen aus der Begehrlichkeit? Solcherlei Entstehung ist unmöglich; wer davon träumt, ein Narr, ja Schlimmeres; die Dinge höchsten Wertes müssen einen andern, eignen Ursprung haben – aus dieser vergänglichen verführerischen täuschenden geringen Welt, aus diesem Wirrsal von Wahn und Begierde sind sie unableitbar! Vielmehr im Schoße des Seins, im Unvergänglichen, im verborgnen Gotte, im ›Ding an sich‹ – da muß ihr Grund liegen, und sonst nirgendswo!« – Diese Art zu urteilen macht das typische Vorurteil aus, an dem sich die Metaphysiker aller Zeiten wiedererkennen lassen; diese Art von Wertschätzungen steht im Hintergrunde aller ihrer logischen Prozeduren; aus diesem ihrem »Glauben« heraus bemühn sie sich um ihr »Wissen«, um etwas das feierlich am Ende als »die Wahrheit« getauft wird. Der Grundglaube der Metaphysiker ist der Glaube an die Gegensätze der Werte. Es ist auch den Vorsichtigsten unter ihnen nicht eingefallen, hier an der Schwelle bereits zu zweifeln, wo es doch am nötigsten war: selbst wenn sie sich gelobt hatten »de omnibus dubitandum«. Man darf nämlich zweifeln, erstens, ob es Gegensätze überhaupt gibt, und zweitens, ob jene volkstümlichen Wertschätzungen und Wert-Gegensätze, auf welche die Metaphysiker ihr Siegel gedrückt haben, nicht vielleicht nur Vordergrunds-Schätzungen sind, nur vorläufige Perspektiven, vielleicht noch dazu aus einem Winkel heraus, vielleicht von unten hinauf, Frosch-Perspektiven gleichsam, um einen Ausdruck zu borgen, der den Malern geläufig ist? Bei allem Werte, der dem Wahren, dem Wahrhaftigen, dem Selbstlosen zukommen mag: es wäre möglich, daß dem Scheine, dem Willen zur Täuschung, dem Eigennutz und der Begierde ein für alles Leben höherer und grundsätzlicherer Wert zugeschrieben werden müßte. Es wäre sogar noch möglich, daß was den Wert jener guten und verehrten Dinge ausmacht, gerade darin bestünde, mit jenen schlimmen, scheinbar entgegengesetzten Dingen auf verfängliche Weise verwandt, verknüpft, verhäkelt, vielleicht gar wesensgleich zu sein. Vielleicht! – Aber wer ist willens, sich um solche gefährliche Vielleichts zu kümmern! Man muß dazu schon die Ankunft einer neuen Gattung von Philosophen abwarten, solcher, die irgendwelchen andern, umgekehrten Geschmack und Hang haben als die bisherigen – Philosophen des gefährlichen Vielleicht in jedem Verstande. – Und allen Ernstes gesprochen: ich sehe solche neue Philosophen heraufkommen.
3
Nachdem ich lange genug den Philosophen zwischen die Zeilen und auf die Finger gesehn habe, sage ich mir: man muß noch den größten Teil des bewußten Denkens unter die Instinkt-Tätigkeiten rechnen, und sogar im Falle des philosophischen Denkens; man muß hier umlernen, wie man in betreff der Vererbung und des »Angeborenen« umgelernt hat. So wenig der Akt der Geburt in dem ganzen Vor- und Fortgange der Vererbung in Betracht kommt: ebensowenig ist »Bewußt-sein« in irgendeinem entscheidenden Sinne dem Instinktiven entgegengesetzt, – das meiste bewußte Denken eines Philosophen ist durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen. Auch hinter aller Logik und ihrer anscheinenden Selbstherrlichkeit der Bewegung stehen Wertschätzungen, deutlicher gesprochen, physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben: Zum Beispiel, daß das Bestimmte mehr wert sei als das Unbestimmte, der Schein weniger wert als die »Wahrheit«: dergleichen Schätzungen könnten, bei aller ihrer regulativen Wichtigkeit für uns, doch nur Vordergrunds-Schätzungen sein, eine bestimmte Art von niaiserie, wie sie gerade zur Erhaltung von Wesen, wie wir sind, nottun mag. Gesetzt nämlich, daß nicht gerade der Mensch das »Maß der Dinge« ist...
4
Die Falschheit eines Urteils ist uns noch kein Einwand gegen ein Urteil; darin klingt unsre neue Sprache vielleicht am fremdesten. Die Frage ist, wie weit es lebenfördernd, lebenerhaltend, Arterhaltend, vielleicht gar Art-züchtend ist; und wir sind grundsätzlich geneigt zu behaupten, daß die falschesten Urteile (zu denen die synthetischen Urteile a priori gehören) uns die unentbehrlichsten sind, daß ohne ein Geltenlassen der logischen Fiktionen, ohne ein Messen der Wirklichkeit an der rein erfundenen Welt des Unbedingten, Sich-selbst-Gleichen, ohne eine beständige Fälschung der Welt durch die Zahl der Mensch nicht leben könnte – daß Verzichtleisten auf falsche Urteile ein Verzichtleisten auf Leben, eine Verneinung des Lebens wäre. Die Unwahrheit als Lebensbedingung zugestehn: das heißt freilich auf eine gefährliche Weise den gewohnten Wertgefühlen Widerstand leisten; und eine Philosophie, die das wagt, stellt sich damit allein schon jenseits von Gut und Böse.
5
Was dazu reizt, auf alle Philosophen halb mißtrauisch, halb spöttisch zu blicken, ist nicht, daß man wieder und wieder dahinter kommt, wie unschuldig sie sind – wie oft und wie leicht sie sich vergreifen und verirren, kurz ihre Kinderei und Kindlichkeit – sondern daß es bei ihnen nicht redlich genug zugeht: während sie allesamt einen großen und tugendhaften Lärm machen, sobald das Problem der Wahrhaftigkeit auch nur von ferne angerührt wird. Sie stellen sich sämtlich, als ob sie ihre eigentlichen Meinungen durch die Selbstentwicklung einer kalten, reinen, göttlich unbekümmerten Dialektik entdeckt und erreicht hätten (zum Unterschiede von den Mystikern jeden Rangs, die ehrlicher als sie und tölpelhafter sind – diese reden von »Inspiration« –): während im Grunde ein vorweggenommener Satz, ein Einfall, eine »Eingebung«, zumeist ein abstrakt gemachter und durchgesiebter Herzenswunsch von ihnen mit hinterher gesuchten Gründen verteidigt wird – sie sind allesamt Advokaten, welche es nicht heißen wollen, und zwar zumeist sogar verschmitzte Fürsprecher ihrer Vorurteile, die sie »Wahrheiten« taufen – und sehr ferne von der Tapferkeit des Gewissens, das sich dies, eben dies eingesteht, sehr ferne von dem guten Geschmack der Tapferkeit, welche dies auch zu verstehen gibt, sei es um einen Feind oder Freund zu warnen, sei es aus Übermut und um ihrer selbst zu spotten. Die ebenso steife als sittsame Tartüfferie des alten Kant, mit der er uns auf die dialektischen Schleichwege lockt, welche zu seinem »kategorischen Imperativ« führen, richtiger verführen – dies Schauspiel macht uns Verwöhnte lächeln, die wir keine kleine Belustigung darin finden, den feinen Tücken alter Moralisten und Moralprediger auf die Finger zu sehn. Oder gar jener Hokuspokus von mathematischer Form, mit der Spinoza seine Philosophie – »die Liebe zu seiner Weisheit« zuletzt, das Wort richtig und billig ausgelegt – wie in Erz panzerte und maskierte, um damit von vornherein den Mut des Angreifenden einzuschüchtern, der auf diese unüberwindliche Jungfrau und Pallas Athene den Blick zu werfen wagen würde – wieviel eigne Schüchternheit und Angreifbarkeit verrät diese Maskerade eines einsiedlerischen Kranken!
6
Allmählich hat sich mir herausgestellt, was jede große Philosophie bisher war: nämlich das Selbstbekenntnis ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter mémoires; insgleichen, daß die moralischen (oder unmoralischen) Absichten in jeder Philosophie den eigentlichen Lebenskeim ausmachten, aus dem jedesmal die ganze Pflanze gewachsen ist. In der Tat, man tut gut (und klug), zur Erklärung davon, wie eigentlich die entlegensten metaphysischen Behauptungen eines Philosophen zustande gekommen sind, sich immer erst zu fragen: auf welche Moral will es (will er –) hinaus? Ich glaube demgemäß nicht, daß ein »Trieb zur Erkenntnis« der Vater der Philosophie ist, sondern daß sich ein andrer Trieb, hier wie sonst, der Erkenntnis (und der Verkenntnis!) nur wie eines Werkzeugs bedient hat. Wer aber die Grundtriebe des Menschen daraufhin ansieht, wieweit sie gerade hier als inspirierende Genien (oder Dämonen und Kobolde –) ihr Spiel getrieben haben mögen, wird finden, daß sie alle schon einmal Philosophie getrieben haben – und daß jeder einzelne von ihnen gerade sich gar zu gerne als letzten Zweck des Daseins und als berechtigten Herrn aller übrigen Triebe darstellen möchte. Denn jeder Trieb ist herrschsüchtig: und als solcher versucht er zu philosophieren. – Freilich: bei den Gelehrten, den eigentlich wissenschaftlichen Menschen, mag es anders stehn – »besser«, wenn man will –, da mag es wirklich so etwas wie einen Erkenntnistrieb geben, irgendein kleines unabhängiges Uhrwerk, welches, gut aufgezogen, tapfer darauflos arbeitet, ohne daß die gesamten übrigen Triebe des Gelehrten wesentlich dabei beteiligt sind. Die eigentlichen »Interessen« des Gelehrten liegen deshalb gewöhnlich ganz woanders, etwa in der Familie oder im Gelderwerb oder in der Politik; ja es ist beinahe gleichgültig, ob seine kleine Maschine an diese oder jene Stelle der Wissenschaft gestellt wird, und ob der »hoffnungsvolle« junge Arbeiter aus sich einen guten Philologen oder Pilzekenner oder Chemiker macht – es bezeichnet ihn nicht, daß er dies oder jenes wird. Umgekehrt ist an dem Philosophen ganz und gar nichts Unpersönliches; und insbesondere gibt seine Moral ein entschiedenes und entscheidendes Zeugnis dafür ab, wer er ist – das heißt, in welcher Rangordnung die innersten Triebe seiner Natur zueinander gestellt sind.
7
Wie boshaft Philosophen sein können! Ich kenne nichts Giftigeres als den Scherz, den sich Epikur gegen Plato und die Platoniker erlaubte: er nannte sie Dionysiokolakes. Das bedeutet dem Wortlaut nach und im Vordergrunde »Schmeichler des Dionysios«, also Tyrannen-Zubehör und Speichellecker; zu alledem will es aber noch sagen »das sind alles Schauspieler, daran ist nichts Echtes« (denn Dionysokolax war eine populäre Bezeichnung des Schauspielers). Und das letztere ist eigentlich die Bosheit, welche Epikur gegen Plato abschoß: ihn verdroß die großartige Manier, das Sich-in-Szene-Setzen, worauf sich Plato samt seinen Schülern verstand – worauf sich Epikur nicht verstand! er, der alte Schulmeister von Samos, der in seinem Gärtchen zu Athen versteckt saß und dreihundert Bücher schrieb, wer weiß? vielleicht aus Wut und Ehrgeiz gegen Plato? – Es brauchte hundert Jahre, bis Griechenland dahinterkam, wer dieser Gartengott Epikur gewesen war. – Kam es dahinter? –
8
In jeder Philosophie gibt es einen Punkt, wo die »Überzeugung« des Philosophen auf die Bühne tritt: oder, um es in der Sprache eines alten Mysteriums zu sagen:
adventavit asinus pulcher et fortissimus.
9
»Gemäß der Natur« wollt ihr leben? O ihr edlen Stoiker, welche Betrügerei der Worte! Denkt euch ein Wesen, wie es die Natur ist, verschwenderisch ohne Maß, gleichgültig ohne Maß, ohne Absichten und Rücksichten, ohne Erbarmen und Gerechtigkeit, fruchtbar und öde und ungewiß zugleich, denkt euch die Indifferenz selbst als Macht - wie könntet ihr gemäß dieser Indifferenz leben? Leben – ist das nicht gerade ein Anders-sein-wollen, als diese Natur ist? Ist Leben nicht Abschätzen, Vorziehn, Ungerecht-sein, Begrenzt-sein, Different-sein-wollen? Und gesetzt, euer Imperativ »gemäß der Natur leben« bedeute im Grunde so viel als »gemäß dem Leben leben« – wie könntet ihr's denn nicht? Wozu ein Prinzip aus dem machen, was ihr selbst seid und sein müßt? – In Wahrheit steht es ganz anders: indem ihr entzückt den Kanon eures Gesetzes aus der Natur zu lesen vorgebt, wollt ihr etwas Umgekehrtes, ihr wunderlichen Schauspieler und Selbst-Betrüger! Euer Stolz will der Natur, sogar der Natur, eure Moral, euer Ideal vorschreiben und einverleiben, ihr verlangt, daß sie »der Stoa gemäß« Natur sei, und möchtet alles Dasein nur nach eurem eignen Bilde dasein machen – als eine ungeheure ewige Verherrlichung und Verallgemeinerung des Stoizismus! Mit aller eurer Liebe zur Wahrheit zwingt ihr euch so lange, so beharrlich, so hypnotisch-starr, die Natur falsch, nämlich stoisch zu sehn, bis ihr sie nicht mehr anders zu sehn vermögt – und irgendein abgründlicher Hochmut gibt euch zuletzt noch die Tollhäusler-Hoffnung ein, daß, weil ihr euch selbst zu tyrannisieren versteht – Stoizismus ist Selbst-Tyrannei –, auch die Natur sich tyrannisieren läßt: ist denn der Stoiker nicht ein Stück Natur?... Aber dies ist eine alte ewige Geschichte: was sich damals mit den Stoikern begab, begibt sich heute noch, sobald nur eine Philosophie anfängt, an sich selbst zu glauben. Sie schafft immer die Welt nach ihrem Bilde, sie kann nicht anders; Philosophie ist dieser tyrannische Trieb selbst, der geistigste Wille zur Macht, zur »Schaffung der Welt«, zur causa prima.
10
Der Eifer und die Feinheit, ich möchte sogar sagen: Schlauheit, mit denen man heute überall in Europa dem Probleme »von der wirklichen und der scheinbaren Welt« auf den Leib rückt, gibt zu denken und zu horchen; und wer hier im Hintergrunde nur einen »Willen zur Wahrheit« und nichts weiter hört, erfreut sich gewiß nicht der schärfsten Ohren. In einzelnen und seltnen Fällen mag wirklich ein solcher Wille zur Wahrheit, irgendein ausschweifender und abenteuernder Mut, ein Metaphysiker-Ehrgeiz des verlornen Postens dabei beteiligt sein, der zuletzt eine Handvoll »Gewißheit« immer noch einem ganzen Wagen voll schöner Möglichkeiten vorzieht; es mag sogar puritanische Fanatiker des Gewissens geben, welche lieber noch sich auf ein sicheres Nichts als auf ein ungewisses Etwas sterben legen. Aber dies ist Nihilismus und Anzeichen einer verzweifelnden sterbensmüden Seele: wie tapfer auch die Gebärden einer solchen Tugend sich ausnehmen mögen. Bei den stärkeren, lebensvolleren, nach Leben noch durstigen Denkern scheint es aber anders zu stehen: indem sie Partei gegen den Schein nehmen und das Wort »perspektivisch« bereits mit Hochmut aussprechen, indem sie die Glaubwürdigkeit ihres eignen Leibes ungefähr so gering anschlagen wie die Glaubwürdigkeit des Augenscheins, welcher sagt »die Erde steht still«, und dermaßen anscheinend gutgelaunt den sichersten Besitz aus den Händen lassen (denn was glaubt man jetzt sicherer als seinen Leib?) – wer weiß, ob sie nicht im Grunde etwas zurückerobern wollen, das man ehemals noch sicherer besessen hat, irgend etwas vom alten Grundbesitz des Glaubens von ehedem, vielleicht »die unsterbliche Seele«, vielleicht »den alten Gott«, kurz, Ideen, auf welchen sich besser, nämlich kräftiger und heiterer, leben ließ als auf den »modernen Ideen«? Es ist Mißtrauen gegen diese modernen Ideen darin, es ist Unglauben an alles das, was gestern und heute gebaut worden ist; es ist vielleicht ein leichter Überdruß und Hohn eingemischt, der das bric-à-brac von Begriffen verschiedenster Abkunft nicht mehr aushält, als welches sich heute der sogenannte Positivismus auf den Markt bringt, ein Ekel des verwöhnteren Geschmacks vor der Jahrmarkts-Buntheit und Lappenhaftigkeit aller dieser Wirklichkeits-Philosophaster, an denen nichts neu und echt ist als diese Buntheit. Man soll darin, wie mich dünkt, diesen skeptischen Anti-Wirklichen und Erkenntnis-Mikroskopikern von heute recht geben: ihr Instinkt, welcher sie aus der modernen Wirklichkeit hinwegtreibt, ist unwiderlegt, – was gehen uns ihre rückläufigen Schleichwege an! Das Wesentliche an ihnen ist nicht, daß sie »zurück« wollen: sondern, daß sie – wegwollen. Etwas Kraft, Flug, Mut, Künstlerschaft mehr: und sie würden hinauswollen – und nicht zurück! –
11
Es scheint mir, daß man jetzt überall bemüht ist, von dem eigentlichen Einflusse, den Kant auf die deutsche Philosophie ausgeübt hat, den Blick abzulenken und namentlich über den Wert, den er sich selbst zugestand, klüglich hinwegzuschlüpfen. Kant war vor allem und zuerst stolz auf seine Kategorientafel, er sagte mit dieser Tafel in den Händen: »das ist das Schwerste, was jemals zum Behufe der Metaphysik unternommen werden konnte.« – Man verstehe doch dies »werden konnte«! er war stolz darauf, im Menschen ein neues Vermögen, das Vermögen zu synthetischen Urteilen a priori, entdeckt zu haben. Gesetzt, daß er sich hierin selbst betrog: aber die Entwicklung und rasche Blüte der deutschen Philosophie hängt an diesem Stolze und an dem Wetteifer aller Jüngeren, womöglich noch Stolzeres zu entdecken – und jedenfalls »neue Vermögen«! – Aber besinnen wir uns: es ist an der Zeit. Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? fragte sich Kant, – und was antwortete er eigentlich? Vermöge eines Vermögens: leider aber nicht mit drei Worten, sondern so umständlich, ehrwürdig und mit einem solchen Aufwande von deutschem Tief- und Schnörkelsinne, daß man die lustige niaiserie allemande überhörte, welche in einer solchen Antwort steckt. Man war sogar außer sich über dieses neue Vermögen, und der Jubel kam auf seine Höhe, als Kant auch noch ein moralisches Vermögen im Menschen hinzu-entdeckte – denn damals waren die Deutschen noch moralisch, und ganz und gar noch nicht »real-politisch«. – Es kam der Honigmond der deutschen Philosophie; alle jungen Theologen des Tübinger Stifts gingen alsbald in die Büsche – alle suchten nach »Vermögen«. Und was fand man nicht alles – in jener unschuldigen, reichen, noch jugendlichen Zeit des deutschen Geistes, in welche die Romantik, die boshafte Fee, hineinblies, hineinsang, damals, als man »finden« und »er finden« noch nicht auseinanderzuhalten wußte! Vor allem ein Vermögen fürs »Übersinnliche«: Schelling taufte es die intellektuale Anschauung und kam damit den herzlichsten Gelüsten seiner im Grunde frommgelüsteten Deutschen entgegen. Man kann dieser ganzen übermütigen und schwärmerischen Bewegung, welche Jugend war, so kühn sie sich auch in graue und greisenhafte Begriffe verkleidete, gar nicht mehr un-recht tun, als wenn man sie ernst nimmt und gar etwa mit moralischer Entrüstung behandelt; genug, man wurde älter – der Traum verflog. Es kam eine Zeit, wo man sich die Stirne rieb: man reibt sie sich heute noch. Man hatte geträumt: voran und zuerst – der alte Kant. »Vermöge eines Vermögens« – hatte er gesagt, mindestens gemeint. Aber ist denn das – eine Antwort? Eine Erklärung? Oder nicht vielmehr nur eine Wiederholung der Frage? Wie macht doch das Opium schlafen? »Vermöge eines Vermögens«, nämlich der virtus dormitiva – antwortet jener Arzt bei Molière
quia est in eo virtus dormitiva, cujus est natura sensus assoupire.
Aber dergleichen Antworten gehören in die Komödie, und es ist endlich an der Zeit, die Kantische Frage »wie sind synthetische Urteile a priori möglich?« durch eine andre Frage zu ersetzen »warum ist der Glaube an solche Urteile nötig?« – nämlich zu begreifen, daß zum Zweck der Erhaltung von Wesen unsrer Art solche Urteile als wahr geglaubt werden müssen; weshalb sie natürlich noch falsche Urteile sein könnten! Oder, deutlicher geredet und grob und gründlich: synthetische Urteile a priori sollten gar nicht »möglich sein«: wir haben kein Recht auf sie, in unserm Munde sind es lauter falsche Urteile. Nur ist allerdings der Glaube an ihre Wahrheit nötig, als ein Vordergrunds-Glaube und Augenschein, der in die Per spektiven-Optik des Lebens gehört. – Um zuletzt noch der ungeheuren Wirkung zu gedenken, welche »die deutsche Philosophie« – man versteht, wie ich hohe, ihr Anrecht auf Gänsefüßchen? – in ganz Europa ausgeübt hat, so zweifle man nicht, daß eine gewisse virtus dormitiva dabei beteiligt war: man war entzückt, unter edlen Müßiggängern, Tugendhaften, Mystikern, Künstlern, Dreiviertels-Christen und politischen Dunkelmännern aller Nationen, dank der deutschen Philosophie, ein Gegengift gegen den noch übermächtigen Sensualismus zu haben, der vom vorigen Jahrhundert in dieses hinüberströmte, kurz – »sensus assoupire«...
12
Was die materialistische Atomistik betrifft: so gehört dieselbe zu den bestwiderlegten Dingen, die es gibt; und vielleicht ist heute in Europa niemand unter den Gelehrten mehr so ungelehrt, ihr außer zum bequemen Hand- und Hausgebrauch (nämlich als einer Abkürzung der Ausdrucksmittel) noch eine ernstliche Bedeutung zuzumessen – dank vorerst jenem Polen Boscovich, der, mitsamt dem Polen Kopernikus, bisher der größte und siegreichste Gegner des Augenscheins war. Während nämlich Kopernikus uns überredet hat zu glauben, wider alle Sinne, daß die Erde nicht feststeht, lehrte Boscovich dem Glauben an das letzte, was von der Erde »feststand«, abschwören, dem Glauben an den »Stoff«, an die »Materie«, an das Erdenrest- und Klümpchen-Atom: es war der größte Triumph über die Sinne, der bisher auf Erden errungen worden ist. – Man muß aber noch weiter gehn und auch dem »atomistischen Bedürfnisse«, das immer noch ein gefährliches Nachleben führt, auf Gebieten, wo es niemand ahnt, gleich jenem berühmteren »metaphysischen Bedürfnisse« – den Krieg erklären, einen schonungslosen Krieg aufs Messer – man muß zunächst auch jener andern und verhängnisvolleren Atomistik den Garaus machen, welche das Christentum am besten und längsten gelehrt hat, der Seelen-Atomistik. Mit diesem Wort sei es erlaubt, jenen Glauben zu bezeichnen, der die Seele als etwas Unvertilgbares, Ewiges, Unteilbares, als eine Monade, als ein Atomon nimmt: diesen Glauben soll man aus der Wissenschaft hinausschaffen! Es ist, unter uns gesagt, ganz und gar nicht nötig, »die Seele« selbst dabei loszuwerden und auf eine der ältesten und ehrwürdigsten Hypothesen Verzicht zu leisten: wie es dem Ungeschick der Naturalisten zu begegnen pflegt, welche, kaum daß die an »die Seele« rühren, sie auch verlieren. Aber der Weg zu neuen Fassungen und Verfeinerungen der Seelen-Hypothese steht offen: und Begriffe wie »sterbliche Seele« und »Seele als Subjekts-Vielheit« und »Seele als Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte« wollen fürderhin in der Wissenschaft Bürgerrecht haben. Indem der neue Psycholog dem Aberglauben ein Ende bereitet, der bisher um die Seelen-Vorstellung mit einer fast tropischen Üppigkeit wucherte, hat er sich freilich selbst gleichsam in eine neue Öde und ein neues Mißtrauen hinausgestoßen – es mag sein, daß die älteren Psychologen es bequemer und lustiger hatten –: zuletzt aber weiß er sich eben damit auch zum Erfinden verurteilt – und, wer weiß? vielleicht zum Finden. –
13
Die Physiologen sollten sich besinnen, den Selbsterhaltungstrieb als kardinalen Trieb eines organischen Wesens anzusetzen. Vor allem will etwas Lebendiges seine Kraft auslassen – Leben selbst ist Wille zur Macht –: die Selbsterhaltung ist nur eine der indirekten und häufigsten Folgen davon. – Kurz, hier wie überall, Vorsicht vor überflüssigen teleologischen Prinzipien! – wie ein solches der Selbsterhaltungstrieb ist (man dankt ihn der Inkonsequenz Spinozas –). So nämlich gebietet es die Methode, die wesentlich Prinzipien-Sparsamkeit sein muß.
14
Es dämmert jetzt vielleicht in fünf, sechs Köpfen, daß Physik auch nur eine Welt-Auslegung und -Zurechtlegung (nach uns! mit Verlaub gesagt) und nicht eine Welt-Erklärung ist: aber, insofern sie sich auf den Glauben an die Sinne stellt, gilt sie als mehr und muß auf lange hinaus noch als mehr, nämlich als Erklärung gelten. Sie hat Augen und Finger für sich, sie hat den Augenschein und die Handgreiflichkeit für sich: das wirkt auf ein Zeitalter mit plebejischem Grundgeschmack bezaubernd, überredend, überzeugend – es folgt ja instinktiv dem Wahrheits-Kanon des ewig volkstümlichen Sensualismus. Was ist klar, was »erklärt«? Erst das, was sich sehen und tasten läßt – bis so weit muß man jedes Problem treiben. Umgekehrt: genau im Widerstreben gegen die Sinnenfälligkeit bestand der Zauber der platonischen Denkweise, welche eine vornehme Denkweise war – vielleicht unter Menschen, die sich sogar stärkerer und anspruchsvollerer Sinne erfreuten, als unsre Zeitgenossen sie haben, aber welche einen höheren Triumph darin zu finden wußten, über diese Sinne Herr zu bleiben: und dies mittelst blasser kalter grauer Begriffs-Netze, die sie über den bunten Sinnen-Wirbel – den Sinnen- Pöbel, wie Plato sagte – warfen. Es war eine andre Art Genuß in dieser Welt-Überwältigung und Welt-Auslegung nach der Manier des Plato, als der es ist, welchen uns die Physiker von heute anbieten, insgleichen die Darwinisten und Antiteleologen unter den physiologischen Arbeitern, mit ihrem Prinzip der »kleinstmöglichen Kraft« und der größtmöglichen Dummheit. »Wo der Mensch nichts mehr zu sehen und zu greifen hat, da hat er auch nichts mehr zu suchen« – das ist freilich ein andrer Imperativ als der Platonische, welcher aber doch für ein derbes arbeitsames Geschlecht von Maschinisten und Brückenbauern der Zukunft, die lauter grobe Arbeit abzutun haben, gerade der rechte Imperativ sein mag.
15
Um Physiologie mit gutem Gewissen zu treiben, muß man darauf halten, daß die Sinnesorgane nicht Erscheinungen sind im Sinne der idealistischen Philosophie: als solche könnten sie ja keine Ursachen sein! Sensualismus mindestens somit als regulative Hypothese, um nicht zu sagen als heuristisches Prinzip. – Wie? und andre sagen gar, die Außenwelt wäre das Werk unsrer Organe? Aber dann wäre ja unser Leib, als ein Stück dieser Außenwelt, das Werk unsrer Organe! Aber dann wären ja unsere Organe selbst - das Werk unsrer Organe! Dies ist, wie mir scheint, eine gründliche reductio ad absurdum: gesetzt, daß der Begriff causa sui etwas gründlich Absurdes ist. Folglich ist die Außenwelt nicht das Werk unsrer Organe –?
16
Es gibt immer noch harmlose Selbst-Beobachter, welche glauben, daß es »unmittelbare Gewißheiten« gebe, zum Beispiel »ich denke«, oder, wie es der Aberglaube Schopenhauers war, »ich will«: gleichsam als ob hier das Erkennen rein und nackt seinen Gegenstand zu fassen bekäme, als »Ding an sich«, und weder von seiten des Subjekts, noch von seiten des Objekts eine Fälschung stattfände. Daß aber »unmittelbare Gewißheit«, ebenso wie »absolute Erkennt-nis« und »Ding an sich«, eine contradictio in adjecto in sich schließt, werde ich hundertmal wiederholen: man sollte sich doch endlich von der Verführung der Worte losmachen! Mag das Volk glauben, daß Erkennen ein zu Ende-Kennen sei, der Philosoph muß sich sagen: wenn ich den Vorgang zerlege, der in dem Satz »ich denke« ausgedrückt ist, so bekomme ich eine Reihe von verwegnen Behauptungen, deren Begründung schwer, vielleicht unmöglich ist, – zum Beispiel, daß ich es bin, der denkt, daß überhaupt ein Etwas es sein muß, das denkt, daß Denken eine Tätigkeit und Wirkung seitens eines Wesens ist, welches als Ursache gedacht wird, daß es ein »Ich« gibt, endlich, daß es bereits feststeht, was mit Denken zu bezeichnen ist – daß ich weiß, was Denken ist. Denn wenn ich nicht darüber mich schon bei mir entschieden hätte, wonach sollte ich abmessen, daß, was eben geschieht, nicht vielleicht »Wollen« oder »Fühlen« sei? Genug, jenes »ich denke« setzt voraus, daß ich meinen augenblicklichen Zustand mit andern Zuständen, die ich an mir kenne, vergleiche, um so festzusetzen, was er ist: wegen dieser Rückbeziehung auf anderweitiges »Wissen« hat er für mich jedenfalls keine unmittelbare Gewißheit. - An Stelle jener »un-mittelbaren Gewißheit«, an welche das Volk im gegebnen Falle glauben mag, bekommt dergestalt der Philosoph eine Reihe von Fragen der Metaphysik in die Hand, recht eigentliche Gewissens-fragen des Intellekts, welche heißen: »Woher nehme ich den Begriff Denken? Warum glaube ich an Ursache und Wirkung? Was gibt mir das Recht, von einem Ich, und gar von einem Ich als Ursache, und endlich noch von einem Ich als Gedanken-Ursache zu reden?« Wer sich mit der Berufung auf eine Art Intuition der Erkenntnis getraut, jene metaphysischen Fragen sofort zu beantworten, wie es der tut, welcher sagt: »ich denke und weiß, daß dies wenigstens wahr, wirk-lich, gewiß ist« – der wird bei einem Philosophen heute ein Lächeln und zwei Fragezeichen bereitfinden. »Mein Herr«, wird der Philosoph vielleicht ihm zu verstehen geben, »es ist unwahr-scheinlich, daß Sie sich nicht irren: aber warum auch durchaus Wahrheit?« –
17
Was den Aberglauben der Logiker betrifft: so will ich nicht müde werden, eine kleine kurze Tatsache immer wieder zu unterstreichen, welche von diesen Abergläubischen ungern zugestanden wird – nämlich, daß ein Gedanke kommt, wenn »er« will, und nicht wenn »ich« will; so daß es eine Fälschung des Tatbestandes ist zu sagen: das Subjekt »ich« ist die Bedingung des Prädikats »denke«. Es denkt: aber daß dies »es« gerade jenes alte berühmte »Ich« sei, ist, milde geredet, nur eine Annahme, eine Behauptung, vor allem keine »unmittelbare Gewißheit«. Zuletzt ist schon mit diesem »es denkt« zuviel getan: schon dies »es« enthält eine Auslegung des Vorgangs und gehört nicht zum Vorgange selbst. Man schließt hier nach der grammatischen Gewohnheit »Denken ist eine Tätigkeit, zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist, folglich –«. Ungefähr nach dem gleichen Schema suchte die ältere Atomistik zu der »Kraft«, die wirkt, noch jenes Klümpchen Materie, worin sie sitzt, aus der heraus sie wirkt, das Atom; strengere Köpfe lernten endlich ohne diesen »Erdenrest« auskommen, und vielleicht gewöhnt man sich eines Tages noch daran, auch seitens der Logiker ohne jenes kleine »es« (zu dem sich das ehrliche alte Ich verflüchtigt hat) auszukommen.
18
An einer Theorie ist es wahrhaftig nicht ihr geringster Reiz, daß sie widerlegbar ist: gerade damit zieht sie feinere Köpfe an. Es scheint, daß die hundertfach widerlegte Theorie vom »freien Willen« ihre Fortdauer nur noch diesem Reize verdankt –: immer wieder kommt jemand und fühlt sich stark genug, sie zu widerlegen.
19
Die Philosophen pflegen vom Willen zu reden, wie als ob er die bekannteste Sache von der Welt sei; ja Schopenhauer gab zu verstehn, der Wille allein sei uns eigentlich bekannt, ganz und gar bekannt, ohne Abzug und Zutat bekannt. Aber es dünkt mich immer wieder, daß Schopenhauer auch in diesem Falle nur getan hat, was Philosophen eben zu tun pflegen: daß er ein Volks-Vorurteil übernommen und übertrieben hat. Wollen scheint mir vor allem etwas Kompliziertes, etwas, das nur als Wort eine Einheit ist, – und eben im einem Worte steckt das Volks-Vorurteil, das über die allzeit nur geringe Vorsicht der Philosophen Herr geworden ist. Seien wir also einmal vorsichtiger, seien wir »unphilosophisch« –, sagen wir: in jedem Wollen ist erstens eine Mehrheit von Gefühlen, nämlich das Gefühl des Zustandes, von dem weg, das Gefühl des Zustandes, zu dem hin, das Gefühl von diesem »weg« und »hin« selbst, dann noch ein begleitendes Muskelgefühl, welches, auch ohne daß wir »Arme und Beine« in Bewegung setzen, durch eine Art Gewohnheit, sobald wir »wollen«, sein Spiel beginnt. Wie also Fühlen und zwar vielerlei Fühlen als Ingredienz des Willens anzuerkennen ist, so zweitens auch noch Denken: in jedem Willensakte gibt es einen kommandierenden Gedanken – und man soll ja nicht glauben, diesen Gedanken von dem »Wollen« abscheiden zu können, wie als ob dann noch Wille übrig bliebe! Drittens ist der Wille nicht nur ein Komplex von Fühlen und Denken, sondern vor allem noch ein Affekt: und zwar jener Affekt des Kommandos. Das, was »Freiheit des Willens« genannt wird, ist wesentlich der Überlegenheits-Affekt in Hinsicht auf den, der gehorchen muß: »ich bin frei, ›er‹ muß gehorchen« – dies Bewußtsein steckt in jedem Willen, und ebenso jene Spannung der Aufmerksamkeit, jener gerade Blick, der ausschließlich eins fixiert, jene unbedingte Wertschätzung »jetzt tut dies und nichts andres not«, jene innere Gewißheit darüber, daß gehorcht werden wird, und was alles noch zum Zustande des Befehlenden gehört. Ein Mensch, der will –, befiehlt einem Etwas in sich, das gehorcht oder von dem er glaubt, daß es gehorcht. Nun aber beachte man, was das Wunderlichste am Willen ist – an diesem so vielfachen Dinge, für welches das Volk nur ein Wort hat: insofern wir im gegebnen Falle zugleich die Befehlenden und Gehorchenden sind, und als Gehorchende die Gefühle des Zwingens, Drängens, Drückens, Widerstehens, Bewegens kennen, welche sofort nach dem Akte des Willens zu beginnen pflegen; insofern wir andrerseits die Gewohnheit haben, uns über diese Zweiheit vermöge des synthetischen Begriffs »ich« hinwegzusetzen, hinwegzutäuschen, hat sich an das Wollen noch eine ganze Kette von irrtümlichen Schlüssen und folglich von falschen Wertschätzungen des Willens selbst angehängt – dergestalt, daß der Wollende mit gutem Glauben glaubt, Wollen genüge zur Aktion. Weil in den allermeisten Fällen nur gewollt worden ist, wo auch die Wirkung des Befehls, also der Gehorsam, also die Aktion erwartet werden durfte, so hat sich der Anschein in das Gefühl übersetzt, als ob es da eine Notwendigkeit von Wirkung gäbe; genug, der Wollende glaubt, mit einem ziemlichen Grad von Sicherheit, daß Wille und Aktion irgendwie eins seien –, er rechnet das Gelingen, die Ausführung des Wollens noch dem Willen selbst zu und genießt dabei einen Zuwachs jenes Machtgefühls, welches alles Gelingen mit sich bringt. »Freiheit des Willens« – das ist das Wort für jenen vielfachen Lust-Zustand des Wollenden, der befiehlt und sich zugleich mit dem Ausführenden als eins setzt – der als solcher den Triumph über Widerstände mitgenießt, aber bei sich urteilt, sein Wille selbst sei es, der eigentlich die Widerstände überwinde. Der Wollende nimmt dergestalt die Lustgefühle der ausführenden, erfolgreichen Werkzeuge, der dienstbaren »Unterwillen« oder Unter-Seelen – unser Leib ist ja nur ein Gesellschaftsbau vieler Seelen – zu seinem Lustgefühle als Befehlender hinzu. L'effect c'est moi: es begibt sich hier, was sich in jedem gut gebauten und glücklichen Gemeinwesen begibt, daß die regierende Klasse sich mit den Erfolgen des Gemeinwesens identifiziert. Bei allem Wollen handelt es sich schlechterdings um Befehlen und Gehorchen, auf der Grundlage, wie gesagt, eines Gesellschaftsbaus vieler »Seelen«: weshalb ein Philosoph sich das Recht nehmen sollte, Wollen an sich schon unter den Gesichtskreis der Moral zu fassen: Moral nämlich als Lehre von den Herrschafts-Verhältnissen verstanden, unter denen das Phänomen »Leben« entsteht. –
20