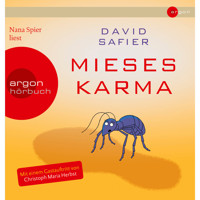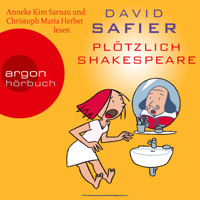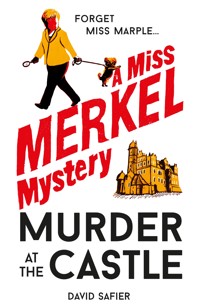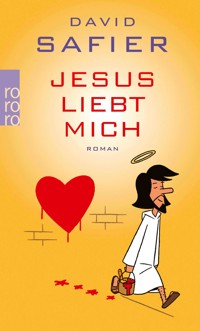
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marie hat das beeindruckende Talent, sich ständig in die falschen Männer zu verlieben. Kurz nachdem ihre Hochzeit geplatzt ist, lernt sie einen Zimmermann kennen. Und der ist so ganz anders als alle Männer zuvor: einfühlsam, selbstlos, aufmerksam. Dummerweise erklärt er beim ersten Rendezvous, er sei Jesus persönlich. Zunächst denkt Marie, dieser Zimmermann habe nicht alle Zähne an der Laubsäge. Doch bald dämmert ihr: Joshua ist wirklich der Messias. Und Marie fragt sich, ob sie sich diesmal nicht in den falschesten aller Männer verliebt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
David Safier
Jesus liebt mich
Roman
Über dieses Buch
Marie hat das beeindruckende Talent, sich ständig in die falschen Männer zu verlieben. Kurz nachdem ihre Hochzeit geplatzt ist, lernt sie einen Zimmermann kennen. Und der ist so ganz anders als alle Männer zuvor: einfühlsam, selbstlos, aufmerksam. Dummerweise erklärt er beim ersten Rendezvous, er sei Jesus persönlich. Zunächst denkt Marie, dieser Zimmermann habe nicht alle Zähne an der Laubsäge. Doch bald dämmert ihr: Joshua ist wirklich der Messias. Und Marie fragt sich, ob sie sich diesmal nicht in den falschesten aller Männer verliebt hat.
Vita
David Safier, 1966 geboren, zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Autoren der deutschen Drehbuchszene. Er konzipierte zahlreiche Serien. Bekannt wurde er vor allem mit seinen Drehbüchern zu TV-Erfolgen wie «Nikola», «Mein Leben & Ich» sowie «Berlin, Berlin», für das er unter anderem mit dem Grimme-Preis und dem Emmy, dem amerikanischen Fernseh-Oscar, ausgezeichnet wurde. David Safier lebt und arbeitet in Bremen. Sein Debüt, «Mieses Karma», verkaufte sich bisher über eine Million Mal. «Jesus liebt mich» steht seit über einem Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2010
Copyright © 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Illustration: Ulf K.
ISBN 978-3-644-30371-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Marion, Ben und Daniel
… ich liebe euch
1
So hat Jesus doch nie im Leben ausgesehen, dachte ich, als ich mir ein Abendmahl-Gemälde im Pfarrbüro ansah. Der war doch ein arabischer Jude, wieso sieht er dann auf den meisten Bildern aus wie einer von den Bee Gees?
Weiter kam ich in meinen Gedanken nicht, denn Pastor Gabriel betrat das Büro, ein älterer Herr mit Bart, einschüchternden Augen und tiefen Sorgenfalten, die sicherlich jeder bekommt, der über dreißig Jahre Schäfchen hüten muss.
Ohne jegliche Begrüßung fragte er mich: «Liebst du ihn, Marie?»
«Ja … ähem … klar liebe ich Jesus … großartiger Mann …», antwortete ich.
«Ich meine den Mann, den du in meiner Kirche heiraten willst.»
«Oh …»
Pastor Gabriel stellte immer so indiskrete Fragen. Die meisten Leute in unserem kleinen Örtchen Malente führten das darauf zurück, dass er sich ernsthaft für die Menschen interessierte. Ich hingegen glaubte, dass er schlicht und ergreifend unglaublich neugierig war.
«Ja», erwiderte ich, «natürlich liebe ich ihn.»
Mein Sven war ja auch ein liebenswerter Mann. Ein sanfter Mann. Einer, bei dem ich mich geborgen fühlen konnte. Dem es auch kein bisschen was ausmachte, mit einer Frau zusammen zu sein, deren Body-Mass-Index Anlass für Klagegebete gab. Und vor allen Dingen: Bei Sven konnte ich mir sicher sein, dass er mich nicht mit einer Stewardess betrügt – so wie mein Ex Marc, von dem ich hoffte, dass er einmal in der Hölle schmoren würde. Betreut von äußerst kreativen Dämonen.
«Nimm Platz, Marie», forderte Gabriel mich auf und schob seinen Lesesessel an den Schreibtisch. Ich setzte mich hin und versackte im dunklen 70-Jahre-Leder, während Gabriel an seinem Tisch Platz nahm. Ich musste zu ihm aufsehen, und mir war sofort klar: Das ist eine von ihm durchaus beabsichtigte Blickachse.
«Du willst also in der Kirche heiraten?», fragte Gabriel.
Nein, im Hühnerstall, hätte ich am liebsten gereizt geantwortet, erwiderte aber in möglichst nettem Tonfall: «Ja, darüber wollte ich mit Ihnen sprechen.»
«Ich habe dazu nur eine Frage, Marie.»
«Und welche?»
«Warum willst du in der Kirche heiraten?»
Die ehrliche Antwort darauf wäre gewesen: Weil es nichts Unromantischeres gibt als eine Hochzeit auf dem Standesamt. Und ich schon als kleines Mädchen von einer kirchlichen Hochzeit in Weiß geträumt habe und es auch jetzt noch tue, obwohl ich vom Kopf her natürlich weiß, dass es nichts Kitschigeres gibt, aber wer interessiert sich bei einer Heirat schon für den Kopf?
Doch dies zuzugeben schien mir nicht gerade förderlich für mein Anliegen. Daher stammelte ich mit dem besten Lächeln, das ich nur zaubern konnte: «Ich … Es ist mir ein tiefes Bedürfnis in der Kirche … vor Gott …»
«Marie, ich sehe dich hier so gut wie nie in den Gottesdiensten», unterbrach mich Gabriel scharf.
«Ich … ich … muss beruflich viel tun.»
«Am siebten Tag sollst du ruhen.»
Ich ruhte am siebten Tag, und auch am sechsten Tag, und manchmal feierte ich sogar krank, um an einem der ersten fünf Tage zu ruhen, aber das war wohl nicht das, was Gabriel meinte.
«Du hast schon vor zwanzig Jahren in meinem Konfirmandenunterricht an Gott gezweifelt», mahnte Gabriel.
Der Mann hatte vielleicht ein Gedächtnis. Dass er das noch wusste! Damals war ich dreizehn und mit dem coolen Kevin zusammen. In seinen Armen fühlte ich mich wie im Himmel, und mit ihm hatte ich auch meinen ersten Zungenkuss. Aber leider wollte er mich nicht nur küssen, er wollte auch immer wieder unter meinen Pulli. Ich ließ das nicht zu, weil ich fand, dass das noch Zeit hatte. Eine Ansicht, die er nicht teilte. Deswegen fummelte er bei der Konfirmanden-Freizeit-Party unter dem Pulli einer anderen, direkt vor meinen Augen. Und die Welt, wie ich sie kannte, endete in diesem Augenblick.
Es konnte mich auch nicht trösten, dass Kevin die Brüste der anderen mit der gleichen Sensibilität behandelte, die Bäcker beim Herstellen von Brötchenteig an den Tag legen. Selbst meine zwei Jahre ältere Schwester Kata konnte mich nicht beruhigen, obwohl sie so schöne Dinge sagte wie: «Der hat dich gar nicht verdient», «Er ist ein blöder Sack» oder «Man sollte ihn standrechtlich erschießen».
So lief ich zu Gabriel und fragte ihn mit Tränen in den Augen: «Wie kann es einen Gott geben, wenn es in der Welt etwas so Fieses wie Liebeskummer gibt?»
«Erinnerst du dich auch, was ich dir darauf geantwortet habe?», fragte Gabriel.
«Gott lässt den Liebeskummer zu, weil er den Menschen einen freien Willen gegeben hat», erwiderte ich mit einem leicht leiernden Tonfall.
Ich erinnerte mich auch daran, dass ich damals fand, dass Gott Kevin ruhig den freien Willen wieder hätte nehmen können.
«Ich habe ebenfalls einen freien Willen», erklärte Gabriel. «Ich bin kurz vor der Pensionierung und muss nicht mehr jeden trauen, von dessen Gottesfürchtigkeit ich nicht überzeugt bin. Warte auf meinen Nachfolger. Der kommt in sechs Monaten!»
«Wir wollen aber jetzt heiraten!»
«Und das ist mein Problem, weil …?», fragte er provozierend.
Ich schwieg und fragte mich: Darf man Pastoren eigentlich hauen?
«Ich mag es nicht, wenn man meine Kirche als Eventstätte nutzt», erklärte Gabriel und sah mich durchdringend an. Ich war kurz davor, mich schuldig zu fühlen – meine Wut wich einem diffusen schlechten Gewissen.
«Du weißt, dass es noch eine evangelische Kirche im Ort gibt», sagte Gabriel.
«Aber … in der will ich nicht heiraten.»
«Und warum nicht?»
«Weil … weil …», ich wusste nicht, ob ich es wirklich sagen sollte. Aber eigentlich war es ja auch egal, Pastor Gabriel hatte offensichtlich eh keine gute meine Meinung von mir. Also sagte ich etwas kleinlaut: «Weil in der Kirche meine Eltern geheiratet haben.»
Verblüffenderweise wurde Gabriel nun sanfter: «Du bist Mitte dreißig, da müsstest du doch über die Trennung deiner Eltern langsam mal hinweg sein?»
«Klar … klar, bin ich das, wäre ja auch albern, wenn nicht», antwortete ich. Schließlich hatte ich ja ein paar Stunden Therapie hinter mir, bis die mir zu teuer wurde. (Eigentlich sollten alle Eltern darauf verpflichtet werden, für ihre Kinder gleich bei der Geburt ein Sparkonto einzurichten, damit die später davon ihren Psychologen zahlen konnten.)
«Aber du hast dennoch Angst, dass es Unglück bringt, dich in der Kirche trauen zu lassen, in der deine Eltern heirateten?», hakte Gabriel nach.
Nach kurzem Zögern nickte ich: «Ich bin halt abergläubisch.»
Er sah mich an, mit einem überraschend verständnisvollen Blick. Anscheinend setzte gerade seine christliche Nächstenliebe ein.
«Einverstanden», erklärte er. «Ihr könnt hier heiraten.»
Ich konnte es kaum fassen: «Sie … Sie sind ein Engel, Pastor!»
«Ich weiß», antwortete er und lächelte dabei merkwürdig melancholisch.
Als Gabriel merkte, dass mir dies auffiel, bedeutete er mir hinauszugehen. «Schnell, bevor ich es mir anders überlege.»
Ich sprang erleichtert auf und eilte Richtung Tür. Dabei fiel mein Blick auf ein weiteres Gemälde, diesmal eines von der Wiederauferstehung Jesu. Und ich dachte bei mir: Der sieht wirklich so aus, als ob er gleich Stayin’ Alive singen würde.
2
«Ich hab dir doch gesagt, Pastor Gabriel ist ein ganz netter Mann», sagte Sven, während er mir auf dem Sofa in unserer süßen kleinen Dachgeschosswohnung die Füße massierte. Das machte er – im Gegensatz zu allen anderen Männern – supergerne, was ich auf einen seltenen Gendefekt zurückführte. Meine Exfreunde hatten mich meistens nicht länger als zehn Minuten massiert und erwarteten für diese großartige Leistung anschließend Sex. Besonders Stewardessliebhaber Marc, von dem ich hoffte, dass er später in der Hölle von äußerst kreativen Dämonen betreut würde, die in der altehrwürdigen Kunst der Kastration ausgebildet waren.
Bevor ich mit Mitte dreißig Sven kennenlernte, war ich Single und mein Sexleben inexistent. Jedes Mal, wenn ich Frauen mit Kindern sah, merkte ich, wie meine biologische Uhr ticktack machte. Und jedes Mal, wenn diese völlig übermüdeten Mütter mich mitleidig anlächelten und mir erzählten, dass man nur mit Kindern eine glückliche, erfüllte, in sich ruhende Frau sein konnte, traf das mein äußerst fragiles Selbstbewusstsein. In diesen Augenblicken konnte ich mich nur mit einem Liedchen beruhigen, das ich extra für solche Situationen gedichtet hatte: «Ich hab keine Schwangerschaftsstreifen, dudei, dudei! Ich hab keine Schwangerschaftsstreifen, dudei, dudei, hey!»
Ich versuchte mich schon mit der Tatsache abzufinden, als eine dieser alten Frauen zu enden, die sieben Monate nach ihrem Tod zufällig von Entrümpelungsunternehmern verwest in ihrer Zweizimmerwohnung gefunden werden, da traf ich Sven.
Ich hatte zuvor in einem Malenter Café im Vorbeigehen gegenüber einer extrem nervigen frischgebackenen Mutter meinen Schwangerschaftsstreifen-Song etwas zu laut gesungen. Die glückliche, erfüllte Mutter zeigte mir daraufhin, wie sehr sie in sich ruhte: Sie schüttete mir ihren Kaffee ins Gesicht. Ich stolperte, fiel und schlug gegen eine Tischkante. Ich hatte eine Platzwunde an der Stirn, fuhr sofort mit dem nächsten Taxi ins Krankenhaus und wurde von Sven in Empfang genommen. Er arbeitete dort als Pfleger und war keine überragende Schönheit – von daher passten wir sehr gut zueinander. Als ich beim Nähen der Wunde weinte, gab er mir ein Taschentuch. Als ich wegen der Flecken auf meiner schönen Bluse jammerte, tröstete er mich. Und als ich ihm für alles dankte, lud er mich zur Pizza ein. Fünfzehn Pizzen später zog ich zu ihm und war heilfroh, meine Zweizimmerwohnung nie wieder sehen zu müssen.
Weitere vierundachtzig Abendessen später machte Sven mir einen formvollendeten Heiratsantrag: auf den Knien, mit einem wunderschönen Ring, der ihn mindestens ein Monatsgehalt gekostet hatte. Dabei ließ er die Kinderfußballmannschaft, die er in seiner Freizeit betreute, ein riesiges Herz aus Rosen legen und Dein ist mein ganzes Herz singen.
Er fragte mich: «Willst du meine Frau werden?»
Für einen Augenblick dachte ich mir: «Wenn ich jetzt nein sage, dann sind die Kinder für den Rest des Lebens verstört.»
Dann antwortete ich tief gerührt: «Klar will ich das!»
Sven rieb meine Füße gerade mit Extra Sensitive Massageöl ein, das künstlich nach Rosen duftete, da fiel mein Blick auf den «Malenter Kurier». Er hatte eine Immobilienanzeige angekringelt.
«Du … hast da was angekreuzt?»
«Da gibt’s ein Neubaugebiet, wo wir uns die Grundstückspreise leisten könnten.»
«Und … warum sollten wir uns das angucken?», fragte ich alarmiert.
«Na ja, etwas Größeres wäre nicht schlecht … wenn wir mal Kinder haben wollen.»
Kinder? Hatte er da eben «Kinder» gesagt? In meinen Single-Zeiten hatte ich zwar neidisch auf Mütter gestarrt, aber seitdem ich mit Sven zusammen war, fand ich, dass ich noch ein bisschen Zeit hatte, bis ich als Augenringe-Zombie anderen erzählte, wie erfüllt ich bin.
«Ich … finde, wir sollten unser Leben als Paar noch ein bisschen genießen», gab ich zu bedenken.
«Ich bin neununddreißig und du vierunddreißig. Mit jedem Jahr, das wir warten, wird die Chance größer, dass wir ein behindertes Kind bekommen», erklärte Sven.
«Du hast eine nette Art, eine Frau vom Kinderkriegen zu überzeugen», erwiderte ich und versuchte dabei zu lächeln.
«Entschuldige.» Sven entschuldigte sich immer sehr schnell.
«Schon gut.»
«Aber … du willst doch auch welche?», fragte er.
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Wollte ich wirklich welche? Meine Sprechpause näherte sich bedrohlich einer Schweigeminute, als der zunehmend verunsicherte Sven nachfragte: «Nicht wahr, Marie?»
Da ich diesen lieben Mann einfach nicht leiden sehen konnte, scherzte ich: «Klar, fünfzehn Stück.»
«Fußballmannschaft plus Auswechselspieler», lächelte er glücklich. Dann küsste er meinen Nacken. Damit begann er traditionell das Vorspiel. Aber er brauchte ausnahmsweise mal sehr lange, um mich in Wallung zu bringen.
3
«Kläranlage wird dreißig Jahre alt» tippte ich als Überschrift meines neuen Seite-eins-Artikels, ohne jeglichen Anflug von Elan. Als ich die Journalistenschule verließ, hatte ich noch auf eine Stelle bei einem Magazin wie dem «Spiegel» gehofft, aber dazu hätte ich wohl einen besseren Abschluss als 2,7 haben müssen. So landete ich zuerst in München bei der «Anna», dem Magazin für die moderne Frau, deren Aufmerksamkeitsspanne für höchstens eine halbe Seite langt. Es war kein Traumjob, aber an guten Tagen fühlte ich mich fast wie Carrie aus «Sex and the City». Um so zu sein wie sie, fehlten mir eigentlich nur ein fünfstelliges Budget für Markenklamotten und eine Fettabsaugung.
Vielleicht wäre ich ewig bei der «Anna» geblieben. Aber leider wurde dort Marc Chefredakteur. Leider war er supercharmant. Leider wurden wir ein Paar. Leider betrog er mich mit der schlanken Stewardess, und leider reagierte ich darauf nicht ganz so souverän, wie ich es hätte tun sollen: Ich versuchte ihn mit dem Auto zu überfahren.
Na ja, nicht wirklich ernsthaft.
Aber er musste schon ein bisschen aus dem Weg springen.
Nach dieser Aktion kündigte ich bei der «Anna» und fand mit meinem suboptimalen Lebenslauf auf dem ausgetrockneten Journalistenmarkt keine andere Stelle als ausgerechnet beim «Malenter Kurier», und die auch nur, weil mein Vater den Verleger kannte. Mit einunddreißig Jahren in meinen Heimatort zurückzukehren war für mich so, wie mit einem Schild herumzulaufen, auf dem stand: «Hallo, ich habe in meinem Leben aber so was von komplett versagt.»
Der Vorteil, in so einer verstaubten Redaktion zu arbeiten, lag lediglich darin, dass ich genug Zeit hatte, mir über die Sitzordnung der Hochzeitsfeier Gedanken zu machen, was bekanntlich eine Wissenschaft für sich ist. Besonders beschäftigte mich die Frage, wie ich meine geschiedenen Eltern positionieren sollte. Während ich mir darüber den Kopf zerbrach, betrat Papa die Redaktion und machte die Sache mit der Sitzordnung noch komplizierter. Migräne verursachend kompliziert.
«Ich muss dir dringend etwas erzählen», begrüßte er mich. Ich war verwundert, lag doch ein Strahlen in seinem sonst so blassen Gesicht. Er hatte reichlich Eau de Cologne aufgetragen, und seine wenigen verbliebenen Haare waren ausnahmsweise gekämmt.
«Du, Papa, kann das noch ein bisschen warten?», fragte ich. «Ich habe keine Zeit, ich muss einen Artikel schreiben über alles, was ich noch nie über die Beseitigung von Exkrementen wissen wollte.»
«Ich habe eine Freundin», platzte es aus ihm heraus.
«Du … du … Das ist ja wunderbar», stammelte ich und vergaß die Exkremente.
Papa hatte eine Freundin? Das war eindeutig eine Überraschung. Ich malte mir aus, wer diese Frau wohl sein mochte: eine ältere Dame aus dem Kirchenchor vielleicht? Oder eine Patientin aus seiner Urologenpraxis (obwohl ich mir die erste Begegnung lieber nicht so genau vorstellen mochte).
«Sie heißt Swetlana», strahlte Papa.
«Swetlana?», wiederholte ich und versuchte sämtliche Vorurteile gegenüber slawisch klingenden Frauennamen aus meinen Gedanken zu verdrängen. «Klingt … nett …»
«Sie ist nicht nur nett. Sie ist großartig», strahlte er noch mehr.
Mein Gott, er war verliebt! Das erste Mal seit über zwanzig Jahren. Und obwohl ich mir das immer für ihn gewünscht hatte, war ich mir gerade nicht ganz sicher, wie ich das finden sollte.
«Du wirst dich bestimmt gut mit Swetlana verstehen», sagte Papa.
«Ah ja?»
«Ihr habt ein Alter.»
«Was?!?»
«Jedenfalls fast.»
«Was heißt das? Ist sie vierzig?», fragte ich.
«Nein, sie ist fünfundzwanzig.»
«Wie alt?»
«Fünfundzwanzig.»
«WIE ALT?»
«Fünfundzwanzig.»
«WIEEEE ALT???»
«Warum fragst du das immer wieder?»
Weil sich mein Hirn bei der Vorstellung, dass mein Vater eine fünfundzwanzigjährige Freundin hatte, der Kernschmelze näherte.
«Wo, wo, woher kommt sie denn genau?», fragte ich, um Contenance bemüht.
«Aus Minsk.»
«Russland?»
«Weißrussland», korrigierte er mich.
Ich schaute mich irritiert um und hoffte, irgendwo eine versteckte Kamera zu erspähen.
«Ich weiß, was du jetzt denkst», sagte Papa.
«Dass hier bestimmt eine versteckte Kamera ist?»
«Gut, ich weiß doch nicht, was du denkst.»
«Was hast du denn gedacht, was ich dachte?», fragte ich.
«Dass Swetlana auf mein Geld aus ist, nur weil ich sie über eine Partnervermittlung im Internet kennengelernt habe …»
«Du hast sie wo kennengelernt?», unterbrach ich ihn.
«Bei www.amore-osteuropa.com.»
«Oh, www.amore-osteuropa.com – das klingt ja total seriös!»
«Du bist ironisch, oder?»
«Und du naiv», erwiderte ich.
«Auf www.Partnervermittlungs-Test.de hat die Agentur die besten Ratings», hielt er dagegen.
«Na, wenn www.Partnervermittlungs-Test.de das sagt, dann ist Swetlana sicherlich eine hochanständige Frau, die weder Interesse an deinem Geld noch der deutschen Staatsbürgerschaft hat», ätzte ich.
«Du kennst Swetlana doch gar nicht!» Papa war nun sehr beleidigt.
«Aber du?»
«Ich war letzten Monat in Minsk …»
«Halt, halt, halt – alle Maschinen stopp!» Ich sprang von meinem Stuhl auf und baute mich vor ihm auf. «Du hast mir doch erzählt, du besuchst mit dem Kirchenchor Jerusalem. Du hattest dich doch so auf die Grabeskirche gefreut.»
«Ich habe gelogen.»
«Du hast deine eigene Tochter angelogen?» Ich konnte es nicht fassen.
«Weil du mich sonst aufgehalten hättest.»
«Und zwar mit Waffengewalt!»
Papa atmete durch: «Swetlana ist ein extrem reizendes Wesen.»
«Ja, das glaub ich. Sie reizt mich ja jetzt schon», erwiderte ich.
«Aber …»
«Nichts aber! Sich auf so eine Frau einzulassen ist verrückt!»
Papa antwortete mit einer Mischung aus Trotz und Trauer: «Du gönnst mir mein Glück nicht.»
Das traf mich. Natürlich gönnte ich ihm jedes Glück. Seit meinem zwölften Lebensjahr, seit dem Tag, als Mama ihn verlassen hatte, wollte ich Papa wieder glücklich sehen.
Als er damals, weiß wie eine Wand, vor mir stand und mir erklärte, dass Mama ausgezogen sei, konnte ich es nicht glauben. Ich fragte ihn, ob es denn gar keine Chance gebe, dass sie wieder zu uns zurückkehrt.
Er schwieg. Lange. Schließlich schüttelte er nur stumm den Kopf. Dann begann er zu weinen. Ich brauchte eine Weile, bis ich es überhaupt realisierte: Mein Papa weinte. Als er gar nicht mehr aufhören konnte, nahm ich ihn in die Arme. Und er weinte an meiner Schulter.
Keine Zwölfjährige sollte ihren Papa so weinen sehen.
Ich dachte nur: «Lieber Gott, bitte mach, dass alles wieder gut wird. Dass Mama wieder zu ihm zurückkommt.» Aber mein Gebet wurde nicht erhört. Vielleicht musste Gott ja gerade Leute in Bangladesch vor einer Flutkatastrophe retten.
Jetzt war Papa endlich wieder glücklich, nach all den Jahren. Aber anstatt mich für ihn zu freuen, hatte ich nur Angst, ihn nochmal weinen zu sehen. Diese Swetlana würde ihm mit Sicherheit das Herz brechen.
Entschlossen sagte er zu mir: «Und damit du es weißt, ich bringe Swetlana mit zur Hochzeit.»
Dann ging er hinaus und knallte dabei die Tür zu, ein bisschen zu theatralisch, wie ich fand. Ich starrte noch etwas auf die Tür, schließlich fiel mein Blick wieder auf die Sitzordnung. Und die Migräne setzte ein.
4
Egal, was Pastor Gabriel von mir dachte, ich betete öfter mal zu Gott. Ich glaubte zwar nicht hundertprozentig an einen allmächtigen Herrn im Himmel, hoffte aber sehr, dass es ihn gab. So betete ich, wenn ein Billigflieger, in dem ich saß, startete und landete. Oder vor der Ziehung der Lottozahlen. Oder wenn ich wollte, dass der ständig laut singende Operntenor in der Wohnung unter uns seine Stimme verliert.
Vor allen Dingen aber betete ich, dass diese Swetlana meinem Papa nicht das Herz brach.
Meine ältere Schwester Kata, die mit ihren blonden, wilden Haaren aussah wie eine widerborstige Version von Meg Ryan, fand meine Gebete albern, und das sagte sie mir auch. Sie war eine Woche vor der Hochzeit nach Malente angereist, und wir joggten gerade gemeinsam um den Malenter See.
«Marie», lächelte Kata, «wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann so Dinge wie Nazis, Kriege oder Modern Talking?»
«Weil er den Menschen den freien Willen gegeben hat», antwortete ich, Gabriel zitierend.
«Und warum gibt er den Menschen einen freien Willen, mit dem sie sich gegenseitig quälen?»
Ich überlegte eine Weile, dann antwortete ich geschlagen: «Touchez.»
Kata war schon immer die Abgeklärtere von uns beiden. Mit siebzehn schmiss sie die Schule, ging nach Berlin, hatte dort ihr Coming-out als Lesbe und startete eine Karriere als Zeichnerin eines täglichen Comicstrips einer überregionalen Zeitung. Mit dem Titel «Sisters». Über zwei Schwestern. Über uns.
Kata hatte von uns beiden auch die viel bessere Kondition. Sie schnaufte kein bisschen, während ich schon nach achthundert Metern den schönen Malenter See nicht mehr halb so schön fand.
«Sollen wir aufhören zu laufen?», fragte sie.
«Ich muss … bis zur Hochzeit noch zwei Kilo abnehmen», keuchte ich.
«Dann wiegst du immer noch 69», grinste Kata.
«Kein Mensch mag schlanke Klugscheißer», konterte ich hechelnd.
«Es ist doch schön, wenn Papa nach zwanzig Jahren Abstinenz mal Sex hat», brachte Kata das Thema auf www.amore-osteuropa.com.
Papa hatte Sex?
Das war ein Bild, das ich nie vor Augen haben wollte! Das sich aber gerade zu meinem Entsetzen in meine Hirnrinde einfräste.
«Er ist dabei bestimmt glücklich und …»
Weiter kam Kata nicht, ich hielt mir die Hände an die Ohren und sang laut: «Lalala, ich will das gar nicht hören. Lalalala, das interessiert mich nicht.»
Kata hörte auf zu reden. Ich nahm die Hände wieder von den Ohren.
«Obwohl Männer», hob Kata lächelnd wieder an, «die wie Papa so lange ohne feste Bindung waren, zwischendrin sicher mal zu Prostituierten gehen …»
Ich nahm erneut die Hände an die Ohren und sang so laut ich konnte: «Lalalala, wenn du noch weiterredest, hau ich dich …»
Kata schmunzelte: «Ich bin immer wieder beeindruckt, wie erwachsen du doch bist.»
Ich war viel zu sehr außer Atem, um etwas zu erwidern, und ließ mich erschöpft auf die nächste Parkbank fallen, die im Schatten eines Kastanienbaums stand.
«Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut deine Kondition ist», ergänzte Kata.
Ich warf ihr eine Kastanie an den Kopf.
Kata grinste nur. Sie war auch nicht ein Zehntel so schmerzempfindlich wie ich. Während ich schon jammerte, wenn ich einen eingerissenen Zehennagel hatte, jammerte sie nicht mal, als sie vor fast fünf Jahren einen Tumor im Kopf hatte. Oder – wie sie es formulierte – «die Gelegenheit herauszufinden, wer meine wahren Freunde sind».
Als sie so krank war, nahm ich jedes Wochenende den Flieger nach Berlin und besuchte sie in der Klinik. Es war hart zu sehen, wie sehr meine Schwester litt, wie sie vor lauter Schmerzen nicht mal mehr richtig schlafen konnte. Tabletten linderten ihr Leiden kaum. Infusionen auch nicht. Und die Chemotherapien taten ihr Übriges: Aus meiner kraftvollen Schwester wurde ein abgemagertes kahlköpfiges Wesen, das seine Glatze mit einem frechen Totenkopf-Tuch verhüllte. Damit sah sie aus, als ob sie jeden Moment auf Captain Sparrows Piratenschiff Black Pearl anheuern würde. Nach sechs Wochen wunderte ich mich, dass Katas damalige Freundin Lisa nicht mehr zu Besuch kam.
Kata erklärte nur: «Wir haben uns getrennt.»
«Wieso das denn?», fragte ich geschockt.
«Wir hatten unterschiedliche Interessen», antwortete Kata kurz.
«Welche?», wollte ich irritiert wissen.
Kata lächelte süßsauer: «Sie zieht gerne durchs Nachtleben, ich kotze wegen Chemo.»
Meine Schwester war fest entschlossen, den Tumor zu besiegen. Als ich sie fragte, woher sie ihren unglaublichen Willen nehme, antwortete sie: «Ich habe gar keine andere Wahl. Ich glaube doch nicht an ein Leben nach dem Tod.»
Ich aber betete für Kata, natürlich ohne ihr davon zu erzählen, das hätte sie nur genervt.
Jetzt hatte sie es fast geschafft – sollten in den nächsten Monaten keine Rückschläge mehr auftreten, würde sie noch ein langes Leben vor sich haben. Und ich würde endgültig wissen, ob Gott meine Gebete erhört hatte. Denn das war nun mal sein Aufgabengebiet. Ein Tumor hatte ja wohl kaum etwas mit dem freien Willen der Menschen zu tun.
«Was schaust du denn so nachdenklich?», fragte Kata. Mir war nicht danach, das Gespräch auf den Tumor zu bringen, denn Kata konnte es – verständlicherweise – nicht ertragen, dass mich ihre Krankheit stets trauriger stimmte als sie selbst. Ich stand von der Bank auf und machte mich auf den Rückweg.
«Laufen wir nicht mehr?», fragte Kata.
«Ich nehme lieber mit einer Diät ab.»
«Warum willst du überhaupt abnehmen?», fragte Kata. «Du hast doch immer erzählt, dass Sven dich so liebt, wie du bist.»
«Sven schon, aber ich mich nicht», antwortete ich.
«Und, wollt ihr bald Kinder?», fragte Kata scheinbar leichthin.
«Hat noch Zeit», erwiderte ich.
Kata schaute mich an, mit dem beiläufigen Blick, den sie immer draufhatte, wenn sie auf etwas hinauswollte.
«Sieh mal, dahinten schwimmt ein schwarzer Schwan», versuchte ich – wenig elegant –, das Thema zu wechseln.
«Bei Marc wolltest du immer Kinder», bemerkte Kata, die mich eigentlich nie Themen wechseln ließ, wenn ich wollte.
«Sven ist nicht wie Marc.»
«Deswegen frage ich ja», sagte Kata ernst, «du hast Marc so sehr geliebt, dass du mir gleich in der zweiten Woche die Namen der beiden Kinder verkündet hast, die du mit ihm haben wolltest. Mareike und …»
«… Maja», vollendete ich leise. Ich wollte immer zwei Töchter, die so ein tolles Verhältnis haben wie Kata und ich.
«Und, was ist jetzt mit Mareike und Maja?», fragte Kata.
«Ich will noch die Zeit als Paar genießen», antwortete ich, «die Blagen müssen sich etwas gedulden, bis sie mich nerven können.»
«Hat es was mit Sven zu tun?» Kata ließ einfach nicht locker.
«Quatsch!»
«Protestierte sie eine Spur zu laut», grinste Kata, hörte dann aber auf, mich weiter mit dem Thema zu löchern. Ich fragte mich verunsichert, ob ich nicht wirklich eine Spur zu laut protestiert hatte. Wollte ich vielleicht gar keine Kinder?
5
Unterdessen
Während sich Marie und Kata vom Malenter See entfernten, schwamm der schwarze Schwan ans Ufer. Dort watschelte er über die Kieselsteine auf den Uferweg, schüttelte sein feuchtes Gefieder und … verwandelte sich in George Clooney.
Clooney strich sich durch sein trocken glänzendes Haar, zupfte seinen eleganten schwarzen Designeranzug zurecht und setzte sich auf die schattige Parkbank, auf der eben noch die beiden Schwestern verschnauft hatten. Er saß dort eine Weile und wartete auf etwas. Oder jemanden. Dabei bewarf er einige Enten im See so scharf und gezielt mit Kastanien, dass sie davon k.o. gingen und ertranken. Aber auch dieser kleine Spaß konnte dem Mann keine Freude bereiten. Er war müde. Sehr müde. Er litt unter dem Burn-out-Syndrom. Dieses verdammte letzte Jahrhundert!
Vorher ging es ja noch, aber seitdem: Egal, wie er sich auch anstrengte, die Menschen waren einfach viel, viel besser darin, sich die Hölle auf Erden zu bereiten, als er, Satan.
Sicher, er hatte auch ein paar gute Ideen entwickelt, um die Menschen zu quälen: Neoliberalismus, Reality-TV, Modern Talking (auf den Song Cheri, Cheri, Lady war er besonders stolz), aber alles in allem konnte er den Menschen nicht mehr das Wasser reichen. Die waren mit ihrem blöden freien Willen viel zu kreativ.
«Lange nicht mehr gesehen», sagte plötzlich eine Stimme hinter ihm.
Satan drehte sich um und sah … Pastor Gabriel.
«Das letzte Mal vor ziemlich genau 6000 Jahren», erwiderte Satan, «als er mich aus dem Himmel rauswarf. Oder besser gesagt: runterwarf.»
Gabriel nickte: «Das waren noch Zeiten.»
«Ja, das waren sie», nickte Satan.
Die beiden lächelten sich an wie zwei Männer, die einstmals befreundet waren und es tief in ihrem Herzen bedauern, dass sie es nicht mehr sind.
«Du siehst müde aus», sagte Satan zu Gabriel.
«Danke gleichfalls», erwiderte Gabriel.
Die beiden lächelten sich noch mehr an.
«Also, wozu dieses Treffen?», wollte Satan wissen.
«Ich soll dir etwas von Gott ausrichten», antwortete Gabriel.
«Und was?»
«Das Jüngste Gericht steht vor der Tür.»
Satan überlegte eine Weile, dann seufzte er erleichtert: «Wurde ja auch langsam mal Zeit.»
6
Unsere Hochzeit begann wie bei vielen anderen Paaren auch: mit einem mittleren Nervenzusammenbruch der Braut. Zitternd stand ich vor dem Eingang der Kirche, in der die Gäste auf meinen Auftritt warteten. Eigentlich war fast alles so perfekt, wie ich es mir immer gewünscht hatte: Die Kirchenbänke waren voll, alle würden gleich mein wunderbares weißes Kleid bestaunen, in das ich nun auch sehr gut reinpasste, weil ich es tatsächlich geschafft hatte, drei Kilo herunterzuhungern. Aber das Beste war: Wir hatten die standesamtliche Hochzeit übersprungen! Ich würde also ganz romantisch in der Kirche mein Jawort geben, und der Standesbeamte würde anschließend noch vor Ort die Sache staatlich beglaubigen. Wie gesagt, fast alles war perfekt. Es gab nur ein Problem: Mein Papa wollte die Braut nicht mehr hineinführen.
«Du hättest», sagte Kata zu mir, «seine Swetlana einfach nicht so hart beschimpfen sollen.»
«Ich hab sie nicht hart beschimpft», erwiderte ich mit Tränen in den Augen.
«Du hast sie ‹Wodka-Nutte› genannt.»
«Okay, ich hab sie vielleicht doch hart beschimpft», gab ich zu.
Bevor ich in die Kutsche zur Kirche stieg, hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, bei meinem ersten Zusammentreffen mit Swetlana ganz cool zu bleiben. Als ich dann aber tatsächlich auf diese zwar stark geschminkte, aber dennoch hübsche, zierliche Frau traf, war mir klar, dass sie meinem Papa das Herz brechen würde. So ein junges Model konnte sich gar nicht in ihn verliebt haben! Ich sah vor meinem geistigen Auge, wie Papa wieder in meinen Armen weinte. Und da ich diese Vorstellung nicht ertragen konnte, bat ich Swetlana, sich wieder nach Weißrussland zu verziehen. Oder gleich nach Sibirien durchzufahren. Das machte Papa wütend. Er beschimpfte mich. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass er nur ausgenutzt würde. Er beschimpfte mich noch mehr. Da rastete ich aus. Da ich ausrastete, rastete auch er aus. Und da fielen nun mal Begriffe wie «Wodka-Nutte», «undankbare Tochter» und «Viagra-Papa».
Warum nur tut man immer den Menschen am meisten weh, die man vor sich selbst schützen will?
«Komm», sagte Kata, trocknete meine Tränen und nahm mich an der Hand. «Ich führe dich hinein.»
Sie öffnete mir die Tür, das Orgelspiel begann. Am Arm meiner geliebten Schwester betrat ich möglichst würdevoll die wunderschöne Kirche und machte mich auf den Weg Richtung Altar. Die meisten der anwesenden Gäste hatte Sven eingeladen. Viele waren mit ihm verwandt; und die anderen waren seine Freunde aus dem Fußballverein, seine Kollegen aus dem Krankenhaus, Leute aus der Nachbarschaft … Ach, eigentlich war halb Malente mit Sven verwandt oder befreundet. Ich selbst hatte bei weitem nicht so viele Freunde. Eigentlich nur einen richtigen, er saß in Reihe fünf: Michi war ein dünner, klappriger Kerl, hatte wirres Haar und trug ein T-Shirt mit der Aufschrift «Schönheit ist total überbewertet».
Wir beide kannten uns schon seit den Schulzeiten. Damals gehörte er einer echt freakigen Minderheit an: Er war ein katholischer Messdiener.
Auch heute noch war Michi der einzige richtig gläubige Mensch, den ich kannte. Jeden Tag las er in der Bibel, über die er mal zu mir sagte: «Marie, was in der Bibel steht, muss einfach stimmen. Die Storys sind so durchgeknallt, das kann sich gar kein Mensch ausgedacht haben.»
Michi nickte mir aufmunternd zu, und ich konnte wieder lächeln. In Reihe drei sah ich meinen Vater, und ich hörte schlagartig wieder auf damit. Er war immer noch wütend auf mich, während Swetlana ganz verunsichert auf den Boden blickte und sich wahrscheinlich fragte, was wir Deutsche so unter Gastfreundschaft verstanden. Und unter verwandtschaftlichem Zusammenhalt.
In Reihe eins, absichtlich weit weg von Papa, saß meine Mutter, die mit ihren kurzen, rotgefärbten Haaren ein bisschen aussah wie eine Betriebsratsvorsitzende. Sie wirkte viel vitaler als damals, als sie im blauen Bademantel am Frühstückstisch saß und mit müdem Gesicht zu Kata und mir sagte: «Ich trenne mich von eurem Vater.»
Mama erklärte uns geschockten Kindern bemüht sanft, dass sie Papa schon lange nicht mehr liebe, dass sie nur wegen uns bei ihm geblieben sei und dass sie einfach nicht weiter eine Lüge leben könne.
Heute weiß ich, dass es für sie der richtige Schritt war. Schließlich konnte sie ihren Traum vom Psychologiestudium verwirklichen, den Papa immer blockiert hatte. Sie lebte nun in Hamburg, hatte dort eine Praxis für – ausgerechnet – Paartherapie und war viel, viel selbstbewusster als je zuvor. Dennoch wünschte sich ein Teil von mir immer noch, dass Mama damals die Lüge weitergelebt hätte.
«Eine Ehe zu führen ist schwer», verkündete Pastor Gabriel bei der Predigt mit seiner sonoren Stimme, «aber alles andere ist noch schwerer.»
Es war nicht gerade eine «Was-für-ein-schöner-Tag-lasst-uns-jubilieren-und-frohlocken»-Predigt. Aber das war von Pastor Gabriel auch nicht anders zu erwarten gewesen. Ich war ja schon froh, dass sich sein Vortrag nicht um «Menschen, die meine Kirche für Events missbrauchen» drehte.
Sven sah mich während der Predigt in einer Tour überglücklich an. So überglücklich, dass ich es nicht ertragen konnte, nicht so überglücklich zu sein wie er, obwohl ich doch so gern so überglücklich sein wollte und es wohl nur noch nicht war, weil ich von dem Streit mit Papa zu durcheinander war.
Ich bemühte mich, nun auch zu strahlen. Aber je mehr ich mich bemühte, desto verkrampfter wurde ich. Vor lauter schlechtem Gewissen gegenüber Sven sah ich von ihm weg, schaute mich ein bisschen in der Kirche um und blieb mit meinem Blick an einem Jesus-Kreuz hängen. Zuerst schossen mir dumme Sprüche durch den Kopf, die wir als Pubertierende im Konfirmandenunterricht gemacht hatten: «Hey, Jesus, was machst du denn hier?» – «Ach, Paulus, ich häng hier nur so rum.»
Aber dann sah ich die roten Punkte an den Händen, wo die Nägel durchgehauen worden waren. Ein Schauer durchlief meinen Körper. Kreuzigen, was war das nur für ein brutaler Mist? Wer hatte sich das überhaupt ausgedacht? So etwas unglaublich Grausames! Wer auch immer das war, musste eine echt schlimme Kindheit gehabt haben.
Und Jesus? Der wusste doch, was auf ihn zukommen sollte. Warum hat er sich dem ausgesetzt? Klar, um all unsere Sünden auf sich zu nehmen. Das war ein beeindruckendes Opfer für die Menschheit. Aber hatte Jesus denn überhaupt eine Wahl? Konnte er es sich aussuchen, sich zu opfern? Es war doch seine Bestimmung, schon von Kindesbeinen an. Dafür hatte ihn sein Vater auf die Erde geschickt. Aber was war das für ein Vater, der so ein Opfer von seinem Sohn verlangte? Und was hätte die Super Nanny zu diesem Vater gesagt? Höchstwahrscheinlich: «Geh doch bitte mal in die Wuthöhle.»
Plötzlich bekam ich Angst: Es war sicher keine gute Idee, in der Kirche Gott zu kritisieren. Schon gar nicht bei der eigenen Hochzeit.
Entschuldige bitte, Gott, sprach ich in Gedanken zu ihm. Es ist nur, musste Jesus so gequält werden, um zu sterben? War das wirklich nötig? Ich meine, hätte er nicht durch was anderes sterben können als durch so eine Kreuzigung? Durch etwas Humaneres? Vielleicht durch einen Schlaftrunk?
Andererseits, gab ich mir darauf selber zu bedenken, würden bei einem Schlaftrunk in allen Kirchen statt Kreuzen überall Trinkbecher hängen …
«Marie!», sagte Pastor Gabriel mit durchdringender Stimme.
Erschrocken blickte ich zu ihm: «Ja, hier!»
«Ich habe dir eine Frage gestellt», sagte er.
«Klar, klar … habe ich gehört», flunkerte ich verlegen.
«Und, willst du die vielleicht auch beantworten?»
«Nun ja, warum nicht?»
Ich schaute zu dem verunsicherten Sven. Dann blickte ich in das Kirchenschiff, sah in jede Menge irritierter Augen und überlegte, wie ich mich herauswinden könnte, aber mir fiel rein gar nichts ein.
«Ähem, wie war nochmal die Frage?», wandte ich mich verunsichert wieder an Gabriel.
«Ob du Sven heiraten willst?»
Mir wurde heiß und kalt. Es war einer von jenen Augenblicken, in denen man am liebsten spontan ins Koma fallen möchte.
Die halbe Kirche lachte, die andere Hälfte war entsetzt, und Svens verunsichertes Lächeln geriet zur Grimasse.
«War nur ein kleiner Scherz», erklärte Gabriel.
Erleichtert atmete ich auf.
«Ich habe lediglich gefragt, ob du für den Trauspruch bereit bist.»
«Entschuldigen Sie, ich war in Gedanken», erklärte ich kleinlaut.
«Und an was hast du gedacht?»
«An Jesus», erwiderte ich wahrheitsgemäß. Die genauen Details behielt ich lieber für mich.
Gabriel war mit der Antwort zufrieden, die Gäste ebenfalls, und Sven lächelte erleichtert. Dem Pastor bei der eigenen Trauung wegen Jesus nicht zuzuhören war anscheinend in Ordnung.
«Wollen wir also mit dem Trauspruch beginnen?», fragte Gabriel, und ich nickte.
Es wurde schlagartig still in der Kirche.
Gabriel wandte sich an Sven: «Sven Harder, willst du Marie Holzmann, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen – in guten und in bösen Tagen –, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.»
Sven hatte Tränen in den Augen und antwortete: «Ja, mit Gottes Hilfe.»
Es war unglaublich, es gab tatsächlich einen Mann, der mich heiraten wollte. Wer hätte das je gedacht?
Gabriel drehte sich daraufhin zu mir, ich wurde nun extrem nervös, meine Beine zitterten, und mein Magen wurde flau.
«Marie Holzmann, willst du Sven Harder, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen – in guten und in bösen Tagen –, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.»
Mir war schon klar, dass ich in diesem Augenblick «Ja, mit Gottes Hilfe» hätte sagen müssen. Doch schlagartig wurde mir bewusst: «Bis dass der Tod euch scheidet» war eine weitreichende Zeitspanne. Eine extrem weitreichende Zeitspanne. Das hatte man sich bestimmt damals ausgedacht, als die Christen eine Lebenserwartung von dreißig Jahren hatten, bevor sie in ihren Lehmhütten starben oder von einem Löwen im Circus Maximus verspeist wurden. Aber heute, heute hatten wir Menschen eine Lebenserwartung von achtzig, neunzig Jahren. Wenn die Medizin so weitermachte, dann könnte man sicher auch hundertzwanzig Jahre alt werden. Andererseits war ich nicht privat versichert, also würde ich doch nur achtzig, neunzig Jahre alt werden, aber das war immer noch alt genug …
«Hmm!», räusperte Gabriel sich auffordernd.
Ich versuchte, mit einem gerührten Gluckser Zeit zu gewinnen. Die Leute sollten denken, dass ich kein Wort rausbekam, weil ich vor Rührung weinte. Mein Blick ging indessen zur Tür. Ich erinnerte mich an die «Reifeprüfung», in der Dustin Hoffman die Braut aus der Kirche entführte, und fragte mich, ob Marc vielleicht von meiner Hochzeit erfahren hatte und nach Malente gefahren war und jetzt gleich durch die Tür stürmen würde … Dass ich in diesem Augenblick an Marc dachte, war nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
«Marie, das ist der Augenblick, wo du ‹Ja› sagen müsstest», erklärte Pastor Gabriel mit einem leicht drängelnden Unterton.
Als ob ich das nicht wüsste!
Sven biss sich hypernervös auf die Lippen.
In der Menge sah ich meine Mutter und fragte mich: Würde ich bei Sven vielleicht auch so enden wie sie? Würde ich meinen Töchtern auch irgendwann am Frühstückstisch verkünden: Tut mir leid, Mareike und Maja, ich liebe euren Vater schon seit Jahren nicht mehr?
«Marie, jetzt antworte bitte!», forderte Gabriel mich auf.
In der ganzen Kirche war nur noch eins zu hören … mein Magenknurren.
«Marie …», flehte Sven. Er geriet langsam in Panik.
Ich dachte an die Tränen meiner noch nicht geborenen Töchter. Und da wusste ich plötzlich, warum ich keine Kinder von Sven haben wollte.
Ich liebte ihn. Aber nicht genug für ein ganzes Leben.
Doch was würde ihm mehr wehtun? Wenn ich jetzt «Nein» sagte oder mich später von ihm scheiden ließe?
7
«Was habe ich nur getan, was habe ich nur getan?», heulte ich, als ich auf dem kalten Boden der Kirchen-Damentoilette saß.
«Du hast ‹Nein› gesagt», erwiderte Kata, die neben mir saß und dafür sorgte, dass das von mir vollgeheulte Klopapier im Bindeneimer landete.
«Ich weiß, was ich gesagt habe!», jaulte ich auf.