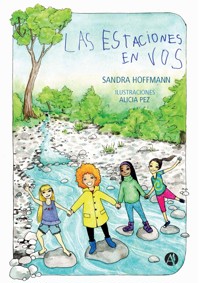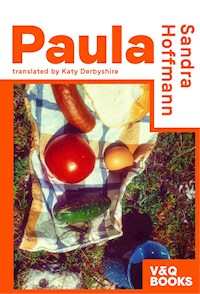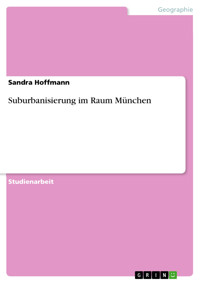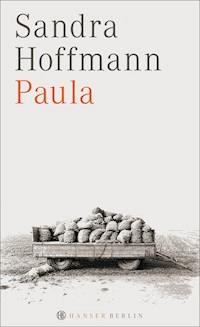19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Claire liebt ihr einsames Leben im Wald. Als Pädagogin lehrt sie Schulklassen in einem Wildniscamp, wie aufmerksame Wahrnehmung das Verhältnis zur Natur verändern kann. Einige Kilometer von ihrer Arbeit entfernt, bewohnt die 42-jährige Frau zusammen mit der Hündin Nora ein Haus auf einer Waldlichtung. Hier ist ihr Körpergefühl das Barometer für ihr Wohlbefinden. Als jedoch nach einer Campwoche der 16-jährige Janis auf ihrem Grundstück auftaucht, verbirgt sie sich zuerst vor ihm. Erinnerungen an Momente sexuellen Verlangens werden in ihr wach. Bilder, die sie scheut. Sie spürt eine Angst, die sie erst, als der Junge da ist, wirklich verstehen kann. Literarisch brillant erzählt »Jetzt bist du da« von einem Tag und einer Nacht der Umkreisung und der Wucht menschlicher Sehnsüchte.
»Sandra Hoffmann schafft es auf wundersame Weise, das reiche und geheimnisvolle Leben im Wald zu verbinden mit der Sehnsucht nach einem anderen Menschen, seinem Körper, seinem Geist, und danach, Teil eines größeren Ganzen zu sein.« Zora del Buono
»Eine Expedition in die Wildheit unseres Menschseins, wo Alter und Geschlecht verwischen und nur eine Frage bleibt: Welche Verantwortung tragen wir für unser Verlangen?« Katharina Adler
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Die Arbeit an diesem Roman wurde mit einem Arbeitsstipendium der Stadt München, einem Neustart Kultur-Stipendium der VG Wort sowie einem Stipendium des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst gefördert.
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Bridgeman Images / McConochie, David
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitate
1
2
3
Danke
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
(…)
I am the old woman
Found always in stories like this one,
Who says, Go back, my dear.
Back is into the cellar
Where the worst is,
Where the others are,
Where you can see
What you would look like dead
And who wants it.
Then you will be free
To choose. To make
Your way.
Margaret Atwood
Was ist schwieriger:
ein Pferd zu halten oder es springen zu lassen, und –
da wir es sind, dieses von uns gehaltene Pferd –
was ist mühseliger: zurückgehalten zu sein oder unsere Kraft auszuspielen?
Marina Zwetajewa
1
Drüben auf dem Weg geht jemand. Mein Blick sucht nach einer Schneise im Dickicht der Haselbüsche, der jungen Erlen und Buchen, bis ich nach ein paar Atemzügen die Bewegungen einer schmalen Gestalt auf dem Waldweg ausmachen kann. Es ist nicht der Jäger, auch nicht der Förster und Achim erst recht nicht. Warum meine ich die Person zu kennen, die da geht? Nora schaut seit Minuten konzentriert in den Wald hinein, aber sie bellt nicht, was mich wundert. Ich kneife die Augen zusammen. Ein Mädchen, denke ich zuerst, und als ich das denke, glaube ich zu wissen, wer es ist. Ich springe auf. Nora erschrickt. Komm, sage ich, ohne mich zu ihr umzudrehen. Im selben Augenblick wird mir klar, dass es vollkommen sinnlos wäre, mich im Haus zu verstecken. Du hast mich gefunden. Jetzt bist du da. Ich schließe die Balkontür. Ich drehe mich um und betrachte den Raum, als wäre er plötzlich ein anderer geworden: Ofen, Tisch, die Stühle drum herum, alles ist mit irgendetwas belegt. Die Blumen welken. Ich verstehe das nicht. Wo kommst du jetzt her? Wie konntest du mich finden? Nora geht unruhig zwischen der Tür und mir hin und her, sie spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich gehe neben ihr in die Hocke. Was machen wir jetzt, frage ich, während meine Hand über ihr glattes schwarzes Fell streicht. Die Hündin leckt mir die Finger. Schon gut, sage ich und setze mich zu ihr auf die Dielen. Mein Puls ist hoch, als hätte ich eine volle Schubkarre das Grundstück hinaufgeschoben. Ich spüre die Herzschläge im Hals. Hast du uns schon entdeckt? Was für eine Frage, wir sind ja nicht zu übersehen vom Wald aus. Jeder sieht uns, bevor wir ihn sehen. Nora bellt nicht, wenn sie jemanden kennt. Sie hat den Kopf auf mein Schienbein gelegt, die Augen aber nicht geschlossen. Was machen wir jetzt, frage ich noch einmal. Sie schaut mich weiter aufmerksam an. Du musst uns gesehen haben, und dass das Auto da ist, hast du sicher längst bemerkt. Du wirst warten, vielleicht den Tisch betrachten. Die kleine Motorsäge. Daneben das Wasser im Bierkrug, halb ausgetrunken. Meine Arbeitshandschuhe. Alles sieht aus, als ob ich gleich zurückkomme.
Für gewöhnlich steht der Wald da wie ein weiter, ruhiger See. Ich schaue in seine Tiefe hinein, bis mein Blick in der Verdichtung der Stämme oben an der Halde hängen bleibt. Dort, wo ich die Bäume nicht mehr unterscheiden kann, wo ich aufhöre zu sagen: Das ist die Rinde einer Eiche, das sind die Blätter einer Buche und das die Früchte einer Erle. Oder irgend so etwas. Mein Blick verweilt auf den Stämmen, an klaren Tagen im durch die Kronen schimmernden Licht der Sonne, in klaren Nächten im Mondlicht, das den Wald in hell und dunkel teilt. Ich kann mich darin verlieren, meinen Gedanken folgen oder sie freilassen. Im Wald spiegle ich mich. Im Laub höre ich mich ums Haus gehen, ich bin es, die alle Schritte macht, ich bin es, die hustet, sich schnäuzt; und wenn ich mit mir selbst rede, bin ich das auch. Ich bin der Klang der Axt, der Ton des Spatens in der Erde, am lautesten bin ich im Brüllen der Motorsäge, ich bin der Atem auf den Bohlen der Terrasse, bin die, vor der die Eidechsen sich nicht mehr fürchten, die barfuß ums Haus geht und in Gummistiefeln in den Garten. Und die, die manchmal vergisst, dass sie ein Geräusch ist. Nora folgt mir, aber sie ist leise, manchmal höre ich ihre Krallen auf den Holzdielen, sehr selten bellt sie oder gähnt betont. Manchmal sitzt der rote Kater auf dem Dach des Schuppens. Er lässt sich nicht stören. Der Wald hat seinen Rhythmus und jedes Geräusch seine Zeit. Das Rufen der Käuze, das Bellen der Rehe, das schnelle Schlagen der Wildschweinhufe, wenn die Rotte, vom Berg herabkommend, über den Forstweg zieht, hinunter zum Rand der Lichtung, wo die große Eiche steht. Der frühe Klang der Singdrossel, das Einstimmen der Amseln, der Meisen, des Zilpzalps, der Finken und schließlich aller anderen. Der Wald, wenn er das Erwachen feiert, bis es Tag ist.
Als ich hier hinzog, in diesen Wald, hatte ich Angst. Nicht vor den Tieren. Und auch nicht vor dem Alleinsein, sondern davor, gesehen und gehört zu werden. Ich fühlte mich schwächer, angreifbar. Ich hatte Angst vor meinem Licht in der Dunkelheit, weil man es weithin sehen konnte. Ich hatte Angst vor meiner Gestalt auf dem Grundstück, die mir wie eine Einladung erschien an jede imaginierte Männerfigur hinter jedem möglichen Baum. Ich wäre am liebsten unsichtbar gewesen, gar nicht da als Mensch mit einem Körper. Wenn ich menstruierte, glaubte ich, man könne mich riechen. Förster, Jäger, Holzarbeiter. Schon meine Großmutter hatte Angst vor dem Wald, meine Mutter hatte Angst vor dem Wald, und schließlich hatte auch ich sie. Weil Angst sich vererbt. Als ob der Wald einem Böses wollte, als ob die Gefahr hier größer wäre als in der Stadt. Für eine Frau. Als ob im Wald hinter jedem Busch einer lauert, als ob der Mann ein Wolf ist und die Frau ein Reh. Es ist möglich, sich diese Angst abzutrainieren, ich führe den Beweis selbst. Das sage ich den Mädchen, die das Camp besuchen, und ich sage es auch den Jungen: Dieses Camp ist ein Ort, an dem ihr Dinge üben könnt, von denen ihr vielleicht vorher gar nicht wusstet, dass es euch hilft, sie zu können. Sie machen euch nicht zu besseren Menschen, aber zu bewussteren. Ihr nehmt euch mehr wahr, und ihr nehmt die Natur mehr wahr. Damit seid ihr auf der besseren Seite. Ich sage nicht: Inzwischen lebe ich sogar allein im Wald, und dort ist es mindestens so einsam wie hier im Camp. Ich sage nur: Ihr müsst vor dem Wald weniger Angst haben als vor eurer Fantasie, sie ist mächtiger, als ihr glaubt. Die meisten Jungs lachen, wenn sie das hören, bis heute wird ihnen schon im Kindergarten erzählt, dass sie stark zu sein haben. So sind anscheinend auch ihre Fantasien.
Jede Bewegung fühlt sich unsicher an. Ich sitze noch immer auf dem Boden, Nora atmet ruhig gegen meinen Schenkel. Wenn du auf die Terrasse kommst, wenn du zum Fenster hereinschaust, wenn du vor der Terrassentür stehst, wirst du mich sehen. Ich spüre, wie meine Finger sich einkrümmen wollen, aber so leicht geht das nicht, ich stütze mich mit den Händen auf den Dielen ab. Unter der Treppe hat sich eine Spinne eingenistet, sie bewegt sich schnell, arbeitet an einem langen Faden zwischen den Stufen. Ich könnte sie stören, aber ich lasse es; irgendwann wird sie das Netz von selbst aufgeben, dann kann ich es entfernen. Ich mische mich nur ungern in die Angelegenheiten der Tiere. Wir könnten nach oben gehen, sage ich zu Nora. Und dann denke ich: Unsinn. Das ist mein Grundstück, mein Gelände, das ist mein Haus, mein Zuhause, ich bin hier, und ich entscheide, wer hier sein darf und wer nicht. Und dann: Bin ich verrückt, warum fürchte ich mich vor dir? Eigentlich weiß ich es. Aber das macht es nicht besser, das macht es nicht leichter. Mein Körper verharrt, will sich nicht rühren, ich sitze fest. Ich kann doch nicht, sage ich zu Nora, und ich weiß nicht, wie der Satz zu Ende geht. Und ich weiß es doch. Aber ich kann es nicht sagen. Nora rührt sich nicht. Ich lausche nach draußen, nichts ist zu hören, nicht einmal ein Vogel. Doch, ich höre die Rabenkolonie oben am Kamm. Sind nicht alle Fenster zu, alle Türen? Ich erschrecke, die Tür oben zum kleinen Balkon hin ist geöffnet. Wie einen Einbrecher sehe ich dich über den Brennholzstapel hinaufklettern, fast nicht möglich, das schafft nur eine Katze. Aber du bist ein guter Kletterer, das hat sich schnell herausgestellt im Camp. Es muss nicht immer so sein, nur weil jemand leicht und feingliedrig ist, ist er noch lange nicht so beweglich wie du. Nein, du wirst nicht ins Haus eindringen, dazu bist du viel zu gut erzogen. Nora hebt den Kopf, und wie sie zu lauschen beginnt, schwillt auch mein Puls wieder an, ich spüre ihn links am Hals, ein Klopfen fast bis zum Ohr. Ist er da, frage ich sie, ich flüstere, spüre meinen harten Nacken, ich sitze vollkommen eingesunken da, das merke ich jetzt. Und nichts will sich aufrichten in mir.
Bilder.
Ich selbst als Fünfzehnjährige auf der Sommerfreizeit der Pfadfinder im Zimmer des melancholischen Betreuers. Freiwillig. Ich weiß nicht, was ich da suchte, ich mochte ihn, er unterhielt sich anscheinend gern mit mir, er meinte nur mich, wenn ich da war. Er sah mich. Jedenfalls dachte ich das. Nichts passierte, außer dass ich am falschen Ort war, vor falschen Augen, mit falschen Gesten.
Einmal, es war Fasching, wie ich nach dem letzten Saisonspiel meines Sportteams eine Piratin war. Wie ich im Gasthaus die Laternenmaßkrüge nicht an mir vorbeiziehen ließ, auf meinem Oberschenkel die flinke Wurfhand des Linksaußens aus der Herrenmannschaft, schon nicht mehr auf meinem kurzen Lederrock, und wie ich nicht wusste, ob mir das gefällt, aber es gefiel mir, dass er mich ausgesucht hatte, dass ich es war und keine der anderen. Dabei war er nicht einmal schön. Aber die Nummer eins der Mannschaft. Dass mein Bein es war, das er berühren wollte, meine Rockkante. Ich konnte nicht Nein sagen, deshalb. Wie ich später – und natürlich hatte ich von jedem der Laternenmaßkrüge mitgetrunken, wie es sich gehörte unter Sportsleuten –, wie ich da vor der Toilette auf ihn gestoßen bin. Gestoßen. Drei Treppenstufen höher schob er der Piratin die Finger unter die Strumpfhose, unters Höschen und weiter, blieb da, bohrte, streichelte. Die Piratin ertrug es und knutschte weiter mit ihm. Ich empfand nichts oder habe es vergessen. Es hat nicht viel gefehlt, und der Trainer hätte mich geohrfeigt, als er mich mit dem Linksaußen auf der Treppe entdeckte. Wer also trägt die Schuld? Seinen Teamkollegen hat er weggeschickt. Fotos von mir mit dem Teleobjektiv aufgenommen bei einem Schulfest. Das Zoom auf das Achselhaar des jungen Mädchens gehalten. Mein dunkles Achselhaar. Darüber mein Gesicht, das Gesicht eines Kindes. Wie schlecht es sich anfühlte, mich auf so einem Foto zu sehen. Nur verstand ich nicht, warum, damals. Heute sehe ich den Blick hinter der Kamera, ich sehe den Voyeur. Mehr als fünfundzwanzig Jahre später.
Nora atmet wieder ruhig, ich spüre ihren Herzschlag an den Rippen, ich lausche; ein paar Amseln zwitschern, sprechen miteinander, in der Ferne übt der junge Hahn der Nachbarn das Rufen. Ich höre leise Geräusche aus der Wand, da sind die Hornissen mit ihrem beständigen Raunen, Murren und Summen, ununterbrochen scheinen sie in Kontakt zu sein, als berieten sie den Sommer lang ihr Vorgehen, ihr Leben hier im Haus. Dich höre ich nicht. Ich stelle mir vor, wo du dich hingesetzt hast, draußen. Ich will mir das nicht vorstellen, aber ich muss. Ich sehe dich auf dem Spaltklotz sitzen hinterm Haus im Schatten, deine nackten Knöchel unterm Saum der blauen Cordhose, die du oft getragen hast im Camp, ich sehe dich im weißen T-Shirt, sehe deine gebräunten Arme und wie du mit der linken Hand die Haare aus der Stirn streichst, mit der rechten auf dem Telefon herummachst, mit dieser merkwürdigen Lässigkeit benutzt du deinen langen Daumen, mit dem du dir dann über die Augenbrauen fährst, als müsstest du sie ordnen. Ich sehe, wie du aufschaust, mich anschaust, wie du lächelst, als du mich siehst, wie dein Gesicht leuchtet. Ich schließe meine Augen, für einen Moment schließe ich sie, um dieses Bild nicht zu sehen. Doch es bleibt. Ich spüre, wie meine Züge weich werden, mache eine Grimasse, kneife die Lider zusammen, das Bild verschwimmt. Du musst andere Kleidung tragen heute, das war keine blaue Hose, was ich zwischen den Bäumen hindurch sah, kein weißes T-Shirt. Was habe ich überhaupt gesehen? Eine Gestalt, die Bewegung eines Körpers, jemand hinter den Büschen, der mir bekannt vorkam, und dann nichts mehr. An der Kleidung habe ich dich nicht erkennen können. Aber ich habe dich erkannt, du bist hier, das weiß ich. Wer bist du hier, wo ich zu Hause bin? Ein Eindringling bist du. Willst du das sein? Möchte ich dich hier haben? An meinem Ort, von dem du eigentlich nichts wissen kannst. Vielleicht erkenne ich dich so nicht wieder, vielleicht bist du ein anderer Mensch, wenn ich dich hier sehe, wenn ich hier mit dir allein bin. Ich will überhaupt nicht mit dir allein sein. Ich habe das schon im Camp tunlichst vermieden. Tunlichst ist ein Wort meines Vaters. Er wäre doppelt so alt wie deiner, wahrscheinlich. Zweiundneunzig. Was man alles erbt, was man übernimmt. Vatertochter. Papakind. Meine letzte präzise Erinnerung an ihn – bevor er krank wurde, bevor ihm die Erinnerung abhandengekommen war und seine Logik brüchig wurde –, meine Wut auf ihn, und dass er diese Wut nicht kapierte, als er mir stolz noch einmal die alten Fotos zeigte. Das Gefühl, er kennt seine Grenze nicht. Kannte sie nie. Ein Einschnitt.
Ich fühle mich von mir selbst bedrängt, vom Strom meiner Gedanken, von ihrem Herumschweifen, von ihrer Unermüdlichkeit. Dabei komme ich mir erschöpft vor, wie ich inzwischen auf den Holzdielen liege, noch immer an der gleichen Stelle. Ich weiß nicht, wie viel Zeit seither vergangen ist. Eine halbe Stunde oder mehr? Nora, jetzt mit dem Kopf in meiner Achsel, stupst mit der Schnauze immer wieder meine Wange an, als wolle sie mich trösten. Ich möchte meine Ruhe. Ich möchte mich zurückhaben, so wie ich war bis vor sieben Wochen. Ich wünschte nichts. Zumindest denke ich das. Ich hatte alles. Ich wusste nicht, an wen du mich erinnerst, als du mir begegnet bist. Ich sah deine dunklen Augen, die braunen Locken, deine feinen Glieder und hatte sofort das Gefühl, ich kenne dich irgendwoher, du bist mir ganz vertraut. Zuerst dachte ich, du wärest ein Mädchen. Nein, ich dachte gar nichts. Ich sah ein Mädchen. Aber du bist ein Junge. Ich erinnere mich, ich wollte augenblicklich darüber nachdenken im Camp, woher ich dich kannte und wen ich kannte, an die du mich erinnertest, aber das ging nicht, ich war bei der Arbeit. Immerhin ähnelte deine Stimme keiner, die ich kannte, nur hätte ich sie mir heller vorgestellt; deine Stimme war die eines Jungen nach dem Stimmbruch. Und dieses sanfte Anschlagen der Zunge an den Zähnen mochte ich sofort.
Als ich hier in diesen Wald zog, gab es zunächst niemanden außer mir und dem roten Kater, der sich mir manchmal zuwandte, wie Katzen es tun, und sich von mir abwandte, wie Katzen es tun, der unabhängig war bis auf die Sehnsucht, manchmal ein wenig Futter von mir zu bekommen, das er auch anderswo bekommen würde, wenn ich nicht da wäre. Ein Fuchs frisst am Tag zwanzig Mäuse, und eine Katze braucht wahrscheinlich nicht viel weniger. Aber welche Katze lebt schon ausschließlich von Mäusen. Die anderen Tiere sehe ich, höre ich, aber sie kommen mir nicht nah.
Wenn ich mich dir nicht öffne, denke ich, wirst du einfach wieder gehen. Wenn ich nicht mit dir spreche, kannst du nicht mit mir sprechen. Wenn ich mich dir nicht zeige, kannst du mich nicht sehen. Wenn ich mich dir nicht hingebe, kannst du mich nicht nehmen. Ich erschrecke bei diesem Gedanken.
Aus einer der Ritzen zwischen den Dielen klettert ein schwarzer Marienkäfer hervor. Er hat nur drei rote Punkte. Es gibt hier unendlich viele von dieser schön ausschauenden Plage. Weil die schwarzen anscheinend mehr stinken als die anderen, haben sie weniger Fressfeinde, und weil es ihnen des dunklen Gewands wegen schneller warm wird, werden sie im Frühling schneller wach und aktiv. Und weil das so ist, haben sie wahrscheinlich mehr Nachkömmlinge. Immer hängt alles mit allem zusammen. Auch bei den Tieren. Und obwohl es so viele hier im Haus gibt, kann ich sie nicht töten. Ich mag ihre glänzenden Panzer, die zu Flügeln werden können. Sie wohnen in den Wänden, im Winter leben sie ganz aus sich selbst heraus.
Ich weiß nicht, ob ich mich hier jemals einsam gefühlt habe. Ich wache auf, wenn die Sonne aufgeht, und ich werde müde, wenn sie untergeht. Dazwischen bin ich, und dazwischen ist meine Arbeit. Die am Haus, die im Garten und die im Camp. Ich bin zweiundvierzig Jahre alt. Alt genug, um entscheiden zu können, was ich möchte und was nicht, weil ich alles erlebt habe, was nötig war, um jetzt zu wissen, ich möchte es so und nicht anders, auf keinen Fall anders.
Bilder.
Ich war zehn, als ich mich zum ersten Mal für ein anderes Mädchen interessierte, für den Körper des anderen Mädchens, und ich war zehn, als ich mich zum ersten Mal für den Körper eines Jungen interessierte, und dann hörte das nicht mehr auf. Ich war elf oder zwölf, da kannte ich bereits die Körper von Liese und von Anton und von Florian und von Enders, und ich wusste, was im Bauch passierte, wenn man den eigenen Körper an denen der anderen rieb, und was im Herz passierte auch. Und dass ich beten musste, wenn ich nicht in die Hölle kommen wollte, mein Körper nicht im Fegefeuer landen sollte. Das glaubte ich eine Zeit lang, aber etwas in mir war stärker. Ich küsste und rieb mich, und ich betete. Mit zwölf Jahren küsste ich zum ersten Mal leidenschaftlich mit Zunge. Mit dreizehn noch leidenschaftlicher, mit vierzehn war ich verliebt, fasste einem Jungen in die Hose. Er war ein Jahr älter als ich und hatte Angst vor mir. Ich wollte nicht, dass jemand Angst vor mir bekam. Er war schön. Ich begehrte seinen schönen Körper, der den meinen nicht begehrte. Irgendwann, nach Jahren, hörte ich auf zu beten, rieb mich weiter und mehr und öfter, und so war das auch mit dem Küssen.
Ich möchte einmal mit dir in meinem Bett liegen, einfach nur so. Ein Satz. Die Einladung vom melancholischen Betreuer bei den Pfadfindern. NEIN! Und Schluss. Scham, bis heute über diesen Antrag. Selbst schuld, ein Gefühl, bis heute. Weil ich mich ihm anvertraut habe mit allen Ängsten. Als Mädchen, als Siebzehnjährige. Ab dann wollte ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Gar nichts. Nie mehr. Bis heute bin ich diese scheinheilige kleine Verführerin, die nur gesehen werden will: Vor mir selbst bin ich das, bis heute. Ich muss nicht mehr gesehen werden.
Die Spinne hat das Netz nicht nur vergrößert, es ist auch dichter geworden und spannt sich über einen Neunziggradwinkel unterhalb der Treppe. Die Spinne arbeitet im Moment nicht. Ich weiß nicht, worauf sie wartet. Ich beobachte den Käfer, der immer noch die Kante der Holzdiele entlangläuft, aber den kann sie nicht sehen. Immer wieder verschwindet der Käfer in der Ritze zwischen den Dielen, und wenn er hervorkommt, reckt er die Flügel, als wolle er abheben. Und senkt sie wieder. Wenn er weitergeht, wenn er immer weiter diese Diele entlanggeht, genau in diese Richtung, wird er unter der Treppe ankommen, ganz nah bei der Spinne. Die ihn dann sehen wird, die ihn beobachten wird, so wie ich ihn gerade beobachte, die ihn bereits dann riechen wird und vielleicht wissen: Er schmeckt nicht. Oder aber so verzückt sein von der leuchtenden Schönheit, dass sie hoffen wird, er erklimmt dort, wo die Diele endet, die Wand zu ihrem Versteck hinauf. Sie beobachtet ihn, so wie du mich gerade beobachtest. Ich erschrecke. Wenn du mich sehen könntest, würde ich es spüren. Wo hast du dich hingesetzt, um zu warten? Lass mich einfach in Ruhe, sage ich leise. Nora schaut kurz auf. Nichts, sage ich zu ihr, ich schüttle den Kopf, sie senkt ihren wieder. Der Käfer nähert sich. Ich sehe ihn bereits ins Netz gehen, ich spüre sogar, wie sich in mir so etwas wie Freude regt bei diesem Gedanken. Ich schäme mich dafür. Der rote Kater fängt manchmal Eidechsen. Ich schaue zu, wie er sie quält. Ich kann nicht wegsehen. Er jagt ihnen die Krallen in ihre zarte Haut, wirft sie in die Luft, schnappt sie wieder, wenn sie fallen, lässt sie einen Augenblick rennen, sich verstecken und weiß, sie werden sich wieder zeigen. Ich schaue zu, ich tue nichts, obwohl ich möchte, dass die Eidechsen überleben, aber ich schaue auch zu, weil mich das fasziniert, was die Katze, dieses der Eidechse so übermächtige Tier, da treibt.
Ob du wieder gegangen bist? Ich habe die Tür am Balkon geschlossen. Ich bin dafür ins Obergeschoss hinaufgegangen und Nora hinterher. Hier kannst du uns nicht sehen. Wir liegen trotzdem auf dem Boden, auf dem Bauch, Nora an meine Hüfte geschmiegt. Über den Balkon hinab sehe ich, wie die Buchentriebe sich ausbreiten und die Brombeeren. Ich muss sie schneiden, sie bewachsen sonst das Haus über die Dachrinne hinaus. Die Triebe der Brombeeren sind hartnäckig, sie gelangen auch unter die Dachziegel.
Bilder.
Damals stand ich vor dem Spiegel im Bad unseres Ferienhauses an der spanischen Riviera. Mein zwölfjähriger Körper in Adidas-Shorts, wie sie Haile Gebrselassie bei den Olympischen Spielen trug, wie sie danach alle trugen, die ihn verehrten, auch die Handballerinnen, wie ich eine war, wie auch mein Vater einmal einer war, aber im Gegensatz zu ihm war ich nicht gut genug, zu scheu im Kontakt, zu ausweichend, nicht aggressiv genug gegen die Gegnerinnen. Damals in diesem kleinen weißen Haus mit dem flachen Dach stand ich mit nichts als diesen roten knappen Gebrselassie-Shorts bekleidet vor dem Badezimmerspiegel, allein und sicher, und betrachtete meine sprießenden Brüste, die mir noch sehr eigenartig vorkamen und nicht recht zu mir gehörig, als er anscheinend mit der Fotokamera hinter mir stand und meinen Rücken und mich, in mir selbst versunken, im Spiegel aufnahm: Ich habe es nicht einmal bemerkt. Erst als ich die Bilder zu Gesicht bekam, fühlte ich einen Vertrauensbruch, der mir schrecklich erschien. Der nicht wiedergutzumachen war, weil ich lange nicht darüber sprechen konnte, weil ich erst bereit war, mit ihm zu sprechen, als er mir die Bilder noch einmal zeigte, aber schon nicht mehr gut denken konnte. Es ist nie zu spät. Doch. Für manches ist es irgendwann zu spät.
Der Specht schlägt ans Haus, er macht das so häufig, dass Nora nicht einmal mehr den Kopf hebt. Der Specht ist ein Geräusch, wie die Waschmaschine ein Geräusch ist. Wie der Herzschlag ein Geräusch ist. Immer wieder hämmert der Vogel seinen Schnabel ins Holz. Vermutlich ist es der Schwarzspecht, der oben in den Buchen seine Höhle hat, er ist scharf auf Käfer, die gut schmecken, und auf die Holzameisen, die jeden Frühsommer eine Straße über die alten Balken des Hauses und an der Wand der Küche entlangziehen, bis sie irgendwann wieder verschwunden sind. Das alte Haus ist ein Insektenparadies und damit auch eines für die Vögel, die sie fressen. Wenn du draußen auf dem Spaltklotz säßest, wäre der Specht sicher vorsichtiger. Kurz hat ein Eichelhäher Alarm geschlagen, aber das war weit weg. Sonst ist da nichts. Wärst du da, wir müssten dich doch hören. Ich kann alles denken, nur nicht das. Dass du meinetwegen hier auftauchst. Hast du nur eine Frage? Brauchst du Hilfe? Dann kannst du auch anrufen. Im Camp. Sagen, dass du mich sprechen willst. Ob ich dich zurückrufen kann? Würde ich dich denn zurückrufen? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht mehr, dass sich jemand in mich verliebt. Das muss man doch merken, das musst du doch gemerkt haben. Sitzt du vor der Tür und wartest? Sitzt du da und denkst, sie wird schon herauskommen irgendwann. Der Hund wird vor die Tür müssen. Ja, so wird es sein, Nora wird vor die Tür müssen.
Ein Camp im Wald für Jugendliche, wer braucht denn so etwas? Hat meine Mutter gesagt. Die Jugendlichen, was glaubst du, wie viele Stadtkinder noch niemals im Wald waren? Mutter konnte sich das nicht vorstellen, jedes Schulkind muss doch beim Wandern durch den Wald laufen, an der Grillstelle wird Feuer gemacht, werden die Würstchen an Stecken gebraten, bis sie fast schwarz sind. Du irrst dich, habe ich gesagt. Ich habe Kinder kennengelernt, die waren mit elf oder zwölf Jahren noch kein einziges Mal im Wald. Die können gerade einmal eine Katze von einem Fuchs unterscheiden. Eine Krähe von einer Meise. Aber die kennen außer Weihnachtsbaum kein einziges Baumwort. Äpfel wachsen im Supermarkt. Mutter hat mich ausgelacht. Allein hätte ich das niemals begonnen. Wieso soll eine Frau als Pädagogin in der Psychiatrie, wo die Türen meist abgeschlossen sind, wo positive Veränderung in Gramm und nachlassenden Zwangsgedanken und Zwangshandlungen gemessen wird und wo Natur aus dem Kastanienbaum vor dem Fenster besteht, so eine grundlegende Entscheidung treffen?
Am Hang hinter dem Haus, dort, wo der Wald ansteigt hinauf auf die Höhe des Forstwegs und dann zum Gipfel des Geigers, riecht es an Sommertagen wie heute zwischen den Kiefern ein bisschen wie unter französischen Pinien. Ihr Harz erwärmt sich in der Sonne, es dunstet aus und erfüllt die Luft mit diesem ätherischen Duft, der einen sofort mit Fernweh erfüllt. Als wäre das Leben irgendwo besser als da, wo man ist. Es ist paradox, ich habe alles, was ich brauche, hier im Haus, im Wald, aber an klaren Tagen, wenn der Himmel tiefblau über den Kiefern, über den Buchen, den Eschen und Wildkirschen, über der großen Eiche am Haus und der Erle steht, wenn die Luft erfüllt ist vom Geruch des Waldes, wenn die Sonne das trockene Laub, die Nadeln, die letzten Eicheln, die die Rehe im Winter nicht gefunden haben, die Schalen der Bucheckern, die Zapfen auf dem Waldboden erwärmt, alles bei jedem Schritt, den ich mache, bröselnd knirscht und sich dieser unnachahmliche Geruch von Sommerwald verströmt, dann sehne ich mich ans Meer. Immer wieder, immer noch. Wie merkwürdig ist der Mensch.
Hast du dich etwa in mich verliebt? Wie dumm man in seiner Verliebtheit sein kann. Das verstehe ich bis heute nicht. Vor meinen Augen Bilder. Ich schließe die Augen. Das hilft gar nichts. Ein Mann taucht auf, ein Gesicht, eine Heiterkeit, ein Name, kein Körper, eine Stimme, ein Bild, unscharf, ein Zimmer, sein Zimmer, ein Bett, das eine Matratze ist auf dem Fußboden, ein Geruch. Wie unmöglich es ist, so etwas auszulöschen: ein Geruch, als sei das Bettzeug seit Wochen nicht gewaschen. Das falsche Bett. Die Flucht aus dem Geruch, das Erschrecken, wie es passieren kann, in so einem Bett zu landen, in so einem Geruch. Ort, den ich sofort vergessen will. Scham, die bleibt. Wie kann ich mich so täuschen? Und doch auch Erleichterung. Ich habe das Bett rechtzeitig verlassen. Der Weg nach Hause im Dunkeln in größter Verstörung. Die Tränen zu Hause in der Wohngemeinschaft, die Frage einer Freundin: Wofür bist du blind? Und du? Siehst du nicht, dass ich sechsundzwanzig Jahre älter bin als du? Und wie zum Widerspruch kommt sofort die nächste Erinnerung. Mit Marcus mitten in der Nacht, eingepackt in warme Mäntel, im noch jungfräulichen Schnee der großen Stadt, die schon schlief, als wir noch einmal hinausgingen; um Spuren zu hinterlassen, nur deshalb. Eine echte Liebe, trotz mehr als zwanzig Jahren, die uns trennten; neben dem Begehren die vielen zärtlichen Gesten, der Versuch, die Mitte zwischen den trennenden Jahren zu finden. Annäherung. Ich kneife die Augen zusammen. Was bleibt in der Rückschau übrig? Und wer? Ich schüttle mich. Nora ist aufgesprungen. Sie schaut mich an. Setz dich hin, sage ich zu ihr. Sie tut immer, was ich sage. Das müsste sie nicht.
Wer kommt hier vorbei außer dem Förster, dem Jäger, dem Waldbauern mit dem hellblauen Traktor, dem Paar mit den beiden Alpakas, die sie an der Leine führen wie Hunde? Einmal fuhr ein Wagen mit einem tschechischen Kennzeichen den Waldweg hinauf und nach einer halben Stunde wieder hinab. Drei Nächte lang habe ich danach mit dem großen Küchenmesser neben dem Bett geschlafen. Habe ich überhaupt geschlafen? Ich muss das lernen, ich darf mich nicht sofort von etwas Fremdem bedroht fühlen, dachte ich damals. Nun bin ich seit fünf Jahren hier im Wald, ich habe es gelernt. Seit Nora da ist, fühle ich mich noch sicherer, sie ist mein Bewegungsmelder, meine Alarmanlage, ihr kann ich vertrauen. Warum spreche ich eigentlich die ganze Zeit mit dir? Als hättest du dich schon eingenistet in mir.