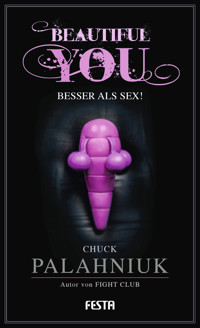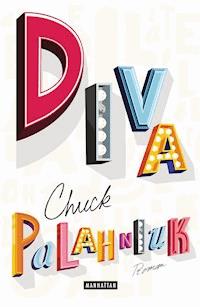5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Grotesk, obszön, faszinierend. Geschichten wie Offenbarungen. Du kannst sie nie mehr vergessen … Durch die Romanvorlage von FIGHT CLUB wurde Chuck Palahniuk weltberühmt. JETZT BIST DU DRAN! präsentiert 22 Meisterwerke seiner Erzählkunst. Es geht um die geldgeile Gesellschaft, Selbstverstümmelung, Drogen, Geschlechtsverkehr mit neuen Lebensformen und um andere Unkeuschheiten. Fans des Kultautors werden entzückt sein. Und sollte es noch Leser geben, die ihn nicht kennen, seien sie ausdrücklich gewarnt: Chuck Palahniuk schrieb einige der verstörendsten Bücher aller Zeiten. Ihn zu lesen erweitert das Bewusstsein. Wienerin: »Palahniuk ist ein Genie!« San Francisco Chronicle Book Review: »Falls jemand Kurt Vonnegut den Rang in der amerikanischen Gegenwartsliteratur ablaufen kann, dann ist es Chuck Palahniuk.« Sonntagszeitung: »Mit lakonischer Schärfe knöpft sich Palahniuk thematisch immer wieder aufs Neue die Familie vor und spiegelt in ihr die Verwerfungen der amerikanischen Gesellschaft. Konsequenterweise nannte ein Kritiker Palahniuk den ›Leichenbeschauer des 20. Jahrhunderts‹, seine Romane ›Autopsieberichte einer an Übersättigung verendeten Kultur‹. Kollegen wie Bret Easton Ellis trauen ihm sogar die Nachfolge von Ikonen wie Thomas Pynchon und Don DeLillo zu.« FESTA MUST READ: Große Erzähler ohne Tabus. Muss man gelesen haben. FESTA MUST READ erscheinen als Hardcover mit Leseband und einem Schutzumschlag in der Festa-Lederoptik (robust und bibliophil).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Manfred Sanders
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe
Make Something Up: Stories You Can’t Unread
erschien 2015 im Verlag Doubleday.
Copyright © 2015 by Chuck Palahniuk
© dieser Ausgabe 2016 by Festa Verlag, Leipzig
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-503-1
www.Festa-Verlag.de
Inhalt
Impressum
KLOPF-KLOPF
ELEANOR
WIE DIE ÄFFIN HEIRATETE, EIN HAUS BAUTE UND IN ORLANDO IHR GLÜCK FAND
ZOMBIES
LOSER
RED SULTAN’S BIG BOY
ROMANZE
CANNIBAL
WARUM DER KOJOTE NIE KLEINGELD FÜRS PARKEN HATTE
PHÖNIX
AUFKLÄRUNG
KALTAKQUISE
DER KRÖTENPRINZ
RAUCH
ZÜNDLER
LITURGIE
WARUM DAS ERDFERKEL NIE AUF DEM MOND LANDETE
APPORT
EXPEDITION
MISTER ELEGANT
LIEBESTUNNEL
NEIGUNGEN
WIE EINE JÜDIN DAS WEIHNACHTSFEST RETTETE
Chuck Palahniuk
Entdecke die Festa-Community
KLOPF-KLOPF
Mein alter Herr kann aus allem einen großartigen Witz machen. Was soll ich sagen – er bringt nun mal gerne die Leute zum Lachen. Als Kind habe ich die Hälfte seiner Witze nicht kapiert, aber ich grölte trotzdem. Wenn er zum Friseur ging, hat er immer die anderen vorgelassen – es war ihm egal, er wollte nur den ganzen Samstag dasitzen und den Leuten Witze erzählen. Sie zum Grölen bringen. Sich die Haare schneiden zu lassen, war ihm nicht so wichtig.
Er sagt: »Unterbrecht mich, wenn ihr den schon kennt …« So erzählt mein alter Herr, wie er ins Büro des Onkologen geht und fragt: »Nach der Chemo – kann ich dann noch Geige spielen?«
Der Onkologe gibt zur Antwort: »Er ist metastasiert. Sie haben noch sechs Monate zu leben …«
Und indem er mit seinen Augenbrauen zuckt wie Groucho Marx und Asche von einer imaginären Zigarre abklopft, fragt mein alter Herr: »Sechs Monate? Ich will ein zweites Gutachten.«
Und der Onkologe erwidert: »Okay, Sie haben Krebs und Ihre Witze so einen Bart.«
Und so verpassen sie ihm die übliche Chemotherapie und Bestrahlung, auch wenn der Mist ihn innerlich so übel verbrennt, dass er jedes Mal, wenn er pinkeln geht, das Gefühl hat, Rasierklingen zu pissen. Er ist immer noch jeden Samstag unten im Friseurladen und erzählt Witze, obwohl er jetzt so kahl ist wie eine Billardkugel. Und er ist mager wie ein kahlköpfiges Skelett und muss ständig eine dieser Sauerstoffdruckflaschen auf Rollen hinter sich herschleppen wie eine Sträflingskugel. Er kommt in den Friseurladen, hinter sich die Sauerstoffflasche, deren Schlauch nach oben um seine Nase, über seine Ohren und um seinen völlig kahlen Schädel führt, und er sagt: »Nur ein bisschen die Spitzen schneiden, bitte.« Und die Leute lachen. Versteht mich nicht falsch: Mein alter Herr ist kein Uncle Milty. Er ist kein Edgar Bergen. Der Mann ist klapperdürr wie ein Halloween-Skelett und hat keine Haare mehr und wird in sechs Wochen tot sein, deshalb ist es scheißegal, was er sagt, die Leute wiehern auf jeden Fall wie die Esel, allein weil sie ihn so mögen.
Aber im Ernst, ich tue ihm unrecht. Es ist meine Schuld, wenn es nicht richtig rüberkommt, aber mein alter Herr ist lustiger, als es klingt. Sein Sinn für Humor ist ein Talent, das ich anscheinend nicht geerbt habe. Damals, als ich sein kleiner Charlie McCarthy war, jung und grün hinter den Ohren, da pflegte er zu fragen: »Klopf-klopf?«
Ich sagte: »Wer ist da?«
Er sagte: »Die Lady dort …«
Ich fragte: »Die Lady wo?«
Und er sagte: »Wow, ich wusste gar nicht, dass du jodeln kannst!«
Und ich, ich begriff es nicht. Ich war so dumm, ich war sieben und noch in der ersten Klasse. Ich konnte die Schweiz nicht von Shinola unterscheiden, aber ich wollte, dass mein alter Herr mich liebt, also lernte ich zu lachen. Was immer er sagt – ich lache. Mit der »Lady«, so glaubte ich damals, meint er meine Mom, die weggelaufen ist und uns alleingelassen hat. Alles, was mein alter Herr über sie sagt, ist, dass sie eine »Granate« war und bloß keinen Sinn für Humor hatte. Sie war eine echte Spielverderberin.
Er fragte mich: »Als Vinnie van Gogh sich das Ohr abschnitt und an diese Nutte schickte, auf die er so scharf war, wie hat er es geschickt?«
Die Pointe lautet: »Mit der Ohrpost«, aber ich mit meinen sieben Jahren wusste natürlich weder, wer van Gogh war, noch was eine Nutte ist, aber nichts ruiniert einen Witz schneller, als meinen alten Herrn darum zu bitten, ihn zu erklären. Wenn er also sagte: »Was bekommt man, wenn man Graf Dracula mit einem Schimmelpilz kreuzt?«, dann fragte ich besser nicht: »Was ist ein ›Graf Dracula‹?«, sondern hielt mich bereit, laut loszuprusten, wenn er selbst die Antwort gab: »Einen Schwammpir!«
Und wenn er sagt: »Klopf-klopf …«
Und ich frage: »Wer ist da?«, und er sagt: »Lasse.«
Und ich: »Welcher Lasse?«, und er fängt schon an zu wiehern, als er antwortet: »Lasse doch jammern, ich fick sie von hinten …« Dann – scheiß drauf – lache ich einfach los. Während meiner ganzen Kindheit war ich davon überzeugt, dass ich nur zu blöd war, einen guten Witz zu würdigen. In der Schule hatten wir noch nicht mal schriftliche Division und die ganzen Multikomplikationstabellen, deshalb ist es nicht die Schuld meines alten Herrn, dass ich nicht weiß, was »ficken« bedeutet.
Meine Mom, die uns verlassen hat – er sagt, dass sie diesen Witz hasste, also habe ich vielleicht ihren Mangel an Humor geerbt. Aber Liebe … ich meine – man muss doch seinen alten Herrn lieben. Ich meine – es ist ja nicht so, dass man eine Wahl hätte, nachdem man geboren wurde. Niemand will seinen alten Herrn aus einer Sauerstoffflasche atmen sehen, oder wie er ins Krankenhaus geht, um vollgepumpt mit Morphium zu sterben, und wie er nicht mal einen Bissen von dem roten Wackelpudding isst, den es zum Nachtisch gibt.
Unterbrecht mich, wenn ich euch den schon erzählt habe: Aber mein alter Herr hat diesen Prostatakrebs, der nicht mal richtig wie Krebs ist, denn es dauert 20, 30 Jahre, bevor wir überhaupt wissen, dass er so krank ist, und dann ist es plötzlich so weit und ich versuche mich an all die Dinge zu erinnern, die er mir beigebracht hat. Zum Beispiel wenn man ein bisschen Rostlöser auf die Schaufel sprüht, bevor man ein Loch gräbt, dann geht das Graben viel leichter. Und er hat mir beigebracht, dass man einen Abzug drückt, anstatt daran zu ziehen und damit die Waffe zu verreißen. Er hat mir beigebracht, wie man Blutflecken beseitigt. Und er hat mir Witze beigebracht … Unmengen an Witzen.
Und klar, er ist kein Robin Williams, aber ich habe mal diesen Film gesehen, wo sich Robin Williams mit einem roten Gummiball auf der Nase verkleidet und mit einer knallbunten Afroperücke und diesen riesigen Clownsschuhen und einer falschen Nelke im Knopfloch, aus der Wasser spritzt, und er ist so ein Klassedoktor, der die ganzen kleinen Kinder, die Krebs haben, so doll zum Lachen bringt, dass sie aufhören zu sterben. Ja, ganz genau: Diese kahlköpfigen Kinderskelette – die schlimmer aussehen als mein alter Herr –, sie werden GESUND, und der ganze Film basiert auf einer wahren Begebenheit.
Was ich meine, ist: Wir wissen alle, dass Lachen die beste Medizin ist. Bei so viel Zeit, die ich im Wartesaal des Krankenhauses verbringen musste, habe ich sogar Reader’s Digest gelesen. Und wir kennen doch alle die wahre Geschichte von dem Typen mit diesem Gehirntumor im Schädel, so groß wie eine Grapefruit, und er ist kurz davor, seinen letzten Seufzer zu tun – alle Ärzte und Priester und Experten sagen, dass er es nicht mehr lange machen wird –, aber er zwingt sich dazu, sich nonstop Filme von den Drei Stooges anzusehen. Dieser Krebs-im-Endstadium-Typ zwingt sich, nonstop über Abbot und Costello und Laurel und Hardy und die Marx Brothers zu lachen, und er wird geheilt von den ganzen Endoofinen und dem oxygierten Blut.
Also sage ich mir: Was habe ich zu verlieren? Alles, was ich tun muss, ist, mich an ein paar von den Lieblingswitzen meines alten Herrn zu erinnern und dafür zu sorgen, dass er sich auf den Weg der Besserung lacht. Was soll es schon schaden, sage ich mir.
Also geht dieser erwachsene Sohn in das Sterbezimmer seines Vaters, zieht sich einen Stuhl neben das Bett und setzt sich. Der Sohn schaut in das bleiche, sterbende Gesicht seines Vaters und sagt: »Da kommt diese Blonde in eine Kneipe, wo sie vorher noch nie war, und sie hat Titten bis HIER und einen knackigen kleinen Arsch, und sie bestellt an der Theke ein Budweiser, und der Barkeeper serviert ihr ein Budweiser, nur dass er ihr vorher K.-o.-Tropfen in die Flasche tut, und die Blonde wird ohnmächtig, und die Typen in der Bar legen sie auf den Billardtisch und schieben ihren Rock hoch und ficken sie der Reihe nach, und als der Laden dichtmacht, wecken sie sie mit ein paar Ohrfeigen und sagen ihr, sie muss jetzt gehen. Und alle paar Tage kommt diese Schnitte mit den geilen Titten in die Kneipe und bestellt ein Budweiser und bekommt K.-o.-Tropfen und wird von den Kerlen gefickt, bis sie eines Tages reinkommt und den Barkeeper bittet, ihr heute stattdessen ein Michelob zu geben.«
Zugegeben – ich habe diesen ziemlich langatmigen Witz nicht mehr gebracht, seit ich in der ersten Klasse war, aber mein alter Herr hat den nächsten Teil immer besonders geliebt …
Der Barkeeper lächelt scheißfreundlich und fragt: »Was? Mögen Sie kein Budweiser mehr?«
Und die Schnitte, sie beugt sich verschwörerisch über die Theke und flüstert: »Erzählen Sie es nicht weiter …«, flüstert sie, »aber von Budweiser tut mir immer die Möse weh …«
Als ich diesen Witz lernte, als mein alter Herr ihn mir beibrachte, da wusste ich nicht, was »Möse« bedeutet. Ich wusste nicht, was »K.-o.-Tropfen« sind. Ich wusste nicht, was die Leute meinten, wenn sie von »ficken« redeten, aber ich wusste, dass dieses ganze Gerede meinen alten Herrn zum Lachen brachte. Und als ich mich im Friseurladen hinstellen und den Witz erzählen musste, da lachten die Friseure und die ganzen alten Männer mit ihren Detektivzeitschriften so laut los, dass der Hälfte von ihnen Spucke und Schnodder und Kautabak aus der Nase spritzten.
Und jetzt erzählt der erwachsene Sohn seinem alten, sterbenden Vater diesen Witz, ganz allein mit ihm in diesem Krankenzimmer, tief in der Nacht, und – stellt euch vor – der alte Herr lacht nicht. Also versucht der Sohn es mit einem anderen Lieblingswitz, er erzählt den von dem Vertreter, der einen Anruf von einer Farmerstochter erhält, die er vor ein paar Monaten unterwegs kennengelernt hat, und sie sagt: »Erinnerst du dich noch an mich? Wir hatten viel Spaß, und du hast gesagt, ich wäre ein prima Kumpel«, und der Mann sagt: »Wie geht’s dir?«, und sie sagt: »Ich bin schwanger und werde mich umbringen.« Und der Vertreter sagt: »Wow … du bist wirklich ein prima Kumpel!«
Mit sieben konnte ich den Witz wirklich gut rüberbringen – aber heute Nacht liegt mein alter Herr einfach da und lacht immer noch nicht. Ich habe gelernt, »Ich liebe dich« zu sagen, indem ich für meinen alten Herrn gelacht habe – auch wenn ich es meistens vorspielen musste –, und das ist es doch nur, was ich zurückgeben will. Alles, was ich von ihm will, ist ein Lachen, nur ein einziges Lachen, und er rückt nicht mal ein Kichern raus. Kein Glucksen. Nicht mal ein Stöhnen. Und noch schlimmer als das Nichtlachen ist, dass mein alter Herr die Augen zupresst, ganz fest, und sie wieder öffnet, und sie sind voller Tränen, und eine fette Träne rollt aus jedem Auge und läuft die Wange hinab. Der alte Mann keucht mit seinem großen zahnlosen Mund, als würde er nicht genug Luft bekommen, und weint dicke Tränen in die Falten seiner Wangen, bis sein Kissen ganz nass ist. Und dieser Junge – der kein kleiner Junge mehr ist, längst nicht mehr – greift in seine Hosentasche und holt eine falsche Nelke heraus, mit der er aus Spaß an der Freude Wasser ins Gesicht der alten Heulsuse spritzt.
Der Junge erzählt von dem Polacken, der mit seinem Gewehr durch den Wald geht und da auf diese nackte Frau trifft, die mit gespreizten Beinen auf einem Bett aus weichem, grünem Moos liegt, und die Puppe sieht echt gut aus, und sie sieht den Polacken und seine Kanone an und fragt: »Was machst du hier?« Und der Polacke sagt: »Ich suche was zum Schießen.« Und die geile Puppe, sie zwinkert ihm heftig zu und sagt: »Du kannst bei mir zum Schuss kommen.«
Also – BAMM! – erschießt der Polacke sie. Dieser Witz hat immer ein solides, todsicheres, brüllendes Gelächter hervorgerufen, doch mein alter Herr liegt nur weiter da und stirbt. Immer noch weint er, macht nicht mal den Versuch, zu lachen, aber was ich auch tue, der alte Mann muss mir auf halber Strecke entgegenkommen. Ich kann ihm nicht helfen, wenn er nicht mehr leben will. Ich frage ihn: »Was bekommt man, wenn man eine Schwuchtel mit einem Juden kreuzt?« Ich frage: »Was ist der Unterschied zwischen Hundescheiße und einem Nigger?«
Und es geht ihm immer noch nicht besser. Ich überlege, dass sich der Krebs vielleicht auf seine Ohren ausgebreitet hat. Mit dem Morphium und dem ganzen Zeug kann er mich vielleicht gar nicht hören. Also, nur um zu testen, ob er mich hört, beuge ich mich vor in sein Heulsusengesicht und frage: »Wie kriegt man eine Nonne schwanger?« Und dann, lauter, vielleicht etwas zu laut für dieses Katholen-Krankenhaus, schreie ich: »Man FICKT sie!«
In meiner Verzweiflung versuche ich es mit Schwulenwitzen und Mexikanerwitzen und Judenwitzen – wirklich mit jeder wirksamen Behandlungsmethode, die der medizinischen Wissenschaft bekannt ist –, aber der Alte stirbt immer weiter. Hier vor mir, in diesem Bett, liegt der Mann, der aus ALLEM einen Witz machen konnte. Schon allein die Tatsache, dass er nichts mehr isst, jagt mir eine Scheißangst ein. Ich schreie: »Klopf-klopf!«, und als er nichts darauf erwidert, ist es genauso, als hätte er keinen Puls mehr. »Klopf-klopf!«, brülle ich.
Ich schreie: »Warum überquert der Existenzialist die Straße?«
Und er stirbt IMMER noch, mein alter Herr lässt mich zurück ohne eine Antwort auf irgendetwas. Er lässt mich im Stich, obwohl ich immer noch so verdammt dumm bin. In meiner Verzweiflung nehme ich die schlaffen blauen Finger seiner eiskalten sterbenden Hand, und er zuckt nicht mal zusammen, als ich einen batteriebetriebenen Handschocker gegen die blaue Haut seiner frostigen Handfläche drücke. Ich schreie: »Klopf-klopf?«
Ich schreie: »Warum hat die Lady ihren Mann und ihren vierjährigen Sohn verlassen?«
Nichts ruiniert einen Witz zuverlässiger, als meinen alten Herrn zu bitten, ihn zu erklären, und jetzt liegt er da in seinem Bett, hört auf zu atmen. Kein Herzschlag. Nichts mehr.
Und so nimmt der Junge, der in diesem Krankenhauszimmer so spät neben dem Bett sitzt, das Scherzartikel-Äquivalent zu diesen elektrischen Paddeln, mit denen Ärzte einen Herzstillstand kurieren, das Haha-Pendant zu dem, was ein Robin-Williams-Sanitäter in einer Clown-Notaufnahme benutzen würde – eine Art Slapstick-Defibrillator –, der Junge nimmt also eine große, cremige, doppelstöckige Torte mit einer fetten Schicht Sahne obendrauf, eine von der Sorte, mit der Charlie Chaplin einem das Leben retten würde, und der Junge holt mit der Torte aus, so hoch wie er kann, und klatscht sie runter, feste, blitzschnell, wie einen Dunking oder einen Schuss aus der Schrotflinte des Polacken – BAMM! –, mitten in die Fresse seines alten Herrn.
Und ungeachtet der wundersamen, wohldokumentierten Heilkräfte der Komödienkunst stirbt mein alter Herr mit einem letzten, dicken blutigen Schiss in sein Bett.
Nein, wirklich: Es ist lustiger, als es klingt. Bitte macht meinem alten Herrn keinen Vorwurf. Falls ihr jetzt immer noch nicht lacht, dann ist es meine Schuld. Ich habe es nur nicht richtig erzählt, ihr wisst ja, wenn man die Pointe versaut, kann man den besten Witz ruinieren. Zum Beispiel als ich zurück in den Friseurladen gegangen bin und ihnen erzählt habe, wie er gestorben ist und wie ich versucht habe, ihn zu retten, bis hin zu der Sache mit der Torte und wie die Securityleute des Krankenhauses mich in die Klapse gebracht haben zu einer 72-stündigen Beobachtung. Und sogar als ich diesen Teil erzählte, habe ich es vermasselt – denn die Jungs im Friseurladen haben mich nur angeglotzt. Ich erzählte, wie mein alter Herr aussah – und roch –, tot und vollgeschmiert mit Blut und Scheiße und Schlagsahne, der ganze Gestank und der Zucker, und sie glotzten mich nur an, die Friseure und die alten Tabak kauenden Männer, und keiner lachte. Im gleichen alten Friseursalon stehe ich, all die Jahre später, und ich sage: »Klopf-klopf.«
Die Friseure hören auf, Haare zu schneiden. Die alten Trottel hören auf, ihren Kautabak zu kauen.
Ich sage: »Klopf-klopf?« Niemand atmet und es ist, als stünde ich in einem Raum voller toter Männer. Und ich sage: »Der Tod! Der TOD ist hier! Lest ihr Leute denn nicht Emily … Dickerson? Habt ihr noch nie von Jean-Paul … Stuart gehört?« Ich wackle mit den Augenbrauen und klopfe die Asche von meiner imaginären Zigarre und sage: »Wer ist da?« Ich sage: »Ich weiß nicht, wer da ist – ich kann noch nicht mal Geige spielen!«
Was ich allerdings weiß, ist, dass ich ein Gehirn voller Witze habe, die ich nicht vergessen kann – wie ein Tumor im Schädel, so groß wie eine Grapefruit. Und ich weiß, dass letzten Endes sogar Hundescheiße weiß wird und aufhört zu stinken, aber ich habe meinen Kopf unwiderruflich voll mit Scheiße, die für lustig zu halten mir mein ganzes Leben eingetrichtert wurde. Und zum ersten Mal, seit ich ein kleiner Komiker war und hier in dem Friseurladen stand und Wörter wie Schwuchtel und Möse und Nigger und ficken sagte, begreife ich, dass ich niemals einen Witz erzählt habe – ich war der Witz. Ich meine, endlich kapiere ich es. Es ist ja so: Ein solider, todsicherer Witz ist wie ein Budweiser, eiskalt serviert – mit K.-o.-Tropfen – von jemandem, der so scheißfreundlich lächelt, dass man gar nicht mitkriegt, wie übel man verarscht wird. Und es hat schon seinen Grund, dass »Pointe« auf Englisch »punch line« heißt, denn eine gute Pointe ist wie eine Faust mit einer dicken Schicht Sahne, unter der sich der Schlagring versteckt, der einen mitten in die Fresse trifft, der einen – BAMM! – mitten ins Gesicht trifft und sagt: »Ich bin cleverer als du« und »Ich bin stärker als du« und »Ich sage hier, wo es langgeht, mein JUNGE.«
Und ich stehe in dem alten Friseurladen am Samstagvormittag und schreie: »Klopf-klopf!«
Ich verlange: »KLOPF-KLOPF!«
Und endlich sagt einer der alten Knacker mit kaum vernehmbarem Tabakflüstern, so leise, dass man ihn fast nicht hören kann, er fragt: »Wer ist da?«
Und ich warte einen Herzschlag lang, wegen der Spannung – mein alter Herr hat mir beigebracht, dass das Timing entscheidend ist, dass das Timing ALLES ist –, und dann, endlich, lächle ich scheißfreundlich und sage: »Lasse …«
ELEANOR
Randy, der hasst Bäume. Der hasst Bäume so heißbrünstig, dass, wenn das Internet über die haufenweise Abholzung im Amazonas-Regendschungel transpiriert, er, Randy, das als ’ne gute und edle Sache anbetrachtet.
Vor allem: Kiefern. Randy, der hasst das, wie so ’n Kieferbaum sich bewegt; erst langsam, dann schnell. Erst so exorbital langsam, dass man überhaupt gar nicht merkt, dass er überhaupt in Mobilität ist. Mit der Methode schafft so ’n Baum nämlich seine Tonnage von Holzbrettern immer höher und höher nach oben, bis er über seinem Ziel ist, direkt über dem Kopf von jemand. Und dann bewegt sich so ’n Kieferbaum blitzmäßig schnell, wie ’ne Mausefalle so schnell. Zu schnell, um’s kommen zu sehen.
Jedenfalls Randy sein Daddy, der hat nix kommen gesehen. Nach ’nem ganzen Leben voll mit Gleithakensetzen und Brettersortieren war die Zeit von Randy seinem Daddy sowieso gezählt. Nur eine blitzmäßige Bewegung, und das ganze Rohholz zerballert ihm seinen haarigen dünnen Schädel in Milliarden blutige Fraktale.
Randy, der sagt sich, dass er Besseres zu tun hat, als hier rumzuhängen, bis er irgendwann von 100 Tonnen hinterträchtiger Botanik gebügelt wird. Randy, der hasst Oregon.
Randy, der fasst die Begebenheit, an ’nem Ort zu leben, wo er rosa Putz an ’n Wänden hat und wo Bäume nix zu melden haben. Randy, der stopft sich’s Geld von der Lebensverbesserung in die Tasche und seinen Pitbull ins Auto. Südwärts steuert er, dreht sein Tempus mehr und mehr auf, als wäre ’n ganzer Schwarm tollwütender Wolfshunde hinter Randys Arsch her.
In Kalifornien beliebäugelt die Immobilienmackerin den Schlitten von Randy: ’n Toyota Celica, getürkt mit Chrom im Wert zweimal so doppelt wie der Karre ihr Listenpreis. Und die Mackerin, die ergreift auch Notiz von Randy seinem Pitbull. Lauter klitschenhafte, konfessionelle Auflehnungen. Die Mackerin, die beglupscht umfänglich Randy seinen rasierten Kopf und sein frisch geklöppeltes Gesichtstattoo, wo immer noch Blut rausdiffamiert. Und die Mackerin, die klappt ihren Laptop auf und sucht nach ’ner runtergeladenen Raubdownloadkopie. Die Mackerin, die sagt: »Alter.« Die sagt: »Alter, wie angegossen wirst du in die Hütte da passen.«
Die Immobilienmackerin, der ihr Name ist Gazelle.
Und Gazelle ihr Laptop, der spielt ’n Film ab vor Randy seinen glotzenden Augäpfeln. Der Film, der ist was mit nicht jugendfreundlichem Inhalt, raubkopiert von ’ner Raubkopie von ’ner Raubkopie von ’ner Raubkopie von ’nem Download, tausend Generationen weit weg von irgendwas, wo irgendjemand echte momentäre Währung für bezahlt hat. Die Mackerin, die sagt: »Alter.« Die sagt: »Alter, das Ding, das heißt Lauf um dein Leben, kleine weiße Frau IV.«
Besagter Film, der ist mit Jennifer-Jason Morrell. Die agitiert da drin als so ’ne blonde kleinkriminöse Gelegenheitseinbrecherin, die in ’ne coole Hütte einsteigt, wo ’n Dutzend schwarze Muskelmacker ihren Mittagsschlaf abservieren. Die Jungs, die traumatisieren im Bett nach ’ner bewegten Nacht ausladender Fortpflanzungsakribitäten unter beträchtlichem Einflößen von Rémy Martin. Die Handlung, die fängt da an, wie Jennifer-Jason versucht, die Goldketten von besagten schlummertrunkenen Hälsen zu konspirieren. Aber erst als diese atlantischen, heißblütigen Muskelmacker erwachen – verständlicherweise äußerst evaporiert –, kommt besagter Film ernsthaft in Wallung.
Das Haus in dem Film, das ist außen ganz rosa verputzt. ’n Swimmingpool, der füllt den Hinterhof aus, mit ’ner Seite, wo das jodierte Wasser gemächlich über ’n Rand augenscheinbar in die Unewigkeit fließt. Segundokaktösen wachsen in der schotterigen Einfahrt in ’ner Umgebung, wo’s nicht mal einen Baum gibt.
Die Immobilienmackerin, Gazelle, die weist beim Rundgang auf die Absonderlichkeiten hin, vom weißen Marmorflurboden bis zum zweistöckigen Eingangsfauxpas. Das ist die Stelle, an die sich Jennifer-Jason mit der Horde williger Muskelmacker lokalisiert hat und wo die sich jetzt der Reihe nach abwechseln, um ihr energetisch beizuwohnen.
Randy und die Immobilienmackerin, die stehen nur da und ehrerbieten. Beide sind sie in Staunen vertieft angesichts der atemstockenden cineastischen Totaloperation, die auf diesem rechteckigen Bildmaterial ihren Verlauf nimmt.
Randy, der ist tief beeinflusst, der sagt: »Alte, Schwester, ich verspüre die hysterische Bedeutung.«
Und Gazelle, die sagt: »Alter, wenn du die Eigentümerschaft ergreifst. Du kannst Eintrittskarten veräußern und geführte Führungen verunstalten.«
Gazelle, die legt nahe, dass dieser weiße Marmorflurboden da ’n idealer Standort für die Positionierung von ’nem Weihnachtsbaum wäre. Aber Randy, der hasst Bäume, lebendig oder tot.
Die Immobilienmackerin, die intrigiert darauf, Randy rumzuführen, durch die Haschküche, das Restebad, den begehrlichen Kleiderschrank, die Stressecke, das Fernwehzimmer und das moderne Abseitszimmer, aber Randy, der ist schon verkauft. Randy, der will nur wissen, ob’s auch Platz genug für ’n Hundeauslauf gibt. Randy, der induziert mit dem Finger auf seinen Hund, ’n amerikanischen Bullterrier. Der Hund, der heißt Eleanor.
Randy und Gazelle, die schreiten das Auswärtsgelände der geschotterten Immobilie ab. Und siehe da, zwischen hier und den Juan Cordobas nebenan gibt’s auslaufend Platz für Eleanor. Und Randy, der erbittet somit, besagtes Haus käuflich in Besitz zu nehmen mittels einer umfassenden Bargeldtransfusion.
Der Pitbull, Randy nimmt ihn mit in ’n Park und bringt ihm bei zu adoptieren, mit ’ner falschen abgetrennten Hand. Das sieht aus wie ’n blutiges, übrig gebliebenes Reservoir von ’nem Halloweenfilm. Aus der Nahentfernung sieht das falsche Blut an dem falschen Handgelenk total lebensfroh aus. Die Fingerspitzen sind ganz blau angeschwärzt und abscheußlich. Nichtsumsoweniger ist der Ausgelassenheit kein Ende gesetzt, wenn Eleanor aus ’m Gebüsch apostrophiert kommt, mit solch einem Schock verbreitenden Appendix zwischen den Beißfängen.
Randy, der spielt das Adoptieren mit dem Pitbull nur, um die Nachbarn zu vergällen, diese Juan-Cordoba-Spießgesellen, die das Vorurteil selektieren, dass Pitbulls ’n ganzen Tag nix anderes machen, als mit ihren rasiermesserspitzen Kinnladen kleine Babys zu zerfletschen.
Einfach um die Spaßhaftigkeit zu extrapolieren, fängt Randy an, ’ne kleine rosa Plastikbabypuppe für Eleanor zum Adoptieren zu nehmen. Randy, der schlendert besagte Puppe in die umliegende Botanik und die Segundokaktösen, und Eleanor, die kollabiert hinter dem Ding her. So ’n Pitbull dabei zu beäugen, wie er wild rumtollt und allem Augenschein nach ’n hilflosen Säugling masturbiert, das findet Randy so amourös, dass er rumschreien könnte.
Zu Hause, da ergötzt er sich am frohlockenden Optionalszenario, dass Jennifer-Jason sich aufmacht, um ’ne sentimentale Reise zu machen. Jeden Tag kann sie ihren Porsche in seine Auffahrt motorisieren und an der Klingel läuten, um ihre alte Würgungsstätte noch mal zu besuchen. Wenn das geschieht, so traumwandelt Randy, wird er Jennifer-Jason in seine feste, aber zärtliche Umarmung insolvieren, und Randy, der wird – wie mancher Macker vor ihm – dazu ansetzen, ihr gründlich und detailliert beizuwohnen.
In der Zwischenzeit, um seine Einsamkeit zu kandieren, bauchpinselt Randy Gazelle. Randy, der zeigt ihr was von dem Geld, das von der Lebensverbesserung übrig ist, und sagt: »Alte, Schwester, ich observiere dir ungetrübte Bargeldverhältnisse, wenn du dich mir anempfiehlst im scheinheiligen Stand der Ehe.« Randy, der romantisiert sie, der grillt ihr Steaks und verdirbt ihre Figur, indem er ihr Pfirsich Elba serviert. Und Gazelle, die artizirkuliert schließlich ihr Eingeständnis, ihn zu ehelichen.
Und Randy, der sagt sich obendrein, dass es ja wohl ’ne Verbesserung ist, in Kalifornien zu leben. In diesem impotenten tektonischen Meisterwerk von ’nem Haus zu wohnen, das weiß Randy, verleiht seinem beschwerlichen Leben ’n zutiefst koloriertes Resümee. Wenn er hier respiriert, fühlt er sich wie ’n richtiger Jemand. Wie ’n Museumskommentator oder ’n Wächter, der ’ne ewige Flamme verhütet.
Randy, der hasst es, ’n Niemand zu sein. Das ist, wie wenn ’n fallender Baum ihn bereits in Fraktale planiert hat.
Die geheime Wahrheit ist, dass seit dem Tod von Randy seinem Daddy, dass Randy sich da zutiefst und unabkömmlich dezimiert fühlt.
Nichtsumsoweniger erweist sich jegliche Verbesserung seiner Lebensführung als täuschende Infusion. Seine neue Seelengefährtin, Gazelle, die verschwindet andauernd, die geht zur Boxhochschule oder zum Haus für missverstandene Frauen. Und Randy, wenn der aufmarschiert, um sie nach Hause zu holen, dann subtrahiert sie den Sachbearbeitern im Hausfrauenhaus, Randy habe ihre Angina unziemlich pervertiert, wo doch Gazelle höchstselbst ihm anheimvertraut hat, dass die eigentliche traumatöse Perforation ihren Verlauf nahm während eines vor langer Zeit erfolgten spätnächtlichen autotextuellen Vorfalles.
Randy, der hat nichtsumsoweniger Sorge. Gazelle, wenn die nämlich mit ihren Anschmutzungen zielweisend ist, dann ist nämlich er, Randy, es, welcher sich vor Gericht zu habilitieren hat und der hinter schwedische Gitter einfahren muss. Und statt mit Jennifer-Jason hat er’s mit Umständlichkeiten zu tun, die sich seiner Beaufsichtigung entziehen. In der Strafentzugsanstalt wird Randy der sein, dessen empfindlichen Intimitäten brutal beigewohnt wird, Tag für Nacht, von wilden Banden brüstiger Muskelmacker, allesamt nachdrücklich gewillt, fruchtlose Akte gefängniszellulärer Reproduktion zu vollziehen.
Und um dem Fass die Krone aufzusetzen, transpiriert auch noch das Internet, dass Jennifer-Jason, dass die sich ’n schweren Fall von Selbsttötung zugezogen hat. In Achtsamkeit ihres Lebenswerkes erigiert Randy ’n kleinen Schrein mit Jennifer-Jason ihrem Foto vorm Haus. Randy, der hofft auf hierherpilgernde Pilger, aber die Juan Cordobas nebenan, die sagen, sein Schrein ist abstößig besagten Fotos wegen, welches Jennifer-Jason in Verübung ihrer Berufung zeigt.
Jedes Foto mit Jennifer-Jason bei der Exerzierung ihrer gewerbsmäßigen Profession, das Randy in seinem Schrein exhumiert, ist zeitnah abgängig.
Jahreszeitenmäßig, in Kalifornien, da sehen Frühling, Sommer und Weihnachten alle gleich aus, außer dass die Nachbarn von Randy, dass die nebenan ’ne Krüppelszene hinbauen. Es trägt nicht gerade zur Verbesserung der gutnachbarlichen Bezüge bei, wenn die sich drüber beschweren, dass Eleanor, dass die zu viel Spekulatius macht, und wenn Randy über ’n Grenzzaun akklamiert, dass sein Hund, dass der wenigstens englisch bellt.
Weihnachten, das ist ja auch die Zeit, wo überall frisch gefällte Oregonkoryphäen auf neue Opfer lauern. Auf einem dieser zapfenbewehrten Attentäter, da ist Randy sicher, steht sein Name drauf.
Die Nachbarn nebenan, die stellen ’ne Krüppelszene auf, weil die nämlich kleine papstleckende Juan Cordobas sind. ’n komplettes Krüppelspiel mit Plastikjosef und Plastikjungfraumaria. Das Plastikbaby, das liegt mit ’m Gesicht nach oben in ’nem orangen Kasten, ausstopfiert mit haufenweise gelbem Stroh. Dieses ruchlose Jesusbaby, das sieht ganz rottig aus, weil’s die ganze Zeit viel zu viel Sonarstrahlung abgekriegt hat. Mit dem rissigen Plastikgesicht und der gebleichten Farbe, findet Randy, sieht’s schlimmer aus wie Schweineschlachtabfall.
Das Problem, das ist nur, dass für Eleanor dieses Jesusbaby, dass das genauso aussieht wie die Puppe, die sie jetzt die ganze Zeit zu adoptieren gelernt hat. Immerzu wirft Eleanor ihre Augäpfel drauf. Schon steht der Pitbull kurz vorm Hypervitaminieren wie ’ne enthemdete Jennifer-Jason Morrell, ganz elaboriert von diesem kirchlichen Gekitsche.
Vielleicht um ihn zu produzieren, investiert Gazelle drauf, dass sie shoppen gehen. Gazelle, die verlangt, dass sie ’n Baum anwerben mit ’nem Durchschnitt, groß genug, um das ganze zweistöckige Eingangsfauxpas zu füllen. Gazelle, die intoniert völlig Randy seine Klagen, wischt seine Warnhinweise hinweg, dass ja Randy sein eigener Daddy, dass der von so ’nem Oregonmonster zur frühzeitigen Löffelabgabe kompostiert wurde. Nein, Gazelle, die sagt: »Alter.« Die sagt: »Alter, wir dezimieren den Baum mit farbenfrohen gläsernen Weihnachtsdepressionen.«
’n Baum zu kaufen, kapituliert Randy, ist billiger, wie die Unterhaltung für ’ne Ex-Frau zu bezahlen. Und so erwerben sie besagten Baum und dezimieren ihn mit tausend Anhängseln aus geblasenem Glas. Zu selbigem Zweck lassen sie die Haustür sperraugenweit aufstehen.
Und so begibt es sich zu niemandes Verblüffung, dass Eleanor, der Pitbull, dass sie sich aus dem Haus abmontiert.
Immer schneller akzentuierend, ergreift sie Besitz von der Plastikjesuspuppe und ist mit expotenzieller Fluchtgeschwindigkeit in nordnordwestlicher Richtung flüchtig.
’n paar Leute, die fahren vorbei, vielleicht ’n Jude oder ’n Zeuger Jehovas, aber jemand, der nicht antizipiert, dass Jesus Gott sein Sohn ist, der denkt, dass Eleanor da ’n original Baby zahnmäßig mangelt. Die Leute, die bekommen diesen desolaten Blick. Alle diese Vorstadtspießgesellen, die sperren ihre virtuellen Wahrnehmungshormone auf. Und die fangen an, Eleanor zu beglupschäugen und Videocastings zu verschicken, bis Brasillionen von schamheiligen Juan-Cordoba-Spießgesellen ebenfalls mit Eleanor eindrücklich bösäugeln in gefährlich hohem Ausmaß. Und alle sind sie mit illegalen Waffen hochgerüstet.
Gazelle, die merkt gar nix von dem ganzen Krabatz und schulmeistert Randy. Gazelle, die erzählt und erzählt von so ’nem Urinal, das an der Wand von so ’nem frankreichischen Kunstmausoleum rumhängt. Die schreit: »Marcel Duchamp, Alter!«
Im einen Sekundenbruchteil schluckt sie sein Elaborat, und im nächsten kotzt sie semesterweise halbunverdaute Boxhochschulkurse aus. Die Alte ist ’n echtes Hysterium. Gazelle, die hohnlächelt ihn, die sagt: »Alter, praktizipierst du denn gar nicht am Kunstleben?«
Und schlussletztlich kapiert Randy ein Wort von dem, was Gazelle da extrahiert.
Aus der aufklaffenden Haustür schreiend, schreit Randy: »Lauf um dein Leben, Eleanor!«
Und hinter sich, da hört er Gazelle, schwerstens verrauscht vom Rémy Martin. Gazelle, die faucht: »Alter!« Gazelle, die schnauft: »Alter, das ist fürs Pervertieren meiner Angina!« Und unter Aufopferung all ihrer unbeträchtlichen Kraft begibt sie sich daran, die Weihnachtskoryphäe in Kippung zu bringen!
Und das nächste unglückliche Ungemach ist, dass ’ne Brasillion Tonnen mordgieriger Oregontannennadeln und fraktaler Glasdepressionen in Randy seinen Rücken krachen. Doch nichtsumsoweniger stirbt er nicht, solange er nicht Zeugnis erlangt von einem herzentwarnenden Weihnachtswunderwerk.
Sein Pitbull, Eleanor, die bewerkstelligt nämlich Jesus Christoph seine Rückkehr von den Toten. Gehalten im Kontext von einem Pitbull seiner dentalen Umklammerung transferiert sich dieses tote, gebleichte Symptom zurück in ’n echtes Heiliges Baby.
Und wie er aus seinem löchrigen Leib entweicht, erkennt Randy, dass das Leben wie ’n Baum ist.
Das Leben, zuerst bewegt sich das langsam. So exorbital langsam, dass man überhaupt gar nicht merkt, dass das Leben sich überhaupt die ganze Zeit bewegt. Das Leben, die ganze Zeit bewegt sich das. Die ganze Zeit bewegt sich das. Und dann bewegt sich das Leben schneller als schnell. Am Ende bewegt sich das Leben zu schnell, um’s kommen zu sehen. Nichtsumsoweniger, Randy, als er spürt, wie das heiße Blut aus seinem Körper ausweicht, wie es aus den koryphäeninduzierten Perspirationen rausläuft, da singt Randy weihnachtlich: »Lauf um dein Leben, Eleanor! Lauf um dein Leben!«
Und schwelend auf der Schwelle zwischen Tod und Bleiben – schon halb Gespinst –, da singt Randy: »Sauf um deine Leber, Allohol!«
Auf seinem letzten Lebensfunken glühend, singt Randy flüsternd: »Rauf um deinen Eber! Tauf dein Baby! Kauf kein Leder! Auf die Schweden! Klau die Nägel! Haus im Regen! Tausend Neger! Kaufverträge! Auf und nieder!« Seine Worte zerfallen in Fraktale, während Randy sich an den Busen von seinem vorzeitig dahingeschiedenen Daddy nuschelt.
Und derweil, den Pitbull betreffend …
So schnell, wie ihre pelzverbrämten Füße sie tragen können, expediert Eleanor weiter nordnordwestwärts. Und auch wenn diese ganzen Juan-Cordoba-Vorstadtspießgesellen, wenn die schnell sind, lässt sich doch nicht leugnen, dass Eleanor der Pitbull, dass sie, blitzschnell, leichtfüßig, immer und ewig, die Schneckste ist.
WIE DIE ÄFFIN HEIRATETE, EIN HAUS BAUTE UND IN ORLANDO IHR GLÜCK FAND
Vor vielen Jahren, in einer Welt vor der Desillusionierung, spazierte die Äffin durch den Wald, ihr Mund vor Stolz breit und prall. Nach vielen Mühen und Opfern hatte sie ihre langjährige Ausbildung beendet. Vor dem Raben prahlte sie: »Schau mich an! Ich habe einen Bachelorabschluss in Kommunikationswissenschaft!« Dem Kojoten gegenüber rühmte sie sich: »Ich habe viele wertvolle Praktika absolviert!« In einer Welt, in der sie sich noch nicht an Schande und Niederlage satt gegessen hatte, stolzierte die Äffin mit ihrem Lebenslauf in die Personalabteilung von Llewellyn Food Product Marketers, Inc.
Die Äffin bestand auf einer persönlichen Audienz beim Hamster, dem Chef der Personalabteilung. Kühn legte sie ihren Lebenslauf vor und verlangte: »Ich will mich bewähren. Gib mir eine echte Aufgabe!«
Und so kam es, dass die Äffin hinter einem Klapptisch postiert wurde. In Supermärkten und Kaufhäusern verteilte die Äffin Wurstwürfel, aufgespießt auf Zahnstocher. Sie bot kleine Häppchen Apfelkuchen in winzigen Pappschälchen an oder Papierservietten mit kleinen Tofustückchen. Sie versprühte Parfüm und hielt ihren eigenen schlanken Hals dem schwerfälligen Elch zum Schnuppern hin, und der Elch kaufte und kaufte. Die Äffin war gesegnet mit Charme, und wenn sie den Hirsch oder den Panther oder den Adler anlächelte, so lächelten sie zurück und kauften das Produkt, das die Äffin gerade anpries. Sie verkaufte Zigaretten an den Dachs, der nicht rauchte. Und sie verkaufte Trockenfleisch an den Widder, der kein Fleisch aß. So geschäftstüchtig war die Äffin, dass sie Handcreme an die Schlange verkaufte, die gar keine Hände hatte!
Zurück bei Llewellyn Foods teilte ihr der Hamster mit: »Ich habe eine Geschäftseröffnung in Vegas«, und Vegas wurde für die Äffin der erste in einer langen Reihe von Triumphen. Mittlerweile war sie Teil eines Teams und erwies sich als hervorragende Teamplayerin, und wenn der Hamster sie an eine neue Wirkungsstätte schickte – nach Philly, in die Twin Cities, nach San Fran –, machte die Äffin sich sofort mit großem Eifer daran, einen neuen Sandwichbelag anzupreisen oder einen neuen Sportdrink unter die Leute zu bringen. Und im Bewusstsein ihres bescheidenen Erfolgs trat die Äffin erneut in der Personalabteilung vor den Hamster und sprach: »Du warst mein Fürsprecher, Hamster, und ich habe Llewellyn Foods gedient. Stell mich härter auf die Probe.«
Und der Hamster erwiderte: »Du suchst eine Herausforderung?« Der Hamster sagte: »Wir haben da einen Käse, der sich nicht verkauft.«
Und so arrogant war die Äffin, dass sie verlangte: »Gib mir deinen problematischen Käse.« Und ohne auch nur einen Blick auf das besagte Produkt zu werfen, versprach die Äffin einen Marktanteil von mindestens 14 Prozent auf dem hart umkämpften Markt für importierte Milchprodukte mittlerer Preiskategorie zu erzielen, und sie versprach weiterhin, dass dieser Erfolg mindestens sieben Wochen anhalten und sie den Käse noch vor der anstehenden Urlaubssaison auf den Markt bringen würde. Im Gegenzug sicherte der Hamster ihr den Posten des Regionalleiters der Unternehmensgruppe Nordwest zu, sodass die Äffin sich in Seattle niederlassen und eine Eigentumswohnung kaufen und einen Partner finden und eine Familie gründen konnte als Gegengewicht zu ihrer Karriere. Und vor allem würde die Äffin nie wieder gezwungen sein, ihren Hals irgendeinem schnüffelnden Elch hinzuhalten. Oder freundlich den Schakal im Supermarkt anzulächeln, der immer wieder an ihrem Tisch vorbeikam, um ihr die Kekse wegzufuttern.
In dieser längst vergangenen Zeit, bevor sie den bitteren Geschmack des Scheiterns kennenlernte, stand die Äffin also wieder hinter einem Klapptisch, diesmal in einem Supermarkt in Orlando. Die Äffin lächelte hinter einem Wald aus Zahnstochern, einem breiten Fakirbett aus Holznägeln, und an jedem steckte ein kleiner, glänzend weißer Würfel. Die Äffin lächelte und lächelte und fing den Blick des Grizzlybären auf. Und da sagte die Äffin sich: »Seattle, ich komme!« Aber als der Grizzlybär den Supermarkt durchquerte, blieb er plötzlich stehen. Er schnupperte in der Luft, hob ein Knie, dann das andere und überprüfte, ob ihm irgendetwas an den Fußsohlen klebte. Er zog den Kopf ein und roch verstohlen an seinen Achselhöhlen. Erst dann kehrte der Blick des Grizzlybären zur Äffin zurück; aber sein Lächeln war verschwunden, und er kam auch nicht mehr näher. Ein Ausdruck des Ekels verzerrte seine Lippen. Dann ergriff der Grizzlybär die Flucht. Mit ihrem unwiderstehlichen Lächeln versuchte die Äffin als Nächstes, den Wolf anzulocken, aber der Wolf kam nur ein paar Schritte auf sie zu, bevor seine Nasenlöcher sich weiteten. Die grauen Augen vor Entsetzen weit aufgerissen, preschte der Wolf davon. Gleichermaßen wurde auch der Adler vom Charme der Äffin angezogen, aber er flog nur ein paar Meter tiefer, dann stieß er ein ersticktes Krächzen aus und zog sich mit kräftigen goldenen Flügelschlägen durch die Supermarktluft zurück.
Der Äffin war es zunächst nicht aufgefallen – vielleicht war ihre Nase abgestumpft vom vielen Parfüm- und Zigarettenprobenverteilen –, aber der Käse stank absolut widerlich. Er roch nach Fäkalien und verbrannten Haaren, und er sonderte winzige klare Tropfen stinkenden Öls ab. Und so sehr stank dieser Käse, dass die Äffin sich fragte, woher denn irgendjemand wissen sollte, ob er nicht verdorben war. So wie er müffelte, konnte der Käse doch bis oben hin voll mit Salmonellen sein. Um ihre Theorie zu testen, lächelte die Äffin, um das Schwein anzulocken, aber nicht mal das Schwein wollte etwas von ihrer übel riechenden Ware wissen. Mit eingefrorenem Lächeln auf dem Gesicht fing die Äffin den Blick des Gorillas auf. Der Gorilla stand in sicherem Abstand und trug eine grellrote Weste, denn er war der Geschäftsführer des Supermarkts. Die Arme vor der gewaltigen Brust verschränkt, schüttelte der Gorilla seinen mächtigen Kopf und sagte: »Nur ein Wahnsinniger würde diesen Käse in seinen Mund stecken!«
In jener Nacht in ihrem Motelzimmer in Orlando rief die Äffin den Hamster an. Sie sagte: »Ich glaube, mein Käse ist giftig.«
Und über das Telefon antwortete der Hamster: »Beruhige dich, dein Käse ist vollkommen in Ordnung.«
»Er riecht nicht gut«, beharrte die Äffin.
»Wir zählen auf dich«, erwiderte der Hamster. »Wenn irgendjemand eine Marktnische für diesen Käse öffnen kann, dann du.« Der Hamster erklärte, dass Llewellyn Foods sich vertraglich verpflichtet habe, den Käse landesweit auf den Markt zu bringen, und zwar zu einem so niedrigen Preispunkt, dass er einem Verlust von zwölf Prozent pro Einheit entspräche. Der Hamster ließ durchblicken, dass der Erzrivale der Äffin, der Kojote, den gleichen Käse in Raleigh-Durham einführe und von keiner Verbraucherzurückhaltung berichte. Über Telefon stieß der Hamster einen dicken Seufzer der Verbitterung aus und meinte, dass der Kojote vielleicht einen besseren Regionalleiter der Unternehmensgruppe Nordwest abgeben würde. Dass der Kojote vielleicht einen stärkeren Wunsch nach Seattle hege.
Nachdem sie aufgelegt hatten, sagte die Äffin sich: »Ich werde diese Beförderung nicht an den Kojoten verlieren.« Sie sagte sich: »Der Hamster lügt. Der Kojote könnte nicht mal Nüsse an das Eichhörnchen verkaufen.« Und doch lag die Äffin die ganze Nacht wach, hörte zu, wie im Nebenzimmer das Kaninchen es mit dem Nerz trieb, und ärgerte sich darüber, dass sie trotz ihres Abschlusses in Kommunikationswissenschaft in einer Karrieresackgasse steckte und sich für den Rest ihres Berufslebens vom Elch beschnüffeln lassen musste. Um Trost zu suchen, wollte sie ihre Mutter und ihren Vater anrufen, aber dann sagte sie sich: »Du bist jetzt erwachsen, Äffin. Du musst selbst mit deinen Problemen fertigwerden.« Also saß sie in ihrem Bett, hörte das Stöhnen und Brunften durch die Motelwand und tat so, als würde sie Die Geschichte der Wapshots lesen. Als die Sonne in Orlando aufging, zog die Äffin sich an und schminkte sich, voller Sorge, dass sie niemals ihre Liebe finden würde. Dass sie nie ein richtiges Zuhause haben würde.
Am folgenden Tag, hinter ihrem stacheligen Wald aus Zahnstochern, wartete die Äffin auf ein ganz bestimmtes Tier. Sie strahlte die Eule an; quer durch den Supermarkt rief sie dem Opossum und dem Walross und dem Puma zu: »Kommt und probiert meinen Käse! Er wurde in der Schweiz hergestellt, aus Biomilch von frei laufenden Kühen ohne Wachstumshormone oder künstliche Inhaltsstoffe.« Aber jedes Wort der Äffin war eine hoffnungsvolle Lüge. Sie wusste gar nichts über den Käse. Sie wusste nicht einmal, wie er schmeckte. Nur ein Verrückter würde diesen furchtbaren Käse über seine Lippen bringen.
In dieser Nacht in ihrem Motelzimmer überging die Äffin ihren Vorgesetzten. Sie rief den Bison an, den Direktor auf Bundesebene, vier Ebenen über dem Hamster. Schlimmer noch – die Äffin rief den Bison auf seiner privaten Handynummer an. Sie stellte sich vor, aber der Bison fragte nur: »Bist du mir unterstellt?«
Die Äffin erklärte, dass sie Mitarbeiterin des mobilen Produktvorstellungsteams sei, das die Aufgabe habe, einen neuen Probekäse auf den Markt von Florida zu bringen. Sie sei im Bereich Orlando tätig, aber sie habe die Befürchtung, dass der Käse verdorben sein könnte. Die Äffin nannte den Bison »Sir«, etwas, das sie sich geschworen hatte, nie zu irgendjemandem zu sagen – nicht einmal ihren Vater hatte sie so genannt.
»Verdorben?«, fragte der Bison. Es war früher Abend in Chicago, aber die Stimme des Bisons klang verwaschen. Die Äffin hörte ein Plätschern und Gluckern, als würde jemand Gin aus einer Flasche trinken. Sie hörte das Rappeln einer Pillendose. Die Stimme des Bisons dröhnte und hallte, als wäre sein Haus riesig groß, und die Äffin stellte ihn sich vor, wie er in ein vergoldetes Telefon sprach und in einer großen Halle mit Marmorboden und Deckenfresken saß.
»Sir«, sagte die Äffin kleinlaut, »selbst die Maus wollte ihn nicht anrühren.«
Der Bison fragte: »Hast du das mit dem Hamster besprochen?«
Da sagte die Äffin: »Sir, irgendwann wird ein Kind diesen Käse probieren und sich daran vergiften, und ich werde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.« Sie sagte: »Im Ernst, selbst das Stinktier meinte, dass er fürchterlich riecht.«
Als Antwort erklärte der Bison, dass das Leben kein Swimmingpool sei. Übers Telefon brabbelte er etwas von Durchhaltevermögen. Er klang abwechselnd wütend und weinerlich, aber immer ziemlich angesäuselt. Wie aus heiterem Himmel fragte er: »Was denn? Hast du Angst, beim Kacken Scheiße an den Arsch zu bekommen?«
Und so stand die Äffin auch am dritten Tag wieder hinter ihrem Klapptisch, hinter der Palisade aus Zahnstochern, die wie Piken aussahen, wie ein Zaun aus angespitzten Pfählen. Von der anderen Seite der Barriere betrachteten die anderen Tiere, der Panther und das Stachelschwein, sie mit Mienen, die offene Abscheu oder tiefes Mitleid ausdrückten. Eine unsichtbare Wolke aus Käsegestank hielt alle auf Abstand, und aus dem Brennpunkt ihrer unglücklichen Blicke heraus flehte die Äffin und versuchte sie zu überreden, dieses fabelhafte neue Produkt zu probieren. Die Äffin beschimpfte die anderen als Feiglinge. Sie forderte sie heraus. Sie versuchte, sie mit doppelter Geld-zurück-Garantie zu bestechen, falls sie den Käse probierten und nicht mochten. Sie beschwor sie, lockte: »Wer wird der Erste sein, der diese unwiderstehliche Gaumenfreude kostet?«
Aus sicherer Entfernung rief der Rabe: »Man müsste schon lebensmüde sein, um da reinzubeißen!« Andere Tiere nickten und kicherten. Der Gorilla schaute zu, tappte ungeduldig mit den Zehen, verschränkte seine Finger und ließ die Gelenke knacken, bereit, die Äffin nach draußen vor die Tür zu werfen.
»Wenn das Zeug so großartig ist, Lady«, provozierte das Frettchen sie, »warum isst du es dann nicht?«
Die Äffin schaute auf den Tisch, auf dem die kleinen Würfel dieses weißen Giftes aufgereiht standen. Sie dachte: »Alle glauben, dass dieser schreckliche Gestank von mir kommt.« Ihre Arroganz war verschwunden. Die Äffin hatte seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen und ihr ganzer Stolz war verpufft. Sie sagte sich: »Lieber wäre ich tot, als noch länger hier herumzustehen und von allen verachtet oder bemitleidet zu werden.« Sie stellte sich vor, wie sie unter entsetzlichen Qualen auf dem nackten Fußboden dieses Supermarktes in Orlando starb. Sie stellte sich die Anklagen wegen fahrlässiger Tötung vor und wie ihre Eltern eine bahnbrechende Zivilklage gegen Llewellyn Foods gewannen. Die Äffin nahm einen Zahnstocher mit zwei Fingern und hob ihn zwischen sich und der Zuschauermenge empor. Wie eine Fackel hielt sie den Käsewürfel. Sie stellte sich ihr Begräbnis vor und sah sich tot in einem Sarg liegen, diese Finger, die jetzt den Zahnstocher hielten, über ihrer Brust gefaltet. Die Äffin sah einen Grabstein vor sich, der ihren Namen und das heutige Datum trug. Der Käse roch so, wie der Tod roch. Er roch so, wie sie bald riechen würde.
»Gib mir eine echte Aufgabe«, sagte die Äffin zu sich selbst, während sie den Käse hochhielt. »Stell mich härter auf die Probe.«
Die Menge sah sprachlos zu. Mit offenem Mund. Die Pute weinte leise.
Die Äffin schloss die Augen und führte den Käse an ihren Mund. Ihre Lippen pflückten ihn vom Zahnstocher, und sie begann zu kauen. Die Augen immer noch geschlossen, hörte sie den Gorilla rufen, die Stimme schrill vor Panik: »Schnell, ruft den Notarzt!«
Die Äffin aß den Käse, aber sie starb nicht. Sie aß ihn und aß. Sie wünschte sich, ihn niemals schlucken zu müssen, ihn nur immer weiter kauen zu können, den Käse ewig zwischen ihren Zähnen zu zermahlen und ohne Ende zu genießen. Sie wünschte sich, ewig zu leben und nie etwas anderes zu essen. Der Käse brachte sie nicht um; viel schlimmer – er schmeckte unglaublich! Was eben noch der schlimmste Geruch der Welt gewesen war, wurde zum schönsten, und selbst als die Äffin den Käse heruntergeschluckt hatte, lutschte sie noch den Zahnstocher ab, um auch die letzte Spur des Geschmacks zu genießen. Der Käse war in ihr; er war jetzt ein Teil von ihr, und sie liebte ihn.
Lächelnd öffnete die Äffin die Augen und stellte fest, dass alle sie anstarrten, die Gesichter vor Grauen verzerrt. Sie glotzten sie an, als hätten sie sie dabei erwischt, wie sie ihre eigenen Exkremente aß. So widerwärtig die anderen sie vorher schon gefunden hatten, schienen sie sie jetzt sogar noch mehr zu verabscheuen, aber der Äffin war es egal. Während alle Tiere zusahen, aß sie ein weiteres Stück des Käses und dann noch eins. Sie wollte sich mit diesem herrlichen Geschmack und Geruch vollstopfen, bis ihr der Bauch wehtat.
An dem Abend klingelte in ihrem Motelzimmer das Telefon. Es war der Hamster. Er sagte: »Bleib dran, während ich den Bison auf der anderen Leitung anrufe.« Die Äffin wartete, und nach ein paar Klicklauten meldete sich eine Stimme: »Hier Bison.«
Der Bison sagte: »Auf Anraten der Rechtsabteilung nehmen wir den Käse aus dem Sortiment.« Er sagte: »Wir können die Haftung nicht übernehmen.«
Die Äffin wusste, dass ihr Job auf dem Spiel stand. Sie wusste, dass es besser war, ruhig zu bleiben und die Dinge ihren Lauf nehmen zu lassen, aber stattdessen sagte sie: »Wartet.«
Der Hamster sagte: »Niemand macht dir einen Vorwurf.«
Die Äffin sagte: »Ich hatte unrecht.« Sie sagte: »Ihr könnt mich feuern, aber der Käse ist köstlich.« Sie sagte: »Bitte.« Sie sagte: »Sir.«
Mit einem Achselzucken in der Stimme meinte der Bison: »Die Sache liegt nicht mehr in unseren Händen.« Aus dem Telefon sprach er: »Morgen entsorgst du deine Musterproben.«
»Fragt den Kojoten«, flehte die Äffin. »Der Kojote verkauft ihn doch auch.«
»Der Kojote ist in Seattle«, sagte der Bison. »Wir haben ihn zum Regionalleiter der Unternehmensgruppe Nordwest befördert.«
Bei einer offensichtlichen Lüge erwischt, sagte der Hamster: »Du musst deine Interessen hinter diejenigen des Teams zurückstellen, Prinzessin. Oder du wirst gefeuert.«
Nachdem sie so lange Parfüm- und Trockenfleisch- und Handcremeproben verteilt hatte, hatte die Äffin endlich ein Produkt, an das sie wirklich glaubte. Bis jetzt hatte die Äffin immer gewollt, dass die Welt sie liebte, doch jetzt war sie bereit, für einen Käse in den Hintergrund zu treten. Es war ihr egal, wie sehr die anderen Tiere sie mit unverhohlenem Ekel anglotzten, sie war bereit, sich in den Augen von Millionen Tieren komplett zu erniedrigen, allein der winzigen Chance wegen, dass jemand das schmeckte, was sie geschmeckt hatte, und ihren Glauben bestätigte. Wenn das geschah, würde dieses mutige Tier ebenfalls den Käse lieben und die Äffin wäre nicht mehr allein auf dieser Welt. Sie war bereit, ihre Würde zu opfern für den Ruhm dieses Käses.
Einer SMS des Leguans zufolge war der gesamte Großhandelsbestand bereits an einen Liquidator versteigert worden. Am folgenden Tag verpasste die Äffin absichtlich ihren Flug nach Cleveland. Bei ihren Produktpräsentationen trug die Äffin normalerweise ein rosa Poloshirt von Brooks Brothers, ein zweiknöpfiges Polohemd, bei dem sie nur den obersten Knopf offen ließ. Die Farbe Rosa stand für flott, sportlich, adrett, und die Äffin schlug nie den Kragen hoch. Da es heute allerdings ums Ganze ging, brachte sie die schwere Artillerie zum Einsatz: ein Rüschentop mit wattierten Trägern und so kurz, dass es einen breiten Streifen ihres nackten Bauches frei ließ. Sie zwängte ihre Brüste in einen gefütterten BH. Um diesem Käse zum Erfolg zu verhelfen, war die Äffin bereit, die Tempelhure zu spielen und sich greller aufzutakeln, als es je jemand bei Llewellyn Foods gewagt hatte.
Unerschrocken nahm sie ihren Klapptisch, die Zahnstocher und die weißen Würfel dieses köstlichen, berauschenden Nirwanas und ging zurück in den Supermarkt in Orlando. Die Äffin stand hinter ihrem Altar aus Käseproben wie eine Missionarin. Eine Fanatikerin. Sie war eine Predigerin, sie zeterte und appellierte an alle Kunden des gut besuchten Supermarktes. In deren Augen war sie eine Verrückte – jemand, der diesen Käse aß, war zu allem fähig –, und das schien sie für den Augenblick zu schützen. Wenn sie ihre Begeisterung nur weitergeben konnte und sie nur ein einziges anderes Tier verstand, dann würde ihr das schon reichen.
»Die Befriedigung all eurer Wünsche wartet auf euch«, sagte die Äffin. »Die absolute Glückseligkeit kann euer sein, kostenlos!« Nur der Gestank des Käses hielt die Ente und den Ochsen davon ab, sie anzugreifen, die Äffin zu packen und aus dem Gebäude zu werfen, aber der Grizzlybär schrie ihr Schimpfwörter zu und der Papagei bewarf sie mit Pennystücken.
Niemand stellte sich auf ihre Seite. Die Äffin stand allein, bewaffnet nur mit ihrem Glauben.
Die Äffin war noch immer eine Teamplayerin, aber jetzt war sie die Einzige in ihrem Team.
Chaos brach aus. Die Herde stürmte ihren Tisch, warf ihn um und die Käseproben fielen auf den schmutzigen Boden. Auf dem staubigen Beton, wo die Äffin sich erst gestern selbst hatte sterben sehen, wurde ihr heiliger Käse zertrampelt. Dieser Käse, den sie mehr liebte als ihr Leben, wurde von den Hufen des Rentiers zerquetscht und unter den Tatzen des Tigers verschmiert. Eine riesige Hand schloss sich um den Arm der Äffin und zerrte sie zur Tür. Es war der Gorilla, der sie wegschleppte, auf den Rest ihres trostlosen Berufslebens bei Llewellyn Foods zu, ein Leben, in dem sie jede Nacht ruhig schlafen konnte. In dem sie wie eine Schlafwandlerin durch jeden Tag ging. Eine Zukunft, in der sie nie richtig erwachen musste.
Der einzige Käsewürfel, der noch übrig war, war der Käse an dem Zahnstocher, den die Äffin in der Hand hielt. Er war ihr Schwert und ihr Heiliger Gral, und die Äffin stieß damit nach dem Gesicht des Gorillas. Sie rammte den Zahnstocher tief in den Mund des Gorillas, und der keuchte und würgte und spuckte den Käse aus, aber die Äffin fing den feuchten weißen Würfel auf und klatschte ihn zwischen die Lippen des Gorillas. Während der Ansturm der anderen Tiere sie beide hochhob und zum Ausgang trug, hielt die Äffin ihre Hand fest auf den Mund des Gorillas gepresst, ihren Blick tief in seine Augen versenkt, bis der Gorilla kaute und schluckte. Bis sie spürte, wie die gewaltigen Muskeln seiner mächtigen Arme sich entspannten und erschlafften und er verstand.
ZOMBIES
Es war Griffin Wilson, dem wir die Theorie der De-Evolution zu verdanken hatten. In Organischer Chemie saß er zwei Reihen hinter mir, der Inbegriff des diabolischen Genies. Er war der Erste, der den Großen Sprung Zurück machte.
Alle wissen es, denn Tricia Gedding war mit ihm im Krankenzimmer, als er den Sprung machte. Sie lag auf der anderen Liege, hatte ihre Periode vorgetäuscht, um sich vor einem unangekündigten Test über die Perspektiven der morgenländischen Kultur zu drücken. Sie sagte, sie habe das laute »Fiiiep!« gehört, sich aber nichts dabei gedacht. Als Tricia Gedding und die Schulschwester ihn auf seiner Liege fanden, dachten sie im ersten Moment, Griffin Wilson wäre die Reanimationspuppe, an der immer die Herzdruckmassage geübt wurde. Er atmete fast gar nicht, bewegte kaum einen Muskel. Sie hielten es zuerst für einen Scherz, denn er hatte immer noch sein Portemonnaie zwischen den Zähnen klemmen und an beiden Seiten seiner Stirn hafteten noch die Drähte.
Seine paralysierten Hände hielten ein wörterbuchgroßes Kästchen fest, die Finger auf einen großen roten Knopf gepresst. Alle hatten dieses Kästchen schon so oft gesehen, dass sie es zuerst gar nicht erkannten, aber es hatte an der Wand des Krankenzimmers gehangen: der Herzdefibrillator. Der Herzschocker für Notfälle. Offenbar hatte Griffin Wilson ihn heruntergenommen und sich die Anleitung durchgelesen. Er hatte das gewachste Papier von den Haftelektroden abgezogen und die Dinger auf seine Schläfenlappen geklebt. Eine simple Plug-and-Play-Lobotomie. So einfach, dass es sogar ein 16-Jähriger schafft.
In Miss Chens Englischunterricht haben wir gelernt: »Sein oder Nichtsein …«, aber dazwischen existiert eine große Grauzone. Vielleicht gab es zu Shakespeares Zeiten nur diese zwei Alternativen. Griffin Wilson hat gewusst, dass die Hochschulzulassungstests nur der erste Schritt zu einem Leben voller Scheiße sind. Einem Leben, in dem man heiratet und aufs College geht. In dem man Steuern zahlt und versucht, Kinder großzuziehen, die nicht zu Amokläufern werden. Und Griffin Wilson wusste, dass Drogen nur ein vorübergehender Notbehelf sind. Wenn man Drogen nimmt, braucht man einfach immer mehr Drogen.
Das Problem, wenn man talentiert und begabt ist, besteht darin, dass man manchmal zu schlau wird. Mein Onkel Henry sagt immer, ein gutes Frühstück ist deshalb so wichtig, weil das Gehirn noch wächst. Aber niemand redet darüber, dass das Gehirn manchmal auch zu groß werden kann.
Wir sind im Grunde genommen große Tiere, von der Evolution darauf trainiert, Muscheln zu knacken und rohe Austern zu essen, aber jetzt erwartet man von uns, dass wir uns alle 300 Kardashian-Schwestern und alle 800 Baldwin-Brüder merken. Im Ernst, so schnell, wie die Kardashians und Baldwins sich reproduzieren, werden sie bald alle anderen menschlichen Spezies ausgerottet haben. Wir anderen, Sie und ich, wir sind lediglich evolutionäre Sackgassen, die darauf warten, auszusterben.
Man konnte Griffin Wilson alles fragen. Man konnte ihn fragen, wer den Vertrag von Gent unterzeichnet hatte. Er war wie dieser Zeichentrickzauberer im Fernsehen, der sagt: »Und jetzt werde ich ein Kaninchen aus meinem Arsch zaubern.« Abrakadabra, und er hatte die Antwort. In Organischer Chemie konnte er einem was über die Stringtheorie erzählen, bis er blau anlief, aber alles, was er wirklich wollte, war, glücklich zu sein. Nicht einfach nur nicht unglücklich, er wollte vielmehr auf die Weise glücklich sein, wie ein Hund glücklich ist. Nicht ständig hierhin und dahin gehetzt von dringenden Textnachrichten oder Änderungen bei den Steuerbestimmungen. Aber er wollte auch nicht sterben. Er wollte sein … und nicht sein – aber beides gleichzeitig. Ja, so ein bahnbrechendes Genie war er.
Der Schuldirektor ließ Tricia Gedding schwören, keiner Menschenseele etwas zu erzählen, aber man weiß ja, wie das läuft. Die Schulbehörde hatte Angst vor Nachahmungstätern. Diese Defibrillatoren hängen heutzutage überall.
Seit dem Tag im Krankenzimmer wirkt Griffin Wilson so glücklich wie nie zuvor. Er kichert immer zu laut und wischt sich mit dem Ärmel Spucke vom Kinn. Die Sonderpädagogen klatschen schon Beifall und überschütten ihn mit Lob, wenn er es nur schafft, die Toilette zu benutzen. Typischer Fall von Doppelmoral. Wir anderen kämpfen mit Klauen und Zähnen um jedes bisschen an Scheißkarriere, das wir kriegen können, während Griffin Wilson sich für den Rest seines Lebens über billige Süßigkeiten und Wiederholungen der Fraggles halb tot freuen kann. Und früher war er unzufrieden, wenn er nicht jedes Schachturnier gewann. So wie er jetzt ist, hat er erst gestern seinen Schwanz rausgeholt und angefangen, sich bei der morgendlichen Anwesenheitskontrolle einen abzurubbeln. Bevor Mrs. Ramirez mit »S« und »T« durch ist – die Schüler antworten »hier« und »anwesend«, aber zu langsam, sie kichern und glotzen –, bevor Mrs. Ramirez nach hinten rennen und ihn aufhalten kann, ruft Griffin Wilson: »Ich zaubere ein Kaninchen aus meiner Hose« und spritzt heißen Babysaft auf ein Bücherregal, in dem nichts weiter steht als hundert Ausgaben von Wer die Nachtigall stört. Und die ganze Zeit lacht er dabei.
Trotz seiner Lobotomie weiß er immer noch, was ein cooler Spruch wert ist. Anstatt nur ein Streber unter vielen zu sein, ist er jetzt der Mittelpunkt der Party.
Der Stromschlag hat sogar seine Akne geheilt.
Gegen solche Resultate ist schwer zu argumentieren.
Keine Woche, nachdem er zum Zombie geworden war, ging Tricia Gedding in das Fitnesscenter, in dem sie Zumba machte, und nahm in der Frauenumkleide den Defibrillator von der Wand. Seit ihrer selbst verabreichten Plug-and-Play-Behandlung in einer Toilettenkabine ist es ihr egal, wo sie ihre Periode bekommt. Ihre beste Freundin Brie Phillips benutzte den Defibrillator, der neben den Toiletten des Baumarktes hing, und jetzt spaziert sie auf der Straße herum, bei Regen und Sonnenschein, ohne eine Hose zu tragen. Und wir reden hier nicht vom Abschaum der Schule. Wir reden von der Klassensprecherin und der Anführerin der Cheerleader. Den besten und klügsten. Allen, die in sämtlichen Sportteams die erste Geige spielten. Es waren alle Defibrillatoren zwischen hier und Kanada nötig, aber seither, wenn sie Football spielen, spielt keiner mehr nach den Regeln. Und selbst wenn sie haushoch verlieren, grinsen sie wie verrückt und klatschen sich ab.
Sie sind weiterhin jung und heiß, aber sie machen sich keine Sorgen mehr über den Tag, an dem sie es nicht mehr sein werden.
Es ist Selbstmord, aber auch wieder nicht. In den Zeitungen werden die tatsächlichen Zahlen nicht genannt. Die Zeitungen pinkeln sich nicht an den eigenen Karren. Tricia Geddings Facebook-Seite hat mittlerweile eine größere Leserschaft als unsere Tageszeitung. Hört mir auf mit Massenmedien; sie packen die Titelseite voll mit Arbeitslosigkeit und Krieg und denken, das hat keine negativen Auswirkungen? Mein Onkel Henry liest mir einen Artikel über eine vorgeschlagene Änderung der Bundesstaatsgesetze vor. Politiker fordern eine zehntägige Wartezeit beim Verkauf von Herzdefibrillatoren. Es ist die Rede von polizeilichen Führungszeugnissen und psychologischen Gutachten, aber noch ist es nicht im Gesetz verankert.
Mein Onkel Henry blickt von der Zeitung auf und sieht mich über das Frühstück hinweg an. Er durchbohrt mich mit diesem ernsten Blick und fragt: »Wenn alle deine Freunde von einer Klippe springen würden, würdest du es auch tun?«
Mein Onkel ist das, was ich anstelle einer Mom und eines Dads habe. Er würde es niemals zugestehen, aber hinter diesem Klippenrand liegt ein gutes Leben. Ein lebenslanger Vorrat an Behindertenparkausweisen. Onkel Henry begreift nicht, dass alle meine Freunde bereits gesprungen sind.
Sie mögen behindert sein, aber meine Freunde haben immer noch einiges am Laufen. Mehr als vorher sogar. Sie haben heiße junge Körper und die Gehirne von Kleinkindern. Von beiden Welten das Beste. LeQuisha Jefferson steckte ihre Zunge in Hannah Finermann während des Werkunterrichts, brachte sie mitten im Unterricht zum Stöhnen und Quieken, den Rücken an die Standbohrmaschine gelehnt. Und Laura Lynn Marshall? Sie lutschte Frank Randall im Kurs über Internationale Küche einen ab, während alle zusahen. Alle ließen ihre Falafel anbrennen, und niemand machte eine Staatsaffäre daraus.