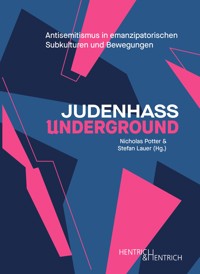
Judenhass Underground E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Hentrich & Hentrich
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Niemand will Antisemit sein. Erst recht nicht in Subkulturen und Bewegungen mit einem progressiven, emanzipatorischen Selbstbild. Judenhass geht aber auch underground – ob Rapper gegen Rothschilds, DJs for Palestine oder Punks Against Apartheid. BDS, die Boykottkampagne gegen den jüdischen Staat, will nahezu jedes Anliegen kapern, von Klassenkampf bis Klimagerechtigkeit. Altbekannte Mythen tauchen in alternativer Form wieder auf, bei Pride-Demos, auf der documenta oder beim Gedenken an den Terror von Hanau. Und viele Jüdinnen*Juden fragen sich, wo ihr Platz in solchen Szenen sein soll. Eine Anklage mit anschließender Diskussion. Kritisch, aber konstruktiv. Und vor allem solidarisch."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gefördert von der Amadeu Antonio Stiftung
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de/ abrufbar.
© 2023 Hentrich & Hentrich Verlag Berlin Leipzig
Inh. Dr. Nora Pester
Capa-Haus
Jahnallee 61
04177 Leipzig
http://www.hentrichhentrich.de
Lektorat: Philipp Hartmann
Umschlag: gegenfeuer
Gestaltung: Michaela Weber
Druck: Winterwork, Borsdorf
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
ISBN 978-3-95565-615-7
eISBN 978-3-95565-633-1
JUDENHASSUNDERGROUND
Antisemitismus in emanzipatorischenSubkulturen und Bewegungen
Herausgegeben von Nicholas Potter und Stefan Lauer
Inhalt
Intro
Theorie
Israelhass und Antisemitismus
Nikolas Lelle und Tom Uhlig
Linker Antisemitismus
Jan Riebe
BDS
Stefan Lauer
Antisemitismus und Intersektionalität
Riv Elinson
Juden und Klasse
Ruben Gerczikow und Monty Ott
Praxis
Kulturbetrieb
Konstantin Nowotny
Antirassistische und antiimperialistische Gruppen
Anastasia Tikhomirova
Klimabewegung
Nicholas Potter
Queere Community
Stefan Lauer
Feministische Bündnisse
Merle Stöver
Clubkultur
Nicholas Potter
Hiphop
Lilly Wolter
Punk
Annica Peter
Hardcore
Maximilian Kirstein und Timo Büchner
Dialog
documenta, Kunstfreiheit und die Kulturszene: Laura Cazés und Leon Kahane
Pinkwashing, Homonationalismus und queerer Antisemitismus: Hengameh Yaghoobifarah und Rosa Jellinek
Klimabewegung, Iranproteste und antirassistische Bündnisse: Luisa Neubauer und Shahrzad Eden Osterer
BDS, Clubkultur und #DJsForPalestine: Yaron Trax und Lutz Leichsenring
Hiphop, Querfront und postmigrantische Allianzen: Ben Salomo und Massimo Perinelli
Über die Autor*innen
Intro
Zionism is not compatible with JudaismThe hijacked faith. The state is misrepresentingIsrael equals misplacement and ethnic cleansingI know I’m on a list, for being more verbalCurse every Zionist since Theodor HerzlBalfour was not a wise man. Shame on RothschildBetween them the monster they created has gone wild.
– Lowkey
Antisemitismus boomt. Mal wieder. Auch in Subkulturen und Bewegungen, die ein emanzipatorisches Selbstbild kultivieren. Punk oder Techno, Hiphop oder Hardcore, Klimabewegung oder queere Community: Diverse Szenen im mehr oder weniger linken Spektrum haben nicht nur Schwierigkeiten, ihn beim Namen zu nennen. Leute, die sich sonst auf der „richtigen Seite“ der Geschichte wähnen, können oder wollen Antisemitismus oft beim besten Willen nicht erkennen. Mehr noch: Gerade mithilfe von Antisemitismus stilisieren sie sich als „die Guten“ – durch Songtexte gegen geldgierige Globalisten und die mächtigen Rothschilds, durch Boykottkampagnen gegen den „Kindermörder Israel“. Judenhass geht auch underground. Das macht ihn nicht weniger gefährlich.
Antisemiten sind allerdings immer die anderen: die Faschisten, die Geflüchteten, die Islamisten. Viele Linke glauben, sie könnten per se nicht antisemitisch sein, der ganzen Tradition des linken Judenhasses zum Trotz. Der Vorwurf des Antisemitismus wird vehementer bekämpft als der Antisemitismus selbst. So schlecht ist der Ruf der Judenhasser seit den Gaskammern der Nationalsozialist*innen. Antisemitismus wird allzu oft als Gespenst der Vergangenheit gesehen, als abgeschlossenes Kapitel der Weltgeschichte. Er wird erst ernst genommen, wenn er in Vernichtungsfantasien mündet.
Aber Antisemitismus fängt nicht bei Auschwitz an. Und er hört mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 nicht auf. Ronen Steinkes Buch Terror gegen Juden endet mit einer Chronik antisemitischer Vorfälle in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der erste Eintrag stammt aus Juli/August 1945: „Im bayerischen Diespeck werden auf dem jüdischen Friedhof mehrere Grabsteine umgeworfen.“ Antisemitismus ist, wie der britisch-jüdische Schriftsteller Howard Jacobson in seinem preisgekrönten Roman The Finkler Question schreibt, eine Rolltreppe, die nie stillstand und auf die jeder nach Belieben aufsteigen kann. Wo diese Rolltreppe letztlich hinführt, ist hinlänglich bekannt.
Knapp 80 Jahre nach dem Holocaust, den wir im Folgenden als Shoah (hebräisch für „Katastrophe“) bezeichnen werden, grassiert weiterhin der Judenhass. Doch auch wenn das Wort „Judenhass“ im Titel dieses Bandes steht, ist Antisemitismus so viel mehr als bloße Ablehnung von Jüdinnen*Juden. Er ist der Hass auf alles, was Antisemit*innen als „jüdisch“ verstehen. Er steht für den Hass auf Demokratie, Gleichwertigkeit, auf die Moderne und ihre Errungenschaften. Der moderne Antisemitismus ist vor allem Produkt der bürgerlichen Gesellschaft: Der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn nennt ihn deshalb die „negative Leitidee der Moderne“. Er gehört genauso zum rechten Rand wie zur gesellschaftlichen Mitte. Antisemitismus ist die Leitideologie ganzer Staaten. Und leider ist er auch Teil von emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen.
Antisemitismus vereint: Antirassist*innen landen bei Verschwörungspredigern, Möchtegern-Antifas bei türkischen Rechten, Queers marschieren neben Islamisten. Das sind nicht unbedingt Widersprüche, denn ein Milieu kann emanzipatorisch für den eigenen Befreiungskampf sein, ohne konsequent gegen jede Unterdrückung zu kämpfen. Gleichzeitig kann der Antisemitismus an sich auch emanzipierend sein – von der Moderne, der Weltverschwörung, dem „jüdischen Kapital“, den Strippenziehern hinter den Kulissen, der „Staatsräson“. Von all dem bietet der Antisemitismus Befreiung: Emanzipation als Widerstand gegen Macht.
Aber was ist Antisemitismus überhaupt? Und was unterscheidet ihn vom Rassismus? Die Nazis imaginierten die Juden als „Rasse“, verabschiedeten die „Nürnberger Rassengesetze“. Aber Antisemitismus ist mehr als nur antijüdischer Rassismus. Denn Rassismus hierarchisiert Menschengruppen, um sie auszubeuten. Das kann eine brutale, mörderische Form annehmen, wie Kolonialismus und Sklaverei schmerzhaft zeigen. Und nicht selten diente er der Kapitalakkumulation: pragmatischer, profitorientierter Menschenhass. Oder er kann sich durch Alltagsdiskriminierung oder Mikroaggressionen manifestieren. Aber zentral für Rassisten ist die vermeintliche Minderwertigkeit der rassifizierten Gruppen.
Bei Antisemitismus ist das anders. Er schreibt „den Juden“* eine Übermacht zu: Sie seien betrügerisch, rachsüchtig, blutgierig, hinterlistig. Sie zögen die Fäden, kontrollierten die Medien, planten die Welteroberung – oder hätten sie längst erreicht. Ein Schlüsseltext des modernen Antisemitismus ist Die Protokolle der Weisen von Zion: ein antisemitisches Hetzpamphlet, zunächst 1903 auf Russisch erschienen, später Pflichtlektüre im Nationalsozialismus und bis heute ein Standardwerk für Islamisten. Die angeblichen Protokolle geben vor, die geheimen Pläne jüdischer Weltverschwörer zu enthüllen. Das ist brandgefährlich. Denn Antisemiten fühlen sich bedroht: Sie wollen „die Juden“ nicht ausbeuten, sondern auslöschen. Und diese Auslöschung ist alles andere als pragmatisch, sie ist ideologisch. Der Historiker Saul Friedländer spricht deshalb vom „Erlösungsantisemitismus“ der Nazis. Denn auch sie glaubten, auf der richtigen Seite zu stehen. Ihr Credo: Die Welt wäre ohne Juden eine bessere.
Aber Antisemitismus entstand nicht erst mit den Nazis oder mit den Protokollen: Tilman Tarach zeigt in seinem Buch Teuflische Allmacht den bis heute prägenden Antijudaismus des Christentums auf. Das erste belegte antijüdische Pogrom findet im Jahr 388 in Callinicium statt, dem heutigen Raqqa in Syrien. Der örtliche Bischof hatte seine Gemeinde angestachelt, die Synagoge der Stadt anzuzünden. Acht Jahre zuvor war das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich geworden.
Judenhass entwickelt sich weiter, über Aufklärung und Nationalsozialismus bis hin zu Verschwörungsideologien im Internet. Aber es gibt Narrative, die wiederkehren. Sie bedienen sich altbekannter Mythen: Kindermörder, Brunnenvergifter, Weltverschwörer. Heute werden sie neu verpackt, als Kritik gegen Israel, Zionisten oder die „Ostküstenelite“. Aus der Ritualmordlegende werden bei QAnon blutsaufende Promis und Politiker*innen, die angeblich aus den Untergrundlaboren von George Soros und den Rothschilds mit der Wunderdroge Adrenochrom versorgt werden, hergestellt aus entführten Kindern. Ein antisemitisches Repertoire aus Klischees und Bildsprache zieht sich wie ein roter Faden durch diverse Epochen. So waren antisemitische Karikaturen mit Hakennasen und spitzen Zähnen, die auch im NS-Blatt Der Stürmer hätte erscheinen können, im Sommer 2022 auf der renommiertesten Kunstmesse der Bundesrepublik, der documenta, zu sehen.
Antisemitismus ist, wie Theodor W. Adorno es in Minima Moralia formulierte, das Gerücht über die Juden. Im Verschwörungswahn traut man ihnen alles zu: Chemtrails, Impfdiktatur, „Großer Austausch“ oder Great Reset. Anetta Kahane, Gründerin der Amadeu Antonio Stiftung, nennt Antisemitismus deshalb das Betriebssystem von Verschwörungsideologien. Und das ist ein attraktives Angebot für viele Nichtjuden, denn durch Antisemitismus dürfen sie Opfer eines hinterlistigen Plans, einer geheimen Verschwörung sein. Entlastung durch Judenhass. Es ist ein vereinfachtes Narrativ, aber eines, das verfängt: Auf komplexe Probleme folgen simple Lösungen – und an allem Bösen in der Welt sei der Jude schuld. Der Weg zu Vernichtungsfantasien ist dann nicht mehr weit.
Antisemitismus kann notfalls ganz ohne Juden funktionieren. Vermeintlich mächtige nichtjüdische Personen werden zu Juden erklärt, ob Bill Gates oder Angela Merkel. „Existierte der Jude nicht, der Antisemit würde ihn erfinden“, schreibt Jean-Paul Sartre schon 1944. Oder Argumente, die in der Geschichte immer wieder benutzt wurden, um die Verfolgung und Diskriminierung von Jüdinnen*Juden zu legitimieren, werden ohne Juden neu verpackt, ohne dass sich ihre eigentliche Funktion ändert: Der Antisemitismus wird strukturell, ob durch Wall Street, Globalisten oder das „eine Prozent“.
Es gibt verschiedene Versuche, Antisemitismus zu definieren. An sich keine leichte Aufgabe, denn die Erscheinungsformen des Antisemitismus entwickeln sich durch die Jahre und Epochen immer weiter. Eine nützliche und weit verbreitete Arbeitsdefinition kommt von der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IHRA. Beschlossen 2016 von Vertreter*innen von über 30 Ländern und inzwischen von 39 Staaten und zahlreichen Regierungsorganisationen und NGOs übernommen, ist die Arbeitsdefinition im Kern eine einfache: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.“ Dazu liefert die IHRA elf Beispiele von Antisemitismus, von klassischen antisemitischen Motiven über Holocaustleugnung bis hin zu „Vergleichen der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der Nationalsozialisten“.
Heute richtet sich Antisemitismus häufig gegen Israel und „die Zionisten“. Deshalb drehen sich mehrere IHRA-Beispiele um diese virulente Form des modernen Judenhasses. Denn gemeint ist dasselbe: Israel sei ein Kindermörder, Brunnenvergifter, Frauenvergewaltiger, der die Medien mit seiner mächtigen Lobby beeinflusse. Die Zionisten seien die Speerspitze des globalen Imperialismus, würden die Menschheit knechten, die Welt beherrschen. Dieser Hass ist nicht durch den Nahostkonflikt**ausgelöst, vielmehr dient Israel als bloße Projektionsfläche für Antisemit*innen. Auf einem Wahlplakat der Neonazi-Partei Die Rechte steht: „Israel ist unser Unglück“ – eine Anspielung auf die Worte Heinrich von Treitschkes und spätere NS-Maxime „Die Juden sind unser Unglück“. Für die Kader vom „III. Weg“ ist Israel ein zionistischer „Terrorstaat“, der boykottiert gehört.
Auch bis in die sogenannte Mitte der Gesellschaft hinein ist israelbezogener Antisemitismus ein Problem. Die Ergebnisse der Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung, die seit Jahren rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland untersuchen, machen das deutlich. So stimmen in der Studie 2020/21 31 Prozent der Deutschen dem folgenden Satz ganz oder teilweise zu: „Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.“ 45 Prozent der Befragten waren ganz oder teilweise der Meinung, Israel mache mit den Palästinenser*innen „im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben“. In der Leipziger Autoritarismus-Studie von 2020 halten sogar 70 Prozent der Befragten die israelische Politik für „genauso schlimm wie die Politik der Nazis im Zweiten Weltkrieg“.
Die Linke ist hier keine Ausnahme: Dort wird Israel teilweise zum Feindbild schlechthin erklärt, zum Inbegriff des Bösen. Das Land wird zum Alleinschuldigen aller Konflikte im Nahen Osten, wenn nicht in der ganzen Welt – Israel, ein Pariastaat. Die Ablehnung des jüdischen Staates hat sogar einen eigenen Begriff verdient, der für andere Länder kaum vorstellbar wäre: „Israelkritik“. Der französisch-jüdische Historiker Léon Poliakov nannte Israel deshalb den „Juden unter den Staaten“.
Der linke Hass auf Israel ist auch auf einen plumpen Antiimperialismus zurückzuführen, auf eine Teilung der Welt in West und Ost, oder neuerdings: in den Globalen Norden und Süden. Nach dieser Logik gibt es nur zwei Lager, Unterdrücker und Unterdrückte, den bösen kapitalistischen Imperialismus und die guten Kolonialisierten. Heute feiern Antiimperialist*innen gerne mal die Hamas, die Taliban oder den Iran: Hauptsache, gegen den westlichen Imperialismus. Der jüdische Staat wiederum – ganz egal, um welche konkrete Regierung oder welchen Aspekt der vielschichtigen Gesellschaft es geht – ist und bleibt der Endgegner.
Auch die postkoloniale Theorie hat Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen befeuert: Die Aufarbeitung des Kolonialismus ist zweifelsohne wichtig und wird im deutschen Kontext stark vernachlässigt. Aber die Erinnerungskultur an die Shoah, die selbst von unten hart erkämpft werden musste, ist nicht schuld an dieser Leerstelle. Und sie bedeutet nicht, dass der Kolonialismus nicht aufgearbeitet werden muss. Beides ist parallel möglich. Gleichzeitig kann eine postkoloniale Perspektive allein die Welt nicht erklären. Im Fall Israels führt sie zu einer Verzerrung der Realität: Aus einem Fluchtort für Shoah-Überlebende wird ein rassistischer Kolonialstaat. Die dekolonialen, ja die antikolonialen Elemente des Zionismus, der auch eine emanzipatorische Befreiungsbewegung für Jüdinnen*Juden weltweit war bzw. ist, um Diskriminierung, Gewalt und Massenmord zu entfliehen, werden dabei ausgeblendet. Ganz zu schweigen von der Vertreibung von rund 900 000 Jüdinnen*Juden aus arabischen Ländern und dem Iran, die seit 1948 Zuflucht in Israel gefunden haben.
In emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen hat vor allem BDS Antisemitismus salonfähig gemacht. Durch „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“ will die antiisraelische Kampagne den jüdischen Staat wirtschaftlich, wissenschaftlich und kulturell isolieren. Israel wird mit Buzzwords wie Apartheid, ethnische Säuberung, Völkermord, Siedlerkolonialismus oder gar Faschismus belegt und dämonisiert. Promis wie Roger Waters, Lowkey oder Alice Walker geben der Kampagne Glanz. Nicht alle BDS-Anhänger*innen sind per se Antisemiten. Ohnehin gilt es, Antisemitismus als Phänomen zu betrachten und sich nicht auf einzelne Akteur*innen zu fokussieren. Es ist weniger wichtig, wer etwas macht, entscheidend ist, was passiert. Und Agenda und Ideologie der BDS-Kampagne sind antisemitisch. Der Hass entlädt sich oft nicht vor israelischen, sondern vor jüdischen Einrichtungen. Vor Synagogen, Schulen oder Kunstzentren. In der Praxis bedeutet das: Jüdinnen*Juden fühlen sich häufig nicht sicher, werden von Räumen oder Bewegungen ausgeschlossen, gar bedroht. Auch wenn es einige Jüdinnen*Juden gibt, die sich bei BDS engagieren.
BDS will nahezu jedes Anliegen für Israelhass kapern, ob CSD, Klimademos oder Mahnwachen für die Opfer rechtsterroristischer Anschläge. Jeder Anlass passt. „Free Palestine“ sei ein feministisches Thema, stehe für queere Befreiung, bedeute Klimagerechtigkeit oder Klassenkampf. Eine Überidentifizierung, die aber letztendlich zu einer Dämonisierung des einzigen jüdischen Staates der Welt führt. Vor allem in den sozialen Medien gelingt es BDS, Israelhass durch virale Posts zu verbreiten. Durch verkürzte Instagram-Slides, Hashtagkampagnen oder schlicht Desinformation wird in unterschiedlichen Subkulturen und Bewegungen Stimmung gegen Israel gemacht.
Die Politik dieser oder jener israelischen Regierung zu kritisieren, ist nicht zwangsläufig antisemitisch. Es ist notwendig. Und es gehört zu einer Demokratie. In einem politisch-militärischen Konflikt ist auch nicht jeder Akt der Aggression gegen Israel unbedingt antisemitisch. In der Westbank, seit dem Sechstagekrieg 1967 von Israel besetzt, herrscht etwa eine Zwei-Klassen-Justiz: Für Israelis sind Zivilgerichte zuständig, für Palästinenser*innen Militärgerichte. Das 2022 gewählte Gruselkabinett von Benjamin Netanjahu bildet die rechteste Regierung in der Geschichte des Landes. Dazu zählen rassistische Siedler und bekennende Homohasser. Und das hat hunderttausende Israelis auf die Straße mobilisiert, die als Reaktion auf geplante Justizreformen eine breite Protestbewegung formiert haben. Die Aussichten sind aktuell düster. Und die israelische Demokratie steht vor einer harten Probe, wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte.
Aus linker, emanzipatorischer Sicht ist eine Kritik an Politik und Entwicklung des Landes dringender denn je. Denn das Leid der Palästinenser*innen ist real. Eine emanzipatorische Position zum Nahostkonflikt muss auch heißen, ihre Situation zu verbessern – nicht nur in der Westbank und Gaza, sondern auch in den Nachbarländern wie im Libanon, Syrien oder Ägypten, wo Palästinenser*innen teilweise seit Generationen in Geflüchtetenlagern leben, weitgehend ohne Rechte und ohne Perspektive, sich in die dortigen Gesellschaften zu integrieren. Diese Kritik geht auch ohne Antisemitismus, ohne dem jüdischen Staat seine Daseinsberechtigung abzusprechen, ohne Israel mit dem NS-Staat gleichzusetzen, ohne Juden weltweit für die Politik Israels verantwortlich zu machen, ohne dämonisierende Doppelstandards, die mit der Realität wenig zu tun haben.
Doch in Judenhass Underground geht es nicht um den Nahostkonflikt. Uns geht es um den Konflikt um den Konflikt. Vor allem dann, wenn er antisemitisch wird.
Antisemitismus tritt selbstredend nicht nur in emanzipatorischen Bewegungen und Subkulturen auf. Die Stichwörter liefern die sogenannte Hochkultur und die Akademie. Nachdem der Bundestag 2019 der BDS-Bewegung Antisemitismus attestiert und eine öffentliche Finanzierung von Veranstaltungen der Kampagne unterbunden hatte, gründete sich im Dezember 2020 prompt die Initiative GG 5.3 Weltoffenheit. Darin schlossen sich einige der namhaftesten Kulturinstitutionen des Landes zusammen und lehnten in einer Erklärung BDS explizit ab, um im nächsten Atemzug zu beklagen, dass die „missbräuchliche Verwendung des Antisemitismusvorwurfs wichtige Stimmen“ beiseite dränge und „kritische Positionen“ verzerrt darstelle. Zeitgleich findet der „Historikerstreit 2.0“ statt: In den Feuilletons des Landes wird debattiert, ob die deutsche Erinnerungskultur nun provinziell sei oder nicht, und ob sie einer Aufarbeitung der Kolonialgeschichte im Weg stehe.
Auch in emanzipatorischen Subkulturen ist es nicht anders: In der Clubkultur wächst der Einfluss von BDS, antiisraelische Boykottkampagnen wie #DJsForPalestine gehen viral. Im Punk gehören vereinfachte Oben-Unten-Dichotomien, eine verkürzte Kapitalismuskritik und ein antisemitisch aufgeladener Antiamerikanismus zum guten Ton. In der Hardcore-Szene vergleichen vegane Bands Schlachthöfe mit Vernichtungslagern, andere rufen zur Intifada gegen Israel auf. Im Hiphop, einst eine Reaktion auf Diskriminierung, Rassismus und Polizeigewalt, gelten antisemitische Provokationen heute einigen als Stilmittel, „Rothschild-Theorie“, 9/11-Verschwörung und Anschlagsfantasien inklusive.
Auf der Straße wird der antisemitische Tenor immer lauter: Anhänger*innen von antirassistischen Gruppen wie Migrantifa oder Palästina Spricht fordern „Intifada bis zum Sieg“ oder skandieren Vernichtungsparolen gegen Israel. In Teilen der Klimabewegung wird die Shoah instrumentalisiert, um Aufmerksamkeit auf die Klimakrise zu lenken. Manche „Fridays for Future“-Aktivist*innen feiern palästinensischen Terror gegen Israel und rufen zum Boykott des jüdischen Staates auf. In feministischen Bündnissen wird die PFLP-Terroristin Leila Khaled teilweise als Ikone gefeiert. In der queeren Community wird Israel „Pinkwashing“ unterstellt, wenn das Land sich für LGBTQ*-Rechte einsetzt. Pride-Demos werden immer wieder von BDS gekapert: „Free Palestine“ sei ein queeres Anliegen. „No Pride in Apartheid“, heißt es auf Transparenten.
In all diesen Subkulturen und Bewegungen sucht man eine Sensibilisierung zu Antisemitismus vergeblich. Selbstkritik? Fehlanzeige.
Die russisch-deutsch-jüdische Schriftstellerin Lena Gorelik bemerkt noch vor der documenta 2021 im Sammelband Über jeden Verdacht erhaben? Antisemitismus in Kunst und Kultur: „Man fragt sich, was schlimmer ist: der beabsichtigte oder der unbeabsichtigte Antisemitismus? Der, mit dem man gespielt hat, weil man überprüfen wollte, wo die Grenzen liegen, ob sie sich verschoben haben, jetzt zuletzt, in den vergangenen Jahren? Oder der, den man selbst nicht bemerkt, weil die Stereotype so sehr zum eigenen Weltverständnis gehören, dass man sie gar nicht mehr infrage stellt?“
Bei allen anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit herrscht in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen Konsens: Die Betroffenen haben die Definitionsmacht darüber, was sie für rassistisch, queerfeindlich, sexistisch halten. Vor allem im Kontext von Antirassismus werden Alltagsdiskriminierung, Mikroaggressionen, transgenerationelle Traumata oder strukturelle Benachteiligung zu Recht ernst genommen. Das gilt aber offenbar nicht für eine der meistverfolgten Gruppen der Menschheitsgeschichte, für Jüdinnen*Juden. Viel zu oft herrscht eine Hierarchie von Betroffenheit. Ganz weit unten: Antisemitismus. Das veranlasste den britisch-jüdischen Komiker David Baddiel, sein 2021 erschienenes Buch Jews Don’t Count zu nennen – Juden zählen nicht.
Dabei geht es nicht darum, Rassismus und Antisemitismus gegeneinander auszuspielen. Es geht nicht um eine identitätspolitische Unterdrückungsolympiade. Vielmehr muss der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus zusammengedacht werden – trotz aller Unterschiede und wegen aller Gemeinsamkeiten.
Die Kritik an Antisemitismus trifft in sonst emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen oft auf Abwehr: Antisemitismusvorwürfe würden „zur Waffe“, um vermeintliche Gegner*innen „mundtot“ zu machen – die sogenannte Antisemitismuskeule, die vom „echten Antisemitismus“ ablenke. Oder sie seien Teil einer hinterlistigen zionistischen Kampagne Israels. Menschen, die Antisemitismus anprangern, werden zu Zionisten, „Antideutschen“, Rassisten, gar Faschisten deklariert. Manche gehen so weit zu behaupten, dass Antisemitismuskritik an sich ein rechtes Anliegen sei. Jüdinnen*Juden, die sich mit Israel als Sehnsuchtsort, Schutzraum und einzigem jüdischen Staat der Welt identifizieren, wird abgesprochen, überhaupt links sein zu können. Nichtjüdische BDS-Unterstützer*innen etwa behaupten mithilfe einer Handvoll Kronzeug*innen, im Namen der wahren linken jüdischen Mehrheit zu sprechen. Diese „guten Juden“ bestätigen das eigene Weltbild, die „schlechten“ anderen dienen umso mehr als Projektionsfläche für antisemitische Vorurteile.
Solche Anfeindungen erweisen dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst. Dabei waren es immer auch Teile der gesellschaftlichen Linken, die sich trotz des sehr realen Antisemitismus in emanzipatorischen Bewegungen glaubhaft und entschlossen gegen jeden Judenhass eingesetzt haben. Im rechten und konservativen Lager wird der Kampf gegen Antisemitismus tatsächlich oft instrumentalisiert, um Stimmung gegen Geflüchtete oder den Islam zu machen. Israelsolidarität wird dort nur hochgehalten, solange sie rassistischen Ressentiments dienen kann.
Judenhass Underground ist vor allem eine Selbstkritik: Wir geben dieses Buch heraus, gerade weil wir aus den beschriebenen Subkulturen und Bewegungen kommen. Weil wir ihr radikales, emanzipatorisches Potenzial für wichtig halten. Wir und unsere Co-Autor*innen und Gesprächspartner*innen sind straight, queer, goj, jüdisch, deutsch, nichtdeutsch und alles dazwischen. Aber vor allem teilen wir ein linkes, emanzipatorisches Selbstverständnis. Wir wollen reden – und streiten.
Die Geschichte dieses Bandes beginnt im Corona-Sommer 2021. Die Clubkultur liegt brach. Aber während der pandemischen Feierpause macht die queere Partyreihe Buttons am 22. Juni via Instagram mit dem Berliner Club ://about blank Schluss. Jahrelang feierte das internationale Partykollektiv in dem ehemaligen Kindergarten am Ostkreuz. Die Organisator*innen wollen sich aber nun gegen „Apartheid“ in Israel einsetzen. Denn queere Befreiung sei grundsätzlich mit den Träumen von der palästinensischen Befreiung verbunden. Und das bedeutet für sie, die Zusammenarbeit mit einem Club zu beenden, in dem die Parole „gegen jeden Antisemitismus“ zum Grundkonsens gehört. Beifall kommt von den queeren Partyreihen Cocktail d’Amore, Gegen und Lecken. Zeitgleich erscheint ein offener Brief der „Berlin Nightlife Workers Against Apartheid“ im fast selben Wortlaut. Wir schreiben seit Jahren über Antisemitismus. Und trotzdem ist das für uns ein einschneidender Moment. Das Private wird endgültig politisch.
Mit Judenhass Underground liefern wir kein komplettes Bild, das Buch hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist ein Schnappschuss. Eine Momentaufnahme. Viele, aber nicht alle unserer Beispiele stammen aus Deutschland. Dennoch sind sie vielfach universell, stehen sinnbildlich für einen alarmierenden Trend in progressiven, international vernetzten Milieus weltweit.
Judenhass Underground gliedert sich in drei Teile: Theorie, Praxis, Dialog. Wir untersuchen die Ursprünge des Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen, von der Leerstelle in Intersektionalitätsdebatten und der Rolle von Jüdinnen*Juden im Klassenkampf über die Entstehung der BDS-Kampagne bis zur antisemitischen Ideologie mancher Linker, die ab 1968 in Terror gegen Jüdinnen*Juden mündete. Wir beschreiben Antisemitismus im aktivistischen und subkulturellen Alltag – von der Straße und den Timelines in die Clubs und Konzertsäle. Und wir suchen das Gespräch mit Künstler*innen, Aktivist*innen und von Antisemitismus Betroffenen, die von ihren unterschiedlichen Erfahrungen berichten. Eine Anklage mit anschließender Diskussion. Kritisch, aber konstruktiv.
Nicholas Potter und Stefan Lauer
*In diesem Text differenzieren wir zwischen dem ungegenderten Begriff „Jude/Juden“ als imaginärem Konstrukt und Projektionsfläche des Antisemitismus und tatsächlichen „Jüdinnen*Juden“, um die Bandbreite jüdischer Identitäten zu benennen.
**Wir verwenden den Begriff „Nahostkonflikt“ in Bezug auf Israel und Palästina, obwohl es nicht der einzige Nahostkonflikt ist. Der Konflikt ist älter als der Staat Israel selbst und beschränkt sich nicht nur auf Israelis und Palästinenser*innen, auch die benachbarten Länder und der Iran spielen eine maßgebliche Rolle.
Theorie
Israelhass und Antisemitismus
Nikolas Lelle und Tom Uhlig
„Aber es gibt keine Antisemiten mehr“ – mit diesen Worten beginnen Theodor W. Adorno und Max Horkheimer die letzte These ihrer „Elemente des Antisemitismus“, 1947 zur Dialektik der Aufklärung hinzugefügt. Selbstverständlich wussten die beiden, dass es weiterhin Antisemitismus gibt. Es gab in Deutschland keine Stunde Null – nicht mal beim Antisemitismus. Dennoch stimmt der Satz, denn Antisemit wollte und will kaum jemand mehr sein. Jürgen Elsässer, Herausgeber des rechtsextremen Magazins Compact, und Xavier Naidoo, Schnulzensänger und Verschwörungsinfluencer, zogen vor Gericht, weil ihr Antisemitismus als solcher benannt wurde. Selbst die NPD behauptet von sich, keine antisemitische Partei zu sein.
Währenddessen zeigen Studien wie die 2022 vom World Jewish Congress veröffentlichte, dass antisemitische Ressentiments nach wie vor weit verbreitet sind. Jedoch seltener in Form offener Hetze gegen Jüdinnen*Juden: Das Ressentiment ist verklemmt, es wagt sich nicht ins Freie, sondern muss Umwege nehmen, um nicht gesellschaftlich abgestraft zu werden. Während niemand mehr Antisemit sein will, finden Verschwörungserzählungen, Geschichtsrevisionismus und Israelhass ein Millionenpublikum. In der postnationalsozialistischen Gesellschaft werden Codes und Chiffren genutzt, um diejenigen zu umschreiben, die man eigentlich meint. Man schwadroniert von Strippenziehern, Globalisten, Rothschilds, Blutsaugern oder vom Ostküstenkapital und der Zinsknechtschaft – und hetzt vor allem immer wieder gegen Israel.
Kein Land wird so leidenschaftlich und so ausgiebig kritisiert wie der jüdische Staat. Das kleine Land am Mittelmeer mit einer Fläche ungefähr so groß wie Hessen wurde weit öfter vom UN-Menschenrechtsrat verurteilt als alle anderen Länder dieser Welt zusammen. Zwischen 2006 und 2022 wurde Israel allein 95-mal gerügt. Syrien kommt mit 38 Verurteilungen auf Platz zwei, Nordkorea mit 14 auf Platz drei. Diese bizarre Verzerrung ist ohne Verweis auf Antisemitismus kaum zu erklären. Gleichzeitig wird immer wieder behauptet, es gebe ein Tabu, israelische Politik zu kritisieren. Dabei sind die Tageszeitungen voll von israelfeindlichen Artikeln: Bei jeder neuen Eskalation zeigt sich, dass dieses Tabu nicht besteht, wie Robert Beyer und Monika Schwarz-Friesel im Sammelband Judenfeindschaft und Antisemitismus in der deutschen Presse über fünf Jahrhunderte beweisen.
Das angebliche Tabu wird hierzulande oftmals mit der deutschen Schuld begründet. Wegen der Shoah sei man befangen. Die deutsche Geschichte vernebele den Blick auf die Gegenwart, weshalb man sich von ihr lösen müsse, sei es durch Normalisierung, Historisierung oder Relativierung. Die Dämonisierung Israels lindert die deutsche Schuld, und umgekehrt bereitet die Schuldabwehr die Dämonisierung vor. Jedoch bröckelt die Fassade, es gehe lediglich um Israel: Nicht zufällig finden sogenannte propalästinensische Demos regelmäßig am Jahrestag der Novemberpogrome statt. Und nicht zufällig wird immer wieder vor deutschen Synagogen gegen israelische Politik demonstriert. Die Angriffe auf die wenigen Errungenschaften der deutschen Erinnerungskultur, die von unten hart erkämpft worden sind, haben auch den Zweck, israelbezogenen Antisemitismus zu enttabuisieren. Sie richten sich „gegen Israel, das stellvertretend gemeint ist, wenn es um den Topos der Einzigartigkeit des Holocaust geht“, schreibt die Historikerin Sybille Steinbacher im Band Ein Verbrechen ohne Namen: „Der Holocaust darf also auch deshalb nichts Besonderes sein, weil sich dann – und erst dann – die Legitimität des jüdischen Staates in Frage stellen lässt.“
Eine repräsentative Studie im Auftrag des American Jewish Committee (AJC) zeigte 2022, dass Israelhass und Judenhass sich nicht trennen lassen. Wer schlecht über Israel denkt, stimmt auch eher offen antisemitischen Einstellungen zu. Dass Juden reicher als Deutsche seien, glaubt im Durchschnitt jede*r Dritte. Unter denjenigen aber, die schlecht über Israel denken, glauben es die Hälfte.
Zwischen Israelhass und Judenhass zu trennen, wie es auch in der Debatte um die documenta viel zu oft getan wurde, ist irreführend, tauchen die beiden Phänomene doch meist gemeinsam auf. Die kategoriale Trennung aber suggeriert, es gebe guten und schlechten Antisemitismus, oder jedenfalls Antisemitismus, der diskutabel sei und den man darum aushalten müsse. Dabei ist israelbezogener Antisemitismus keine Lappalie, sondern brandgefährlich für Jüdinnen*Juden weltweit. Mit der Trennung von Antisemitismus und Israelhass wird Letzterer verharmlost, und dessen gewaltförmige Konsequenzen werden in Abrede gestellt. Israelbezogener Antisemitismus wird oft zum Streitfall erklärt, zu etwas, über das sich ergebnisoffen diskutieren lasse.
Antisemitismus in 3D
Israelbezogener Antisemitismus ist nicht etwas gänzlich anderes als die sonstigen Formen des Judenhasses. Im Gegenteil: Er bedient sich derselben Motive und Argumentationen wie der offene Antisemitismus. Monika Schwarz-Friesel beschreibt in ihrem Buch Judenhass im Internet das „Chamäleon Antisemitismus“. Dessen Kern bleibt immer gleich, doch seine Erscheinungsform ändert sich und passt sich historisch an die jeweilige Umwelt an. Israelbezogener Antisemitismus bedient sich klassischer antisemitischer Motive wie dem Vorwurf der Verschlagenheit, Unmenschlichkeit, Gier und illegitimen Macht. Der frühere sowjetische Bürgerrechtler und ehemalige Vorsitzende der Jewish Agency Natan Scharanski hat deswegen den 3D-Test eingeführt, um israelbezogenen Antisemitismus zu erkennen: Finden sich in einer Aussage über Israel Dämonisierung, Delegitimierung oder doppelte Standards, wird vermeintliche „Israelkritik“ zu Antisemitismus.
Strukturell gleicht der israelbezogene Antisemitismus dem offenen, er bietet aber den Vorteil, sich dem Antisemitismusvorwurf entziehen zu können. Er ist eine Möglichkeit, Antisemitismus zu verbreiten, in einer Zeit, in der es keine Antisemiten mehr geben soll. Anders formuliert: Israelbezogener Antisemitismus kommt nicht im Gewand einer menschenfeindlichen Ideologie daher, sondern verkleidet sich als etwas Gutes. Er gibt sich besorgt um die Menschenrechtslage im Nahen Osten, ist allerdings lediglich daran interessiert, der israelischen Politik und Gesellschaft die Ursachen der Missstände zuzuschreiben. Ende der 1960er Jahre schrieb der österreichische Schriftsteller und Shoah-Überlebende Jean Améry über diesen „ehrbaren Antisemitismus“, dass der Judenhass im Antizionismus enthalten sei wie das Gewitter in der Wolke.
Übrigens ist auch das moralische Überlegenheitsgefühl keine Besonderheit. Der Antisemitismus gab den Antisemiten immer schon das Gefühl, das Richtige zu wollen. Am brutalsten haben das die Nationalsozialisten durchdekliniert: Weil sie in „den Juden“ das Übel der Welt erkannt hatten, schien ihnen deren Ermordung die einzige Möglichkeit, diese Welt zu erlösen. Der Historiker Saul Friedländer spricht deshalb vom „Erlösungsantisemitismus“. Man suchte das „Heil“, das man sich zum Gruß entgegenschmetterte, im systematischen Mord. Die Propagandist*innen israelbezogenen Antisemitismus würden selbstverständlich in den seltensten Fällen zum Mord aufrufen, allerdings besticht ihr lapidarer Umgang mit dem Leben der israelischen Zivilbevölkerung. Wenn etwa der Abbau der Grenzanlagen in der Westbank gefordert wird, spielt es keine Rolle, dass damit ein sicheres Leben in Israel unmöglich würde.
Wie beim offenen Antisemitismus richtet sich auch der israelbezogene nur vordergründig gegen Verhaltensweisen. Antisemitismus sucht Anlässe, ist aber nicht von ihnen abhängig. Mit dem Verhalten von tatsächlichen Jüdinnen*Juden bzw. Israel hat er nichts zu tun. Immer zielt der Antisemitismus auf die Existenz. Jüdinnen*Juden sollen nicht mehr leben, der Staat Israel soll nicht mehr existieren. Keine Konzession der israelischen Regierung ist genug. Ein freies Palästina „from the river to the sea“, wie eine auf Demonstrationen beliebte Parole lautet, kennt keinen Platz für den einzigen jüdischen Staat. Der israelbezogene Antisemitismus zielt darauf, Israel abzuschaffen.
Dieser Impuls vereint sehr unterschiedliche Milieus. Auch das ist typisch für Antisemitismus im Allgemeinen. Judenhass ist seit jeher ein Kitt, der verschiedene politische Gruppen verbindet und mobilisiert. Die Coronaleugner-Proteste zeigten, wie der Schulterschluss zwischen der extremen Rechten und einer enthemmten Mitte über antisemitische Verschwörungserzählungen gelingt. Auf antiisraelischen Demonstrationen laufen Panarabisten, Islamisten, türkische Rechte und palästinensische Aktivist*innen gemeinsam mit antiimperialistischen Linken und bisweilen auch Neonazis.
Für die verschiedenen Szenen erfüllt israelbezogener Antisemitismus unterschiedliche Funktionen. Für Panarabisten kann Israel etwa zum Quell des gekränkten Nationalismus stilisiert werden. Neonazis artikulieren über den Umweg Israel ihren eliminatorischen Antisemitismus, ohne sich strafbar zu machen. Deutsche Nationalkonservative projizieren die eigene familiäre schuldhafte Verstrickung auf Israel. Von antiimperialistischen Linken wird der Konflikt zwischen Israel und Palästina zu einem Stellvertreterkampf gemacht, der die hiesigen enttäuschten revolutionären Hoffnungen kaschiert. Manche palästinensische Aktivist*innen reduzieren die Ursachen ihrer oftmals prekären Lebenssituationen lediglich auf den Staat Israel, ihrer Diskriminierung und Unterdrückung in vielen Ländern der Region und darüber hinaus zum Trotz. Die Motivlagen, sich an antiisraelischen Aktionsbündnissen zu beteiligen, können also sehr individuell sein. Oft reicht für den Schulterschluss aber allein der gemeinsame Feind.
Antisemitismus definieren
Die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) hat eine mittlerweile weit verbreitete Arbeitsdefinition von Antisemitismus veröffentlicht. Die Definition reagiert auf den grassierenden Antisemitismus des 21. Jahrhunderts und auf den Bedarf, Antisemitismus adäquat bestimmen und erkennen zu können. Denn das scheint in der Praxis gar nicht so leicht. Die Erfahrung zeigt, dass nicht zuletzt Ämter und Behörden damit häufig überfordert sind. Für die fachliche Auseinandersetzung sind Ressourcen nötig, die solchen Organisationen in der Praxis oft nicht zur Verfügung stehen.
Die Definition erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und behauptet auch nicht, der Fachdebatte einen Schlusspunkt zu setzen. Neben einer allgemeinen Definition von Antisemitismus als „Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann“, sich aber auch gegen nichtjüdische Menschen sowie Organisationen und vor allem auf Israel richten kann, arbeitet die Definition mit elf Paradebeispielen antisemitischer Meinungen und Parolen. Der Fokus liegt auf gängigen gegenwärtigen Formen antisemitischer Agitation, also Verschwörungserzählungen, Geschichtsrevisionismus und israelbezogenem Antisemitismus. Damit ist die IHRA-Definition von Antisemitismus eine brauchbare Hilfe für die Praxis und hat sich relativ gut international etabliert: Sie wurde von bislang 39 Ländern weltweit angenommen und wird von hunderten Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen verwendet.
Allerdings gibt es immer wieder Stimmen, die monieren, der Antisemitismusbegriff sei hier ungebührlich ausgeweitet. Diese Kritik ist nicht neu: Seit der Nachkriegszeit gibt es immer wieder Bestrebungen, Antisemitismus allein auf die Shoah zu reduzieren und damit zu historisieren. Hinter der aktuellen Behauptung, die Definition sei zu schwammig, verbirgt sich vor allem die Klage, dass hier israelbezogener Antisemitismus deutlich benannt wird.
Die Annahme der IHRA-Definition durch die Bundesregierung lässt sich auf ein geschärftes Problembewusstsein gegenüber Antisemitismus zurückführen. Zeitgeschichtlich antwortet dieses auf den Antisemitismus seit 9/11, die BDS-Kampagne, die antisemitische Beschneidungsdebatte 2012 sowie die antiisraelischen Massendemonstrationen von 2014. Das neue Problembewusstsein zeigt sich in den beiden unabhängigen Expertenkreisen Antisemitismus, die 2009 und 2013 eingerichtet wurden, sowie in der ersten Studie der Universität Bielefeld aus dem Jahr 2017, „Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland“. In Bund und Ländern wurden daraufhin Antisemitismusbeauftragte einberufen, und der Bundestag beschloss 2019 eine Resolution gegen die BDS-Kampagne. Nach Jahrzehnten der Antisemitismusbekämpfung und der kritischen Erinnerungsarbeit von unten begann nun auch der deutsche Staat, den Einsatz gegen Judenhass als seine Aufgabe zu verstehen. Es sollte auf der Hand liegen, dass das nicht bedeutet, dass die Anstrengungen von unten nicht mehr notwendig sind.
Gegen diese Entwicklung zu einem geschärften Problembewusstsein formiert sich Widerstand. Ein Zusammenschluss von vielen großen Kulturinstitutionen tritt unter dem Namen Initiative GG 5.3 Weltoffenheit Ende 2020 an die Öffentlichkeit und äußert sich besorgt. Es wird befürchtet, der BDS-Beschluss des Parlaments gefährde die Meinungsfreiheit. Wenngleich die Initiative selbst keine Partei für BDS ergreifen wolle, sei es doch wichtig, diese internationalen Stimmen abzubilden. Eine Ächtung der Kampagne würde Deutschland provinzialisieren – ganz so, als sei Antisemitismuskritik allein ein deutsches Anliegen.
Im Fahrwasser der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit wird die Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) veröffentlicht. Was sich als Alternative zur IHRA-Definition präsentiert, stellt einen Rückschritt dar. Auffällig ist nämlich, dass die JDA weitaus schwammiger ist. Der Kern der Definition bestimmt Antisemitismus als „Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit und Gewalt“ gegen Jüdinnen*Juden und fällt damit hinter den Forschungsstand zurück. Gleich im ersten Punkt wird Antisemitismus dann noch als Unterform des Rassismus bestimmt. Moishe Postone schreibt schon in den 1970er Jahren in seinem Aufsatz „Nationalsozialismus und Antisemitismus“, dass man Antisemitismus nicht versteht, wenn er „als bloßes Beispiel für Vorurteile, Fremdenhass und Rassismus allgemein behandelt wird, als Beispiel für Sündenbock-Strategien, deren Opfer auch sehr gut Mitglieder irgendeiner anderen Gruppe hätten gewesen sein können“.
Darüber hinaus frappiert die JDA aber vor allem dadurch, dass sie viel Platz darauf verwendet, was alles „nicht per se“ antisemitisch sein soll, wodurch etliche Klassiker des Israelhasses (wie der Apartheidvorwurf oder der Boykott Israels) vom Antisemitismusvorwurf befreit werden. Die Argumentation ist irreführend, denn „per se“ ist erst einmal recht wenig antisemitisch. Der Kontext ist natürlich entscheidend. Interessant ist nicht, zu erfahren, was „nicht per se“ antisemitisch ist; interessant sind vielmehr die konkreten Fälle, in denen etwas tatsächlich antisemitisch ist. Darüber lässt die JDA einen aber im Dunkeln, weshalb sie für die Praxis des Erkennens von israelbezogenem Antisemitismus schlicht unbrauchbar ist.
Eine Gefahr für Jüdinnen*Juden
Für Jüdinnen*Juden ist israelbezogener Antisemitismus keine Lappalie, sondern eine alltägliche Bedrohung. Weltweit werden sie genötigt, sich für die Politik des Staates Israel zu rechtfertigen, ganz gleich, ob sie einen persönlichen Bezug dazu haben oder nicht. Schlimmer noch: Wo gegen Israel Stimmung gemacht wird, sind Angriffe auf Jüdinnen*Juden nicht weit. Die Demonstrationen im Mai und Juni 2021 und 2022 zeigen das deutlich. In Gelsenkirchen wird vor einer Synagoge „Scheiß Juden“ skandiert. Pressevertreter*innen werden in Berlin als „Zionistenpresse“ beschimpft. 2023 heißt es auf einer propalästinensischen Demo in Berlin-Neukölln: „Tod den Juden.“ Aber auch der Attentäter von Halle wähnte die deutsche Regierung von Zionisten besetzt, und der Attentäter von Hanau träumte von der Vernichtung Israels.
In letzter Konsequenz unterscheidet Israelhass kaum noch zwischen Jüdinnen*Juden und Israel. Den Menschen erscheint es folgerichtig, vor Synagogen gegen israelische Politik zu demonstrieren oder „Free Palestine“ unter Social-Media-Posts von Jüdinnen*Juden zu kommentieren, die nichts, aber auch gar nichts mit Israel zu tun haben – für sie repräsentieren alle Jüdinnen*Juden diesen Staat. Gelegentlich wird das Argument angeführt, dass diese Unterscheidung in Wahrheit den Kritiker*innen des israelbezogenen Antisemitismus schwerfalle. Sie seien es, die in der Ablehnung Israels immer eine Ablehnung der Jüdinnen*Juden vermuten, obwohl lediglich der Staat gemeint sei. Dieses Argument lässt sich allerdings nur aufrechterhalten, wenn man den ständigen Umschlag des Israelhasses in mehr oder minder offen antisemitische Gewalt ignoriert oder betont naiv zu Einzelfällen erklärt. Und wenn man ausblendet, welche Rolle das Konzept Israel seit eh und je im Judentum spielt.
Eine Linke, die solidarisch mit Jüdinnen*Juden sein will, darf die Umwegkommunikation von Antisemitismus über Israelhass nicht ignorieren. Antisemitismus bekämpft nur, wer auch den eigenen und den des eigenen Milieus selbstkritisch in den Blick nimmt. Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen ernst zu nehmen, bedeutet auch, sich selbst zu reflektieren. Die deutsche Linke ist in all ihrer Unterschiedlichkeit aber großteils gojnormativ, wie es Judith Coffey und Vivien Laumann in ihrem Buch Gojnormativität nennen. Die Autor*innen schreiben, dass die Linke nichtjüdische, „gojische Positionen unhinterfragt als ‚normal‘“ annimmt und damit jüdische Positionen übersieht. Jüdinnen*Juden erscheinen lediglich als Verbündete, wenn sie dem eigenen Israelhass nicht im Weg stehen. Ihnen wird die gesellschaftliche Marginalisierung abgesprochen, weil sie als weiß und privilegiert betrachtet werden. Dass (israelbezogener) Antisemitismus vielmals eine alltagsprägende Erfahrung für Jüdinnen*Juden in Deutschland ist, wird dann übersehen. Dieses theoretische Framing verstellt auch den Blick auf israelbezogenen Antisemitismus und Israel. Die vermeintliche Privilegiertheit der Jüdinnen*Juden wird gegen die Marginalisierung der Palästinenser*innen ausgespielt. Israel kann so in eine Genealogie der Unterdrückung eingereiht werden.





























