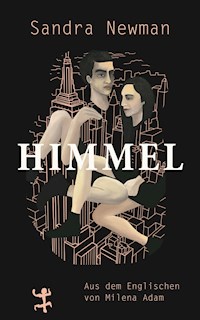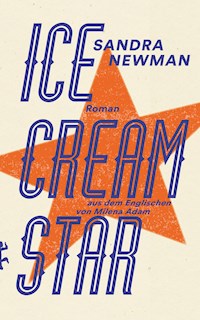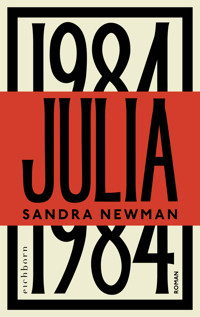
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit seinem berühmten Roman "1984" gelang George Orwell eine visionäre Dystopie über eine Welt der totalen Überwachung. Nun wird dieser Klassiker zu ganz neuem Leben erweckt - und aus der Sicht der weiblichen Hauptfigur erzählt. Die gewitzte Mechanikerin Julia hat längst ihre ganz eigenen Strategien entwickelt, um in dem unmenschlichen Überwachungssystem zu überleben. Doch dann verliebt sie sich in Winston, und damit gerät alles aus den Fugen. Dieser eigentümliche Mann gibt Julia immer wieder Rätsel auf, und sollte ihre Liebe auffliegen, könnte sie das ihr Leben kosten. Allmählich verliert Julia jeglichen Halt in der ihr vertrauten Welt - und dabei gilt immer: Big Brother is watching you ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Hinweis
TEIL 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TEIL 2
13
14
15
16
17
18
19
20
TEIL 3
21
22
23
Danksagung
Anmerkung
Über das Buch
Mit seinem berühmten Roman »1984« gelang George Orwell eine visionäre Dystopie über eine Welt der totalen Überwachung. Nun wird dieser Klassiker zu ganz neuem Leben erweckt – und aus der Sicht der weiblichen Hauptfigur erzählt. Die gewitzte Mechanikerin Julia hat längst ihre ganz eigenen Strategien entwickelt, um in dem unmenschlichen Überwachungssystem zu überleben. Doch dann verliebt sie sich in Winston, und damit gerät alles aus den Fugen. Dieser eigentümliche Mann gibt Julia immer wieder Rätsel auf, und sollte ihre Liebe auffliegen, könnte sie das ihr Leben kosten. Allmählich verliert Julia jeglichen Halt in der ihr vertrauten Welt – und dabei gilt immer: Big Brother is watching you …
Über die Autorin
Sandra Newman, geboren 1965 in Boston, lebte in Deutschland, Russland, Malaysia und England und arbeitete in Berufen vom akademischen bis zum Profi-Zocker-Mileu; heute unterrichtet sie neben ihrer eigenen literarischen Arbeit kreatives Schreiben. Sie hat bereits vier Romane sowie verschiedene Sachbücher veröffentlicht. Ihre Romane standen auf den Longlists und Shortlists diverser Literaturpreise. Auf Deutsch erschienen 2019 Ice Cream Star und 2020 Himmel (Matthes & Seitz) und waren große Kritikererfolge. Sandra Newman lebt in New York.
SANDRA NEWMAN
JULIA
ROMAN
Aus dem Englischen von Karoline Hippe
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Karoline Hippe dankt dem Deutschen Übersetzerfondsfür die Förderung des vorliegenden Textes.
Die Markenbezeichnungen Julia und 1984 werden mit freundlicher Genehmigung des Orwell Estate verwendet.
Eichborn Verlag
Titel der englischen Originalausgabe:»Julia«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2023 by Sandra Newman
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Bärbel Brands, BerlinUmschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung eines Designs von © Luke Bird, auf Grundlage der Originalausgabe 1984 von Secker and Warburg, 1949eBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-4859-9
luebbe.delesejury.de
Hinweis:
Diese Übersetzung orientiert sich an Frank Heiberts Neuübersetzung des Romans 1984 von George Orwell (S. Fischer Verlage, 2021).
TEIL 1
1
Mit diesem Mann aus der Abteilung Archiv fing alles an, diesem knurrigen, grimmigen Typen, der immer so von oben herab wirkte mit seinem Altdenkgehabe und absolut keine Ahnung hatte, was auf ihn zukommen würde. Syme nannte ihn nur Old Misery.
Er war Julia nicht wirklich fremd. Fiktion, Archiv und Recherche nahmen immer gemeinsam um dreizehnhundert die zweite Mahlzeit ein, und irgendwann kannte man halt jedes Gesicht. Aber er war bisher immer nur Old Misery gewesen, der Typ, der so aussah, als hätte er eine Fliege verschluckt, der mehr hustete, als dass er sprach.
Genosse Smith war sein richtiger Name, auch wenn »Genosse« nicht recht zu ihm passte. Und wenn einem schon unwohl dabei war, jemanden »Genosse« zu nennen, sollte man besser einen großen Bogen um diese Person machen.
Er war schlank und gutaussehend. Attraktiv – oder hätte es sein können, wenn er nicht immer so säuerlich aus der Wäsche geguckt hätte. Man sah ihn nie lächeln, es sei denn, er setzte das falsche Grinsen der Parteifrömmigkeit auf. Julia hatte einmal den Fehler gemacht, ihn anzulächeln; bei dem Blick, den er ihr daraufhin zuwarf, wäre beinahe die Milch sauer geworden. Man erzählte sich, er leiste hervorragende Arbeit, könne jedoch nicht befördert werden, weil seine Eltern Unpersonen gewesen waren. Wahrscheinlich war er deswegen so verbittert.
Trotzdem war es nicht schön mitanzusehen, wie Syme ihn quälte. Syme arbeitete im Wahrheitsministerium in der Abteilung Recherche und entwickelte Neusprech-Wörter. Sie sollten den Geist des Volkes reinigen, aber vor allem war es unglaublich nervig, sie zu lernen. Die meisten Leute wurschtelten sich so durch, aber Old Misery Smith konnte nicht einmal ungut sagen, ohne dabei auszusehen, als würde es ihm den Mund verätzen. Syme nahm dies zum Anlass, ihm auf Schritt und Tritt zu folgen und einen auf bester Freund zu machen, um ihn bei jeder Gelegenheit mit Neusprech zu überschütten und belustigt zuzusehen, wie der arme Kerl sich vor Unbehagen wand. Auch das öffentliche Hängen schlug Smith schnell auf den Magen, also erzählte Syme von den Hinrichtungen, denen er beigewohnt hatte, ahmte die Geräusche der strangulierten Männer nach und machte keinen Hehl daraus, wie sehr es ihm gefiel, wenn ihnen die Zunge aus dem Halse hing. Smith lief regelrecht grün an. Das war Symes Art von Humor.
Julia hatte nur einmal mit dem Mann gesprochen, als sie in der Kantine am selben Tisch gelandet waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie die Hoffnung auf ihn noch nicht aufgegeben. In Wahrheit gab es sonst kaum attraktive Männer, und sie dachte, sie könnte sich bestimmt in eine kleine Verknalltheit hineinsteigern und sich mit ihm die öden Tage versüßen. Also plauderte sie mit mehr Begeisterung als angemessen über den neuen Dreijahresplan und darüber, dass – dem Großen Bruder sei Dank – Fiktion glücklicherweise neue Mitarbeiter eingestellt hatte, und wie lief es denn so im Archiv?
Statt zu antworten, fragte er, ohne sie überhaupt anzusehen: »Du arbeitest also an einer der Romanschreibemaschinen?«
Sie lachte. »Ich repariere alles, was kaputtgeht, Genosse. Nicht nur eine Maschine. Das wäre ja ein schöner Apparat, den man den ganzen Tag lang reparieren müsste.«
»Ich sehe dich immer mit einem Schraubenschlüssel.« Sein Blick wanderte zu der roten Schärpe der Jugend-Antisex-Liga um ihre Taille, huschte dann aber hastig davon, als hätte der Anblick ihm einen elektrischen Schlag verpasst. Julia konnte dem armen Kerl ansehen, dass er Angst vor ihr hatte. Er dachte wohl, sie würde ihn gleich wegen Sexkrim anzeigen – als könnte sie sehen, welche schmutzigen Fantasien er sich in seinem Kopf zurechtträumte!
Na gut, das schien also doch keinen Sinn zu haben. Schweigend aßen sie auf.
Der Tag, an dem sich alles änderte, war der Tag, an dem O’Brien der Abteilung Fiktion einen Besuch abstattete. Es war ein strahlendkalter Aprilmorgen, ein fieser Wind hatte ganz London beim Schopf gepackt, die Stadt rasselte und stöhnte. In O’Briens Anwesenheit verwandelte sich Fiktion in ein Irrenhaus – alle wollten zeigen, wie hart sie arbeiteten –, aber Julia hatte nichts zu tun. Sie verbrachte den ganzen Vormittag oben auf der Galerie und hielt vergeblich nach den gelben Fähnchen Ausschau, die ihr anzeigten, dass irgendwo ihr Reparaturservice benötigt wurde. Normalerweise schossen sie wie Pilze aus dem Boden, und Julia flitzte den ganzen Tag hin und her, stets begleitet von dem ewig gleichen Kanon: »Genossin, hier knirscht’s … Oh, jetzt nicht mehr. Könntest du trotzdem mal nachschauen?« Die meisten Reparaturanfragen waren nur ein Vorwand, um sich auf einen Schnack und einen Gin hinauszuschleichen, und Julia spielte stets mit, schaltete die fragliche Maschine ab und gab vor, nach der Ursache des Phantomproblems zu suchen.
Heute knirschte es nirgendwo. Alle hatten Angst davor, von O’Brien für Saboteure gehalten zu werden. Also verbrachte Julia den Morgen damit, die Galerie auf und ab zu wandern. Sie hatte Schmacht nach einer Kippe, doch ihr war klar, dass man sie mit einer Zigarette in der Hand einfach nur für faul und träge halten würde.
Fiktion war in einer riesigen, fensterlosen Fabrikhalle in den ersten beiden Untergeschossen des Wahrheitsministeriums untergebracht. Der Großteil der Halle wurde von der Romanschreibemaschinerie eingenommen – acht gigantische Maschinen, die von außen wie einfache Kästen aus glänzendem Metall aussahen. Doch wenn man sie öffnete, offenbarte sich eine verblüffende Ansammlung von Sensoren und Zahnrädern. Nur Julia und ihre Kollegin Essie wussten, wie man in ihrem Inneren herumkroch, ohne Schaden anzurichten. Der zentrale Mechanismus war das Kaleidoskop. Es bestand aus sechzehn Klauensätzen, die die Handlungselemente auswählten und zusammenfügten; Hunderte von Metalllettern wurden von den Klauen gegriffen und wieder verworfen, bis eine Gruppe gefunden war, die zusammenpasste. Dieses stimmige Muster wurde – auch wieder maschinell – zu einer magnetisierten Platte transportiert, die Platte daraufhin in eine Wanne mit Tinte getunkt, dann herausgeschwenkt und auf eine Papierrolle gestempelt. Die bedruckte Papierbahn wurde abgeschnitten und dann von einem Produktionsleiter von der Walze genommen.
Das Ergebnis war ein Rasterdruck, von den meisten im Scherz nur »Bingokarte« genannt, der die wesentlichen Elemente einer Geschichte kodierte: Genre, Hauptfiguren, Schlüsselszenen. Ein Mitarbeiter von Neuschreib hatte einmal versucht, Julia zu erklären, wie diese Karten zu interpretieren waren, aber vergeblich. Selbst nach fünf Jahren in der Abteilung hätten diese Karten für Julia genauso gut mit ostasiatischer Bilderschrift bedruckt sein können.
Jetzt beobachtete sie, wie ein Produktionsleiter einen neuen Druck von der Rolle nahm und herumwedelte, damit die Tinte schneller trocknete. Als er zufrieden war, rollte er den Druck zusammen, steckte ihn in einen grünen Zylinder und schob den Zylinder in einen Rohrpostschacht. Von ihrer Position aus konnte Julia beobachten, wie der Zylinder durch ein Gewirr von durchsichtigen Röhren an der Decke der Halle schoss und schließlich in eine Tonne am anderen Ende des Raumes plumpste. Dort war die Abteilung Neuschreib. Männer und Frauen saßen in langen Reihen nebeneinander, murmelten in ihre Sprechschreibs, verwandelten die Bingokarten in Romane und Geschichten. In dieser Phase waren keine Maschinen mehr am Prozess beteiligt, und Julia verlor das Interesse.
Ihre Begeisterung für die Romanschreibemaschinerie hingegen war ungebrochen, es faszinierte sie, wie sie funktionierte und was alles schiefgehen konnte. Sie wusste, aus welchen Chemikalien die Tinte bestand, und erklärte anderen nur zu gern, warum das Blau immer wieder Probleme bereitete. Sie wusste, wie das Papier gespannt wurde und was dazu führen konnte, dass es doch mal staute oder zerknitterte. Sie kannte den genauen Zeitpunkt, zu dem ein Teil ersetzt werden musste, und wusste, wie die Bestellung aufzugeben war, damit sie nicht vom Ausschuss für Investitionsgüter abgelehnt wurde. Aber über die Bücher, die Endergebnisse, wusste sie wenig, und sie waren ihr auch herzlich egal.
Einmal erzählte ihr ein Neuschreib-Typ, der früher richtig gerne gelesen hatte, dass es ihm genauso ging: »Man sagt, wenn man Wurst liebt, sollte man nie dabei zusehen, wie sie gemacht wird. Danach ekelt man sich nur noch. So geht’s mir mit Büchern.« Auf Julia traf das nicht zu. Sie hatte selbst schon Wurst hergestellt und sie dann gegessen, ohne mit der Wimper zu zucken. Einmal hatte sie sogar eine rohe Bratwurst verschlungen, um eine Wette zu gewinnen. Was allerdings Die Revolution siegt: Alles für den Großen Bruder und Kriegskrankenschwester VII: Larissa betraf, so musste sie ihm recht geben.
Während sie so untätig ihren Gedanken nachhing, fiel ihr auf, dass sie O’Brien die ganze Zeit beobachtet hatte. Er bahnte sich seinen Weg durch die Halle, hielt spontane Reden, stellte Fragen und schenkte all den Arbeiterinnen und Arbeitern sein freundlichstes Lächeln. Diejenigen, die sich weiter entfernt von ihm aufhielten, standen mit gesenkten Köpfen und ausdruckslosen Mienen da. Sie gaben ihr Bestes, mit den Maschinen eins zu werden, was in vielen Fällen beeindruckend gut gelang. In O’Briens Nähe jedoch waren ihm die Menschen zugewandt, ihre Gesichter von ehrfürchtiger Hoffnung erfüllt, wie Blumen, die sich der Sonne entgegenreckten. O’Briens Anwesenheit hatte mehrere Personen von ihren Posten weggelockt. Sie versammelten sich um ihn, lauschten gebannt seinen Worten. Natürlich hatte eine Unterhaltung mit einem Mitglied der Inneren Parteiriege immer Vorrang vor der Arbeit.
Was Julia von ihrem Aussichtspunkt auf der Galerie aus besonders auffiel, war der frappierende Kontrast zwischen O’Brien und seinen Zuhörern. O’Brien trug die Uniform der Inneren Parteiriege, einen pechschwarzen Overall aus dicker amerikanischer Baumwolle, der so gut saß, dass er maßgeschneidert sein musste. Die um ihn versammelten Mitglieder der Äußeren Parteiriege trugen blaue Overalls aus Viskose, die entweder zu eng oder lächerlich ausgebeult waren. Schon nach einmaligem Tragen leierte die Viskose an den Knien aus; nach zwanzig Mal wurden die Knie durch wiederholtes Stopfen der Löcher ganz knubbelig. Die Farbe verblich beim Waschen, sodass jeder Anzug einen etwas anderen, fleckig verwaschenen Blauton hatte. O’Brien war groß und kräftig gebaut, die Fiktion-Leute entweder erschreckend dürr oder schmerbäuchig. Gekrümmt standen sie da, in der ständigen Geducktheit der Unterwürfigen, während O’Brien in strammer Haltung vor ihnen aufragte, ein Mann wie ein Stier. Es hätte niemanden gewundert, wenn seine großen Hände an den Knöcheln vernarbt und seine Stupsnase gebrochen gewesen wären, aber in Wirklichkeit hatte er keinen einzigen Makel. Und dann war da noch sein Charme: Er begegnete jedem Mann wie einem ganz besonderen Freund, gab jeder Frau das Gefühl, ein Auge auf sie geworfen zu haben. Das war natürlich alles nur vorgetäuscht, aber man konnte nicht umhin, ihn zu mögen.
Er erinnerte Julia an eine Figur aus einem Film – einen Mann der Inneren Parteiriege, der in der Zweiten Agrarregion gestrandet war und schließlich die Ernte rettete. Nur er konnte – dank seines überlegenen Intellekts, symbolisiert durch die adrette Brille auf seiner Nasenspitze – erkennen, dass der Mais von einem winzigen Insekt befallen war, das das Korn von innen her auffraß. Als es an der Zeit war, bei der Ernte zu helfen, klappte er seine Brille zusammen, steckte sie in seine Brusttasche, und seine rohe Kraft ließ die Landarbeiter ehrfürchtig staunen. Die Mädchen seufzten, und die Männer lachten aus vollem Halse über seine hemdsärmeligen Witze.
Genau so ein Typ war O’Brien, samt den goldumrandeten Brillengläsern und den seufzenden Mädchen. Auch Margaret aus Julias Wohnheim war jetzt wie aus dem Nichts neben ihm an Maschine Vier aufgetaucht, lachte über einen seiner Scherze und fuhr sich, die Wangen rosa leuchtend, mit einer Hand durch ihr rotblondes Haar. Margaret arbeitete nicht einmal in Fiktion und hatte beim besten Willen keinen Grund, hier zu sein. Hinter ihr standen Syme und Ampleforth, die so wie Margaret auf Etage Zehn arbeiteten. Alle drei mussten von O’Briens Anwesenheit Wind bekommen haben und herbeigeeilt sein.
Genervt wandte Julia sich ab, denn eigentlich hätte sie jetzt da unten stehen und mit O’Brien plaudern sollen – nicht etwa seiner blauen Augen wegen, sondern um herauszufinden, ob bei ihm zu Hause etwas repariert werden musste. Denn auf Reparaturservice waren die meisten angewiesen: Die Leute von der Wohnungsbaugenossenschaft brauchten ewig, und wenn sie endlich kamen, hatten sie nie die benötigten Ersatzteile dabei. Julia nahm Reparaturaufträge wegen der Herausforderung an, jedenfalls behauptete sie das, aber die meisten Auftraggeber steckten ihr zum Dank fünfzig Dollar zu. Und bei den Mitgliedern der Inneren Parteiriege lohnte sich so ein Auftrag auch ohne Bezahlung. Tatsächlich war es sogar besser, wenn sie nichts zahlten. So konnte man sich einbilden, wie eine Freundin behandelt zu werden. Julia hatte schon gehört, dass manche dank solcher »Freundschaften« einen Job oder eine Wohnung bekommen hatten.
O’Brien wäre der ideale »Freund«. Aber Julia blieb oben auf der Galerie und setzte eine Miene pflichtbewusster Wachsamkeit auf. Allein bei dem Gedanken, sich dem Mann zu nähern, zog sich alles in ihr zusammen. O’Brien war vom Liebesministerium.
In diesem Moment wurde den Maschinen der Strom abgestellt. Ihr Surren und Rattern verlangsamte sich, sie ächzten wie ein großes Tier, das seinen massigen Körper schwerfällig zu Boden sinken ließ. Die darauffolgende Stille – eine vibrierende Stille, eine ohrenbetäubende Stille wie nach dem Einschlag einer Bombe – wurde durchbrochen vom Schrillen der Pfeife für die Zwei Minuten Hass.
Fiktion und ein Dutzend anderer Abteilungen mussten für die Zwei MinutenHass in die Abteilung Archiv. Archiv hatte genug Platz, die Hälfte der Büros war bei der Kleinen Anpassung von ’79 geräumt worden. Außerdem war es eine schöne Abwechslung für die Leute von Fiktion, denn sie arbeiteten in den lichtlosen Tiefen der Wahrheit, während sich die Abteilung Archiv auf Etage Zehn befand, mit Fensterfronten in alle vier Himmelsrichtungen. Der Haken an der Sache war, dass die Arbeiter keine Fahrstühle benutzen durften – Bewegung ist gesund, Genossen! Und als wäre das nicht genug, gab es auch noch drei Geister-Etagen, in denen sich einst geschäftige Büros befunden hatten, die jetzt aber leer standen, sodass Etage Zehn in Wirklichkeit Etage Dreizehn war. Das bedeutete nicht nur drei zusätzliche Stockwerke Treppensteigen, sondern auch, dass man an diesen Etagen der Toten vorbeimusste.
Über jedem Treppenabsatz war ein Telemonitor angebracht. Syme und Ampleforth, denen das Treppensteigen schwerfiel, legten immer wieder eine Pause ein, um mit gespielter Faszination zu kommentieren, was der Telemonitor von sich gab, während sie keuchten und schnauften und sich den Schweiß von der Stirn wischten. Julia hatte die Angewohnheit, jedem Telemonitor im Vorbeigehen zuzulächeln. Sie stellte sich vor, wie ein gelangweilter Mann in der Überwachungszentrale sich an ihrem Lächeln erfreute. Das Treppensteigen machte ihr überhaupt nichts aus. Sie war sechsundzwanzig und noch nie so stark und vor allem noch nie so gut genährt gewesen. Heute hatte sie nach den langen, zähen Stunden des Müßiggangs besonders viel Energie und flitzte die Stufen hinauf, plauderte mit allen möglichen Leuten, an denen sie vorbeikam, schüttelte Hände und lachte über Witze. Syme nannte sie Habmichlieb, was sie manchmal irritierte, aber es hätte auch weitaus schlimmer sein können.
Erst kurz vor Etage Zehn wurde sie abrupt langsamer, denn plötzlich entdeckte sie O’Brien direkt vor sich und wollte vermeiden, ihn zu überholen. Deshalb ließ sie sich hinter ihm zurückfallen, während sie alle ins Archiv gespült wurden.
Ihr Blick fiel sofort auf Smith – Old Misery. Er stellte gerade Stühle in einer Reihe auf und sah, so vertieft in seine Tätigkeit, erstaunlich sympathisch aus. Ein schlanker Mann um die vierzig, mit hellblondem Haar und grauen Augen. Er ähnelte dem Mann auf dem Plakat »Ehret unsere intellektuellen Arbeiter und Arbeiterinnen«, nur ohne Teleskop. Er schien vor sich hin zu träumen, von etwas Kaltem, aber Schönem. Vielleicht dachte er an Musik. Seine Bewegungen verrieten ihr, dass er sich wohlfühlte, obwohl er leicht hinkte; man sah ihm an, dass er sich gern körperlich betätigte.
Doch dann bemerkte er Julia, und seine Lippen wurden vor Abscheu ganz schmal. Es war verblüffend, wie sehr ihn das veränderte: vom Falken zum Reptil. Julia dachte: »Mit dir ist eigentlich alles in Ordnung, du müsstest nur mal wieder richtig durchgevögelt werden.« Sie musste beinahe lachen, denn natürlich war das die ganze Wahrheit: Sein Problem war nicht etwa der Fakt, dass seine Eltern Unpersonen waren oder dass er mit der Parteidoktrin nicht mithalten konnte oder gar sein fieser Husten. Old Misery litt unter einem besonders komplizierten Fall von Sauer Gewordenem Sex. Und natürlich waren die Frauen schuld. Wer denn sonst?
Smith setzte sich – und ohne lange zu überlegen, nahm Julia direkt hinter ihm Platz. Sie redete sich ein, dass sie es nur tat, weil dieser Stuhl direkt am Fenster stand. Aber als sie bemerkte, wie er in ihrer Gegenwart wie versteinert dasaß, freute sie sich diebisch.
Neben ihr stand ein niedriges Bücherregal mit nur einem Buch: ein altes, leicht verstaubtes Neusprech-Wörterbuch von 1981. Sie stellte sich vor, wie sie mit dem Finger durch den Staub fuhr und damit etwas auf Smiths Nacken schrieb – vielleicht ein J für Julia –, obwohl sie so etwas natürlich nie tun würde.
Ärgerlicherweise nahm sie von ihrem Platz aus seinen Geruch wahr. So wie er aussah, hätte er eigentlich nach Schimmel riechen müssen, aber er duftete nach gutem männlichen Schweiß. Sie betrachtete sein Haar, es war voll und schön – sie würde am liebsten reingreifen. Wie ungerecht, dass die Partei ausgerechnet immer die Gutaussehenden verdarb. Sie sollten sich lieber die Ampleforths und Symes vornehmen und die Smiths ihr überlassen.
Dann, wer hätte es gedacht, kam Margaret und setzte sich neben Smith, O’Brien folgte ihr und ließ sich auf Margarets anderer Seite nieder. Margaret und Smith ignorierten einander. Alle Archiv-Leute verhielten sich so. Es war ein tückischer Job, tagein, tagaus mussten sie Altdenk lesen und hielten einander lieber auf Distanz. Doch was Julia viel mehr irritierte, war, dass O’Brien sich so an Margaret geheftet hatte. Ihm konnte doch unmöglich gefallen, wie die schlichte Margaret ihn ansäuselte und anschmachtete?
Julia schaute weg – stets die sicherste Reaktion, wenn jemand sich seltsam verhielt – und blickte aus der weiten Fensterfront. In diesem Moment flog draußen ein Zeitungsfetzen vorbei. Er wirbelte hektisch durch die Luft, ehe er sich entfaltete und auf die Dächer tief unter ihnen zusegelte. Aus dieser Höhe konnte man die Proletenviertel nicht von den Parteivierteln unterscheiden, das war ein eigenartiges Gefühl. Sie brauchte auch immer einen Moment, um die Kluften auszumachen, die die Bomben in die Stadt gerissen hatten; wenn man durch die Straßen lief, sah man sie hingegen überall, London schien manchmal mehr Krater als Stadt zu sein. Tagsüber gab es ein Brennstoffverbot für den Privatgebrauch; nur selten stiegen dort, wo sich die A1-Speisesäle befanden, Rauchschwaden auf. Auch der Strom war abgeschaltet, und die schmuddeligen, unbeleuchteten Fenster der Bürogebäude schimmerten glänzend-düster wie das Meer.
Ein Teil der Aussicht wurde durch den riesigen Telemonitor an der Fassade des nahe gelegenen Gebäudes für Transportmittelverwaltung versperrt. Die bewegten Bilder erweckten die Illusion, dass das Tageslicht ständig flackerte und sich kaum merklich veränderte. Ein Film flimmerte in Dauerschleife über den Monitor. Eine Gruppe von rotwangigen Kindern spielte unschuldig auf einem Spielplatz. Am Horizont wuchsen die Schatten von Perversen, Eurasiern und Kapitalisten heran, die ihre groben Hände nach den Kindern ausstreckten. Dann erschien das Gesicht des Großen Bruders, radierte die Schatten aus, und am Himmel erschien der Slogan: DIR VERDANKEN WIR UNSERE SICHERE KINDHEIT, GROSSER BRUDER! Danach tauchten dieselben Kinder wieder auf, jetzt in den Uniformen der Kinderorganisation Spitzel: graue Shorts, blaues Hemd und rotes Halstuch. Die fröhlichen Spitzel marschierten mit einer Engsoz-Fahne vorbei, und der Slogan am Himmel lautete jetzt: SCHLIESST EUCH DEN SPITZELN AN! Dann verblasste alles, und der Film begann wieder von vorne.
Über dieser Szenerie kreisten Helikopter wie geschäftige Insekten. Die großen fielen einem zuerst ins Auge, ihr Knattern war selbst durch die dicken Scheiben zu hören. Sie waren mit einem Piloten und zwei Bordschützen besetzt. Manchmal sah man einen Schützen lässig in der offenen Tür eines Helikopters hocken, sein schwarzes Gewehr auf das Knie gestützt. Sobald man die Helikopter wahrnahm, fielen einem auch die tiefer fliegenden Schwärme von Mikrokoptern auf; die großen sahen aus wie die Eltern der kleinen. Die Mikrokopter waren nicht bemannt, sondern wurden per Fernsteuerung gelenkt. Sie dienten nur der Überwachung, und den Bewohnern der Äußeren Parteibezirke passierte es nur zu oft, dass sie von einer Tätigkeit aufschauten und ein Mikrokopter wie ein neugieriger Vogel vor ihrem Fenster schwebte.
Doch das bei Weitem Eindrucksvollste an der Aussicht von hier oben war das Liebesministerium. Das Gebäude erhob sich aus dem Gewirr von Ruinen und niedrigen Häusern wie eine weiße Finne aus trübem braunen Wasser. An seiner gleißenden Fassade konnte man die winzigen Pünktchen von Arbeitern erkennen, die an einem feingliedrigen Flechtwerk aus Kabeln hingen und die gespenstisch schneeweiße Flanke schrubbten. Abgesehen von diesen winzigen Pünktchen war das Gebäude so weiß, dass man beim Hinsehen das merkwürdige Gefühl hatte, es sei überhaupt nicht da: ein Portal ins Nichts, eingelassen in die dreckige Stadt und den wolkenverhangenen Himmel. Die Liebe hatte keine Fenster, was ihrer strengen Schönheit eine erdrückende Wirkung verlieh. Julia hatte das Gerücht gehört, die Mäuse dort hätten keine Augen – denn ohne Licht bräuchten sie schließlich keine. Das war natürlich völliger Quatsch. Selbst bei Stromausfall wurden die vier großen Ministerien immer mit elektrischem Licht versorgt. Trotzdem fand sie den Gedanken an diese sagenumwobenen blinden Mäuse beunruhigend. Sie symbolisierten für Julia die wahren Schrecken, die sich hinter diesen Mauern abspielten, Schrecken, die einem verborgen blieben und die man sich selbst in seinen dunkelsten Fantasien nicht ausmalen konnte.
Hinter Liebe, Richtung Südwesten, befand sich der etwas bescheidenere Glasturm des Wohlstandsministeriums, der im Licht glitzerte. Weiter südlich war Frieden nur noch als Schimmer im Nebel zu erkennen. Und noch weiter im Süden, dort, wo sich am äußersten Rande der Stadt die Felder erstreckten, konnte Julia einen schwachen grünlichen Schleier erahnen. Sie stellte sich immer vor, dieser Schleier sei Kent – oder die Semiautonome Zone 5, wie es offiziell hieß –, wo sie aufgewachsen war.
Die meisten anderen Wahrheitsarbeiter waren in der Stadt geboren worden und gingen an den Fensterfronten vorbei, ohne die Aussicht eines Blickes zu würdigen, aber Julia konnte nie genug von London bekommen. Sie liebte sogar, wie dreckig und heruntergekommen die Stadt war, wie wild, wenn man sich von den Parteibezirken entfernte. Es war die beste Stadt von Startbahn Eins, die bevölkerungsreichste Stadt in ganz Ozeanien, von der Semiautonomen Zone Shetland bis zum Argentinischen Wirtschaftsraum. Julia, geboren in der SAZ zwischen Kühen und Arbeitslagern, war jeden Tag dankbar, hier leben zu dürfen.
Während sie aus dem Fenster sah, hatte sich der Raum gefüllt, und dieser männliche Smith-Duft war in einem allgemeinen Mief von schmutziger Wäsche, Mundgeruch und billiger Seife aufgegangen. Die Mienen einiger Leute hatten sich in Vorbereitung auf den Hass bereits verfinstert. Wie seltsam es jedes Mal war, wie sie die leeren Telemonitore anknurrten und zornig anfunkelten. Julia verspürte die übliche Angst, dass es diesmal nicht klappen würde, dass sie alle zwar Anstalten machen würden, draufloszuwüten, dann aber peinlich berührt aufgeben müssten oder einfach in Gelächter ausbrachen. Jedes Mal, wenn Julia sich das vorstellte, sah sie sich selbst hochschnellen und die Spottenden zurechtweisen. Doch wahrscheinlich wäre sie die Erste, die laut prusten würde.
Dann ging es los. Man konnte es spüren, bevor man es sah: ein Vibrieren wie ein Donnergrollen, das nach und nach in das viel zu laute Dröhnen einer schnarrenden Stimme überging. Diese Stimme schien selbst die Metallstühle zum Beben zu bringen und dem elektrischen Licht Kopfschmerzen zu bereiten. Die Anspannung stieg ins Unermessliche, als das so vertraute, abscheuliche Gesicht von Emmanuel Goldstein auf dem Telemonitor erschien.
Sein hageres, intellektuelles Gesicht strahlte eine Güte aus, die einem schon bald falsch und verachtenswert erschien. Die Augen hinter der Brille waren kindlich und obszön zugleich. Die geschwungenen Lippen stets feucht. Bei dem Anblick wollte Julia am liebsten keusch die Beine übereinanderschlagen. Die struppig weiße Haarpracht glich der eines Schafes, ebenso wie seine knochigen Gesichtszüge. Sogar seine Stimme glich einem quengeligen Blöken. Der Film begann. Goldstein hielt eine Rede, die zunächst wie ein beliebiger Parteiappell wirkte. Er hielt sie sogar zum größten Teil in Neusprech: Krankdenk übernehm Plusgut Wahrheitskämpf. Man musste ganz genau hinhören, um zu erkennen, dass es sich um eine Aneinanderreihung von Angriffen auf Ozeanien, die Partei und die Lebensweise des Volkes handelte.
Emmanuel Goldstein, einst ein Held der Revolution, hatte an der Seite des Großen Bruders gekämpft. Dann kehrte er der Partei den Rücken und widmete seine Durchtriebenheit und Energie nun der Zerstörung Ozeaniens und des ozeanischen Volkes. Niemand war vor seiner Boshaftigkeit gefeit. Wenn er es nicht schaffte, die Bevölkerung gegen die Partei aufzubringen, vergiftete er die Wasserversorgung. Wenn es ihm nicht gelang, kleine Kinder zu Perversionen zu verleiten, bombardierte er ihre Schulen. Er verabscheute alles, was keusch und tüchtig war, denn ihm fehlten diese Eigenschaften, und deshalb hasste er den Großen Bruder aus tiefstem – deformierten und parasitären – Herzen. Obwohl seine Reden nur so vor offensichtlichen Lügen und leeren Worthülsen wie freie Meinungsäußerung und Menschenrechte strotzten, gelang es ihm dennoch, einige Menschen einzulullen. Seine Gefolgsleute waren für alles verantwortlich, was in Ozeanien schieflief, angefangen bei der Sabotage, die dazu führte, dass niemand genug zu essen hatte, bis hin zur Schwächung des Kampfgeistes der Soldaten, was Ozeanien daran hinderte, den Krieg zu gewinnen.
Es war ziemlich offensichtlich, dass das nicht alles wahr sein konnte. Um all die Verbrechen zu begehen, die ihm nachgesagt wurden, hätte Goldstein tausend Jahre gebraucht. Angeblich wimmelte es in London nur so von seinen Terroristen, aber niemand hatte jemals einen aus Fleisch und Blut gesehen. Die Geschichten darüber, wie Goldstein immer wieder seiner gerechten Strafe entkam, waren besonders weit hergeholt, stets garniert mit haarsträubenden Mutproben der Jungs in Schwarz, gefolgt von einem peinlichen Fauxpas, bei dem Goldstein beispielsweise auf den Hintern fiel oder schluchzend um sein Leben flehte, nur um in letzter Minute von irgendeinem Schurken gerettet zu werden – in der Regel von einem höheren Parteimitglied, das am Vortag in Ungnade gefallen war.
Heute wetterte Goldstein gegen den Krieg, auf die kindischste und beleidigendste Art und Weise, als wäre Ozeanien allein schuld an diesem Krieg. Die Menschen, die an diesem Morgen durch Bomben getötet wurden, schienen ihm völlig egal zu sein. Nur für den Fall, dass jemand der Anwesenden im Begriff war, zum Feind überzulaufen, erschienen auf dem Telemonitor hinter Goldsteins Kopf jetzt unzählige Reihen von marschierenden eurasischen Soldaten – nicht enden wollende Kolonnen stämmiger Männer mit ausdruckslosen Gesichtern. Der Hass war jetzt in vollem Gange, der ganze Raum tobte und schrie. Margarets hübsches Gesicht war errötet, ihr Mund vor sinnlicher Wut weit aufgerissen, und O’Brien war aufgesprungen, als wollte er einem verhassten Feind entgegentreten. Selbst Smith brüllte überraschend boshaft und trat wie im Wahn gegen die Sprosse seines Stuhls. Einen gefährlichen Moment lang war Julia abgelenkt und fragte sich, ob Smith nur simulierte. Dann fuhr sie panisch zusammen. Sie hatte ganz vergessen weiterzuschreien. Und jetzt musste sie auch noch gähnen.
Aus einem Impuls heraus griff sie nach dem alten Neusprech-Wörterbuch im Regal neben sich. Sie holte tief Luft und schrie: »Schwein! Schwein! Schwein!« Dann schleuderte sie das schwere Buch über die Köpfe der anderen hinweg. Es überschlug sich mehrmals in der Luft und krachte schließlich mit einem lauten Knall gegen den Monitor. Alle zuckten zusammen, und Julia überkamen plötzlich Zweifel. Ihre Aktion konnte auch als Angriff auf den Telemonitor gewertet werden. Die Monitore waren bemerkenswert robust, ein Buch konnte ihnen nicht wirklich schaden – aber war O’Brien das bewusst? Was, wenn er ihre Aktion nun für Sabotage hielte?
Aber O’Brien brüllte unbeeindruckt weiter, und auch andere Leute bewarfen den Telemonitor jetzt mit allem, was sie in die Hände bekamen. Ein Mann schleuderte eine Packung Zigaretten, ein anderer seinen eigenen Schuh. Julia war vor Angst der Schweiß ausgebrochen, aber langsam ließ die Panik wieder nach. Das verräterische Gähnen konnte sie unterdrücken.
Das Bild auf dem Monitor veränderte sich. Goldsteins Gesicht verwandelte sich nun wirklich in das eines Schafes, seine Stimme wurde zu einem echten gellenden Schafblöken. Gerade als die Leute zu lachen und zu spotten begannen, wurde das Schaf durch einen stämmigen eurasischen Soldaten ersetzt, der mit einem Sturmgewehr auf die Zuschauer zuspurtete. Einige Leute in den vorderen Reihen schraken zurück.
Aber dieses Bild zerschmolz sofort zu dem fürsorglichen Gesicht des Großen Bruders – dem Parteiführer –, einem Mann von etwa fünfundvierzig Jahren mit dichtem schwarzen Haar und schwarzem Schnurrbart. Dieser erwachsene Große Bruder glich – und dann doch wieder nicht – dem jungen Großen Bruder mit bloßen Armen auf den Rekrutierungsplakaten der Armee, und dem kindlichen Großen Bruder, der auf den Abzeichen der Spitzel zu sehen war. Der erfahrene Anführer war gutaussehend und auf reine, beruhigende Art und Weise höchst männlich. Er hatte jahrzehntelang für sein Volk gekämpft und überlebt, um seine Vision zu verwirklichen. Auf seiner Mission war er von zahllosen Männern verraten worden, die er für wahre Kameraden gehalten hatte, war von den Kapitalisten mehrmals fast ermordet worden, hatte sich aber gegen diese Sintflut behauptet. Er verstand das einfache Volk und fühlte sich ihm und seinen Problemen verpflichtet. Er war mächtig, aber auch gut. Man musste keine Marionette sein, um den Großen Bruder zu lieben; was auch geschah, auf ihn war immer Verlass.
Als der Große Bruder sprach, wandten sich alle dem Telemonitor zu, als würden sie sich in seinem Licht sonnen. Er sagte: »Wir stehen Seite an Seite. Die Wahrheit ist unser.« Es folgten weitere große, schlichte Worte, die bereits in dem Moment, in dem sie ausgesprochen wurden, wieder aus Julias Gedächtnis verschwanden. Margaret hatte sich über die Lehne des leeren Stuhls vor sich gebeugt und raunte mit bebender Stimme: »Mein Retter!« Dann schlug sie die Hände vors Gesicht. Auch Smith lehnte sich nach vorne und reckte seinen Blondschopf.
In den letzten Sekunden verblasste das Gesicht des Großen Bruders, an seiner Stelle erschienen in dicken schwarzen Lettern auf rotem Hintergrund die drei Partei-Slogans: KRIEG IST FRIEDEN. FREIHEIT IST SKLAVEREI. UNWISSEN IST STÄRKE. Dann wurde der Telemonitor schwarz, und die Zuschauer sahen nur noch ihre eigenen schummrigen Spiegelbilder. Sie stimmten einen Sprechgesang an: »G-B! G-B! G-B!« Erst unkoordiniert und chaotisch, wuchs er zu einem getragenen, beständigen Rhythmus. Diejenigen, die noch saßen, standen auf, einige stampften mit den Füßen im Takt oder trommelten auf die Stuhllehnen. Dieser Teil des Rituals wirkte jedes Mal wie eine Befreiung. Die Spannung fiel von allen ab, sie strahlten. Wieder war ein Gedanke richtig gedacht, ein Gefühl richtig gefühlt. Hier sah man, wie wenig die Partei doch von ihrem Volk verlangte. Man musste nicht des aktuellsten Neusprechs mächtig sein oder sich abmühen, widersprüchliche Dinge zu glauben. Solange man den Feind hasste, wurde man geliebt. Die Anwesenden lächelten einander noch ganz benommen zu, einigen standen die Tränen in den Augen. Das war ein guter Hass.
Jetzt blieb nur noch ein kleines Problem – wann war der richtige Zeitpunkt, das Rufen einzustellen? Niemand wollte zuerst aufhören, aber genauso wenig zuletzt. Julia beschloss, sich an O’Brien zu orientieren – aber noch während sie das dachte, blickte er sich um, und Julia musste verblüfft feststellen, dass er bereits verstummt war. Er hatte einen merkwürdigen Gesichtsausdruck aufgesetzt, seine Miene drückte keine Freude, sondern ein belustigtes Interesse aus. Julia dachte zunächst, er wolle flirten, und war erstaunt, dass die unscheinbare Margaret wirklich sein Interesse geweckt zu haben schien.
Doch O’Brien schaute nicht zu Margaret. Kaum zu glauben – aber er hielt Blickkontakt mit Smith. Und Smiths Gesicht war offen, ruhig und von einer rätselhaften Sanftheit. Es leuchtete wie an einem warmen Sommertag.
Instinktiv wandte sich Julia ab, und in diesem Moment verstummte der Sprechgesang. Mit einem letzten überflüssigen »B!« schloss sie den Mund, und als sie wieder aufsah, blickten O’Brien und Smith wieder mit düsteren Mienen nach vorne. Als hätten die beiden nie auch nur einen Gedanken aneinander verschwendet.
Schon war sie sich nicht mehr sicher, was sie da gerade beobachtet hatte. Menschen sahen sich nun mal an. Was hatte das schon zu bedeuten? Smiths verzückter Gesichtsausdruck hatte sich während des Sprechgesangs nicht unbedingt von denen der anderen unterschieden. Und wieso verwunderte es Julia so sehr, dass O’Brien Old Misery mit distanzierter Belustigung beobachtete? Genau das tat Syme jeden Tag.
Die Leute setzten sich langsam in Bewegung. Ampleforth steuerte auf O’Brien zu und begann unterwürfig mit ihm über die neuen Poesiequoten zu sprechen. O’Brien nickte, blickte interessiert drein und strahlte dabei wieder seine typische Ernsthaftigkeit aus. Smith wiederum, der sich daranmachte, die Stühle zurückzustellen, schaute verkniffen und säuerlich aus der Wäsche, wieder ganz der Alte.
Nein, nichts war geschehen. Julia verdrängte den Gedanken, stand auf und begab sich auf den langen Weg zurück zur Fiktion.
2
Nach den Zwei Minuten Hass meldete Julia sich für zwei Stunden von ihrer Schicht ab. Grund: Krankheit/Menstruation. In Wahrheit wollte Julia zum Wohnheim, um sich um ein hartnäckig verstopftes Klo zu kümmern. Eine Reparatur, die sie jetzt, da O’Brien in Fiktion herumschnüffelte, vielleicht hätte aufschieben sollen, aber das Wohnheim hatte nur zwei Toiletten, und nach Julias Erfahrung würde die zweite spätestens bei Sonnenuntergang verstopft sein. Wie auch immer, Grund: Krankheit/Menstruation war ein Privileg, das alle Mädchen und Frauen nutzten und ausnutzten. So zu tun, als hätte man wirklich Schmerzen oder müsse einen Monatszyklus beachten, war schon längst nicht mehr nötig. In der Wachstube hatte niemand auch nur mit der Wimper gezuckt, als Julia zusätzlich eine Rohrreinigungsspirale ins Verleihregister eintrug. Natürlich waren die Wachhabenden allesamt Männer; vielleicht hielten sie die Spirale für ein notwendiges Werkzeug, wenn man menstruierte.
Um diese Uhrzeit war die Fahrradgarage menschenleer. Die einzige Person, die sich dort aufhielt, war eine Aufsicht, die auf ihrem Stuhl eingenickt war, eine Flasche Victory Gin zwischen den Füßen. Hunderte von ramponierten tomatenroten Fahrrädern lehnten auf ihren Ständern unter einer Reihe von DER-GROSSE-BRUDER-SIEHT-DICH-Plakaten und einem Transparent mit dem Slogan RADFAHREN FÜR DIE GESUNDHEIT! Die meisten Gefährte waren natürlich unbrauchbar, die Ketten verrostet, die Speichen verbogen. An diesem Morgen hatte Julia ein zuverlässiges Atlantic zwischen zwei verbogenen alten Rädern versteckt, aber jemand anders schien es dort entdeckt und weggeschnappt zu haben. Sie suchte die Gepäckträger nach Bändern und Schnüren ab – Markierungen, mit denen die Leute ein funktionierendes Fahrrad kennzeichneten. Nichts. Nach zehnminütiger Suche fand sie schließlich ein robustes altes International, dem sie zutraute, den Heimweg zu überstehen.
Auf den Telemonitoren an den Außenwänden des Ministeriums lief das Musikprogramm der zweiten Mahlzeit; zum Film einer tosenden Brandung ertönte das Lied Jungfrau Ozeaniens. An den Wänden der anderen Gebäude hingen reihenweise G.-B.-Plakate: DER GROSSE BRUDER SIEHT DICH, DER GROSSE BRUDER SIEHT DICH, DER GROSSE BRUDER SIEHT DICH. Nur diese Worte füllten das Plakat, und sein ernstes, fürsorgliches Gesicht, das sich über die Ränder hinweg auszudehnen schien, sodass es den Eindruck erweckte, der Große Bruder würde geradewegs auf die Betrachtenden zukommen. Auch an der nächsten Kreuzung schien links und rechts jede freie Fassade mit einem Plakat zugekleistert worden zu sein. Julia hatte einmal einem Mann bei einem Kartentrick zugesehen, bei dem sich alle Karten in den Pik-König verwandelten. Als er das Deck mischte, sah man die Gesichter der Pik-Könige vorbeirasen, auf unheimliche Weise immer wieder das gleiche Gesicht. Die Plakate zogen einen auf genau diese Weise in ihren Bann. Auf ihrem Weg die Straße hinab rauschten sie wie marschierende Soldaten an Julia vorbei, während der rührselige Refrain von Jungfrau Ozeaniens aus jedem offenen Fenster erklang, von den Telemonitoren in den Bushaltestellen und aus den Lautsprechern in den Bäumen im Park der Dezembermärtyrer. Sogar Julia, die sich selbst gerne für eine abgebrühte Zynikerin hielt, bewegte dieses Lied. Mit dem Wind im Haar, der anschwellenden Musik und dem starrenden Blick des Großen Bruders von allen Seiten fühlte sie sich wie die hübsche Fabrikarbeiterin aus dem Film Startbahn Eins – Freiheit, die sich der Liebe ihres Lebens entsagte, um gegen die Feinde von Engsoz in den Kampf zu ziehen. Das Lied und die Fantasie klangen erst ab, als sie in das alte Justizviertel einbog, wo das London der Proleten begann.
Dies war eine Welt von zerbombten und zusammengefallenen Häusern, die von kreuz und quer vernagelten Holzlatten aufrecht gehalten wurden. Einige Wände wurden mit Stücken von grob zurechtgehackten Baumstämmen verstärkt. Kein einziges Fenster war unversehrt; alle waren entweder mit Brettern verrammelt oder durch von der Regierung bereitgestelltes und inzwischen verdrecktes Verdunkelungsmaterial ersetzt worden. Hier gab es keinen Strom. Tagsüber hielten sich die Bewohner des Viertels mitsamt ihren Möbeln auf der Straße auf. Sie tranken Tee, spielten Karten und flickten Kleidung unter provisorisch errichteten Unterständen, zusammengeschustert aus Verdunkelungsmaterial, Pappe und Überbleibseln zerbombter Häuser. Julia musste umherstreifenden Kindern, Betrunkenen, nassen Sesseln und weggeworfenen Flaschen ausweichen. Die Stimmen der Proleten verstummten, als sie sich auf ihrem Fahrrad näherte, aber niemand sah auf oder schaute ihr nach. Ihr blauer Partei-Overall hätte genauso gut ein Tarnumhang sein können.
Diese belebte Gegend wurde von zwei staubigen Schluchten durchschnitten, dort, wo Raketenbomben alles dem Erdboden gleichgemacht hatten. Die Straßen waren abgesackt oder zerstört, also musste Julia absteigen und ihr Fahrrad über Trümmerteile heben. Der erste Bombenkrater war relativ neu. Gipsstaub hing noch in der Luft, und eine Familie von Lumpensammlern wühlte in den Trümmern. Ihre hübscheste Tochter – ein schwarzäugiges, verwahrlostes Kind von neun oder zehn Jahren in einem viel zu großen Kittelkleid aus unechtem Samt – hockte auf einer Decke am Straßenrand und verkaufte ihre spärlichen Funde an Passanten: zerschlissene Schuhe, alte Nägel und Schrauben, eine verbeulte Brille.
Die zweite Bombenschlucht existierte schon viel länger und war bereits mit notdürftig errichteten Hütten besiedelt. Um sie herum wucherten Weidenröschen aus den Trümmern. Einige Bewohner dieser Hütten hatten einst in den zerstörten Gebäuden gewohnt, aber es gab auch Nomaden, die von Ort zu Ort zogen, meist aus dem Kriegsdienst entlassene Soldaten, die keine Aufenthaltsgenehmigung für London erhalten hatten. Orte wie dieser galten als gefährlich, und die Mädchen aus dem Wohnheim warnten einander eindringlich davor, sich hier aufzuhalten. Aber auch hier blickte ein hagerer Mann nur kurz von seinem Kochfeuer auf, als er Julia vorbeifahren hörte, nahm ihren blauen Overall zur Kenntnis und starrte dann durch sie hindurch, als wäre sie Luft.
Erst als sie die Straßen des Parteibezirks Highbury erreichte und die G.-B.-Plakate das Straßenbild wieder dominierten, fiel alle Anspannung von Julia ab, sodass ihr jetzt erst bewusst wurde, wie nervös sie geworden war. Sie grüßte den Grenzposten am Übergang; er nahm sofort Haltung an. Sein Blick hellte sich auf und ließ ein Grinsen hinter seiner Maske erahnen. Dann war alles ruhig, bis sie an der hohen Mauer des Fußballstadions vorbeikam, auf der ein Wandgemälde von Butlers berühmt-berüchtigtem Tor gegen Ostasien prangte. Die ostasiatischen Trikots waren kürzlich mit weißer Farbe übermalt worden, ein Hinweis darauf, dass das Bündnis mit Ostasien seinem Ende zuging. In Julias Straße blühten die Kastanienbäume. Die breiten roten Bänder um ihre Stämme erweckten den Eindruck, sie seien für ein Fest geschmückt worden, doch es waren nur Markierungen für ihre baldige Fällung.
Eine Gruppe von Kindern spielte auf der Straße. Als Julia von ihrem Fahrrad sprang und es an die Mauer des Wohnheims schob, stimmten sie einen Sprechgesang an und bildeten einen Kreis um ein Mädchen, das über ein Kreidemuster hüpfte und dabei mit der Hand einen Gummiball um die Füße prellen ließ. Julia erkannte das Spiel: Es war Hängt se. Das Kreidemuster stellte einen Galgen dar, und man hüpfte im Rhythmus des Sprechgesangs über die Felder. Wenn ein Fuß oder der Gummiball eine Kreidelinie traf, wurde man zum »Feind« erklärt und »gehängt«.
Hängt se war von der legendären Mamie Faye aus der Kinder- und Jugenddirektion von Wahrheit erfunden worden – sie war bekannt für die Kinderlieder Das Versprechen des kleinen Spitzels und Kein Versteck für Schweinchen Dick. Hängt se hatte sie zum Gedenken an die Hinrichtung der drei berüchtigten Volksfeinde Rutherford, Aaronson und Jones entwickelt. Mamie Faye fügte der Liste der Feinde einen imaginären Onkel hinzu – in Kindergeschichten wurde immer irgendein Onkel von einer scharfsinnigen Nichte oder einem Neffen als Spion enttarnt.
Der Sprechgesang ging so:
Rutherford, Aaronson,
Jones und dein Onkelchen,
Mahlzeit für die Galgenvögel,
Augen und Knöchelchen.
Sie strampeln und treten,
jammern und klagen,
doch uns ist’s egal,
denn wir kenn’n ihre Taten!
Hängt se nackt an’n Galgen,
ob Regen, ob Schnee,
für den Großen Bruder
und seine Idee.
Am Ende musste der Spieler den Ball hoch in die Luft werfen und einen anderen Spieler antippen, der den Ball wiederum fangen musste, bevor er auf dem Boden aufschlug. Fing er ihn nicht, würde er ebenfalls zum Feind und wurde »gehängt«. Das bedeutete, dass man eine Strafe ableisten musste – Wasser aus einer Pfütze trinken oder sich von den anderen Spielern in den Arm zwicken lassen.
Normalerweise amüsierte Julia sich über dieses fiese Spiel. Was für schaurige Dinge Kinder gut fanden! Heute jedoch wanderten ihre Gedanken zurück zu O’Brien und zu Smith, der dem hohen Parteimitglied einen so bewundernden Blick zugeworfen hatte. Plötzlich fiel ihr Smiths Vorname wieder ein: Winston. Viele Männer in Smiths Alter hießen Winston, zweifellos benannt nach einem Helden der Revolution, der später zum Verräter und daraufhin verdampft wurde. Jener Winston hatte mit ziemlicher Sicherheit die Liebe von innen gesehen, oder wie auch immer es damals genannt wurde. Julias Mutter hatte immer gesagt: »Er hat schon die Schrecken der Liebe erfahren, als es noch Vage Zuneigung war.«
Die Kinder hatten Julia inzwischen bemerkt, und ein wieselgesichtiger Junge in der Uniform der Spitzel spähte misstrauisch zu ihr herüber. Julia lächelte ihn freundlich an und drehte sich betont lässig zur Tür von Arbeiterinnen 21. Sie beschloss, ihre Schokoladenration dieser Woche für die Kinder aufzuheben. Sobald sie Julia erst mal als eine Person abgespeichert hatten, die ihnen ab und an ihre Süßigkeiten überließ, wären sie nicht mehr ganz so erpicht darauf, Geschichten über sie zu erfinden. Außerdem konnte nur ein Kindermagen diese widerliche Parteischokolade wirklich vertragen.
Die anderen Mädchen hatten für sie eine Scheibe Brot und Käse am Schalter der Aufseherin in der Vorhalle hinterlegt. Der Käse war dieses Rationszeug, das sie alle nur »alter Schuh« nannten, aber Julia hatte nach ihrer Radfahrt einen Bärenhunger, und die zweite Mahlzeit würde sie ohnehin verpassen. Sie verschlang Brot und Käse noch am Schalter, während Aufseherin Atkins munter drauflosschwatzte.
Atkins war eine Nationelle, ihr Gesicht war sehr dunkel, wovon Julia anfangs fasziniert war. Sie hatte sich sogar gefragt, ob die Farbe von all den afrikanischen Speisen kam, die Atkins zu sich nahm, aber inzwischen wusste Julia, wie töricht das war. Abgesehen davon war Atkins die typische Londoner Parteianhängerin mittleren Alters. Sie lächelte über alles hinweg, zeigte dabei ihre fünf verbliebenen Zähne und konnte fast jeden ihrer Gedanken in Form von Parteibegeisterung ausdrücken, wie ein Hund, der all seine Bedürfnisse durch Bellen und Schwanzwedeln mitteilte. Ihr Overall war mit Flicken übersäht – wie es in ihrer Jugend Mode gewesen war –, und an ihrem Kragen trug sie das bronzene Abzeichen der Mutterheldin, das für die Leistung verliehen wurde, zehn Kinder bis zum Wehrpflichtalter großgezogen zu haben.
An der Wand neben ihrem Schalter hingen Fotos von sieben ihrer Kinder. Sechs davon waren Transportporträts, aufgenommen an der Mauer der Märtyrer vor der Abreise zur Front. Jedes Bild war mit dem Stempel des Roten Löwen verziert, was bedeutete, dass die Person auf dem Foto im Krieg gefallen war. Von der noch lebenden Tochter waren mehrere Fotos aufgehängt worden, vom Säuglingsalter bis zu ihrem vierzigsten Lebensjahr. Sie war ein Mädchen für alles in der Transportmittelverwaltung und hatte sich zu Atkins’ Ebenbild entwickelt. Genossin Atkins erwähnte die drei nicht abgebildeten Kinder mit keinem Wort, sodass Julia ohne zu fragen wusste, dass sie zu Unpersonen geworden waren. Welch seltsamer Gedanke, dass sämtliche Erinnerung an sie ausgelöscht war, bis auf den Drei-Zehntel-Anteil an diesem bronzenen Abzeichen.
Viele Aufseherinnen waren Nationelle. Für sie war die Anstellung eine Möglichkeit, die Parteimitgliedschaft zu erlangen und den Lagern zu entgehen. Die lange Arbeitszeit schien ein Preis zu sein, den sie gerne zahlten. Böse Zungen behaupteten, Nationelle seien eher bereit, ihre weißen Schützlinge zu verpfeifen, und sie würden gnadenlos Bestechungsgelder von ihnen erpressen. Das Gleiche wurde allerdings auch den Leuten aus den Semiautonomen Zonen nachgesagt, sodass Julia solche Behauptungen immer mit Vorsicht genoss. Und auf Aufseherin Atkins traf dies überhaupt nicht zu. Sie nahm gern kleine Geschenke an, aber behandelte Mädchen, die nichts hatten, niemals schlechter. Sie verehrte die Partei und freute sich mit naiver Begeisterung über jede neue Verordnung, zeigte aber kein Interesse daran, andere anzuzeigen, wenn sie jene neuen Verordnungen falsch umsetzten. An zweiter Stelle nach der Partei standen ihre Schützlinge, und sie hatte noch nie ein Betragen/Gelb oder ein Betragen/Rot vermerkt, geschweige denn ein Betragen/Schwarz. Während Julias gesamter Zeit im Arbeiterinnen 21 hatten sie nur drei Frauen verloren. Mit einer rigideren Aufseherin hätten es locker dreizehn sein können.
Atkins hatte eine Schwäche: Sie redete gern. Auch jetzt kam Julia nicht von ihrem Schalter los; Atkins plauderte über die jüngsten Errungenschaften von Engsoz und nickte dabei, als würde sie sich selbst beipflichten. Julia war zunächst noch auf ihr Brot mit altem Schuh fokussiert und hörte kaum hin, als Atkins erzählte, welche Beschlüsse zur Unterstützung der Truppen auf der gestrigen Sitzung der Nord-Londoner Aufseherinnengewerkschaft gefasst worden waren. Hinter Atkins leierte eine monotone Stimme aus dem Telemonitor Informationen über die Reisproduktion in Amerikas Agrarregionen herunter. Die Kombination hatte eine einschläfernde Wirkung auf Julia. Selbst als Atkins in ihrem Monolog zu den jüngsten Streitigkeiten im Wohnheim überging, machte Julia nur ein mitfühlendes Gesicht, während sie ein paar Brotkrümel von Atkins’ Schalter wegwischte. Erst als sie den Namen Vicky hörte, war sie mit einem Ruck wieder wachgerüttelt.
» … so erschöpft«, sagte Atkins. »Ich bin heute Morgen hochgegangen, um die Betten zu machen, und wen entdecke ich da – unsere kleine Vicky, zusammengerollt in ihrem Bett, die Decke über den Kopf gezogen. Wer weiß, wann sie aufgewacht wäre, wenn ich nicht gewesen wäre. Wie kann man nur zur Arbeit im Zentralkomitee zu spät kommen!«
»Das ist der Job«, warf Julia hastig ein. »Vicky ist einfach nur müde.«
»Als ob ich das nicht wüsste!« Atkins nickte. »Zentralkomitee! Das ist zu viel für eine normalsterbliche Person. Ich fände es nur schade, wenn sie darunter leiden muss, nach all der plusguten Arbeit, die sie für den stellvertretenden Vorsitzenden Whitehead geleistet hat.«
Bei der Erwähnung von Whitehead hielten beide inne und vermieden es, in Richtung Telemonitor zu schauen. Man konnte regelrecht spüren, wie sich die Schnüffler näher an ihre Überwachungsmonitore lehnten.
Mit geübtem Enthusiasmus sagte Julia: »Oh, Genosse Whitehead ist doppelplusschlau. Wir bewundern ihn alle so sehr!«
»Oh ja«, sagte Atkins. »Ein wunderbarer Mensch. Aber er macht keine halben Sachen mit den Mädchen. Nimmt sie viel zu hart ran, dafür, dass sie schon so früh bei ihm anfangen. Wie alt ist Vicky, achtzehn?«
»Siebzehn. Gerade geworden.«
»Ich weiß ja – das Zentralkomitee leistet so wichtige Arbeit, aber es ist eine Schande, dass es ihr so schlecht geht«, sagte Atkins. »Sie kann ja kaum Essen bei sich behalten. Das sind die Nerven, nehme ich an.«
Atkins starrte mit gerunzelter Stirn auf ihre Hände. Julia wartete ab, der Käse lag ihr wie Blei im Magen. Auf dem Telemonitor las eine enthusiastische Frauenstimme eine Liste mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor, die in größerem Umfang produziert worden waren als im Dreijahresplan vorgesehen. »Avocados – fünfzig Tonnen Übererfüllung! Bananen – siebzig Tonnen Übererfüllung!« In diesen schillernden Agrarberichten wurden immer wieder Waren aufgelistet, die man in den Geschäften nie sah. Julia hätte gar nicht gewusst, dass einige von ihnen überhaupt existierten, wenn die Nachrichtensprecherinnen nicht ständig betonen würden, in welchem Reichtum sie vorhanden waren. Man hätte ihr eine Avocado an den Kopf werfen können, und sie wäre kein bisschen klüger gewesen.
Atkins fuhr in leisem, vertraulichem Ton fort: »Weißt du, was Vicky meiner Meinung nach tun sollte?«
Jetzt verstand Julia, worauf das hinauslief, und hätte am liebsten laut gestöhnt. Stattdessen zwang sie sich zu einem heiteren »Was denn?«
»Kunstfrucht!«, erwiderte Atkins. »Das sollte sie tun. Sie sollte sich für die Kunstfrucht-Behandlung anmelden.«
Kunstfrucht war das Programm für künstliche Befruchtung, die von der Partei bevorzugte Methode, sich fortzupflanzen. Sex außerhalb der Ehe war schon seit jeher kriminell gewesen, aber jetzt wurde sogar die Ehe verdächtigt, Quelle abtrünniger Loyalität zu sein. Nur wer seine gesamte Energie der Partei widmete, war ein guter Genosse. Doch solche Genossen konnte man nicht aus dem Nichts herbeizaubern. Also mussten sie durch künstliche Befruchtung gezeugt, dann von ihren Gebärenden getrennt und in Säuglingsaufzuchtstationen von leidenschaftslosen Arbeitern aufgezogen werden. Kunstfrucht stand im Mittelpunkt der »neuen Familienpolitik« der Partei, und Mädchen, die sich anmeldeten, wurde sämtliche Unterstützung zugesagt.
Durch Kunstfrucht konnten Mädchen, die bereits schwanger waren, zudem vertuschen, dass sie Sexkrim begangen hatten.
Atkins fuhr unbeirrt fort: »Whitehead wird es sicher verstehen, wenn Vicky um eine Auszeit bittet, um am Kunstfruchtprogramm teilzunehmen. Natürlich solltet ihr Mädels alle darüber nachdenken, aber in Vickys Fall frag ich mich, warum sie es nicht schon längst getan hat. Das ist genau das Richtige, wenn man sich müde fühlt. Durch ihre Teilnahme würde sie zusätzliche Rationen bekommen und könnte sich auf die Zeit in Abtmed freuen, da kann sie dann die Füße hochlegen und sich von den Krankenschwestern Tee bringen lassen. Oh, es ist so eine feine Arbeit, ein Baby zu bekommen. Und bei Kunstfrucht ist alles so sauber und systematisch. Ich würd’s ja selbst machen, wenn ich meine nicht schon auf die Altdenk-Art bekommen hätte. Und Vicky wäre dann immer noch Jungfrau! Stell dir das mal vor.«
Julia versuchte geflissentlich, sich nichts anmerken zu lassen. Natürlich wusste Atkins Bescheid. Vicky war ebenso wenig noch Jungfrau, wie sie eine Avocado war. Was Atkins nicht wusste, war, dass die Mädchen Vicky schon wochenlang von Kunstfrucht vorgeschwärmt und ihr erzählt hatten, was für eine glückliche Zeit das sei – und ein probates Mittel gegen »Störungen im Mutterleib«. Natürlich hatten sie das. Vicky war der Liebling des ganzen Wohnheims, ihr Baby, das immer in Tränen ausbrach, wenn eine der Katzen eine Maus gefangen hatte. Julia hatte sich besonders viel Mühe gegeben und Vicky von ihren eigenen beiden gescheiterten Kunstfrucht-Behandlungen berichtet, von den Süßigkeiten, die man auf der Abtmed bekam, und dem Abzeichen, das sie erhalten hatte, als handele es sich dabei um ihre schönsten Erinnerungen. Sie hatte sogar ganz vorsichtig angedeutet, dass sie sich nicht nur aus patriotischen Gründen bei Kunstfrucht angemeldet hatte. Vicky himmelte Julia an, folgte ihr wie ein Gössel der Gänsemutter; eigentlich hätte es funktionieren müssen.
Aber Vicky war auch ein launischer Teenager, sie wollte ihre Probleme verdrängen und wurde mürrisch und schnippisch, wenn man sie daran erinnerte. In der SAZ hätte man so ein Mädchen am Genick gepackt und Tacheles geredet. Man hätte einfach geradeheraus gesagt: »Sei doch nicht so närrisch! Du bist schwanger, und wenn du jetzt keine Maßnahmen ergreifst, kannst du dein Baby im Lager zur Welt bringen.« In London musste man in Rätseln sprechen, und mit Vicky sprach man eh die meiste Zeit wie gegen eine Wand.
Atkins sagte: »Ich weiß, es hat keinen Zweck, dass ich es anspreche. Wer hört auf so ein dummes altes Ding wie mich? Aber auf dich hört sie, das weiß ich.«
Julia sagte mit bewusster Gleichgültigkeit: »Vielleicht könnte Genosse Whitehead mal mit ihr reden.«
Atkins zuckte zusammen. »Oh, er ist doch aber viel zu beschäftigt. So ein großartiger Mann! Ein selbstloser Arbeiter für den Großen Bruder!«
»Ein großartiger Mann. Er gibt alles für die Partei.«
»Wenn sie wenigstens drüber nachdenken würde.« Atkins schüttelte den Kopf. »Sie bläst Trübsal. So kann es nicht weitergehen.«
Sie hob den Blick und sah Julia flehend an. Julia machte das unendlich wütend. Es waren immer die nettesten Menschen, die alles komplizierter machten. Atkins musste doch wissen, dass man nicht allen helfen konnte, erst recht nicht denen, die sich nicht einmal selbst helfen wollten.
Doch dann hörte sie sich sagen: »Ich werde mit ihr reden. Ich kann nicht versprechen, dass sie auf mich hört, aber ich werd sehen, was sich machen lässt.«
Atkins strahlte, als wäre ihr Tag gerettet. »Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Genossin! Und jetzt will ich dich nicht länger aufhalten. Zeit und Toiletten warten auf niemanden.«
Im Wohnheim Arbeiterinnen 21 befanden sich der Schlafsaal, die Station der Aufseherinnen und der Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss. Alle Räume, die mit Sanitäranlagen ausgestattet waren, lagen im Stockwerk darüber. Julia ärgerte sich jedes Mal über diese Aufteilung. Das sorgte für schwachen Wasserdruck – war ja klar, dass so die Rohre verstopften. Und aus den undichten Stellen tropfte es direkt durch die Decke des Schlafsaals in die Betten. Man erzählte sich, die Gebäude seien so geplant worden, damit im Falle eines Raketenangriffs die Bomben nicht direkt in die Schlafsäle fielen, während die Bewohner schliefen. Das war ja eine nette Theorie, aber Julia hatte eine andere. Sie glaubte, die Partei hatte die Raumverteilung so angeordnet, um ihr auf die Nerven zu gehen.
Die Küche funktionierte schon lange nicht mehr und diente nur noch zum Wäschetrocknen, sodass die Frauen das obere Stockwerk vor allem für Egoleb nutzten. Egoleb war ein Wort aus dem Neusprech für die Zeit, die man allein verbrachte: ausgedehnte Spaziergänge, lange aufbleiben und lesen, Sonnenuntergänge anschauen. Der Begriff hatte immer einen abschätzigen Unterton und sollte die Genossinnen und Genossen daran erinnern, dass Zeit, die nicht für das Wohl des Kollektivs verwendet wurde, vergeudete Zeit war. An einer Wohnheimtür bedeutete Egoleb allerdings nichts anderes als Klo. Als Edie vom Arsch der Welt ins Wohnheim Arbeiterinnen 21 gezogen war, hatte sie das Egoleb-Schild stirnrunzelnd betrachtet und gefragt: »Wollen die uns damit sagen, dass unser Leben kacke ist?« Margaret hatte einen nervösen Blick Richtung Telemonitor geworfen, und Edie verstand sofort und sagte laut: »Ich finde nicht, dass mein Leben kacke ist. Mein Leben ist großartig!« Julia hatte gehört, dass der Begriff ein Überbleibsel aus der Zeit war, als es in Wohnheimen noch Bäder gab und man die Arbeiterinnen natürlich davon abhalten musste, in ihnen zu faulenzen. Jetzt mussten alle das Badehaus der Partei nutzen und sich unter den wachsamen Augen eines Politoffiziers waschen, der in seine Trillerpfeife blies, wenn man zu lange herumtrödelte.
Einen Raum gab es noch im Obergeschoss, eine Umkleide. Darauf steuerte Julia jetzt zu, leicht angespannt, wie immer, wenn sie sich umziehen musste. In den Umkleideräumen hingen Telemonitore an allen vier Wänden, sie waren angewinkelt über den Spinden angebracht, und es war unmöglich, sich außer Sichtweite der Monitore umzuziehen. Außerdem war es verboten, etwas vor die Monitore zu hängen, was die Sicht hätte versperren können. Angeblich, damit es nicht so leicht war, Schwarzmarktware beiseitezuschaffen. Doch alle kannten den wahren Grund: Die Schnüffler glotzten einfach gerne nackte Mädchen an. Offiziell hieß es, das Abtinfo-Personal, das die Telemonitore in den Frauenumkleiden überwachte, sei ein komplett weiblicher Kader, aber Gerüchte besagten etwas anderes. Und selbst wenn: Wenn Julia in ihren Jahren bei der Jugend-Antisex-Liga eines gelernt hatte, dann, dass es genug Frauen gab, die sich gern weibliche Körper ansahen.
Diesem Gedanken hing sie noch nach, als sie ihren Spind öffnete, sodass sie beinahe das Stück Papier, das oben in einen der Lüftungsschlitze gesteckt worden war, nicht bemerkt hätte. Doch dann entdeckte sie es und nahm es geistesabwesend an sich, in der Annahme, es sei eine Notiz zur Toilettensituation. Als sie sah, was dort geschrieben stand, erstarrte sie und schloss die Faust um den Zettel. Ihr Herz raste. Sie zwang sich, gleichmäßig zu atmen, und wandte sich wieder ihrem Spind zu, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen wäre. Sie spürte eine Hitze in sich aufsteigen, eine Hitze, die bald Schweiß treiben würde.
Zu spät fiel ihr ein, dass ein gutes Parteimitglied vor den Telemonitoren sofort entrüstet reagiert hätte und dann die Treppen hinuntergelaufen wäre, um ein Betragen/Rot bei Atkins zu melden. Jetzt, nachdem schon ein paar Sekunden vergangen waren, würde jeder merken, dass ihre Empörung inszeniert wäre. Der Gedanke an die augenlosen Mäuse der Liebe, die im Dunkeln an ihr nagten, jagte ihr durch den Kopf. Der Schweiß war ihr inzwischen ausgebrochen, und sie fröstelte in dem zugigen Raum.
Auf dem Papierfetzen stand:
ICH LIEBE DICH.
In ihrem Anflug von Panik war ihr erster irrationaler Gedanke, der Zettel sei von Winston Smith. Aber das konnte gar nicht sein. Selbst wenn er auf die Idee gekommen wäre, ihr eine solche Nachricht zu schreiben, hätte er das Wohnheim Arbeiterinnen 21 niemals betreten können. Die plausibleren Kandidaten waren der Wohnheiminspektor, der sich oft im Schlafsaal aufhielt und feixend die zum Trocknen aufgehängte Unterwäsche begutachtete, oder aber der Postbote, der die Pakete brachte und sich immer nach der einen oder anderen Bewohnerin verzehrte. Der Kerl, mit dem Julia sich heimlich getroffen hatte, hätte der Hauptverdächtige sein können, er war es aber mit Sicherheit nicht. Es handelte sich um einen Lagerarbeiter vom Wohlstandsministerium, der zwar schön anzusehen war, aber schon nach einer Minute kam und bereits wieder über Parteiverpflichtungen sprach, während Julia noch ihre Schuhe suchte.
Der Zettel an sich gab keinerlei Anhaltspunkte. Die Buchstaben waren ungelenk; sie wurden eindeutig von jemandem geschrieben, der es nicht gewohnt war, einen Stift zu benutzen. Aber das hätte auf jede Person unter dreißig zutreffen können. Seit der Einführung der Sprechschreibs hielten die meisten Menschen nur noch selten einen Bleistift oder Kugelschreiber in der Hand. Die Tinte war wässrig und bläulich, und die zweite Hälfte des letzten H war nur farblos ins Papier geritzt, aber auch das hätte mit jedem x-beliebigen Stift aus London passieren können. Gute schwarze Tinte hätte Julia mehr Aufschluss geben können.
Sie war sich fast sicher, dass die Schnüffler nichts Ungewöhnliches bemerkt hatten: Das hier war nur eine Notiz, wie sie so oft zwischen den Mädchen ausgetauscht wurde, betreffend Hausarbeiten oder gemeinsame Rationen. Vielleicht hatten sie den Zettel gar nicht gesehen. Julia stand mit dem Rücken zu einem der Telemonitore, ihre offene Spindtür schirmte einen anderen ab. Schlimmstenfalls hatten sie nur beobachtet, wie sie einen Blick auf den Zettel warf und sich dann wieder ihrer Arbeit widmete. Und jetzt, wo sie eine halbe Minute Zeit hatte, um einen klaren Gedanken zu fassen, lief es ihr kalt den Rücken runter bei der Vorstellung, sie hätte beinahe einen riesigen Aufstand gemacht. Nicht auszudenken, wenn sie den kleinen Postboten zur Liebe abgeführt hätten, oder diesen armen Tropf von Wohlstand. Und außerdem war keine Anschuldigung ohne Risiko, besonders wenn es um Sexkrim ging. Wenn die Denkpol einen Sexkrimtäter in die Finger bekam, riss er das Mädchen oft gleich mit sich in den Abgrund, in der Hoffnung, selbst besser davonzukommen. Nein, sie hatte wieder alle ihre Sinne beisammen. Ihr SAZ-Instinkt hatte sie vor Schlimmerem bewahrt.
Den Zettel fest umklammert, holte sie das »Dreckszeugs« aus ihrem Spind, einen alten Overall, den sie für schmutzige Jobs anzog. Er war so abgenutzt, dass die Knie vom Stopfen aussahen wie Flechten. Der Hintern war fast durchgescheuert. Winzige Löcher an Brust und Oberschenkel zeigten, wo im Laufe der Jahre glühende Tabakkrümel den Stoff versengt hatten.