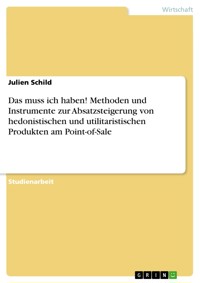Just-in-Time Information Feeding. Chancen und Herausforderungen für den Onlinehandel E-Book
Julien Schild
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Sprache: Deutsch
Heutzutage baut ein Großteil der Unternehmen ihre E-Commerce-Aktivitäten aus und verlagert seine Geschäftsprozesse ins Internet. Dieser Bereich wird immer wichtiger, um eine zunehmend online-affine Kundschaft für sich zu gewinnen. Doch wie können Unternehmen online effektiv Marketing betreiben? Wie soll das richtige Angebot Just-in-Time platziert werden, also als das richtige Produkt zur optimalen Zeit am richtigen Ort für einen potenziellen Kunden? Der Autor Julien Schild gibt in seinem Buch eine Einführung in die Thematik des Onlinehandels. Er bespricht sowohl die zahlreichen Formen des Online-Marketings als auch die Möglichkeiten von Multimedia-Sharing Slides und dem Ausbau von Communities. Dabei geht es nicht nur darum, die Methoden der einzelnen Disziplinen aufzuzeigen, sondern auch um Erfolgsmessung und rechtliche Besonderheiten – wie die Grundlagen des Onlinehandels, Datenschutzrecht und Big Data. Im Hinblick auf Tracking-Verfahren und der Nutzung von Cookies ist dieser Aspekt für Unternehmen besonders interessant. Schild verdeutlicht die Relevanz und praktische Umsetzung des Just-in-Time-Begriffes mit allen seinen Chancen und Herausforderungen. Am Schluss werden Implikationen und Handlungsempfehlungen an den Leser weitergegeben, damit eine gute E-Commerce-Strategie umgesetzt werden kann. Aus dem Inhalt: - Social-Media-Marketing; - Affiliate-Marketing; - Onlinehandel; - E-Commerce; - Suchmaschinenoptimierung (SEO); - Kundenbindung; - Online-Marketing; - Just-in-Time
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Spezifika des E-Commerce
2.1 E-Business und E-Commerce
2.2 Geschäftsmodelle im E-Commerce
2.3 Erfolgspotenziale des E-Commerce
2.4 Herausforderungen des E-Commerce
3 Online-Marketing
3.1 Klassisches Marketing
3.2 Online-Marketing
3.3 Online-Marktforschung
3.4 Methoden der Online-Marktforschung
4 Display Advertising
4.1 Begriff
4.2 Erscheinungsformen
5 Kombinationswerbeformen
5.1 Herausforderungen
5.2 Targeting
5.3 Controlling
6 E-Mail-Marketing
6.1 Begriff
6.2 Erscheinungsformen
6.3 Herausforderungen
6.4 Erfolgspotenziale
6.5 Controlling
6.5.1 Technische Umsetzung
6.5.2 Permission-Marketing
6.5.3 Bewertung und Kennzahlen
7 Affiliate-Marketing
7.1 Begriff
7.2 Tracking-Methoden
7.3 Erscheinungsformen
7.3.1 Arten des Affiliate-Marketing
7.4 Werbemittel
7.5 Affiliate-Netzwerke
7.6 Controlling
7.6.1 Kennzahlen
7.6.2 Provisionsmodelle
7.7 Herausforderungen
7.8 Erfolgspotenziale
8 Suchmaschinenmarketing
8.1 Begriff
8.2 Suchmaschinen
8.3 Search Engine Optimization (SEO)
8.3.1 Begriff
8.3.2 Funktion
8.3.3 On Site Optimization
8.3.4 Controlling
8.4 Search Engine Advertising (SEA)
8.4.1 Begriff
8.4.2 Arten der Suchmaschinenwerbung
8.4.3 Funktion
8.4.4 Herausforderungen
8.4.5 Erfolgspotenziale
8.4.6 Vergütungsmodelle und Kennzahlen
8.5 Preissuchmaschinen
9 Social-Media-Marketing
9.1 Begriff
9.2 Web 2.0
9.3 Social-Commerce
9.4 Erscheinungsformen
9.4.1 Soziale Netzwerke
9.4.2 Kollektivprojekte/Wikis
9.4.3 Multimedia-Sharing-Sides
9.4.4 Weblogs und Podcasts
9.4.5 Sonstiges
9.5 Herausforderungen
9.6 Erfolgspotenziale
10 Mobile-Marketing
10.1 Begriff
10.2 Möglichkeiten der Ausgestaltung
10.3 Herausforderungen
10.4 Erfolgspotenziale
11 Rechtliche Besonderheiten
11.1 Rechtliche Grundlagen des Online-Handels
11.2 Big Data
11.3 Datenschutz
11.4 Interessante Online-Sachverhalte
12 Trends und Entwicklungen
13 Implikationen und Handlungsempfehlungen
14 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Ausprägungen der E-Commerce Dimensionen
Abbildung 2: Ausprägungen der E-Commerce Dimensionen
Abbildung 3: 4C-Business Modell
Abbildung 4: Übersicht über das 4C-Business Modell nach Wirtz (größere Version im Anhang, S 147)
Abbildung 5: Neuer Online-Kaufprozess
Abbildung 6: Das 4-Kräfte-Modell im E-Commerce
Abbildung 7: Prognose der Umsätze mit Bannerwerbung in Deutschland in den Jahren 2015 bis 2021 (in Millionen Euro)
Abbildung 8: Prognose der Umsätze mit Bannerwerbung pro Internetnutzer in Deutschland in den Jahren 2015 bis 2021 (in Euro)
Abbildung 9: Zielsetzung von E-Mail-Marketing
Abbildung 10: Prozess der Suchmaschinenwerbung
Abbildung 11: Entwicklung vom Commerce zum Social-Commerce
Abbildung 12: Phasen des Social-Commerce
Abbildung 13: Störfaktoren im Mobile-Commerce in Prozent
Abbildung 14: Anteil der Befragten, die mobile Geräte zum Einkauf im Internet verwenden in den Jahren 2011 bis 2016
Abbildung 4: Übersicht über das 4C-Business Modell nach Wirtz Quelle: ln Anlehnung an Wirtz 2013, S. 279, 306, 331, 358.
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Vergleich zwischen Online-Marktforschung und klassischer Marktforschung
Tabelle 2: Steuerungsgrößen aus Sicht des Merchants im Affiliate-Marketing
Tabelle 3: Die wesentlichen Unterschiede der beiden Formen des Affiliate-Marketings
Tabelle 4: Gegenüberstellung von SEO und SEA
Tabelle 5: Ansätze zur Suchmaschinenoptimierung.
Tabelle 6: Phasen des Social-Commerce
1 Einleitung
„Das langsame Sterben des Einzelhandels ist ein gerne verwendetes Bild, wenn es darum geht, die Auswirkungen des Online-Handels auf den stationären Handel, wie beispielsweise ein Ladengeschäft, zu beschreiben“ (Ternès/Towers/Jerusel 2015, S. 1). Diese Aussage verdeutlicht die Relevanz, sich genauer mit dem Online-Handel und damit verbunden auch dem E-Commerce, zu befassen. Die Relevanz des Themas zeigt sich ebenso in der raschen Entwicklung der IKT (z.B. schnellere Übertragungsraten und neue Technologien), der Akzeptanz von Online-Medien und der großen Bandbreite an kommunikationspolitischen Maßnahmen (Olbrich/Schultz/Holsing 2015, S. 47). E-Commerce wird nicht nur von jungen, technikaffinen Personen, sondern von fast allen Altersgruppen und sozioökonomischen Schichten genutzt (Grandón/Nasco/Mykytyn 2011, S. 292 ff.). Zudem ist bereits seit Jahren eine Entwicklung vom stationären zum Online-Handel zu verzeichnen. Dies wird auch durch den Globalisierungsvorgang und der Tatsache, dass das Internet Transparenz, Komfort, Zeitersparnis etc. verspricht, vorangetrieben. Des Weiteren beginnt für viele Konsumenten der Kaufprozess nicht im Laden oder im Online-Shop, sondern bei der Informationssuche im Netz. Daraus resultiert auch der Wandel von einer Industrie- zu einer Informationsgesellschaft und die Verlagerung der Geschäftsprozesse ins Internet, wo mittels moderner IKT eine große Zahl elektronischer Geschäfte realisiert wird (Wirtz 2013, S. 16; Meier/Stormer 2012, S. 2). Jeder zweite Deutsche kauft regelmäßig im Internet ein (Stallmann/Wegner 2015, S. 23). Dies liegt mitunter darin begründet, dass nahezu sämtliche Produkte heutzutage online zu erwerben sind. Außerdem ist im E-Commerce-Bereich aufgrund von geringen Wechselbarrieren, sinkenden Eintrittsbarrieren und großer Markttransparenz die Wichtigkeit, Kunden auf seine Internetpräsenz zu locken (und zu behalten) größer denn je (Stallmann/Wegner 2015, S. 24). Hinzu kommt, dass je mehr Kunden auf die eigene Seite gelockt werden, desto mehr der gewünschten Interaktionen (z.B. Bestellen von Newslettern) finden statt und desto mehr Kundendaten können generiert werden.
Bei dem Thema geht es ebenfalls darum, das richtige Angebot Just-in-Time zu unterbreiten. Das bedeutet jedoch mehr als eine bloße Reduktion der Störungen in der Lieferkette oder eine kundenorientierte Ausrichtung der Strukturen. Es bedeutet, das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der richtigen Menge zu unterbreiten (Dickmann 2015, S. 17 ff.).
2 Spezifika des E-Commerce
2.1 E-Business und E-Commerce
Der Online-Handel zeichnet sich durch einen immensen Facettenreichtum aus. Dies zeigt sich bereits in zahlreichen Definitionen und Begriffen, die im Sprachgebrauch oft synonym verwendet werden. Hierunter fallen bspw. Begriffe wie E-Commerce und E-Business. Hinzu kommt die Tatsache, dass in unterschiedlichen Werken der Literatur die unterschiedlichen Begriffe auch unterschiedlich abgegrenzt werden.
Während unter E-Business i.d.R. sämtliche Geschäftsprozesse eines Unternehmens verstanden werden, die über IT bzw. elektronische Netzwerke abgebildet werden (Alt 2012, S. 133 ff.; Wirtz 2013, S. 22), liegt beim E-Commerce das Hauptaugenmerk eher beim Kauf und Verkauf von Gütern sowie Dienstleistungen mittels moderner IKT (Maaß 2008, S. 2). Daraus ist ersichtlich, dass E-Commerce als Teildisziplin des E-Business angesehen werden kann. Weitere Teildisziplinen sind E-Communication, E-Education, E-Information bzw. E-Entertainment (Aichele/Schönberger 2016, S. 2). Hierbei umfasst E-Communication sowohl die entgeltliche als auch die unentgeltliche Nutzung und Bereitstellung netzwerkbasierter und elektronischer Kommunikationsplattformen, während unter E-Education die Transferierung von Aus- und Weiterbildungsleistungen an Dritte mittels elektronischer Netze zu verstehen ist (Wirtz 2013, S. 32). E-Information und E-Entertainment bezeichnet die oftmals unentgeltliche Bereitstellung von unterhaltenden und/oder informierenden Konzepten und Inhalten über elektronische Netze für Dritte (Aichele/Schönberger 2016, S. 4 f.).
Festzuhalten ist allerdings, dass es nicht „die Eine“ allgemeingültige Definition von E-Commerce gibt.
So kann E-Commerce relativ schlicht als „[...] die digitale Anbahnung, Aushandlung und/oder Abwicklung von Transaktionen zwischen Wirtschaftssubjekten“ (Clement/Peters/Preiß 2001, S. 56) angesehen werden. Wirtz hingegen betont zusätzlich den durch Kauf und Verkauf entstehenden Transaktionsaspekt mittels elektronischer Netze (Wirtz 2013, S. 31). Auch das bloße Informieren über Produkte kann dem E-Commerce zugerechnet werden (Baum 2015, S. 22). Thome und Schinzer (1997, S. 11) weisen zusätzlich darauf hin, dass die Geschäftsprozesse über global öffentliche und private Netze (Internet) abgewickelt werden. Wie bei den meisten unternehmerischen Entscheidungen soll langfristig eine Umsatzsteigerung eintreten. Laut Meffert (2000, S. 917 f.) kann man zwischen E-Commerce im engeren und E-Commerce im weiteren Sinne differenzieren. Hierbei ist E-Commerce im engeren Sinne eher deckungsgleich mit den aufgezeigten Definitionen zu E-Commerce. E-Commerce im weiteren Sinne ist eher deckungsgleich mit dem Begriff E-Business. In der vorliegenden Masterarbeit wird der Bereich E-Commerce im weiteren Sinne verwendet, da die Bereiche der anderen Teilgebiete des E-Business, deren Hauptziel es ist, Umsätze zu generieren, für die Arbeit ebenso bedeutsam sind, wie das E-Commerce im engeren Sinne.
Eine Konkretisierung des Begriffs E-Commerce zeigt Abbildung 1. Sie verdeutlicht, dass nicht nur verschiedene Medien, sondern auch verschiedene Transaktionspartner sowie unterschiedliche Transaktionsgüter aufeinander einwirken und so eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Dimensionen auftreten.
Abbildung 1: Ausprägungen der E-Commerce Dimensionen
Quelle: Schultz 2007, S. 13.
Da eine detaillierte Analyse aller Dimensionen den Umfang einer Masterarbeit sprengen würde, wird das Hauptaugenmerk der Arbeit auf die Transaktionsgüter, Produkte und Informationen über Mobile-Systeme sowie das Internet im B2C-Bereich gelegt.
Die universelle Zugänglichkeit zum Internet und sinkende Preise in der Computerwelt unterstützen eben jenen B2C-Bereich, bei dem Händler und Konsumenten direkt miteinander in Kontakt treten, um Handel zu betreiben. Dies muss durch entsprechende Online-Kanäle, also Datenübertragungssysteme, die Informationen von einer Zentraleinheit zu peripheren Geräten und umgekehrt übertragen, unterstützt werden (Olbrich/Schultz/Holsing 2015, S. 7).
Die einzelnen Einsatzmöglichkeiten des E-Commerce werden in Abbildung 2 noch einmal aufgezeigt.
Abbildung 2: Ausprägungen der E-Commerce Dimensionen
Quelle: In Anlehnung an Hermanns/Sauter 2001, S. 25; vgl. Olbrich/Schultz/Holsing 2015, S. 7.
Aufgrund der Tatsache, dass im B2C-Bereich der Leistungsaustausch von digitalen und physischen Gütern und Dienstleistungen zwischen Unternehmen als Anbieter und Endkonsumenten als Nachfrager im Vordergrund steht und die besagten Leistungsaustauschprozesse vorwiegend über Online-Shops realisiert werden (Wirtz 2013, S. 24; Laudon/Laudon/Schoder 2010, S. 575), ist diese Sparte von größerem Interesse für die vorliegende Arbeit, als die anderen Sparten aus Abbildung 2. Hierzu gehört die Nutzung elektronischer Medien, um eine effiziente Abwicklung von Marketingaktivitäten, Bestellungen, Zahlungsmodalitäten, Lieferungen und After Sales Services zu gewährleisten (Sun/Finnie 2004, S. 59).
Charakteristikum von Verkaufsprozessen im B2C E-Commerce ist es, dass ein gewerblicher Anbieter einer Vielzahl von wechselnden Kunden gegenüber steht. Dies kann über eine individuelle Vertriebsplattform (eigener Online-Shop), Marktplätze (z.B. Amazon), Auktionshäuser (z.B. Ebay) oder Shopping Clubs (z.B. Brands4friends) geschehen. Um die Reichweite zu erhöhen, können natürlich mehrere Vertriebsplattformen parallel genutzt werden (Stallmann/Wegner 2015, S. 9 f.). Auch die Güter, die gehandelt werden, sind vielfältig. So werden physische Güter (z.B. Schuhe), digitale Güter (E-Books) oder Dienstleistungen (z.B. Handwerker) über das Internet vertrieben, wobei sich digitale Güter aufgrund des einfachen Versandes am besten für den internationalen Absatz eignen.
2.2 Geschäftsmodelle im E-Commerce
Selbstverständlich haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche E-Commerce Geschäftsmodelle entwickelt. Diese bilden im E-Commerce den Rahmen für die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens im Internet und beschreiben die Vision, die Geschäftsidee, das Ertragsmodell, das Leistungsmodell und die auf die jeweilige Bedingungslage abgestimmten unternehmerischen Leistungsbedingungen (Hansen/Mendling/Neumann 2015, S. 207). So unterscheiden Hansen/Mendling/Neumann (2015, S. 206) folgende Gruppen von Unternehmen im Bereich des E-Commerce nach dem Gegenstand der Geschäftstätigkeit:
Anbieter von Netzwerkdiensten, bspw. für den Internetzugang,
Anbieter von höherwertigen Kommunikationsdiensten, bspw. für Chat-, E-Mail- oder Telefon-Dienste,
Anbieter von Dienstleistungen, die über das Internet erbracht werden können, bspw. Suchdienste,
Anbieter von digitalen Gütern über das Internet, bspw. Video- oder Musikstreaming-Dienste,
Anbieter von materiellen Gütern, wobei der Informationsaustausch und die Bezahlung der Güter über das Internet, die Lieferung der Waren jedoch über traditionelle Logistikwege erfolgen.
Im Rahmen der Geschäftsmodelle hat sich auch das 4C-NetBusiness Modell von Wirtz entwickelt. Es unterteilt die Gesamtheit der von Unternehmen verfolgten Geschäftsmodelle im B2C-Bereich in Bezug auf ihre Leistungs- und Wertschöpfungsprozesse in die vier Typen „Content“, „Commerce“, „Context“ und „Connection“, wobei die Geschäftsmodelle innerhalb eines jeden Typus möglichst homogen und zwischen den einzelnen Typen möglichst heterogen sein sollen, um eine ausreichende Orientierungs-, Differenzierungs- und Klassifizierungsmöglichkeit zu gewährleisten (Wirtz 2013, S. 275 f.). Abbildung 3 gibt einen kurzen Überblick über das 4C-Net-Business Model.
Abbildung 3: 4C-Business Modell
Quelle: in Anlehnung an Wirtz 2013, S. 277.
Sammlung, Selektion, Systematisierung, Kompilierung sowie Bereitstellung von Inhalten (Content) auf einer eigenen Plattform im Netzwerk gehören zu dem Geschäftsmodell Content. Es wird darauf abgezielt, dem Nutzer einen bequemen Zugang auf virtuell aufbereitete Inhalte zu gewährleisten. Hierzu gehören die Bereiche E-Education, E-Entertainment und E-Information, welche jeweils bildende, unterhaltende oder informierende Inhalte bereitstellen. Die einzelnen Kategorien lassen sich jedoch noch weiter aufspalten. So kann man E-Education die Begriffe Virtual University und Public Education zuordnen, E-Entertainment spaltet sich auf in E-Movies, E-Music und E-Games. E-Information kann in E-Politics, Economics und E-Society unterteilt werden (Wirtz 2013, S. 278 f.; Kollmann 2013a, S. 49).
Im Geschäftsmodell Commerce werden die klassischen Phasen einer Transaktion, wie die Anbahnung, Aushandlung oder Abwicklung von Geschäftstransaktionen über Netzwerke, unterstützt, ergänzt oder substituiert, um dem Nutzer die einzelnen Phasen des Kaufprozesses so schnell und überschaubar wie möglich zu gestalten. Das Geschäftsmodell Commerce lässt sich wiederum in E-Attraction, mit den Unterkategorien Banner-Schaltung und Mail-Betreiber, E-Bargaining/E-Negotioation, mit den Unterkategorien Auction und Price Seeking sowie E-Transaction, mit den Unterkategorien Payment und Delivery unterteilen (Wirtz 2013, S. 306 f.; Kollmann 2013a, S. 50).
Klassifizierung, Systematisierung und das Zusammenführen von Leistungen und Informationen im Netzwerk stehen im Vordergrund des Geschäftsmodells Context. Die Verbesserung der Markttransparenz für die Nutzer soll hier durch eine kontext- und kriterienspezifische Kompilierung und Präsentation von Informationen erreicht werden. Zusätzlich zur Komplexitätsreduktion soll auch der Suchaufwand verringert werden. Das Geschäftsmodell lässt sich in Suchmaschinen und Web-Kataloge unterteilen. Hierzu gehören dementsprechend die Bereiche E-Bookmarking, E-Catalogs und E-Search (Wirtz 2013, S. 331 f.; Kollmann 2013a, S. 50).
Bei dem Geschäftsmodell Connection geht es um die Realisierung von kommunikativen, technischen und kommerziellen Verbindungen, also einen Informationsaustausch zwischen Netzwerken. Hier wird eine Differenzierung zwischen Inter- und Intra-Connection vorgenommen. Die Intra-Connection besteht aus Community und Mailing Services und beschreibt das Angebot von Kommunikationsmöglichkeiten. Die Inter-Connection hingegen besteht aus Fix- und M-Connection und enthält Anbieter, die den Zugang zu Netzwerken ermöglichen (Wirtz 2013, S. 357 f.; Kollmann 2013a, S. 50 f.).
Abbildung 4 veranschaulicht noch einmal die Dynamik des 4C-Business Modells.
Abbildung 4: Übersicht über das 4C-Business Modell nach Wirtz (größere Version im Anhang, S 147)
Quelle: In Anlehnung an Wirtz 2013, S. 279, 306, 331, 358.
2.3 Erfolgspotenziale des E-Commerce
Die Tatsache, dass die online generierten Umsätze jährlich steigen, liegt mitunter in der Tatsache begründet, dass das Shoppen im Internet oder über internetfähige Endgeräte zahlreiche Vorteile mit sich bringt. So können Verbraucher, wo auch immer sie sind und wann auch immer sie wollen, bequem innerhalb weniger Klicks ein für sie passendes Angebot finden und kaufen. Sogar wann das Produkt geliefert wird, kann der Konsument z.T. mitbestimmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass Hersteller ihre Ware hier direkt vertreiben können, also nicht zwangsläufig Zwischenhändler eingesetzt werden müssen. Dies führt aufgrund des Wegfalls von Provisionen oft zu Kostenvorteilen für den Konsumenten. Zudem werden mittlerweile nicht nur Sachgüter, sondern auch Vertrauensgüter, Erfahrungsgüter und sogar Dienstleistungen über das Internet vertrieben (Baum 2015, S. 25 f.).
Aber auch für Anbieter bietet das World Wide Web enorme Nutzenpotenziale (Olbrich/Schultz/Holsing 2015, S. 18 ff.): Dies spiegelt sich einerseits in dem Fakt wider, dass der Anbieter sich eine globale Präsenz und damit verbunden den Zugang zu neuen Zielgruppen oder ganzen Märkten sichert. Andererseits werden ihm in Bezug auf Sortimentsbreite, -tiefe und -wechsel aus elektronischer Sicht kaum Grenzen gesetzt. Kunden gelangen schon nach wenigen Klicks von einer Werbeeinblendung zum Kauf eines Produktes. Darüber hinaus gehören natürlich auch die Gewinnung von Kundendaten, Informationen über das Such- und Kaufverhalten von Konsumenten sowie der Möglichkeit, diese Informationen bspw. durch individualisierte Werbemaßnahmen, Cross-Selling oder andere Marketing-Maßnahmen gewinnbringend zu nutzen zu den Vorteilen von E-Commerce. Jedoch sind auch aus Konsumentensicht diverse Nutzenvorteile im Online-Handel erkennbar. Hier sind nicht nur die Angebote zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar, sondern auch die Markttransparenz ist auch aufgrund von Suchmaschinen und Preisvergleichsdiensten in den vergangen Jahren stetig gestiegen. Hinzu kommen die personalisierten Empfehlungen, welche eine erhebliche Nutzensteigerung beim Kunden hervorrufen können. Zusammen mit der immensen Auswahl an Produkten kommt auch die damit einhergehende Auswahl an Nischenprodukten (Anderson 2009, S. 9). Auch der Long-Tail-Effekt, also die Tatsache, dass online aufgrund von z.B. unbegrenzten Präsentationsmöglichkeiten, eine größere Bandbreite an Produkten verkauft wird, ist ein Nebeneffekt des E-Commerce (Brynjolfsson/Hu/Smith 2010, S. 736 ff.).
So hat sich ein neuer Online-Kaufprozess entwickelt, der in Abbildung 5 veranschaulicht wird. Der erste Ansatzpunkt (die Bedürfnisweckung) kann selbstverständlich nur bestmöglich gelingen, wenn Kundendaten generiert und optimal genutzt werden. Anschließend müssen die Händler versuchen, den Kunden bei jedem weiteren Schritt so zu beeinflussen, dass er die gewünschte Handlung durchführt.
Abbildung 5: Neuer Online-Kaufprozess
Quelle: In Anlehnung an Holsing/Schäfers 2010, S. 169 ff.; vgl. Olbrich/Schultz/Holsing 2015, S. 21.