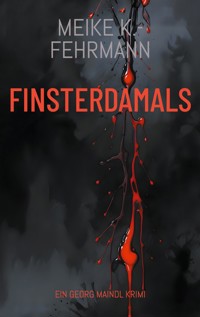Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Patrick fühlte sich nie einsam und sehnte sich auch nicht nach der Gesellschaft eines anderen Kindes in seinem Alter. Die Käfer, Würmer und Nacktschnecken reichten ihm vollkommen als stumme Gesellschafter bei seinem Schachspiel. Im Reihenhaus einer Siedlung betreibt der menschenscheue Patrick ein bizarres Hobby. Der Halbwüchsige züchtet Kakerlaken. Seine eigentliche Passion ist jedoch das Schachspiel: Doch genau wie im realen Leben wagt er auf dem Schachbrett immer nur vorsichtige Züge. Schließlich wird sein Spiel riskanter - und die Partie gerät zu einem Match auf Leben und Tod. Wie im Schach gibt es in dieser Partie eine unkalkulierbare schwarze Dame, einen eiskalten König, ungestüme Springer und Bauernopfer. Die Frage, wer das böse Spiel gewinnt, bleibt spannend bis zum großen Finale - am Ende sind einige der Figuren schachmatt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
1.
Patrick konnte sich nie entscheiden, ob er das Spiel mit einem Bauern oder einem Springer eröffnen sollte. Er fuhr sich mit der Hand durch die lockigen blonden Haare und starrte unschlüssig auf das Schachbrett aus Mahagoni, das vor ihm auf dem runden schwarzen Couchtisch platziert war. Die silberne Nickelbrille rutschte ihm fast von der schmalen geraden Nase, sein Blick schweifte zwischen den Reihen der Figuren hin und her. Noch standen alle in Reih und Glied. Die weißen und schwarzen Bauern schienen sich feindselig anzustarren, zwischen ihnen blieb noch genügend Abstand, vier Felder. Hinter ihnen die stärkeren Spielfiguren. Je zwei Türme, zwei Springer, zwei Läufer, Dame und König. Er streckte unschlüssig seine Rechte nach einem weißen Bauern aus und berührte ihn fast zärtlich. Strich über das geschwungene Holz, konnte sich aber noch nicht entschließen, zuzupacken. Die Bauern schienen ihm oft so plump. Es gab viele von ihnen, acht gegen acht. Der Einzelne war nicht so wichtig. Sie standen nebeneinander und rückten nur in eine Richtung, ein Feld, höchstens zwei vor, Schritt für Schritt. Sie hatten etwas Unschuldiges und Harmloses, gleichzeitig etwas Verzweifeltes. Niemand schützte sie. Sie standen an der vordersten Front, an der Linie zum Niemandsland. Sie schlugen aber hinterhältig. Plötzlich nach rechts oder links. Dennoch war der Bauer unscheinbar, verglichen mit dem Springer, dem Pferdchen. Es gab nur diese beiden Möglichkeiten – Bauer oder Springer.
Patrick mochte Pferde nicht. Sie waren so ungestüm und unberechenbar. Zwei vor und eins quer. In jede Richtung. Niemand sprang so wild wie die Pferdchen. Ihr Wiehern erschreckte ihn und machte ihm Angst. Ein dünner durchsichtiger Speichelfaden rann aus Patricks Mund. In seiner Konzentration bemerkte er ihn erst, als seine Spucke das Spielbrett benässte. Wenn er also den Springer nahm, wusste sein Gegner, er musste sich warm anziehen. Hier kam einer, der es wissen wollte! Ein Wilder, der gleich in die Vollen ging. Achtung, Achtung! Wollte er das? Sich als Cowboy outen schon mit dem ersten Zug? Wie sollte er sich also entscheiden? Er nahm den Bauern. Immer. Jedes verdammte Mal eröffnete er die Schachpartie gegen sich selbst mit einem Bauern. Und jedes Mal brauchte es mehrere Minuten angestrengten Nachdenkens, bis er sich dazu durchgerungen hatte. Der Filz unter dem weißen Bauern ließ ihn sanft nach vorne gleiten, nahezu geräuschlos. Patrick nahm den Bauern, weil er selbst einer war. Nicht wörtlich gemeint, aber er fühlte sich oft wie einer unter vielen. Oder besser gesagt: Er wäre gerne einer unter vielen! Unauffällig und hinterhältig zugleich.
Erleichtert über seine Entscheidung schloss er die Augen und genoss den Moment des Anfangs. Den Zauber des Anfangs, der jeder Schachpartie innewohnte, wenn die erste Figur gezogen war. Kleine Grübchen zeichneten sich für einen kurzen Moment auf seinen Wangen ab, als ein sanftes Lächeln über sein Gesicht huschte. Gleichzeit spürte er aber auch eine leichte Enttäuschung in sich aufsteigen. Hätte er nicht dieses eine Mal den Springer nehmen können? Nur dieses eine Mal!
Aber beim Schach lässt sich eine Entscheidung nicht rückgängig machen. Es ist ein vollkommen konsequentes Spiel. Du ziehst und mit diesem Zug musst du leben. So stellte Patrick sich das wahre Leben im Idealfall auch vor. Nicht dieses dauernde Hin und Her, die ständige Ungewissheit, woran man war, die Haltlosigkeit ohne Regeln.
Schach war das einzige Spiel, das sein Vater, Maxi Heide, ihm je beigebracht hatte. Das war vor vier Jahren, als er ihm zum achten Geburtstag ebendieses Schachspiel geschenkt hatte. Patrick war zunächst enttäuscht und hätte das Spiel am liebsten sofort umgetauscht. Diese altmodischen Figuren mit ihren geschnitzten Gesichtern. Welcher Junge in seinem Alter wollte denn ein solch antiquiertes Spiel bekommen? Und das hatte er seinen Vater auch spüren lassen, indem er das Spiel zunächst achtlos auf dem Tisch zur Seite schob, bis es schließlich mit einem lauten Krachen auf den Boden gefallen war. Eine Playstation wäre ihm lieber gewesen.
Maxi Heide hatte die Spielfiguren schließlich aufgesammelt und wieder in dem zum Spiel gehörigen quadratischen Holzkasten verstaut, ohne auch nur eine einzige Gefühlsregung, wie etwa Enttäuschung oder Ärger, darüber zu zeigen, dass seinem Sohn das Geschenk offenbar nicht gefiel. Dann, in einem Anflug von Langeweile, hatte Patrick sich das Spiel eines Abends geschnappt und mit in sein Bett genommen. Er besah sich die Figuren genauer, versuchte ihre starren Blicke zu deuten und es war ihm, als würden sie ihn direkt anschauen, sie schienen ihm etwas sagen zu wollen in einer Sprache, die er noch nicht verstand. Er brachte das Brett auf seinem Bett in eine stabile Lage und stellte die Figuren auf.
Erst scherte sich Patrick nicht um die Regeln, sondern stellte die Schwarzen und die Weißen willkürlich wie Armeen auf, stieß eine Figur mit der anderen vom Brett, so dass sie über die Bettdecke rollte. Es machte ihm Spaß, sich vorzustellen, dass eine Figur die andere besiegte. Dann bat er irgendwann seinen Vater ihm die Grundregeln des Spiels zu erklären. Und plötzlich begriff er auf wundersame Weise: Einer dieser Bauern war er. Und da waren die anderen Figuren um ihn herum. Sie alle standen zu einem einzigen Zweck da, um den einen zu beschützen: den König. Diesen langweiligen Feigling! Jedes Mal, wenn Patrick ihn ansah, zog er verächtlich eine Augenbraue nach oben. Er schnippte ihn gerne mit dem Zeigefinger um, so dass er möglichst weit weg flog. Wieso konnte die Dame fast alles, zog diagonal kreuz und quer, vor und zurück über das Spielfeld, während der König nahezu nichts tat? Bewegte sich immer nur einen einzigen Schritt und verkroch sich mit Zepter und Krone hinter den Bauern, neben der großen Frau. Nie hatte sich sein Vater ihm zuvor klarer offenbart. Nichts als eine kleine harmlose Schnecke im Purpurgewand. Auf dem Spielbrett offenbarte sich ihm das ganze Desaster seiner Familie.
2.
Der Flug aus Buenos Aires landete mit fast zwei Stunden Verspätung am Frankfurter Flughafen. Nach sechsundzwanzig Stunden Reisezeit, inklusive Zwischenstopp in Madrid, passierte Pedro Ruiz abgekämpft mit seinen zwei schwarzen Rollkoffern und dem bunten Trekkingrucksack auf dem Rücken die Schiebetüren der Ankunftshalle. Das ihn umgebende Stimmengewirr in der großen Halle, die Lautsprecherdurchsagen und die Übermüdung verursachten ihm heftige Kopfschmerzen. Der junge Argentinier wühlte sich durch die Menschenmenge, nahm nur am Rande wahr, wie sich Leute fröhlich in die Arme fielen, küssten und überschwänglich begrüßten. Andere zogen einsam wie er ihre Bahn durch die Masse, die Blicke suchend auf die Anzeigetafeln und Beschilderungen gerichtet, um den richtigen Weg zum Parkhaus, zum Bahnhof oder Taxistand zu finden. Dazwischen eilten Männer und Frauen im Businessdress zielstrebig mit kleinem Gepäck durch die Vorhalle, die ortskundig waren und wahrscheinlich von einer ihrer unzähligen Geschäftsreisen zurückkamen, vermutete Pedro. Er hatte sich vorgestellt, dass er große Erleichterung verspüren würde, wenn er endlich deutschen Boden betrat. Aber nun war er vor allem hungrig und müde, so dass er außer Stande war, diffizilere Gefühle in sich genauer zu definieren, zumal das Pochen in seinen Schläfen immer heftiger wurde.
Schon in Madrid hatte er gemerkt, dass er für europäische Breiten viel zu dünn angezogen war. In Buenos Aires hatten subtropische 25 Grad Celsius geherrscht, als er sich gegen Mittag auf den Weg zum Flughafen gemacht hatte. Er hatte nicht daran gedacht, dass es in Deutschland Anfang November bereits empfindlich kalt sein konnte. Er nahm seinen beigen Wollpullover aus dem Rucksack und streifte ihn sich über. Der nasskalte Dunst, der über der Rhein-Main-Region lag, durchdrang augenblicklich seine Kleider, als er das Flughafengebäude verließ und sich zum Taxistand begab. Die fahle Herbstsonne durchdrang nur mühsam den Wolkenvorhang und wurde schwach von den riesigen Glasscheiben der Eingangshalle reflektiert. Pedro wünschte sich im Moment nichts sehnlicher, als so schnell wie möglich in sein bequemes Hotelzimmer einzuchecken. Die unangenehme feuchte Kälte ließ ihn frieren.
Ein Taxifahrer kam, noch ehe er den Taxihalteplatz erreicht hatte, auf ihn zugeeilt, lächelte ihn freundlich an und griff nach seinen Koffern. Überrascht, aber auch dankbar für so viel Hilfsbereitschaft, oder aber professionelle Geschäftstüchtigkeit, überließ er dem Mann sein Gepäck und trottete ihm hinterher. Dass der Fahrer ihn auf Spanisch angesprochen hatte, machte Pedro nicht weiter stutzig, auch bemerkte er nicht, dass er gar nicht der Erste in der Reihe der Wartenden war, dem das nächste Taxi zugestanden hätte. Das Taxi, zu dem der Mann die Koffer brachte, stand ein wenig abseits hinter den anderen. Flink öffnete der Chauffeur den Kofferraum und warf die Koffer hinein. Pedro stieg ein und ließ sich schwer auf die schwarzen Ledersitze fallen, erst in diesem Augenblick bemerkte er einen Mann, der schon im Fond des Wagens saß und der ihn nun breit angrinste. Der Fahrer schlug die Seitentür des Taxis zu.
„Willkommen in der Freiheit“, sagte der Mann neben ihm auf Spanisch und Pedro griff reflexartig nach dem Türgriff. Doch die Autotür ließ sich nicht mehr öffnen. Das Taxi fuhr los und nahm schnell Fahrt auf. Pedro rüttelte immer noch hektisch am Türgriff. „Ganz ruhig“, sagte sein Sitznachbar.
„Was wollen Sie von mir?“, fragte Pedro panisch. „Ich bin nur ein Tourist.“ Der Mann lachte heiser.
„Hörst du das, Carlos?“, wandte er sich an den Fahrer, „er ist nur ein Tourist.“
Carlos antwortete nicht und gab stattdessen nur einen Grunzlaut von sich. Er fädelte das Taxi geschickt in den zähfließenden Strom der stadtauswärts strebenden Fahrzeuge ein.
„Wir fahren nur zu einer kleinen Unterhaltung, sonst nichts“, fuhr der Mann fort. Pedro schlug heftig mit den Handflächen gegen die Scheibe und versuchte die Blicke von Insassen der in der Nebenspur fahrenden Fahrzeuge auf sich zu lenken. Er wollte raus aus diesem Auto! Jemand musste doch auf ihn aufmerksam werden! Da zog der Mann neben ihm einen blitzenden schwarzen Gegenstand aus der Jacke und schlug zu. Pedro verlor augenblicklich das Bewusstsein und sackte zusammen.
3.
Maxi Heide lebte in der Kardünstraße 1 einer Kleinstadt am Rande des Taunus. Seine Noch-Ehefrau Jacky Heide im selben Reihenhaus nebenan. Die Fassade des Reihenhauses war weiß, die Fenster in der einen Hälfte klar, in der anderen milchig. Das Haus stand am Ende einer Sackgasse, dahinter erstreckten sich nur noch Felder und ein kleines Waldstück. Die Asphaltstraße vor dem Haus war rissig und voller Schlaglöcher, doch der Blick auf Wald und Felder hatte zu jeder Jahreszeit seinen besonderen Reiz. Ihr zwölfjähriger Sohn Patrick lebte mal hier und mal da, je nachdem, wo er vorübergehend mehr für sich rausschlagen konnte. Im Keller gab es eine Verbindungstür zwischen den beiden Haushälften, so dass Patrick nicht mal das Haus zu verlassen brauchte, wenn er von Vater Maxi zu Mama Jacky wollte oder umgekehrt. Maxi und Jacky lebten getrennt, aber irgendwie auch nicht getrennt. Sie hassten sich bis aufs Blut und doch machte keiner von beiden Anstalten auszuziehen, um diese Ehe konsequent zu beenden. In denselben vier Wänden zu leben ging nicht, und doch gab es einige Kleinigkeiten, die die beiden zutiefst miteinander verbanden.
Jacky war eine korpulente Frau mit blondierter Dauerwelle, stets stark geschminkt und immer in hochhackigen Schuhen unterwegs. Ihre kurzen Röcke waren für ihre Figur nicht vorteilhaft, erinnerte sie darin doch oft an ein Nilpferd, das sich zum Karneval versehentlich in ein zu enges Kostüm gepresst hatte. Presswurst, nannte Maxi Heide seine Noch-Ehefrau darum hinter vorgehaltener Hand, wenn er sich wieder einmal über sie geärgert hatte. Dennoch kam er nicht umhin, ihre massigen Beine in den engen Leggins mit Leopardenprint sexy zu finden. Durch ihre enorme Körperfülle fiel es ihr schwer, auf den dünnen Pfennigabsätzen das Gleichgewicht zu halten. Darum trat sie immer stampfend und etwas breitbeinig auf und Patrick wunderte sich, dass so selten ein Absatz abbrach. Man hätte mit den Absätzen fast Mitleid haben können. Jacky hatte das Temperament einer Dampfwalze. Der kleinste Anlass konnte sie aufbrausen lassen, den Kessel zum Überkochen bringen. Sie warf mit Vorliebe mit Porzellan oder Blumentöpfen, wenn sie erzürnt war, am liebsten auf Maxi Heide, den sie für alle Übel in ihrem Leben verantwortlich machte, egal ob er an der gegenwärtigen Misere direkt beteiligt war oder nicht. Manchmal schlug sie ihm auch ins Gesicht, aber nachdem Maxi Heide einmal zurückgeschlagen hatte und statt der flachen Hand reflexartig die Faust benutzte, ließ sie es bleiben und verlegte sich stattdessen auf das Werfen diverser Gegenstände. So konnte sie einen gewissen Sicherheitsabstand zu ihrem Noch-Ehemann wahren und sich dennoch an ihm abreagieren. Auch wenn Jacky sich im Laufe ihres Lebens häufiger den einen oder anderen Faustschlag, zum Beispiel von ihrem Vater, ihren Brüdern oder früheren Freiern, eingefangen hatte, wollte sie sich dies von Maxi auf keinen Fall bieten lassen. Überhaupt fühlte sie sich inzwischen zu alt, um sich von irgendeinem Mann so etwas gefallen zu lassen. Die Zeiten, in denen sie sich hatte herumstoßen lassen, waren längst vorbei. Heute war sie die Herrscherin über ihr Leben und über jeden, der in den Dunstkreis ihres Daseins trat. Jacky war hart im Nehmen und ebenso hart im Austeilen.
Was Patrick an seiner Mutter mochte, war der Duft ihres Parfüms, der jeden Morgen schwer und blumig in der Badezimmerluft hing, ihren selbstgebackenen Käsekuchen und ihre Fähigkeit, Kringel in die Luft zu blasen, wenn sie Zigarre rauchte. Was er an ihr nicht mochte, war die Tatsache, dass sie manchmal ganze Tage lang auf dem Sofa versumpfte und mit einer Flasche Schnaps redete, dass ihre blondierten Haare den Ausguss der Dusche verstopften und sie immer wieder sein Handy benutzte, ohne ihn vorher zu fragen – was schwerer wog als ihre wenigen Vorzüge. Patrick wünschte sich manchmal, dass Jacky nicht seine Mutter wäre. Er schämte sich, wenn sie ihn von der Schule abholte und argwöhnte, dass sich seine Mitschüler heimlich über ihre Massigkeit lustig machten. Oder über ihren auffälligen Schmuck, wie die überlangen goldenen Ohrringe, die ihr bis auf die Schultern baumelten. Manchmal stellte er sich vor, dass Jacky ihn womöglich irgendwo gefunden oder sogar entführt hatte, als er als Baby versehentlich von seiner wahren Mutter in einem Kinderwagen vor einem Einkaufszentrum zurückgelassen worden war. Tatsache war, dass ihre blonden Locken nicht echt waren, Patricks aber schon. Überhaupt konnte er nur wenige Gemeinsamkeiten zwischen sich und Jacky Heide feststellen.
Maxi Heide war hingegen ein großer athletischer und muskulös gebauter Mann, der sehr darauf bedacht war, sich gepflegt zu kleiden und sich gewählt auszudrücken. Nur durch Härte zu sich selbst konnte man im Leben bestehen, das war seine Auffassung. Darum stählte er seinen Körper nicht nur durch Bodybuilding, sondern auch durch tägliches Schwimmen im nahen Fluss und im Winter durch Eisbaden. Über die Jahre meißelte sich die Härte gegenüber den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen in Maxi Heides Gesichtszüge ein, so dass seine Mimik fast erstarrt war. Er hatte sein Jurastudium abgebrochen und verdiente sein Geld als Deutschlandvertreter einer asiatischen Firmengruppe mit einem sehr komplizierten Namen. Das war zumindest die Version, die er Patrick auftischte. Über seine wahren Geschäfte, oder besser Machenschaften, ließ Maxi seinen Sohn im Unklaren. Schwarz war seine Lieblingsfarbe, wie am Interieur seiner Wohnung unschwer zu erkennen war. So stand in seinem Wohnzimmer eine große schwarze Ledercouchgarnitur, das Bad war schwarz gefliest, die Betten im Schlafzimmer schwarz bezogen. Schwarz glänzte auch sein Auto, ein alter BMW, der, wenn er daheim war, vor seiner Reihenhaushälfte parkte. Seine Kleidung trug er meist ebenso uni schwarz. Allerdings zeigten die abstrakten Bilder an den Wänden schwarz-graue geometrische Muster. Maxi schätzte Strukturen, klare Linien und eindeutige Entscheidungen. Das war übrigens auch der Grund dafür, warum er Patrick das Schachspiel zum Geburtstag geschenkt hatte. Er hoffte die Gedanken seines Sohnes damit positiv zu beeinflussen, aus ihm einen Strategen zu machen, der in der Welt Schwarz und Weiß unterscheiden konnte und der sich nicht scheute eine Entscheidung zu treffen und klare Anordnungen dem Chaos im Leben vorzog.
Von Temperament konnte man bei Maxi Heide im Alltag eigentlich gar nicht reden. Er war ein blasser Mann Marke Schlaftablette, der nur dann redete, wenn er wirklich etwas Wichtiges mitzuteilen hatte, was nach Ansicht von Jacky Heide nie der Fall war, und der seine spärlichen Einwürfe stets in überaus korrektem Hochdeutsch zu Gehör brachte. Das verwaschene Hessisch seiner Noch-Ehefrau konnte er ebenso wenig ausstehen wie ihre signalrot lackierten Finger- und Fußnägel.
Was Patrick an seinem Vater mochte, war, dass er trotz seines fehlenden Temperaments auf der Autobahn mit dem BMW wie mit einem frisierten Rennwagen dahinraste, dabei riskante Spurwechsel und Überholmanöver nicht scheute, so dass selbst Formel-1-Fahrer vor Neid erblasst wären, ohne dass man ihm den winzigsten Funken Erregung, Nervosität oder Freude anmerken konnte. Außerdem mochte er, dass sein Vater nie klamm war und ihm ein großzügiges Taschengeld zahlte, sowie seinen Aufräumfimmel, der sich als überaus praktisch erwies, da Patrick selbst nie Lust hatte, sein Zimmer sauberzumachen.
Nicht leiden konnte Patrick an seinem Vater, dass er häufig die Badezimmertür nicht richtig zumachte, wenn er zum Pinkeln ins Bad ging, meist fast die ganze Nacht über an seinem Laptop saß und dabei nicht angesprochen werden wollte und manchmal für ganze Nächte verschwand. Außerdem vergaß er oft für Patrick Essen zu machen. Die Stullen für seine Brotdose für die Schule musste Patrick sich schon seit der ersten Klasse selber schmieren, falls er bei seinem Vater wohnte, wenn er nicht jeden Tag mit Milchschnitte und anderen Süßigkeiten, die seine Mutter in großen Mengen im Vorratsraum ihrer Haushälfte bunkerte, zum Unterricht gehen wollte.
Sehr selten erlebte er, dass sein Vater die Kontrolle verlor, wie an jenem Tag, als er seiner Noch-Ehefrau einen Fausthieb ins Gesicht verpasste. In ihm schlummerte ein Tier, aber Patrick war sich nicht sicher, welche Art von Tier dies war. Ein Murmeltier vielleicht oder doch ein Schwarzer Panther? Lauerte da in seinem Inneren ein unheimliches Monster, das nur des Nachts zum Vorschein kam, wenn er verschwand und wenn Patrick schon schlief?
Da Maxi so wortkarg war und auch seine Mimik für gewöhnlich nichts über seinen Gemütszustand verriet, konnte man sich nie sicher sein, woran man war. Als bei den Mädchen in Patricks Klasse das Vampirfieber ausbrach, fragte Patrick sich eine Zeitlang tatsächlich, ob sein Vater überhaupt ein Mensch war oder vielleicht doch einer dieser Blutsauger. Die fahle Haut, das Wachsein des Nachts, der Wunsch, nahezu die ganze Wohnung mit schwarzen Möbeln auszustatten, die schwarze Kleidung, dicke Vorhänge vor den Fenstern, damit möglichst wenig Sonnenlicht ins Innere der penibel aufgeräumten Haushälfte drang und nicht zuletzt der starre, durchdringende Blick. Wenn Maxi Heide seinen Sohn schweigend musterte, waren seine Pupillen vollkommen reglos. Sie wanderten nicht von den Augen zur Stirn, zum Mund, wieder zu den Augen und so weiter, sondern waren unentwegt geradewegs auf Patricks Pupillen gerichtet, so als würde er bis in sein Gehirn starren.
Eines Tages hatte Patrick sich darum genötigt gefühlt ein für alle Mal festzustellen, ob sein Vater menschlich war oder nicht, und zwar mit dem Blutbeweis. Als bei den Mädchen in seiner Klasse das Vampirfieber ausgebrochen war, hatte Patrick aufgeschnappt, dass Vampire zwar Blut tranken, aber in ihren eigenen Adern und Venen kein Blut floss. Er prüfte diese Behauptung nicht weiter nach, weil es ihm auch so einleuchtend erschien. Andernfalls könnten Vampire sich ja aus ihren eigenen Venen ernähren und bräuchten dafür keine Menschen. Blut dürfte demnach nur in ihrem Magen und Darm zu finden sein, mutmaßte Patrick, ehe sie es sich endgültig einverleibten. Pinkelten Vampire Blut? Vielleicht nur die weißen Blutkörperchen, weil sie die roten verdauten? Als Patrick diese Frage einem Mädchen aus seiner Klasse stellte, und er war tatsächlich an ihrer ehrlichen Meinung interessiert, schrie sie entsetzt auf und verzog angewidert das Gesicht.
„Vampire pinkeln gar nicht, merk dir das!“, hatte sie geschrien und war entrüstet weggelaufen.
Doch Patrick überzeugte das nicht.
Als Maxi Heide eines Abends gemeinsam mit seinem Sohn Gemüse schnitt und Patrick das große scharfe Küchenmesser in der Hand hielt, um einen Kohlrabi zu zerteilen, sah er seine Chance für den Blutbeweis gekommen. Als Maxi, abgelenkt vom Klingeln der Eieruhr, für einen kurzen Moment nicht auf das Schneidebrett vor ihm sah, zog Patrick die scharfe Klinge wie versehentlich über den Handrücken seines Vaters. Maxi Heide schrie nicht auf. Er zog auch nicht die Hand reflexartig zurück, sondern sah seinen Sohn nur reglos an. Patrick beteuerte, dass er aus Versehen beim Kohlrabischneiden abgerutscht sei, konnte seine Erleichterung aber kaum verbergen, als er interessiert auf die Blutstropfen starrte, die aus der hauchdünnen Wunde herausliefen. Maxi Heide hatte die Hand an den Mund geführt und das Blut mit geschlossenen Augen abgeleckt. Patrick meinte in seinem Gesicht so etwas wie Genuss ablesen zu können, was ihn wiederum verunsicherte. Schließlich holte sich sein Vater aber ein Pflaster und das Thema Vampir war für Patrick zunächst erledigt.
Man könnte sich darüber wundern, wieso ausgerechnet Maxi und Jacky Heide zusammengefunden und auch noch entschieden hatten, ein Kind in die Welt zu setzen. Genaugenommen hatte dies aber nur Jacky Heide entschieden. Kurz nachdem sie Maxi kennengelernt hatte, präsentierte sie ihm bereits einen gewölbten Babybauch. Obwohl Maxi nicht hundertprozentig davon überzeugt war, dass das Kind tatsächlich von ihm war, ließ er die Forderung nach einem Vaterschaftstest schnell fallen, nachdem Jacky ihn mit einer Kaffeetasse beinahe an der Stirn erwischt hatte. Da er zu diesem Zeitpunkt noch in sie vernarrt war und nicht auf sie verzichten wollte, blieb ihm also nichts anderes übrig, als Jacky zu heiraten. Das hatte nichts mit gesellschaftlichen Konventionen oder altmodischen Vorstellungen zu tun, wie etwa der, Jackys Ansehen als ehrbare Frau nicht in Verruf zu bringen. Selbst mit Ring am Finger würde niemand auf die Idee kommen, Jacky als „ehrbar“ zu bezeichnen. Seiner Umwelt eine heile Welt vorzugaukeln hatte ihm nie etwas bedeutet. Doch Jacky ließ ihm gar keine Wahl. Das Aufgebot war schon bestellt, bevor er ihr überhaupt einen Antrag machen konnte. Sie hatte ihn mit ihrem dicken Babybauch zum Standesamt gezerrt, und dies war durchaus wörtlich zu verstehen. Bevor er auch nur den Versuch machen konnte, etwaigen Widerspruch geltend zu machen, steckte schon ein goldener Ring an seinem Finger, den Jacky mit seiner Kreditkarte gekauft hatte.
Ihr (möglicherweise) gemeinsamer Sohn Patrick war inzwischen zwölf Jahre alt und wurde in der Schule fälschlicherweise für nicht besonders clever gehalten. Das lag zum einen daran, dass er ziemlich schweigsam war und darum in fast allen Fächern im Mündlichen höchstens bei einer Vier landete. Diese Tatsache reichte Jacky übrigens als Beweis dafür, dass Maxi Heide der Vater von Patrick sein musste. Von ihr könne er diese Mundfaulheit jedenfalls nicht haben. Und zum anderen unterstellte man es ihm deshalb, weil er oft Dinge tat, die seinen Mitschülern und auch seinen Lehrern recht merkwürdig vorkamen. Als die Kinder beispielsweise einmal ein Foto von ihrem Haustier mit in die Schule bringen sollten, hatte sich Patrick, um diese Hausaufgabe zu erfüllen, eine halbe Nacht auf die Lauer gelegt, um ein Eins-a-Foto von einer Küchenschabe zu schießen. Eine Nahaufnahme, auf der alle Details ihrer Anatomie erkennbar waren. Weder die Lehrerin noch seine Schulkameraden hatten allerdings ein gutes Wort für seinen genialen Beitrag übrig. Er wurde, wie so oft, von der Lehrerin getadelt und von den anderen Kindern ausgelacht und fortan Kakerlake gerufen.
Aber die Wahrheit über Patrick Heide war, dass er ein brillanter Erfinder war. So hatte er, um die Küchenschabe fotografieren zu können, einen eigens entwickelten Bewegungsmelder unter dem Küchenschrank installiert, der mit dem Auslöser seiner Kamera verbunden war. Denn jeder weiß, dass Schaben nicht nur nachtaktiv, sondern auch extrem flink und darum gar nicht so leicht zu erwischen sind. Schon alleine für dieses Arrangement hätte er eine Eins verdient, bekam aber eine Fünf, vor allem weil er in dem Aufsatz über sein Haustier schrieb, dass er sich Küchenschaben stärker verbunden fühle als der Katze seiner Mutter, weil diese Insekten die gleichen Lebensmittel bevorzugten wie die Menschen. Auch hierzu hatte Patrick Experimente gemacht und herausgefunden, dass Schaben Brot mit Nussnougatcreme viel lieber mochten als zum Beispiel Salatgurke.
Später fand er aber heraus, dass diese Krabbeltierchen nicht nur Lebensmittel verputzten, sondern fast alles, was ihnen vor die scharfen Mundwerkzeuge kam, egal ob Teppichreste, Holzspäne oder Apfelkerne, einschließlich ihrer eigenen Artgenossen. Da hatte er seine Fünf aber schon kassiert. Die Kakerlaken faszinierten ihn derart, dass er welche einfing (mit einer selbstkonstruierten speziellen Schabenfalle, die er an den Bewegungsmelder koppelte, den er erfunden hatte), um sie in seinem Kinderzimmer zu züchten und besser beobachten zu können. Mit Erstaunen nahm er zur Kenntnis, wie rasant sich Schaben vermehrten. Sein Biolehrer wäre stolz auf ihn gewesen, wenn er davon gewusst hätte. Natürlich verwahrte Patrick seine Schabenzucht im Kinderzimmer in Mama Jackys Haushälfte, denn Papa Maxi hätte in seiner Hälfte die Zucht sofort entdeckt und den Kammerjäger geholt, penibel wie er war. Jacky hingegen betrat Patricks Zimmer so gut wie nie.
Er stellte mit den Schaben allerhand Versuche an. So bestrahlte er sie zum Beispiel über mehrere Stunden mit dem grellen und heißen Licht seiner Nachttischlampe, um zu prüfen, wie sie sich bei Helligkeit und Hitze verhielten und wie lange es dauerte, bis sie anfingen zu dampfen und schließlich starben. Darüber führte er sorgfältig Buch und schoss Fotos.
Patrick führte diese Experimente allerdings nicht in erster Linie durch, weil es ihm gefiel, diesen harmlosen kleinen Tierchen Schmerzen zuzufügen, sondern aus rein wissenschaftlichem Interesse. Wie sich die Tiere beim Sterben verhielten, faszinierte ihn genauso wie ihr Paarungsverhalten. Dabei stellte er interessiert fest, dass bei der Begattung zuerst das Weibchen auf den Rücken des Männchens kletterte, und nicht etwa umgekehrt, und dass das Männchen dann das Weibchen von unten mit seinen hakenförmigen Genitalien ergriff, wobei das Weibchen von seinem Rücken fiel. Die beiden Krabbeltierchen waren dann in entgegengesetzter Richtung mit den Hinterteilen aneinandergekoppelt.
Es hatte einige Zeit gedauert, bis Patrick sicher wusste, was Männlein und was Weiblein war. Wenn es zur Paarung kam, stand Patrick mit einer Stoppuhr daneben und dokumentierte, wie viele Weibchen ein Männchen in einer Stunde begatten konnte und wie lange ihr Liebesspiel dauerte. Manchmal gab es ganze Paarungsketten, also mehrere Tiere, die sich gleichzeitig fortpflanzen wollten. Die reinste Orgie! Mit einem Seziermesser schnitt er manchmal Weibchen auf, um mit Hilfe einer Lupe die Brutkammer in ihrem Leib genauer zu betrachten.
Auch wenn von diesen Tierquälereien niemand in der Schule wusste, galt Patrick in seiner Klasse als Sonderling mit unterirdischem IQ, der noch dazu als „in seinem Sozialverhalten bedenklich“ galt, wie seine Klassenlehrerin Maxi Heide bei einem Elternsprechtag einmal unverblümt vorgehalten hatte.
Patrick hatte keine Freunde und noch dazu einen gewissen Hang zur Hinterlist, wenn es darum ging, es Schulkameraden heimzuzahlen, die ihn ausgelacht hatten. Normalerweise wurde er bei seinen Gemeinheiten nicht entdeckt, oftmals wurde sogar ein anderes Kind statt seiner bestraft, aber eines Tages war er doch erwischt worden, als er in den Sportschuh eines anderen Jungen kurz vor der Turnstunde heimlich Sekundenkleber spritzen wollte. Man hätte das für einen relativ harmlosen oder zumindest unbedachten Streich eines Heranwachsenden halten können, aber Patrick Heide hatte heimlich tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass ebendieser Klassenkamerad barfuß in den Schuh steigen würde, wie er es oft tat – schließlich war Sommer und die wenigsten trugen Socken –, und sein Fuß dank des Sekundenklebers dermaßen stark am Schuh festkleben würde, dass er durch eine schmerzhafte Operation im Krankenhaus entfernt werden müsste.
Das war die Art von Rache, die Patrick gefiel.
Er identifizierte sich also nicht von ungefähr mit den Bauern auf seinem Schachbrett, die nur scheinbar so unauffällig dastanden, so ausgeliefert und dumm wirkten, aber plötzlich nach rechts und links schlagen konnten. Was ihn an deren Rolle in dem Spiel allerdings störte, war die Tatsache, dass Bauern immer wieder geopfert wurden, wenn es dem höheren Ziel diente, also dem Schutze des langweiligen Königs.
Abgesehen von solchen Ausrutschern wie dem Mitbringen des Fotos der Küchenschabe in die Schule und der Hinterhältigkeit mit dem Sekundenkleber im Turnschuh gelang es Patrick ganz gut, nicht weiter aufzufallen. So fühlte er sich als einer unter vielen. Zumindest bildete er sich das ein. Würde man seine Klassenkameraden fragen, würden sie ihn wohl eher als Außenseiter bezeichnen, der nirgends dazugehörte. Eine bereits geschlagene Schachfigur, die irgendwo unbeachtet neben dem Spielbrett lag. Vorausgesetzt einer seiner Klassenkameraden wäre überhaupt in der Lage, Schach zu spielen, was Patrick bezweifelte.
Patrick verbrachte seine Freizeit viel in freier Natur. Häufig lief er von zuhause quer über die Felder bis in den Wald. Unter einer Wurzel eines umgestürzten mächtigen Baumstumpfes hatte er sich ein geheimes Versteck eingerichtet. Dort vergrub er einige ihm wichtige Habseligkeiten und konnte außerdem andere Krabbeltiere und Würmer bestens beobachten und ungestört seinen Gedanken nachhängen. Manchmal nahm er auch sein Schachspiel mit und spielte eine Partie gegen sich selbst. Er fühlte sich nie einsam und sehnte sich auch nicht nach der Gesellschaft eines anderen Kindes in seinem Alter. Die Käfer, Würmer und Nacktschnecken reichten ihm vollkommen als stumme Gesellschafter bei seinem Spiel.
4.
Pedro Ruiz blinzelte. Eine grelle Neonröhre direkt über seinem Gesicht war das Erste, was er nach dem Erwachen aus seiner Ohnmacht wahrnahm. Sofort schloss er die Augen wieder. Gleichzeitig spürte er starke Kopfschmerzen. Als hätte ihm jemand auf diese Seite des Kopfes geschlagen, pochte der Schmerz besonders in der linken Kopfhälfte. Wieder blinzelte er und versuchte in der liegenden Stellung, in der er sich befand, gleichzeitig Arme und Beine zu bewegen. Doch es gelang ihm nicht. Er konnte weder seine Arme anheben noch die Beine anziehen. Immerhin – mit den Fingern konnte er greifen. Angestrengt versuchte Pedro herauszufinden, wo er war und was passiert sein mochte. Doch in seinem Kopf war nur Leere. War er in Argentinien? Er versuchte den schmerzenden Kopf zu drehen. Doch ebenso wenig wie seine Arme und Beine konnte er seinen Kopf bewegen. Endlich begriff er. Sein Körper war fixiert. Bei dem Versuch, seinen Kopf zu bewegen, hatte er einen Riemen gespürt, der über seine Stirn gespannt war. Als er die Augen vorsichtig wieder öffnete, sah er wieder das gleißende Licht. Die Neonröhre hing von einer grauen Steindecke herab. Weitere Details seiner Umgebung konnte er nicht erkennen. Er lauschte und meinte ein tropfendes Geräusch zu vernehmen. Ja, jetzt hörte er das Tropfen ganz deutlich, sanft und gleichmäßig fielen irgendwo Tropfen von Feuchtigkeit auf den Boden. Sein Mund war ganz trocken. Was würde er jetzt für einen Schluck Wasser geben.
Plötzlich hörte er eine Tür schlagen und dann aus seitlicher Richtung die Stimme eines Mannes, der auf Spanisch sagte: „Ach, sieh an, unser südamerikanischer Tourist ist aufgewacht.“
Pedro kannte die Stimme nicht. Redete der mit ihm? War hier jemand? Er hörte, wie sich ihm Schritte näherten, dann beugte sich ein Gesicht über seines. Noch völlig geblendet sah er in einem Sekundenbruchteil nur die Umrisse eines massigen Kopfes, dessen Konturen das weiße Licht wie ein leuchtender Heiligenschein umgab. Ehe Pedro in der Lage war, das Gesicht des Mannes zu fixieren, zog dieser, so schnell, wie er sich über Pedro gebeugt hatte, den Kopf wieder zurück und das grelle Licht blendete ihn erneut ungeschützt.
„Also, Ruiz, machen wir es kurz. Wo ist das Schließfach und wie lautet der Code?“, fragte eine andere Stimme. Sie war höher als die des Mannes, der sich eben über ihn gebeugt hatte.
„Ich verstehe nicht“, stammelte Pedro mit trockener Kehle. Seine Stimme klang heiser.
„Er versteht nicht. Hast du das gehört?“, meinte der mit der höheren Stimme. „Ja, dann wollen wir dem Jungen mal auf die Sprünge helfen!“
Die Pritsche, auf der Pedro festgeschnallt war, senkte sich plötzlich am Kopfende. Die Schmerzen im Kopf nahmen sofort zu, je höher die Beine lagen. Die dunkle, bärenhafte Gestalt erschien wieder über ihm. Pedro erkannte eine Gießkanne in der Hand des Hünen, die der Mann jetzt über sein Gesicht emporhob.
„Aufwachen!“, rief er und schüttete das Wasser mit einem Schwall über Pedros Stirn. Die Kühle des Wassers tat seinem Kopf gut, sofort wurde er munterer. Als der Wasserstrahl sich allerdings über seinen Mund und seine Nase ergoss, verschluckte Pedro sich und musste husten. Nur wenige Tropfen waren in seine Luftröhre gelangt, aber da seine Füße höher lagen als der Kopf und er ihn auch nicht zur Seite drehen konnte, gelang es ihm nur schwer, die Tröpfchen auszuhusten.
„Das war eine schöne Erfrischung, oder?“, fragte der Bär höhnisch.
Pedro prustete noch immer und atmete schwer.
Und der mit der hohen Stimme fügte hinzu: „Ein schöner Vorgeschmack auf weitere Erfrischungen!“
Damit verließen die beiden den Raum und Pedro blieb allein zurück. Das Wasser tropfte von seinen Haaren, auch im Ohr hatte er Wasser, das er nicht herausschütteln konnte.
Pedro dämmerte allmählich, worum es den beiden offensichtlich ging. Sie wollten den Code für das Schließfach mit den Unterlagen seines Vaters aus ihm herauspressen. Von der Existenz eines solchen hochbrisanten Schließfachs hatte ihm sein Vater vor einiger Zeit erzählt. Doch den Code kannte Pedro nicht und er wusste auch nicht, wer ihn verwahrte. Langsam kam die Erinnerung zurück. Er war von Buenos Aires nach Frankfurt geflogen, um einen Freund aus Studententagen aufzusuchen. Jemand, bei dem er bleiben konnte, der keine unnötigen Fragen stellte. Er hatte Marc damals an der Uni in Frankfurt kennengelernt, als er für ein paar Semester in Deutschland studierte. Zwischen den beiden jungen Männern hatte sich eine Freundschaft entwickelt. Pedro wollte zu Marc, um bei ihm unterzutauchen. Marc arbeitete inzwischen als Arzt in einer Klinik im Taunus in der Nähe von Wiesbaden. Daran hatte Pedro gedacht, als er nach einem Zufluchtsort suchte, an dem er ungestört sein weiteres Vorgehen überdenken konnte und der weit genug von der Einflusssphäre seines Vaters entfernt lag. Obwohl er Argentinien liebte, konnte er die Nähe zu seinem Vater in letzter Zeit kaum mehr ertragen. Das war nicht immer so. Pedro war seit Kurzem für ihn tätig. Er sollte sein Nachfolger werden, hatte viele geschäftliche Dinge für ihn erledigt. Bis er letzte Woche hinter ein paar unschöne Machenschaften gekommen war. Er hätte nie gedacht, dass sein Vater einer von den Leuten war, die andere rücksichtslos ausbeuteten und über Leichen ging. In dem Schließfach lagen wichtige Unterlagen zu einem großen Bauprojekt und wahrscheinlich auch Beweise für Korruption und Bestechung, die ihm zu diesem und anderen Aufträgen verholfen hatten. Genau wusste Pedro es nicht. Er kannte weder den Code, noch wusste er, an welchem Ort sich das Schließfach befand. Was wollten diese Leute also von ihm?
Pedro musste pinkeln. Obwohl sein Mund ausgedörrt war und er vor Trockenheit kaum mehr schlucken konnte, war seine Blase voll. Was würden sie mit ihm anstellen? Er musste zur Toilette, er hatte Durst und Hunger.
Pedro wusste nicht, wie lange er schon auf der Pritsche lag. Seine Peiniger hatten sich längere Zeit nicht blicken lassen. Da seine Füße noch immer höher gelagert waren als sein Kopf, waren die Schmerzen kaum mehr auszuhalten. Jetzt erinnerte er sich auch wieder an seine Ankunft in Frankfurt und an die beiden Männer im Taxi. Wahrscheinlich hatten sie ihm eins übergezogen, damit er das Bewusstsein verlor. Das erklärte auch die Schmerzen am Kopf. Endlich öffnete sich die Tür wieder, die außerhalb seines Blickfelds lag, und er hörte, dass die beiden Männer zurückkamen. Ihre schweren Schritte hallten auf dem Steinboden.
„Und, Ruiz?“, fragte der Bärige und beugte sich wieder über Pedro. „Ist dir inzwischen etwas eingefallen?“
„Über ein Schließfach verfüge ich nicht, und falls Sie ein Schließfach meinen, das meinem Vater gehört: Wo es sich befinden könnte, weiß ich nicht, und den Code kenne ich ebenfalls nicht“, entgegnete Pedro mit schwacher Stimme aufrichtig.
„Tatsächlich? Und das soll ich dir glauben? Ich habe mit deinem Vater noch ein paar Rechnungen offen. Er gehört ja nicht zu den zimperlichen Menschen.“
Das wusste Pedro auch, selbst wenn ihm erst in den letzten Wochen klar geworden war, wie brutal sein Vater sein konnte, wenn er seine Interessen durchsetzen wollte. Der Bär beugte sich wieder über ihn. Diesmal kam er ihm mit seinem Gesicht ganz nah, so dass Pedro seinen fauligen Atem riechen konnte.
„Ich halte mich nicht lange mit dir auf. Du kannst selbst entscheiden, ob du mir die Informationen, die ich brauche, jetzt gibst oder später. Naja, falls du später noch reden kannst.“
„Ich weiß nichts“, stotterte Pedro, „wirklich. Ich habe den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen.“
Der Hüne antwortete nicht, sondern schlug stattdessen eine seiner Pranken mit Wucht auf die Pritsche direkt neben Pedros Ohr. Der Knall ließ Pedro zusammenzucken.
„Musik, wenn ich bitten darf“, sagte der Mann leise. Fast augenblicklich dröhnte ohrenbetäubende harte Heavy-Metal-Musik aus einem Lautsprecher, der direkt unter der Pritsche stehen musste. Der brüllende Gesang fuhr Pedro sofort in die Glieder. Die Pritsche schien zu vibrieren.
„Ich weiß wirklich nichts!“, schrie Pedro durch den Lärm. Doch da legte der Mann schon ein weißes Tuch über seinen Mund und seine Nase. Der Stoff des Tuches fühlte sich weich an, doch Pedro beschlich eine Ahnung und Angst krampfte ihm die Brust zusammen. Er hatte davon gehört, welche Art Tortur ihm nun bevorstehen mochte. Er sah die Gießkanne über sich schweben und das konzentrierte Gesicht des Bären.
Die hohe Stimme des anderen übertönte die Musik: „Fang an mit 15/30.“
„Geht klar.“
Dann neigte der Riese die Gießkanne und der kalte Schwall ergoss sich über Pedros Gesicht. Das Tuch wurde augenblicklich schwer und nass. Es klebte an seiner Haut fest, verstopfte Nase und Mund. Das Wasser lief ihm weiter über das Gesicht und spritzte ihm in die Augen. Pedro würgte. Sie würden ihn auf diese Art ertränken. Jetzt musste er die Kontrolle über seine Lebensfunktionen behalten, er durfte nicht in Panik ausbrechen, versuchte er sich zu beruhigen. Luft anhalten, nicht atmen. Doch der Reflex, Luft zu holen, wurde stärker und stärker und immer weiter klatschte das Wasser auf das Tuch auf seinem Gesicht. Das Bedürfnis zu atmen war nicht mehr zu unterdrücken. Alles krampfte sich in ihm zusammen, seine Hände begannen unkontrolliert zu zucken. Dann war es plötzlich vorbei. Das Tuch wurde von seinem Gesicht genommen. Pedro schnappte nach Luft. Die Musik, wenn man sie so nennen konnte, dröhnte weiter.
„Und?“, fragte der Mann interessiert. „Du hast jetzt genau dreißig Sekunden Zeit, mir zu sagen, wo das Schließfach ist.“
Pedro konnte den Reflex nicht mehr unterdrücken, seine Blase entleerte sich schwallartig.
„Pisst er sich jetzt schon in die Hose?“, hörte er die hohe Stimme.
„Dreißig Sekunden sind um“, mit diesen Worten legte der Mann erbarmungslos erneut das Tuch über Pedros Gesicht.
5.
Im Haus neben den Heides wohnte Vera Schmidt. Ihre Tochter Sophie ging in Patricks Parallelklasse und war ebenfalls zwölf Jahre alt. Sophie hatte Patrick schon des Öfteren mit einer bunten Plastiktüte unter dem Arm über die Felder in Richtung Wald laufen sehen. Aus Neugier entschloss sie sich eines Tages ihm nachzugehen. Sophie und Patrick hatten bis zu diesem Tag noch fast kein Wort miteinander gewechselt. Sie hatten zwar denselben Schulweg und manchmal liefen sie in nur wenigen Meter Abstand hinter einander her, aber Sophie fand Patrick unheimlich, denn sie hatte schon einige Anekdoten auf dem Pausenhof über ihn aufgeschnappt und seine Eltern wirkten auch nicht gerade wie normale Menschen, mit denen man gerne zu tun haben möchte.
Patrick interessierte sich noch nicht für Mädchen, auch wenn er Sophie manchmal vom Fenster aus beobachtete, wenn sie mit ihren Freundinnen auf der Kardünstraße herumlungerte. Dies tat er aber eher aus Langeweile. Überhaupt konnte er sich für gar kein anderes menschliches Wesen besonders erwärmen.
„Das ist jetzt nicht dein Ernst!“, fauchte Vera Schmidt ihre Tochter an und warf deren Deutschheft auf den Wohnzimmertisch. „Das kannst du gleich alles nochmal abschreiben!“
Sophie stieg die Zornesröte ins Gesicht und sie erwiderte trotzig: „Das kannst du vergessen! Diese bescheuerten Hausaufgaben gehen mir sowas von auf den Keks!“ Sie stampfte mit dem Fuß auf und griff nach ihrem Heft.
Aber ihre Mutter war schneller und schnappte es sich: „Du schreibst das jetzt alles nochmal sauber ab. So ein Geschmiere! Und der Text ist voller Fehler!“
Mit einem Kugelschreiber begann Vera nun die Fehler in Sophies Abschrift dick anzustreichen. Wütend versuchte Sophie ihr das Heft aus der Hand zu reißen.
„Das mache ich auf keinen Fall!“, schrie sie.
Doch ihre Mutter ließ das Heft nicht los und mit einem leisen Ratsch riss die aufgeschlagene Heftseite entzwei.
„Du bist so gemein!“, brüllte Sophie. „Jetzt ist mein Heft zerrissen! Das wolltest du so, oder? Nur damit ich in der Schule Ärger bekomme!“
Sie biss die Zähne zusammen und stampfte in Richtung Garderobe. Hier warf sie sich eine Jacke über, schlüpfte in ihre Schuhe und schmiss die Haustür mit einem heftigen Knall hinter sich zu. Mit verschränkten Armen blieb sie einen Moment auf dem Treppenabsatz vor dem Haus stehen und versuchte sich zu beruhigen. Was bildete sich ihre Mutter bloß ein? Diese dämliche Hausaufgabe war doch gar nicht wichtig. Auf keinen Fall würde sie den Text nochmal abschreiben, nur wegen ein paar Fehlern! Da entdeckte sie plötzlich Patrick in der Ferne. Es war ein diesiger Tag. Der Nebel hing dicht über dem Boden. Und doch konnte sie erkennen, dass er seine bunte Tüte unter dem Arm trug. Was hatte er vor? Schnell lief er damit über das Feld in Richtung Waldrand. Kurzentschlossen schlug Sophie denselben Weg ein, ohne zu wissen, warum sie das tat, und ohne eine bestimmte Absicht. Sie wollte einfach nur weg von zu Hause!
Vera Schmidt fühlte sich hilflos. Die Mittdreißigerin hatte sich erst vor wenigen Wochen von Sophies Vater getrennt. Sie würden sich scheiden lassen, das stand fest. Es war eine schmerzhafte Trennung für alle drei gewesen. Jetzt saß sie mit hängenden Schultern zusammengesunken auf dem Sofa und vergrub ihren Kopf in den Händen. Es hat keinen Sinn, Sophie nachzulaufen, dachte sie, wenn Sophie einen ihrer Wutausbrüche hat, ist es besser, sie für eine Weile in Ruhe zu lassen. Auch wenn es Vera schwer fiel, zügelte sie sich und zwang sich, ihre Tochter nicht zurückzuholen. Sophie war der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Die letzten Monate waren für alle Beteiligten die reinste Hölle gewesen.
Vera hatte schon seit Jahren den Verdacht gehabt, dass mit ihrem Mann etwas nicht in Ordnung war, weil er sich rigoros dem Sex mit ihr entzog und auch nicht an der kleinsten Zärtlichkeit Interesse zeigte. Bereits kurz nach Sophies Geburt hatte er ihr mitgeteilt, dass ihm ihre Küsse unangenehm waren und er es von nun an unterlassen würde, sie mit seinen Lippen zu berühren. Küssen sei eine Erfindung von Frauen, versuchte er sich zu rechtfertigen, die für Männer vollkommen überflüssig sei. Er hatte das feiner ausgedrückt, das Wort „unangenehm“ war nicht gefallen, aber Vera fühlte sich als Frau gedemütigt. War er durch Sophies Geburt traumatisiert worden? Im Kreißsaal hatte er ihr beigestanden und wirkte glücklich, als sie Sophie in den Armen hielten. Hatte der Anblick von Fruchtwasser, Blut und Kä-seschmiere ihn so verändert? Oder machte ihm die Eifersucht gegenüber seiner Tochter zu schaffen, die naturgemäß nun im Mittelpunkt von Veras Leben stand? Mit der Zeit bildete sie sich immer mehr ein, dass er sie als Person im Ganzen ablehnte, was er so aber nicht bestätigen wollte. Vera hatte seine Kussphobie nicht verstanden und zunächst auch nicht akzeptiert. Doch er wies sie so bestimmt zurück, wann immer sie versuchte, sich ihm mit ihren Lippen zu nähern, dass sie es bald unterließ. Die wenigen Male, die sie, jeweils im Abstand von mehreren Monaten, in den folgenden Jahren noch Sex hatten, fühlten sich für Vera rein mechanisch an. Ein Akt, der vollzogen wurde, weil es irgendwie zu einer Ehe dazugehörte. Sie empfand dabei wegen seiner Kühle keine besondere Verbundenheit oder emotionale Nähe zu ihm. Eines Abends saß sie mit einem guten Freund nach der Arbeit zusammen in einer Kneipe. Sie genossen ein paar Gläschen Wein und plötzlich hatte Vera das Bedürfnis, sich ihm anzuvertrauen.
„Dass es nach der Geburt von Kindern im Bett nicht mehr klappt, geht doch fast allen so“, meinte er und fügte lachend hinzu, „da müsst ihr eben mehr üben, damit wieder Schwung in die Ehe kommt!“
Doch Vera konnte darüber nicht lachen. Ihr stand der Sinn nicht nach üben.
„Er will immer nur von hinten, wenn überhaupt. Ich verstehe das gar nicht“, entgegnete sie resigniert, „früher war er so kreativ und hat mir auf so viele Arten gezeigt, dass er mich will.“
Ohne weiter über seine Worte nachzudenken, erklärte ihr Freund: „Für Männer ist es in dieser Stellung einfacher, sich eine andere Frau vorzustellen. Da sieht er dein Gesicht nicht vor sich.“
Vera brach von einer Sekunde auf die andere in Tränen aus. Die Vorstellung, dass Stefan an eine andere dachte, wenn er mit ihr schlief, verletzte sie und der Wein tat sein Übriges, um einen ganzen Schwall Emotionen loszutreten, der sich in ihr im Laufe der Jahre angestaut hatte.
Nach einigen weiteren Gläsern versiegten ihre Tränen schließlich und sie entschied: „Das tue ich mir nicht mehr an!“