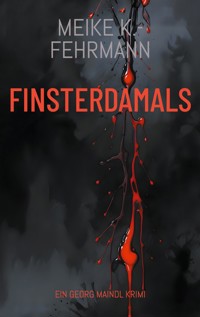
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine alte Frau mit Demenz. Ein Kommissar mit Heimweh. Ungeklärte Todesfälle - und ein Geheimnis, das zu lange verborgen blieb. Frieda hat Alzheimer. Als ihre Haushälterin zu Tode kommt, muss sie ihr vertrautes Zuhause im Geranienweg verlassen und in ein Pflegeheim ziehen. Dort hält die agile Dame nicht nur die Pflegekräfte und ihre Mitbewohner auf Trab, sondern auch die Polizei. Denn während die Beamten nach einem Brandanschlag im Heim ermitteln, verschwindet Frieda auf mysteriöse Weise spurlos. Georg Maindl, der ermittelnde Hauptkommissar, ist gerade frisch aus seiner oberbayerischen Heimat nach Wiesbaden gezogen. Gestresst von der Hektik der betriebsamen Rhein-Main-Region und von Heimweh geplagt, muss er auch noch einen weiteren Mordfall aufklären: Auf einem Aussiedlerhof am Rande des Taunus wurde ein alter Mann auf grausame Weise hingerichtet. Eine bei der Leiche gefundene Botschaft weist zurück auf längst vergangene Ereignisse zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Nur Frieda kennt die fehlenden Puzzleteile. Zwischen Vergessen und Erinnern, Wahrheit und Wahnsinn, entpuppt sie sich als unerwartete Schlüsselfigur - voller Witz, Instinkt und einem tiefen Gespür für menschliche Abgründe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel 16.
Kapitel 17.
Kapitel 18.
Kapitel 19.
Kapitel 20.
Kapitel 21.
Kapitel 22.
1.
Es dauert nicht mehr lange. Er muss gleich kommen. Diese faltigen Hände auf der Fensterbank. Sind das meine? Nein, das sind nicht meine. Das sind die Hände einer alten Frau. Ich bin noch jung. Meine Kindheit war schön, so schön. Dann kam der Krieg. Die Einfahrt liegt im Schatten. Ich sehe das Gesicht einer Greisin schemenhaft auf der Glasscheibe. Struppige weiße Haare. Das bin nicht ich. Bestimmt kommt er gleich. Ein Auto fährt in die Einfahrt und jemand steigt aus. Da ist sie wieder.
Diese Frau, sie kommt mir bekannt vor. War sie schon mal hier? Die Frisur, wie Lilo Pulver, derselbe Bubikopf, nur rot.
Meine Jugend war schön, aber dann kam der Krieg. Gleich muss Johann kommen. Die Frau ist an der Haustür.
„Frieda?“
Da ist sie schon in der Wohnung. Wie ist sie reingekommen?
„Frieda, was machst du denn da am Fenster? Schaust du nach dem Wetter?“ Die Frau fährt sich durch das gefärbte Haar.
Schweißperlen stehen auf ihrer Stirn. Sie spricht mit einem merkwürdigen, harten Akzent.
„Er kommt gleich.“
„Wer?“
„Er kommt gleich, Johann.“
„Ach Frieda, Johann ist schon lange tot, wann begreifst du das endlich?“
„Er kommt um diese Zeit immer von der Arbeit.“
„Setz dich aufs Sofa, ich habe dir Kuchen mitgebracht.“
Die Frau sieht mich an, als würden wir uns schon lange kennen.
Aber das stimmt nicht. Sie ist keine meiner Freundinnen. Ich habe eine Fremde in meine Wohnung gelassen. Papa hat gesagt:
Lass keine Fremden rein. Aber jetzt ist sie da. Sie stellt einen Teller auf den Tisch und legt ein Stück Kuchen darauf. Was soll ich tun? Ich könnte die Polizei rufen. Aber bis die da sind, hat sie mich bestimmt schon ausgeraubt. Die Kaffeemaschine gluckert in der Küche, dieser Duft! Der Kuchen sieht köstlich aus.
Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Sie ist in meiner Küche. Jetzt höre ich ihre Schritte im Flur näher kommen.
„Du stehst ja noch immer am Fenster.“
Vielleicht ist sie gefährlich. Ich setze mich lieber hin. Kirschkuchen. Wir hatten einen Kirschbaum im Garten, damals in Pommern. Er blühte so schön. Pommernland ist abgebrannt.
„Nimm dir ruhig. Warte, ich helfe dir. Du magst doch Kirschkuchen.“
Woher weiß sie das? Der Kuchen schmeckt. Ich werde Ärger bekommen. Ich darf von Fremden nichts annehmen. Vielleicht ist der Kuchen vergiftet. Die Frau isst selbst nicht davon. Aber etwas kommt mir an ihr doch bekannt vor. Es ist die Frisur.
Wie Lilo Pulver. Nur die Farbe stimmt nicht.
„Liselotte.“
„Bitte?“
„Liselotte.“
„Ich heiße Svetlana.“
Svetlana? Der Akzent. Russisch.
„Ich weiß“, entgegne ich vorsichtig. Russen soll man nicht reizen.
„Du machst mir manchmal Angst. Geht es dir gut?“
„Natürlich.“
„Gut.“
Sie schaut mich forschend an. Ihre wässrigen grünen Augen wirken übergroß in ihrem schmalen Gesicht.
„Ich habe einen Film gesehen. Mit Liselotte Pulver.“
„Ach so. Und ich dachte schon, du wüsstest meinen Namen nicht mehr. Wann hast du ihn gesehen?“
„Wen?“
„Den Film.“
„Vor kurzem.“
„Dein Fernseher ist doch kaputt.“
„Sie ist eine gute Schauspielerin.“
„Ja, welchen Film hast du denn gesehen?“
„Mit Lilo Pulver.“
„Sie hat in vielen Filmen mitgespielt.“
„Ja, sie ist eine gute Schauspielerin.“
„Sie lebt nicht mehr.“
„Wer?“
„Liselotte Pulver. Sie lebt nicht mehr.“
Wieso redet sie so laut mit mir? Ich bin nicht schwerhörig.
„Ja, ja.“
„Schau, schon wieder hast du Kuchen unter den Tisch fallen lassen.“
„Ach.“
Sie beugt sich unter den Tisch. Ich sehe ihren Nacken. Er glänzt und ich rieche ihren Schweiß, der Geruch ist widerlich.
Das billige Parfüm stinkt.
„Was soll das? Und wer muss das wieder aufwischen? Ich!
Meinst du, ich habe nicht schon genug zu tun mit dir? Den ganzen Tag arbeite ich und mein Haushalt muss auch noch gemacht werden, und dann verwandelst du hier auch noch alles in einen Saustall!“
Ich mag es nicht, wenn man mich anschreit. Ihre Stimme klingt hysterisch, sie starrt mich aus riesigen Augen an. Rote Adern umsäumen ihre Iris.
„Es tut mir leid. Ich hole einen Lappen.“
„Bleib sitzen. Du fällst sonst noch hin!“
„Johann kann das machen. Er ist ein guter Mann.“
„Johann ist tot!“, kreischt sie.
Ich bin ganz still. Man soll gefährlichen Menschen nicht widersprechen, das macht sie nur noch gefährlicher.
„Gut, dann mache ich es später selbst.“
„Du weißt genau, dass du das nicht kannst.“ Jetzt funkeln ihre Augen gehässig.
„Meine Wohnung ist immer ordentlich“, entgegne ich beleidigt.
„Sie ist ordentlich, weil ich für dich aufräume.“
Sie steht auf und geht in die Küche.
„Was hast du denn schon wieder mit dem Putzlappen gemacht?
Frieda, wo ist der Lappen hin?“, zetert sie aus der Küche.
„Wo er hingehört.“
„Er ist nicht in der Küche.“ Sie kommt zurück.
„Rück mal ein bisschen zur Seite. Dann muss ich den Kuchen eben mit der Serviette aufheben. Dass du aber auch alles verlegen musst!“
Schon verschwindet sie wieder unter dem Tisch. Sie ächzt und der Tisch wackelt ein bisschen, weil sie mit einer Schulter beim Aufwischen dagegen stößt. Sie wird mir bestimmt meinen Schmuck stehlen. Was soll ich nur tun? Jetzt kommt sie wieder unter dem Tisch hervor. Ihr Gesicht ist rot vor Anstrengung.
Da fällt mir etwas ein.
„Bist du so nett und holst mir meinen Gabardinemantel?“
In der Tasche seines Gabardinemantels hatte Papa damals die Pistole versteckt.
„Was willst du denn mit dem Gabardinemantel? Es ist ein warmer Tag.“
Ach ja, es ist warm, natürlich.
„Ich möchte etwas aus der Tasche holen. Etwas sehr Wertvolles.“
„Aus deiner Manteltasche?“ Sie sieht mich skeptisch an.
„Ja, genau. Er ist im Keller.“
Liselotte wischt sich eine Strähne aus der Stirn.
„Bitte.“ Ich schaue so flehend, wie ich kann.
„Was du immer für Einfälle hast!“ In ihren Augen blitzt Neugier auf.
Dann steht sie auf. Als sie aus der Wohnzimmertür in den Flur geht, erhebe ich mich langsam. Leise, ich muss leise sein, wenn ich ihr folge. Die Beine wollen nicht mehr so recht. Mir schwindelt leicht. Von der Kellertür aus ruft sie:
„Frieda, warum bleibst du nicht im Wohnzimmer?“
Jetzt hat sie mich entdeckt.
„Ich wollte dir nur den Weg zeigen.“
„Ich weiß, wo der Keller ist.“
Woher weiß sie das? Sie hat schon eine Hand auf die Klinke gelegt, jetzt drückt sie den Griff nach unten und öffnet die Tür.
Ich bin ganz nah bei ihr.
„Du gehst nicht mit nach unten. Die Treppe ist viel zu steil. Da stürzt du noch. Es ist sowieso ein Unding, dass du die Treppe nie hast erneuern lassen. Die ist ja lebensgefährlich.“
„Ja, genau.“ Das hat Johann auch immer wieder gesagt: Sei vorsichtig auf der Treppe.
Ich stehe dicht hinter ihr. Sie steht nun auf dem Podest zur ersten Stufe, sie dreht sich noch einmal zu mir um, während ihre Finger nach dem Lichtschalter suchen.
„Frieda, jetzt geh doch zurück ins Wohnzimmer, ich bringe dir deinen Mantel schon.“ Sie hat den Schalter gefunden und das helle Kellerlicht geht an.
Ich bin selbst überrascht, mit welcher Kraft ich ihr den Stoß versetze. Mit schreckgeweiteten Augen starrt sie mich für den Bruchteil einer Sekunde an und stürzt dann rücklings hinunter.
Ihr Körper poltert und kugelt in die Tiefe und schlägt mit einem dumpfen Krachen unten auf. Dann ist Stille. Interessiert schaue ich nach unten. Da liegt sie. Sie regt sich nicht. Ihre Lage ist unnatürlich, ein Bein abgewinkelt. Auf den Stufen rote, nasse Flecken, Blut. Ihr Kopf ist blutüberströmt. Nun hat ihr Gesicht dieselbe Farbe wie ihr Haar. Ich mache lieber schnell das Licht aus und schließe die Tür. Mein Herz rast und ich atme schwer. Ich lege eine Hand auf die Brust, drücke sie fest auf mein Herz und halte kurz inne. Ich sollte mich wirklich nicht so anstrengen, Johann hat voll und ganz Recht. Schwerfällig gehe ich zurück zum Wohnzimmer und lasse mich erschöpft auf die Couch sinken. Da fällt mein Blick auf einen Kuchenrest unter dem Tisch. Sie hat ihn übersehen. Lilo Pulver ist eine gute Schauspielerin, aber vom Saubermachen versteht sie nichts.
Er lag mit weit aufgerissenen Augen da und versuchte durch die Nase zu atmen, um ein Keuchen zu unterdrücken. Kalter Schweiß rann ihm vom Nacken zu den Oberarmen hinab und bildete kleine Rinnsale. Ein krampfhaftes Zittern durchlief seinen Körper. Kälte durchdrang ihn bis ins Innerste. Unfähig zu denken, waren aber seine Sinne bis aufs Äußerste geschärft.
Er lauschte panisch, versuchte seinen Kopf etwas anzuheben, um mit seinem Blick die Dunkelheit zu durchdringen. Kamen sie wieder, seine Peiniger? Er machte sich keine Illusionen, dass sie wohl nur für einen Augenblick von ihm abgelassen hatten.
Sein Rücken brannte wie Feuer an den Stellen, wo ihn die Peitsche aus Stacheldraht getroffen hatte. Die einzelnen Striemen hatten sich zu einem Flächenbrand vereinigt, der seine rohe Haut zerfurchte und sich tief in sein Fleisch grub. Seine Finger spürte er nicht mehr, die Kabelbinder, die sie umschnürten, waren viel zu eng gezogen. Er vermochte nicht, sich auf einen einzelnen Punkt seines Körpers zu konzentrieren, der Schmerz schien durch jede Pore zu kriechen. Angst, nackte Angst beherrschte ihn. Sein Herz schlug unnatürlich schnell, er spürte es in seinen Schläfen pochen. Sein Herzschlag erinnerte ihn für einen Moment an den Takt des Metronoms seines Klaviers, das er als Kind gerne auf ganz schnell eingestellt hatte. Ticktack, ticktack, ticktack, ticktack ... Die röchelnden Geräusche, die sich nun ungewollt seiner Lunge entrangen, durchrissen die Stille der Nacht in ungleichmäßigen Abständen, vermischten sich mit seinem leisen, angstvollen, jetzt nicht mehr zu unterdrückenden Wimmern und dem Herzschlag zu einem mehrstimmigen Konzert. Die Dunkelheit hüllte alles ein und schien die Geräusche der Nacht zu dämpfen. Er vernahm das Rufen eines Uhus aus dem nahegelegenen Wald und konnte jetzt auch das flackernde Licht einer Taschenlampe wahrnehmen. Er lag bäuchlings über einem großen Findling, wie sie in dieser Gegend häufiger zu finden waren, seine Füße streiften die warme Erde. Der kalte Felsen berührte seinen entblößten Bauch und seine rechte Wange, die er nun an den Stein geschmiegt hatte, so als wäre er sein Freund. Gerne würde er sich hinter dem Felsen verbergen, in dessen dunklen Schatten gleiten, aber es war ihm nicht möglich, sich zu bewegen. Sie hatten ihm die Hose heruntergezogen und die Hände auf dem Rücken gefesselt. Plötzlich hörte er, wie jemand hinter ihn trat, feine Äste zerbrachen unter schweren Schritten, der Pegel der Taschenlampe war direkt auf seinen Rücken gerichtet, zerschnitt die Finsternis. Gespenstisch zeichnete sich ein Schatten auf dem unebenen Boden ab. Nackt und bloß fühlte er sich ihm ausgeliefert – diesem Schatten, der tänzelte im flackernden, kalten Licht. Zuerst spürte er das raue Leder von Stiefeln, die sich zwischen seine Knie drängten, und schließlich die harte Gummisohle an den Innenseiten seiner Oberschenkel, als seine Beine durch einen brutalen Tritt gespreizt wurden. Der Mann hinter ihm sagte kein Wort. Er konnte ihn nicht einmal atmen hören, als dieser mit kräftigen riesigen Pranken seine Gesäßbacken auseinanderdrückte. Als die abgerundete Eisenstange seinen Anus durchbohrte, durchzuckte ihn ungeheurer Schmerz, er bäumte sich ächzend auf, seine Muskeln versuchten reflexartig verzweifelt mit letzter Kraft dagegenzuhalten. Aber es war zwecklos. Der andere fuhr unbeirrt fort in seinem Tun und drückte die Stange langsam tiefer und tiefer in seinen Leib, indem er sie hin und her drehte. Dann ertönte plötzlich das Geräusch eines Motors in der Ferne und schwoll immer mehr an. Der Mann hinter ihm hielt inne, knipste die Taschenlampe aus. Das Motorengeräusch wurde lauter und für den Bruchteil eines Moments flackerte bei ihm die unsinnige Hoffnung auf, dass doch jemand kommen mochte, um ihn zu retten. Und tatsächlich schien das Auto direkt auf sie zuzuhalten. Konnte es sein, dass jemand in der Nacht auf diesen einsamen Feldweg eingebogen war? Wurde er endlich vermisst? Suchte jemand nach ihm? Dann erstarb das Geräusch genauso schnell, wie es näher gekommen war, und er vernahm wieder den Uhu, der sein schaurig eintöniges Lied sang. Ohne die Taschenlampe wieder anzuschalten, fuhr der Mann hinter ihm mit der Arbeit fort. Der stechende Schmerz steigerte sich bis ins Unermessliche und brachte ihn dem Wahnsinn nahe. Sein Atem setzte für einen Moment aus. Schließlich wurde er von einer gleichgültigen Betäubtheit übermannt, der Schicksalsergebenheit, die ihn schon seit Stunden immer wieder ergriffen hatte. Gekämpft hatte er und verloren, nun stand das bittere Ende bevor, das ihm doch wie eine Erlösung entgegenzuschimmern schien.
Mitten in den tobenden Qualen schlich sich die Ohnmacht immer näher, konnte sich aber noch nicht entschließen, von ihm endlich Besitz zu ergreifen. Als die Stange erbarmungslos weitergetrieben wurde von groben Händen, die zu keiner Seele zu gehören schienen, drängte sie durch den Darm, zerfleischte die Organe und endlich, endlich wurde ihm schwarz vor Augen, das Zucken seiner Gliedmaßen spürte er nicht mehr.
Aber mitunter gibt es keinen gnädigen Gott, der Tod hockt in einer Ecke und wartet. Er hatte noch keine Lust, den Armen zu holen, und so erwachte dieser einige Minuten später aus seiner Ohnmacht aufgepfählt. Kein Schrei konnte sich ihm entringen, denn sein Mund war zugestopft. Lediglich Geräusche, wie sie ein vor Schmerzen ächzenden Tier vernehmen lässt, drangen durch den Knebel. Ein Winseln und Wimmern, das kaum mehr etwas Menschliches hatte. Die Eisenstange wurde in eine mit frischem Beton aufgefüllte Grube gesteckt, Holzkeile verhinderten, dass die Stange umfiel. Er hatte selbst das Loch ausheben müssen, fast einen Meter tief. Und nun zuckte er unkontrolliert, die Stange drang Zentimeter um Zentimeter weiter vor in seine Eingeweide, bis sie zum Stillstand kam, vom Rippenbogen gestoppt und den dazwischen eingeklemmten Muskeln, Organen und Nervenbahnen. Die Hölle war aus ihren Tiefen herausgestiegen, um ihn zu quälen, kam ihm in einem letzten, kurzen, klaren Augenblick der Erkenntnis zu Bewusstsein, bis die schier unmenschliche Gewalt der Schmerzen jegliches Bewusstsein ausschaltete. Aus der Ferne hätte man ihn für einen Hampelmann halten können, der mit zuckenden Gliedmaßen tanzte nach einer Melodie, die nur er selbst zu hören vermochte im hüpfenden Licht der Taschenlampe, die wieder eingeschaltet worden war. Doch schließlich verlosch auch diese und nur der Mond lugte hinter den Wolken mit blassem Antlitz hervor. Der Tod ließ sich Zeit und Gott blickte viele Stunden lang nicht auf die Erde hinab in dieser lauen Nacht am Rande des Taunus.
Erst als der Morgen graute, erbarmte er sich und bereitete mit dem letzten Atemzug, rasselnd und schwer, seiner Qual ein Ende. Den fast nackten, unterkühlten Körper erfasste Todesstarre. Der alte Flickenmantel, den man ihm übergeworfen hatte, blähte sich in dem aufkommenden Wind, rötliche Sonnenstrahlen tanzten auf der Krempe des alten, viel zu großen Huts, der das Gesicht fast vollständig verdeckte. Fast gleichzeitig kamen mit den ersten Sonnenstrahlen die Krähen zum Frühstück aus ihren Nestern. Kaum hatte die Erste ihre Entdeckung ihren Artgenossen vermeldet, kreiste bald ein ganzer Schwarm der Rabenvögel um das unverhoffte Zubrot, das dort für sie aufgespießt stand. Über das Feld streifte der Wind, in sanften Wellen wogten die gelben Blüten und ein neuer Spätsommertag brach an. Nur das Donnern der Flugzeuge vom Frankfurter Flughafen durchschnitt alle paar Minuten die Stille des Morgens. Die Rhein-Main-Region war erwacht.
Sascha stand in der Tür des alten, etwas heruntergekommenen Bauernhauses und strich mit seinen schwieligen Händen über seinen Blaumann. Der Stoff war faltig und voller Flecken, die schwarzen Gummistiefel reichten ihm fast bis unter die Knie.
Die Morgensonne hatte den Hof gerade erfasst und tauchte die Giebel von Wohngebäude und Scheune in einen strahlenden Goldton. Der junge Bauer ließ den Blick schweifen. Das leuchtendgelbe Feld vor ihm, dahinter der Wald in saftigem Grün.
Alles lag friedlich da, das Land breitete sich vor seinen Augen aus, als er um die Ecke des Hauses schritt und die ersten warmen Strahlen auf dem braungebrannten Gesicht wohlig genoss.
Für einen Moment schloss er die Augen und sog die frische Morgenluft tief ein. Der Nebel hing noch über dem Wald hinter den Feldern, die Hügel des Taunus in der Ferne waren noch verdeckt. Er seufzte und fuhr sich durch das strähnige Haar.
An einem Morgen wie diesem, an dem sich das charakteristische Panorama dem Auge noch verbarg, hätte der Hof auch höher im Norden liegen können, irgendwo in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg in der Nähe des Meeres, wo Lucie jetzt lebte. Nun war es schon zwei Jahre her, seitdem sie ihn verlassen hatte und aufs flache Land an die Ostsee gezogen war, zurück zu ihrer Familie. Er seufzte noch einmal und trat mit der Spitze seines Stiefels einen Stein beiseite, der kantig über den grauen Asphalt rollte. Eine ganze Schar Krähen flog über das Haus und riss Sascha aus seinen Gedanken. Wie ein schwarzes Band durchschnitten sie in langer Reihe den Himmel. Er zog unwillkürlich den Kopf ein und wunderte sich über das ungewohnt laute Gekrächze. Sie hielten auf die alte Vogelscheuche zu, hinten im Gelbsenffeld in der Nähe des Waldrands, nur ihre Konturen waren zu sehen, der riesige schwarze Hut und der flatternde Mantel. Etliche der schwarzen Vögel saßen bereits auf der mannsgroßen Puppe, andere umkreisten sie lautstark. Sascha musste grinsen und strich sich über die unrasierte Wange. Das kratzende Geräusch der Bartstoppeln auf seiner rauen Hand erinnerte ihn daran, dass er sich dringend rasieren musste, wenn er heute Abend ausgehen wollte.
Verdutzt beobachtete er für einen Moment das Treiben der Vögel aus der Ferne. Diese frechen Viecher hatten keinen Respekt vor der Attrappe, die die Saat schützen sollte. Aber warum auch? Er hatte gelesen, dass Krähen über eine Menge Intelligenz verfügten, so dass sie diese Abschreckungsmaßnahmen der Menschen sicher schnell durchschauten. Aber sein alter Herr hatte darauf bestanden, die Vogelscheuche aufzustellen, weil sie immer dort gestanden hatte, jedes Jahr aufs Neue. Dieser störrische alte Mann! Bei dem Gedanken an seinen Vater spuckte Sascha verächtlich auf den Asphalt. Noch immer verstand er es, ihm seinen Willen aufzuzwingen. Das Treiben der Krähen wurde immer toller. Irgendetwas stimmte da nicht. Sie versuchten unter den Hut der Vogelscheuche zu gelangen, um dort zu picken. Schließlich fiel der Hut herunter. Er segelte zu Boden, drehte vorher noch eine Pirouette, so als würde die Puppe ihren Hut ziehen, um jemanden zu grüßen. Sascha zog die Stirn in Falten und kniff die Augen zusammen. Die Umrisse des Strohkopfes zeichneten sich scharf im Gegenlicht des noch jungen Morgens ab. Die Krähen stürzten sich wie toll auf die dunkle Kugel über dem Mantel. Ein ohrenbetäubender Lärm ging von ihnen aus. „Weg mit euch!“, rief Sascha mit heiserer Stimme und stapfte durch das Feld auf die Puppe zu. Er mochte Krähen nicht und ihre immer größer werdende Menge ließ ihm einen unangenehmen Schauer über den Rücken laufen. Die Pflanzen standen schon hoch, reichten ihm bis über die Hüfte und gelber Blütenstaub blieb an seinem Blaumann haften.
„Verschwindet!“, er fuchtelte mit den Armen durch die Luft, klatschte verärgert in die Hände, doch die Krähen ließen sich nicht von ihm stören. Immer zahlreicher wurde ihre Schar und sie hielten unbeirrt auf den Strohkopf zu. Geblendet von der Morgensonne, trennten Sascha nur noch wenige Meter von der Vogelscheuche. Er versuchte mit an die Stirn gelegter Hand die Augen abzuschirmen, die im grellen Gegenlicht schmerzten.
Ein Jumbojet donnerte über seinem Kopf hinweg und als er in den Schatten des Waldrandes trat, blieb er abrupt stehen. Langsam senkte er seine Hand. Er spürte, wie sein Atem stockte, das Blut schien in seinen Adern zu gefrieren. Der Mund öffnete sich unwillentlich, die Augen weit aufgerissen, starrte er mit entsetztem Blick auf die Vogelscheuche. Aber da war kein Strohkopf. Stattdessen glotzte er in die toten Züge eines blutüberströmten Menschenkopfs, dem die Krähen die Augen ausgepickt hatten und über den sie sich laut streitend hermachten.
In wildem Gerangel versuchten sie einander Haut- und Fleischfetzen abzujagen und die besten Stücke zu ergattern.
Sascha sackten die Beine weg. Ein unwiderstehlicher Würgereiz überkam ihn und er übergab sich in die gelbe Blütenpracht, besprenkelte sein rechtes Hosenbein mit Spritzern des Erbrochenen. Er fing den Sturz unbeholfen mit den Händen reflexartig ab, kniete für wenige Sekunden auf dem Ackerboden, erlangte aber schnell sein Gleichgewicht zurück und richtete sich hektisch auf. Dann drehte er sich um und wandte sich von der Vogelscheuche mit zitternden Gliedern ab. Er atmete tief durch, fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund und ging unsicher und langsam ein paar Schritte zurück in Richtung Hof, verfiel dann aber in panisches Rennen. Er fühlte sich verfolgt von dem lauten Krächzen der schwarzen Schar, so als würden sie ihm im Nacken sitzen. Er stolperte mit den etwas zu großen Gummistiefeln, fiel hin, tauchte für einen Moment in das gelbe Meer ein. Ein Marienkäfer krabbelte langsam an einem Stängel empor, nur wenige Zentimeter von seinen Augen entfernt.
Sascha rappelte sich wieder auf und hastete auf wackeligen Beinen, immer wieder strauchelnd, weiter. Er kämpfte sich durch das Gewirr aus Stängeln und Blüten und es schien ihm, als wollten die Pflanzen ihn umschlingen und daran hindern, sich von der grauenhaften Gestalt zu entfernen. Es konnte nicht sein, schoss es ihm durch den Kopf. Es war vollkommen ausgeschlossen! Aber das Schreien der hungrigen Krähen belehrte ihn eines Besseren. Er brauchte sich nicht umzuwenden, um zu wissen, dass dort tatsächlich ein Mensch aufgespießt stand. Im Haus angekommen, wählte er außer Atem und mit zittrigen Händen die Nummer des Polizeinotrufs.
Hauptkommissar Georg Maindl erreichte den Wimmerhof erst geraume Zeit nach seinen Kollegen. Mit quietschenden Reifen hielt er vor dem alten Bauernhaus. Schon wieder hatte er sich verfahren, als er, von Wiesbaden kommend, den Aussiedlerhof gesucht hatte. Verärgert würgte er den Motor ab und griff hektisch nach seiner braunen Ledertasche. Längst schon hätte er sich ein Navi kaufen sollen, hatte sich aber bisher stets dagegen gewehrt. Schließlich war sein Orientierungssinn immer ganz ausgezeichnet gewesen. Dennoch nahm er sich nun vor, gleich am Nachmittag eins zu besorgen, denn er wollte nicht zum Gespött der anderen werden, weil er sich als Oberbayer aus der Provinz nicht in dem verschachtelten Straßennetz des Ballungsgebiets zurechtfand. Erstaunlich, dass es hier tatsächlich Bauernhöfe gab, die in einer so ländlichen Abgeschiedenheit liegen, obwohl die Großstadt nur wenige Kilometer entfernt ist, dachte er, als er aus dem Auto stieg und unmittelbar in einen Kuhfladen trat. „Zerfix!“, entfuhr es ihm und er versuchte den Schmutz von seinen neuen schwarzen Lederschuhen abzustreifen. Lisa hatte ihm gesagt, hier in der Stadt taugten seine alten Trekkingschuhe nicht, die er sonst jeden Tag im Dienst getragen hatte. Er würde sich damit nur lächerlich machen. „Auf de hob i hean kinna...!“, knurrte er verärgert und schlug die Tür seines blauen Mazdas kräftig zu. Er zog ein Taschentuch aus der Jackentasche und wischte sich kleine Schweißperlen von der Glatze. Der Wimmerhof bestand aus einem alten Bauernhaus mit hohen Giebeln und einer großen Holzscheune. Rundherum lagen Felder, auf denen vor allem Getreide angebaut wurde und die vom Waldsaum begrenzt wurden. Am Horizont wölbten sich sanft die Hügel des Taunus in den stahlblauen Himmel. Maindl ließ seinen Blick kurz über die Umgebung schweifen und fixierte dann seine Kollegin, Cornelia Schwarz, die eilig auf ihn zukam. Ihre langen braunen Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden, ihre schlanke Gestalt bewegte sich in vollkommener Harmonie, so sanft waren ihre Bewegungen beim Gehen, als würde sie schweben. Dennoch war sie durchtrainiert und Maindl hatte an eine Tänzerin denken müssen, als er das erste Mal hinter ihr im Flur des Präsidiums hergegangen war und seinen Blick kaum hatte von ihrem muskulösen Rücken abwenden können. Sie deutete kurz auf seine Schuhe und grinste: „Dass ausgerechnet du …“ Aber Maindl war nicht zum Scherzen zumute und winkte mit einer kurzen Handbewegung ab. „Komm zur Sache, was haben wir?“, fragte er die junge Kollegin und seine Stimme klang dabei schärfer, als er es beabsichtigt hatte. Sofort verschwanden die Grübchen auf ihren Wangen und sie sah ihn ernst an. „Bisher nicht viel“, antwortete Cornelia und strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. „Da drüben im Raps steht ein Mann aufgepfählt, es gibt Schuhabdrücke und etwas weiter hinten am Waldrand einen großen Findling mit Blutspuren.“ Sie deutete mit dem Zeigefinger in Richtung Feld, auf dem schon etliche Polizisten herumstanden und wartend zu ihm hinüberblickten. „Das ist doch kein Raps“, erwiderte Maindl knapp, „wir haben schon Ende August.“ Am Rande des gelb leuchtenden Feldes stand eine Art Vogelscheuche mit langem Mantel – der Gepfählte. Maindl nickte den Kollegen zu, aber sie standen zu weit weg, um seine Geste deuten zu können. Nur einer hob die Hand zum Gruß, es war Özkan Yilmas. „Und das nennst du nicht viel?“ Maindl schaute aufmerksam zu dem Gepfählten, vor dem ein Kollege kniete und Fotos schoss. Krähen flogen wie wild um ihn herum. „Wir haben erst mal alles so gelassen, bis du da bist“, fuhr sie fort und er versuchte zu ergründen, ob in ihrer Stimme der Hauch eines Vorwurfs über seine Verspätung zu hören war. „In dem Haus wohnen Alfred und Sascha Wimmer, Vater und Sohn“, erklärte sie weiter. Sie zeigte zu dem Bauernhaus, vor dem ein Mann mittleren Alters in einem Blaumann und schwarzen Gummistiefeln stand und einen bestimmten Punkt auf dem Boden zu fixieren schien.
Maindl hatte keine Scheu vor Tatorten, im Gegenteil, spürte er doch von ihnen eine seltsame, sein Denkvermögen anstachelnde Intensität ausgehen und im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hatte er nie Probleme damit gehabt, sich Tote genau anzusehen. Und genau diese Intensität verspürte er auch jetzt wieder, als er zielstrebig auf den Gepfählten zuhielt. Seine Sinne waren geschärft, er roch die Senfblüten, deren Duft süßlich und intensiv in der Luft lag, hörte das Krächzen der unzähligen Krähen, das die Stimmen der murmelnden Polizisten fast vollständig verschluckte. Aber da war noch viel mehr. Der Wind wehte eine Brise Waldluft hinüber, mit der Note von morschem Holz und Erde. Inzwischen hatte Maindl sich daran gewöhnt, dass die Gerüche in der Rhein-Main-Region viel weniger intensiv waren als in seiner Heimat, dem Chiemgau. Über allem schien eine unsichtbare Schicht aus Abgasen und verunreinigter Luft zu liegen. Der Gepfählte stand auf der anderen Seite des Senffeldes, nahe dem Waldrand, so dass er vom Hof aus gut zu sehen war. Vielleicht hingen seine fehlenden Berührungsängste bei der Begegnung mit dem Tod ja auch mit dem Beruf seiner Eltern zusammen. Sie führten ein Bestattungsinstitut und schon als Kind hatte er gelernt, dass der Tod zum Leben dazugehört. Mit großem Interesse hatte er als kleiner Junge beobachtet, wie sich ein toter Körper innerhalb weniger Tage veränderte, bis er schließlich wachsfigurenartig aussah und immer weniger an die Person erinnerte, die er einst gewesen war. Manchmal hatten Angehörige Mühe, ihre aufgebahrten Lieben überhaupt wiederzuerkennen. Er ließ die Umgebung auf sich wirken. Das Gelbsenffeld und den Waldrand, den Mantel des Toten, der schlaff an ihm runterhing. Der Wind hatte sich gelegt. Ein Kollege versuchte mit einem Besen die Krähen von dem Leichnam fernzuhalten. Der Lärm der Flugzeuge durchbrach seine Konzentration immer wieder, dennoch versuchte er die Atmosphäre in sich aufzusaugen, diese merkwürdige Spannung aus Abgeschiedenheit und Lärm. Schweigend stapfte er durch das Feld, ohne die anderen Polizisten besonders zu beachten. Lediglich kurz grüßte er sie, um dann aufmerksam den Toten zu betrachten. Es musste ein alter Mann gewesen sein, das graue Haar klebte auf der blutverschmierten Stirn, die Augenhöhlen waren leer und verheert. Die Krähen hatten ganze Arbeit geleistet. Langsam und so nah, wie es die Spurenlage erlaubte, umkreiste Maindl den Gepfählten, besah ihn sich aus jedem Winkel. „Chef, die Fußspuren“, unterbrach ihn Özkan Yilmas, sein junger Kollege, „sie führen von dem Findling am Waldrand aus hierher, geradewegs durch das Feld. Die Abdrücke sind gut im Boden zu sehen. Es müssen drei Männer gewesen sein. Da sind auch Schleifspuren.“ „Des derf de SpuSi macha“, entgegnete Maindl wortkarg, der es nicht mochte, wenn man ihn störte, während er unbeirrt weiter den Leichnam betrachtete. Als Özkan dennoch neben ihm stehen blieb, wandte Maindl sich ihm zu und sagte: „I brauch no a weng!“ Irritiert nickte der junge Mann, blieb aber trotzdem dicht neben ihm.
Maindl hatte noch nie mit einem türkischstämmigen Kollegen zusammengearbeitet. Dennoch hatte er den jungen Mann sofort gemocht, als er am Tag seines Amtsantritts im Polizeipräsidium seinen Kollegen vorgestellt worden war und Özkan Yilmas ihn mit „Grüß Gott“ begrüßt hatte. „Langjährige Wiesnerfahrungen“, hatte Yilmas lachend erklärt und verschmitzt hinzugefügt, dass auch er noch nie mit einem bayerischstämmigen Kollegen zusammengearbeitet hat. Maindl solle sich aber wegen seines komischen Dialekts keine Sorgen machen. „Kann ja niemand was für seinen Migrationshintergrund“, meinte Özkan Yilmas schelmisch. Bei dem Versuch, sich den ausdrucksvollen, schwarzhaarigen Mann mit der Nickelbrille in Lederhosen und mit einer Maß Bier in der Hand vorzustellen, hatte auch Maindl lachen müssen.
„Haben Sie eine Ahnung, wer der Mann sein könnte?“ Sascha schüttelte den Kopf und sah an Hauptkommissar Maindl vorbei auf den Leichensack aus grauer Folie, in der sich der Tote befand und der nun von zwei Männern in Uniform weggetragen wurde. Er hatte sich eine Zigarette angezündet, obwohl er das Rauchen eigentlich hatte aufgeben wollen. Aber nach drei Wochen ohne Zigarette und in dieser aufwühlenden Situation machte sich nun ein vertrautes Gefühl der Erleichterung in seinem Körper breit und das Nikotin half ihm dabei, sich zu beruhigen. „Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht richtig angesehen“, er strich sich durch das fettige Haar und bereute sofort seine Worte, denn er wollte auf keinen Fall nochmals das Gesicht des Toten anschauen müssen. Nicht das Gesicht und nicht den geschundenen Körper des Gepfählten. Sascha war noch immer fassungslos und lehnte sich gegen die Hauswand.
„Wohnt hier sonst noch jemand?“, fragte Maindl und besah das rohe Mauerwerk an den Stellen der Hausfassade, an denen der Putz abgebröckelt war. Die kleinen Fenster wirkten milchig und schmutzig. „Nur mein Vater, der ist noch im Bett“, Sascha ließ den Rauch langsam beim Sprechen aus seinem Mund quellen.
„Dann wecken Sie ihn bitte auf.“ Der alte Mann muss ja einen gesegneten Schlaf haben, dachte Maindl, wenn er bei dem ganzen Trubel noch immer selenruhig in seinem Bett liegt. Sascha streifte die Gummistiefel neben der Haustür ab und schlüpfte ins Haus, gefolgt von dem Hauptkommissar. Dieser musste sich ducken, als er das Haus betrat, um sich nicht am Türrahmen den Kopf zu stoßen. Das fängt ja gut an, dachte Maindl missmutig. Kaum in Wiesbaden angekommen, und als erster Toter ein Gepfählter. So was hatte es in seiner oberbayerischen Heimat bisher nicht gegeben. Aber das hier war eben die Großstadt, in der es offensichtlich anders zuging als in Rosenheim oder Traunstein. Die Küche war unordentlich. Das Geschirr stapelte sich in und neben dem Spülbecken und auch den Müll hatten Sascha Wimmer und sein Vater offensichtlich seit einigen Tagen nicht entsorgt. Es roch unappetitlich. Maindl setzte sich an den Tisch und betrachtete die halbvollen Kaffeetassen, den überquellenden Aschenbecher und rümpfte die Nase. Ein großer Weidenkorb voll leerer Bier- und Schnapsflaschen stand neben der Treppe. „Ich bin gleich zurück“, murmelte Sascha und stapfte die alte Holztreppe hoch in den ersten Stock. Das Holz der Treppenstufen knarrte unter seinen Schritten. Er klopfte an die Tür seines Vaters, aber niemand antwortete.
„Vater?“, rief Sascha. „Bist du da?“ Keine Antwort. Plötzlich durchzuckte es ihn wie ein Blitz. War es etwa sein Vater, den er dort draußen auf dem Senffeld gefunden hatte, aufgespießt, als Vogelscheuche auf seinem eigenen Grund und Boden? Panik stieg in ihm auf, er trommelte gegen die Tür: „Vater, mach auf!“ Nichts rührte sich. Er riss die Tür auf und schrie erneut:
„Vater!“ Aber das Zimmer war leer. Die Bettdecke war halb aus dem Bett gezogen, der Stuhl vor dem Bett umgefallen, auf dem Fußboden lag ein dunkelblauer Pyjama. Saschas Hand verkrampfte sich an der Türklinke. Er musste schlucken und starrte auf den umgeworfenen Stuhl. „Was schreist du denn hier so rum?“ Erschrocken fuhr Sascha zusammen. Hinter ihm stand sein Vater in Unterhosen. In seinen grauen Brusthaaren hingen noch winzige Wasserperlen und sein dünn gewordenes Haar war ordentlich nach hinten gekämmt. „Kann man nicht mal in Ruhe kacken in diesem Haus?“ Er schob sein kantiges Kinn nach vorne und entblößte seine bräunlichen Zähne. Sascha atmete tief ein. „Es ist etwas passiert, Vater. Die Polizei ist da, du musst runterkommen.“ Er stützte sich mit einer Hand am Türrahmen ab und spürte, wie sich sein Puls langsam wieder senkte. „Die Polizei? Was wollen die denn? Hab mich schon gewundert, was das für ein verdammter Lärm am frühen Morgen ist.“ „Draußen ist ein Toter gefunden worden, auf dem Feld.“ Alfred verzog keine Miene. „Ein Toter? Was für ein Toter?“, fragte er gleichgültig. „Auf meinem Feld?“ „Sie wissen nicht, wer es ist“, erwiderte Sascha ruhig. „Soll ich vielleicht in Unterhosen runtergehen oder machst du mir endlich Platz?“,
keifte sein Vater aufgebracht. Sascha trat schnell einen Schritt zur Seite und sein Vater schlurfte an ihm vorbei ins Zimmer.
Für sein Alter war er erstaunlich agil. Andere siechten mit neunzig längst schon in Pflegeheimen dahin, während er noch immer einen drahtigen, schlanken Körper aufwies. Auch wenn die Haut inzwischen erschlafft war und seine Tätowierung am Oberarm sich dadurch in die Länge zog, so konnte man an den Armen immer noch die sehnigen Muskeln erahnen, die anschwollen, als er nach der Türklinke griff und die Tür vor Saschas Nase zuschmetterte.
„Gepfählt? Das machen heutzutage doch nur noch die Moslems. In dieser neuen Moschee, da sollten sie mal nachgucken, wo die ganzen Kriminellen hausen, diese Terroristen“, blaffte Alfred den Hauptkommissar an, der inzwischen vom Küchenstuhl aufgestanden war und nun an den Schrank gelehnt dastand mit vor der Brust verschränkten Armen. Während Sascha oben bei seinem Vater gewesen war, hatte Maindl die Zeit genutzt, um in die Schränke und Schubladen zu schauen. Natürlich wusste er, dass er das nicht durfte. Bisher gab es keinen Anhaltspunkt, dass die Wimmers etwas mit dem Mord zu tun hatten, und einen Durchsuchungsbeschluss gab es folglich auch nicht. Dennoch hatte er die Zeit des Wartens nicht unverrichteter Dinge verbringen wollen. Die Schränke und Schubladen waren wie erwartet unordentlich und voller Schmutz. Auf dem braunen, altertümlichen Küchenschrank hatte er ein vergilbtes Foto in einem staubigen Rahmen gefunden, das umgefallen war und eine Familie zeigte. Eine junge Frau mit einem kleinen Jungen, wahrscheinlich Sascha Wimmer, auf dem Arm. Die strohblonden Haare waren unverkennbar, neben den beiden stand ein junger Mann etwas abseits und blickte ernst in die Kamera. „Haben Sie in der Nacht irgendetwas gehört oder gesehen?“, begann Maindl das Gespräch. „Ja, natürlich habe ich das“, entgegnete Alfred, „das Schnarchen von diesem Nichtsnutz da“, er zeigte auf Sascha und verzog seinen Mund zu einem höhnischen Grinsen. „Und wie ist es mit Ihnen?“, wandte Maindl sich an Sascha. „Ich habe nichts gehört“, Sascha versuchte Alfreds Kommentar zu ignorieren. „Sie waren also beide die ganze Nacht über hier im Haus?“, hakte er nach. Sascha nickte, während Alfred überhaupt nicht reagierte. „Waren Sie hier im Haus?“, fragte Maindl lauter, dem Alten zugewandt.
„Seh ich aus, als wäre ich schwerhörig?“, erwiderte dieser unwirsch. „Ja, ich war auch hier. Sonst noch was?“ Maindl sah ihn einen Moment lang schweigend an. Die Gefühllosigkeit, mit der der Alte auf die Nachricht reagierte, dass ein Toter auf seinem Feld gefunden worden war, irritierte ihn. „O. k., dann erst einmal danke, und ich komme wieder“, der Polizist verlieh seiner Stimme Nachdruck, „bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung.“ Maindl wollte seine Zeit jetzt nicht mit einem störrischen alten Mann vergeuden. Er spielte mit dem Gedanken, Özkan Yilmas herzuschicken, und musste dabei in sich hineingrinsen. Wie würde der Alte wohl auf seinen türkischen Kollegen reagieren? „Ach so? Dann muss ich wohl meine Sexreise nach Thailand absagen“, Alfred bewegte seinen Unterkiefer so, als würde er etwas zwischen seinen Zähnen zermahlen. „Vater!“ Sascha sah entnervt zu Alfred Wimmer herüber, der es sich auf der Eckbank bequem gemacht hatte. „Wann bekomme ich endlich einen Kaffee? Seitdem deine Frau abgehauen ist, läuft hier gar nichts mehr.“ Sascha schüttelte nur schwach den Kopf und brachte Georg Maindl nach draußen. Das Feld war inzwischen abgesperrt worden und mehrere Polizisten durchkämmten die Senfpflanzen, die niedergetrampelt einen kläglichen Eindruck machten. „Sie machen mir die Ernte kaputt“, sagte er vorwurfsvoll, aber er vermochte es nicht, Kraft in seine Stimme zu legen. Maindl zuckte mit den Achseln: „So ist es eben, wir dürfen nichts übersehen. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Das werden Sie sicher verstehen.“ Er blickte noch einmal über das Feld und fügte hinzu: „Ich habe hier in der Gegend nicht viele Gelbsenffelder gesehen. Ziemlich ungewöhnlich, oder?“ Sascha Wimmer nickte. „Haben wir auch zum ersten Mal. In Bad Schwalbach hat das ein Bauer ausprobiert und sehr gute Erfahrungen damit gemacht“, erklärte er, „die Senfpflanzen wachsen schnell und binden Nitrat. Das ist gut für den Boden. Auch wenn mein Vater davon natürlich nichts hält.“ Der Bauer begleitete ihn zum Auto und fragte schließlich: „Sie sind nicht von hier, oder?“ „Na, Gott sei Dank ned!“, antwortete der Hauptkommissar, dem die Rhein-Main-Region immer unsympathischer wurde.
Maindl fuhr hinter seinen Kollegen her zurück zum Präsidium.
Er wollte sich nicht schon wieder verfahren. Vor seinem Büro erwartete ihn schon sein Vorgesetzter. „Maindl, was haben wir?“, fragte Alexander Prätorius erwartungsvoll. Maindl strich sich über die Glatze. Er überragte seinen Vorgesetzten um mehr als einen ganzen Kopf. Dennoch, so hatte ihn Özkan Yilmas gewarnt, solle er sich vor dem kleinen Mann in Acht nehmen. Nicht umsonst nannte man ihn hinter vorgehaltener Hand Pitbull. Als er antworten wollte, fiel Prätorius ihm sofort ins Wort: „Damit Sie Bescheid wissen, das ist hier Ihr erster Fall. Vermasseln Sie das bloß nicht! Ich erwarte schnelle und präzise Ergebnisse.“ Der Oberbayer nickte nur. „Und noch was“, fuhr der grauhaarige Mittfünfziger fort, „Stallgeruch zu verbreiten ist in Rosenheim vielleicht üblich, hier aber nicht.“
Er zeigte auf Maindls Schuhe, an denen immer noch Reste des Kuhfladens klebten. Prätorius ließ Maindl stehen und stolzierte zackig den Flur hinab. „Der hat einen Stock im Arsch“, flüsterte Özkan grinsend, der Maindl in der Bürotür erwartete, und machte den steifen Gang ihres gemeinsamen Vorgesetzten nach. Schlug sich dann aber die Hand auf den Mund, als ihm der Wortsinn seiner Bemerkung aufging und er an den Gepfählten dachte. „Lass dich nicht einschüchtern, Pitbull kläfft immer laut“, fügte er hinzu, „aber du weißt ja, Hunde, die …“ „Ja, scho guad“, unterbrach ihn Maindl, „pack mas!“ Er warf seinen grünen Parker über eine Stuhllehne und schickte Özkan los, die Kollegen zu einer ersten Besprechung zusammenzutrommeln.
2.
Also eins muss man den Leuten lassen: Sie verstehen es immer zur ungünstigsten Zeit an der Tür zu läuten. Schwerfällig ziehe ich mich am Waschbecken hoch, um von der Toilette aufzustehen. Da klingelt es schon wieder. „Ich komm ja schon!“,
rufe ich verärgert und schlurfe aus dem Badezimmer in den Flur. Meine Unterhose schlackert, ich habe es in der Eile nicht geschafft, sie richtig hochzuziehen und nun hängt sie knapp über den Knien und macht das Laufen nicht gerade einfacher.
Da schrillt die Türklingel noch einmal. Diesmal in penetrantem Dauerton. Ich öffne und blicke in das Gesicht einer älteren Dame. „Hallo Frieda, ist alles in Ordnung bei dir?“, sie mustert mich von oben bis unten. „Natürlich, was soll nicht in Ordnung sein?“, frage ich noch immer mürrisch über so viel Eile am frühen Morgen. „Wie siehst du denn aus!?“, die Frau greift nach meinem Kleid, das ich versehentlich nach meinem Geschäft nicht wieder ganz runtergezogen habe, und zupft daran herum. „War grad auf dem Klo“, sage ich entschuldigend und streiche den Stoff glatt. „Ich wollte nur mal nach dir sehen, weil das Auto von Svetlana schon den ganzen Tag in der Einfahrt steht. Ich habe gedacht, bei dir wäre etwas passiert.“ Neugierig versucht sie an mir vorbei einen Blick in den Flur zu erhaschen, aber ich lasse niemanden rein. In der Einfahrt steht tatsächlich ein Auto, bemerke ich mit einem Blick aus der Haustür. Ich habe es noch nie zuvor gesehen, wahrscheinlich haben die Nachbarn Besuch. „Das ist nicht mein Auto“, entgegne ich, „es gehört den Gästen.“ „Ach, du hast Gäste? Ich dachte, das sei Svetlanas Auto.“ „Ach was“, schüttle ich den Kopf und weiß überhaupt nicht, von wem diese Frau redet. Es wäre mir neu, wenn in der Nachbarschaft eine Svetlana leben würde. „Wir haben keine Gäste, aber die Nachbarn.“ Ich deute mit dem Kopf in eine unbestimmte Richtung. Sie sieht mich zweifelnd an. „Brauchst du vielleicht Hilfe?“, fragt sie aufdringlich und tritt einen Schritt über die Türschwelle in meinen Flur. Noch immer bin ich nicht ganz sicher, wer sie ist. Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer früheren Schulkameradin. Vielleicht ist sie aber auch von einer Behörde. Die dunkelblaue Jacke über der weißen Bluse wirkt doch recht streng. „Du wirst auch nicht jünger“, versuche ich Licht ins Dunkel zu bringen. Sofort zieht sie ihren Fuß zurück und schaut mich verkniffen an. Ihre Lippen sind zusammengepresst, die Augen plötzlich schmal. Kein gutes Zeichen, nehme ich an, aber immerhin ist ihr Blick nun auf mich gerichtet und nicht mehr in das Innere meines Hauses. „Wir werden alle nicht jünger“, entgegnet sie spitz, „aber anders als du bin ich noch in der Lage, mich ordentlich wieder anzuziehen, wenn ich auf der Toilette war.“ „Besonders ordentlich würde ich das nicht nennen“, sage ich und deute mit dem Zeigefinger auf einen Fleck auf ihrer Bluse. Sie neigt den Kopf, sieht nun auch den kleinen braunen Sprenkel auf ihrer Brust und streicht energisch darüber. „Das muss vorhin beim Kaffeetrinken passiert sein.“ „So würde ich mich jedenfalls nicht auf die Straße trauen“, füge ich hinzu, „schon gar nicht in deiner Position.“ „Was bist du doch bösartig geworden auf deine alten Tage!“ Ich und bösartig? „Ich wollte nur schauen, ob es dir gut geht, und da fährst du mich gleich so an. Ich habe es nur gut gemeint“, zischt sie aufgebracht, „es wird ja gleich dunkel und Svetlanas Auto steht schon den ganzen Tag vor deiner Tür.“
Was hat sie bloß dauernd mit dieser Svetlana? Und da fällt es mir ein: Natürlich, sie hat Angst. „Du brauchst dich nicht zu fürchten“, versuche ich sie zu besänftigen, „es ist alles gut, niemand ist hier.“ Ihr Gesichtsausdruck entspannt sich. „Man sollte sie alle in einen Sack stecken und draufhauen“, füge ich hinzu und lächle aufmunternd. „Du hast wirklich einen merkwürdigen Humor“, sagt sie erstaunt und fügt hinzu: „Wenn du etwas brauchst, weißt du ja, wo du mich findest.“ Ich nicke, auch wenn ich wirklich keine Ahnung habe, wo sie wohnen könnte. Aber das macht nichts, denn schließlich brauche ich keine Hilfe. Erleichtert schließe ich die Haustür. Wenn Johann nachher von der Arbeit kommt, werde ich ihn bitten mit den Nachbarn zu sprechen. Es wäre wirklich besser, wenn ihre Gäste in Zukunft woanders parken. Für einen Moment überlege ich einen Abschleppdienst anzurufen. Eigentlich ist es schon eine Unverschämtheit, dass die Leute auf unserem Grundstück parken, ohne zu fragen. Nun ist es aber wirklich Zeit fürs Frühstück. So richtig scheint die Sonne heute nicht durchzukommen, denke ich beim Blick aus dem Küchenfenster.
„Die Polizei sagt, der Mann vom Feld hieß Fritz Lange“, Sascha musterte seinen Vater aufmerksam und als dieser nicht reagierte, fügte er etwas lauter hinzu: „Hörst du, was ich sage?
Fritz Lange.“ Er pustete den Rauch seiner Zigarette in das Schweigen hinein. „Kenn ich nicht.“ Alfred sah aus dem Küchenfenster. Inzwischen dämmerte es. Den Anblick der Felder in der Abendsonne hatte er schon immer geliebt. Seine Hand strich über den bröckelnden Lack des Fensterrahmens, die Zigarette klemmte zwischen Zeige- und Mittelfinger. Kleine weiße Lackfetzen rieselten auf die Fensterbank. „Die Fenster gehören auch mal wieder geputzt“, sagte der Alte herablassend und setzte die Bierflasche an den Mund. Er hatte sich bereits seinen Pyjama angezogen und den gestreiften Bademantel übergeworfen. In letzter Zeit machte er sich morgens manchmal nicht mal die Mühe, sich überhaupt anzuziehen. Wozu auch? Er erwartete keinen hohen Besuch und eitel war er sowieso nie gewesen. Außer vielleicht als junger Bursche, als er stolz seine Uniform getragen hatte, die Haare stramm zurückgekämmt. Aber je älter er geworden war, umso gleichgültiger war ihm, was andere Menschen von ihm dachten. Er rülpste laut und ließ die Asche seiner Zigarette auf die Fensterbank fallen. „Du hast mir mal von einem Fritz Lange erzählt“, bohrte Sascha weiter und betrachtete widerwillig den Rücken seines Vaters, der sich ihm noch immer nicht zugewandt hatte. Alfred blickte kurz zur Seite. „So? Habe ich das?“, sich räuspernd wandte er den Blick wieder nach draußen: „Ja, das stimmt, ich kannte mal einen Fritz Lange, aber das ist doch ein Allerweltsname. Außerdem ist es ewig her.“ Alfred drehte sich nun endlich zu seinem Sohn um und sah ihm mit seinen hellblauen Augen direkt ins Gesicht. Sascha überragte seinen Vater inzwischen fast um einen Kopf, dennoch war die Ähnlichkeit zwischen ihnen unverkennbar. Das kantige Kinn, die breiten Schultern und dieselben hellblauen Augen. Eine Weile sahen sich die beiden Männer an wie zwei Wölfe, die zwar demselben Rudel angehören, aber jederzeit bereit waren, die hauchzarte Schicht des friedlichen Nebeneinanders aus dem kleinsten Anlass aufzugeben und aufeinander loszugehen. Als Sascha noch immer nicht weitersprach, sondern den Altern weiterhin scharf musterte mit zusammengekniffenen Lippen, fragte der Alte schließlich ungeduldig: „Was willst du von mir?“ Dabei stützte er sich mit einer Hand auf die Lehne des alten Holzstuhls. „Er war 89 Jahre alt, so alt wie du“, forschend beobachtete Sascha seinen Vater und stemmte die Arme herausfordernd in die Seiten. „Und? Muss ich vielleicht jeden alten Knacker kennen?“, blaffte Alfred ihn an. „Die Polizei kommt morgen wieder, sie werden dir auch ein Foto zeigen. Und versuch nicht, dich wieder schlafend zu stellen! Die lassen sich nicht auf Dauer verarschen. Der Tote vom Feld war dein Freund“, entgegnete Sascha gereizt. Er spürte Wut in sich aufsteigen. Wieso musste er sich um diesen starrköpfigen unverschämten Greis kümmern? Der ihn beleidigte und rumkommandierte. Kein Wunder, dass Lucie ihn verlassen hatte. Lange würde das nicht mehr gut gehen. Irgendwann würde er sich vergessen und dem Alten im Suff eins überziehen, so dass dieser ihn nie mehr schikanieren konnte. Das war genau der Grund, warum Sascha seit zwei Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt hatte. Seit jenen Tagen, als Lucie ihn verlassen hatte. Trost hatte er an diesem Abend im „Hirsch“, seiner Stammkneipe, gefunden. Als er betrunken nach Hause getorkelt war, hatte sein Vater ihn angegrinst und gehässig gesagt: „Schlampen gibt es überall, was trauerst du der hinterher?“ Da war die Wut in ihm so hochgekocht, dass er auf seinen Vater eingeschlagen hatte. Er hatte schon des Öfteren die Beherrschung verloren, wenn er getrunken hatte, war schon in die eine oder andere Prügelei verwickelt gewesen. Nur Lucie, sie hatte er nie geschlagen, sie war seine Königin gewesen. Aber an jenem Abend von Lucies Verschwinden hätte er den Vater fast getötet. Für einen Augenblick bereute er jetzt fast, dass er damals doch noch die Beherrschung zurückerlangt hatte und der Vater mit ein paar Prellungen im Gesicht davongekommen war. In der ersten Zeit nach diesem Vorfall hatte Alfred etwas mehr Respekt vor ihm gezeigt. Aber das änderte sich nach wenigen Tagen wieder und der Greis wurde erneut zu dem unerträglichen Stinkstiefel, der er schon immer gewesen war. – Nein, vielleicht nicht immer.
Es gab eine Zeit, in der Sascha stolz auf seinen Vater gewesen war. Aber nach dem Tod der Mutter waren alle schlechten Seiten Alfreds von innen nach außen gekehrt worden. Sascha konnte die Gegenwart seines Vaters nicht länger ertragen und ging vors Haus. Er ließ den Alten in der Küche zurück, ohne noch etwas hinzuzufügen. Die Haustür ließ er laut zuschlagen, schlüpfte in die schwarzen Gummistiefel und hielt kurz inne.
Er könnte noch einen kleinen Spaziergang in der Dämmerung machen, die kühle Luft würde auch seinem Kopf etwas Abkühlung verschaffen. Aber als er die Absperrbänder sah und das niedergetrampelte Feld, das nun wie ein gelbgrüner Teppich vor ihm lag, hatte er doch keine Lust mehr, den Ort der Verheerung genauer zu betrachten. Kurz nach den Polizisten waren mehrere Fernsehteams und Reporter angerückt. Sascha hatte kaum das Haus verlassen können, so sehr hatten die Journalisten den Hof belagert, an die Haustür geklopft, durch die Fenster gespäht. Einer von ihnen hatte sogar versucht mit einer Leiter auf den halb verrotteten Balkon zu steigen, bis sich Alfred mit einer alten Schrotflinte bewaffnet am Fenster gezeigt und ein paar Mal in die Luft geschossen hatte. Wie aufgeschreckte Tierchen waren sie danach davongelaufen. Stattdessen setzte er sich auf die Bank vor dem Haus und zündete sich eine weitere Zigarette an. Scheiß Rauchen, dachte er, konnte sich aber dennoch nicht dazu entschließen, die Zigarette wieder auszutreten. Wie soll man auch einen Nikotinentzug schaffen, wenn man mit einem Kettenraucher zusammenlebt, dachte er verdrießlich. Das Gefühl unendlicher Einsamkeit, sein ständiger Begleiter seit Lucies Weggang, ergriff wieder Besitz von ihm.





























