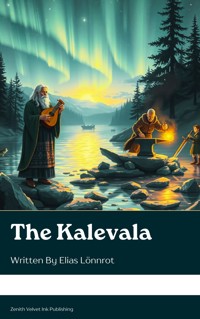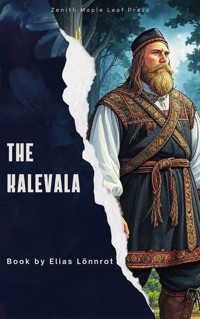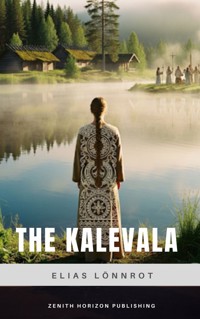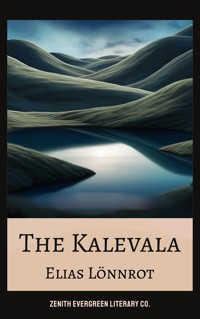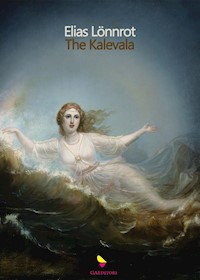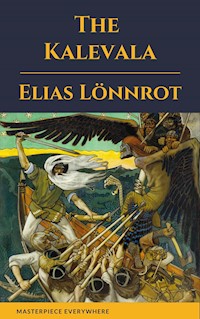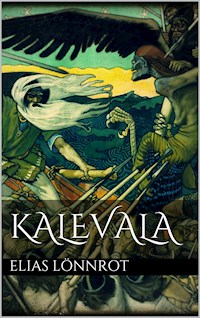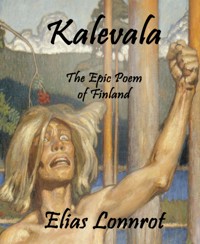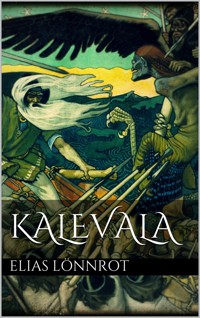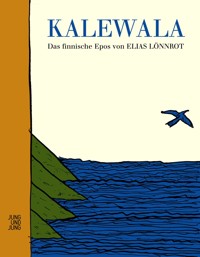
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Meer, die Erde, die Sterne, die Liebe und der Tod: Eine große Verserzählung über die Erschaffung der Welt.Von der Erschaffung der Erde und der Gestirne erzählt dieses Epos, von der Kultivierung des Bodens und dem launischen Meer, vor allem aber von den Begegnungen mit dem schemenhaften Land im Norden, um dessen Tochter die Herren Wäinämöinen, Lemminkäinen und Ilmarinen gleichermaßen werben. Doch auf die Freier warten gefährliche Aufgaben.Kalewala, das Land des Urvaters Kalewa, ist Schauplatz dieses groß angelegten Freskos der mythenumsponnenen Frühzeit Finnlands. Auf zahlreichen Fußreisen hatte Elias Lönnrot – im Geist des spätromantischen 19. Jahrhunderts – Tausende von Versen mündlich überlieferter Lieder gesammelt, Lieder epischen, lyrischen und beschwörenden Inhalts, die er in der Folge zu einem teils heldisch-kriegerischen, teils zauberhaft-magischen Epos verband.Viele namhafte Übersetzer haben sich am Kalewala versucht, doch erst Gisbert Jänickes Arbeit ist es, die den höchsten Ansprüchen genügt: Sie ist vollständig, beruht in allen Details auf dem Original, berücksichtigt auch die neuesten Forschungsergebnisse und besticht durch ihre geschmeidig fließende Eleganz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KALEWALA
Der Verlag dankt dem Informationszentrum für finnische Literaturund der Deutsch-Finnischen Gesellschaftfür ihre Unterstützung.
3. Auflage
© 2011 Jung und Jung, Salzburg und WienTitel des Originals: Kalevala. Toinen painos.Erscheinungsort und -jahr: Helsinki 1849Zweite (revidierte) Textausgabe (11. Gesamtauflage), Helsinki 1909Übersetzt nach der 29. Auflage, Helsinki 1999Alle Rechte vorbehalten, insbesondere auch dasder fotomechanischen Wiedergabe und desauszugsweisen Abdrucks sowie derWiedergabe durch Tonträger und elektronische MittelSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgDruck: CPI Moravia Books, PohořeliceISBN 3-902144-68-3
ELIAS LÖNNROT
KALEWALA
DAS FINNISCHE EPOS
Übersetzt und mit einem Nachwortvon GISBERT JÄNICKE
Contents
Das erste Lied
Das zweite Lied
Das dritte Lied
Das vierte Lied
Das fünfte Lied
Das sechste Lied
Das siebte Lied
Das achte Lied
Das neunte Lied
Das zehnte Lied
Das elfte Lied
Das zwölfte Lied
Das dreizehnte Lied
Das vierzehnte Lied
Das fünfzehnte Lied
Das sechzehnte Lied
Das siebzehnte Lied
Das achtzehnte Lied
Das neunzehnte Lied
Das zwanzigste Lied
Das einundzwanzigste Lied
Das zweiundzwanzigste Lied
Das dreiundzwanzigste Lied
Das vierundzwanzigste Lied
Das fünfundzwanzigste Lied
Das sechsundzwanzigste Lied
Das siebenundzwanzigste Lied
Das achtundzwanzigste Lied
Das neunundzwanzigste Lied
Das dreißigste Lied
Das einunddreißigste Lied
Das zweiunddreißigste Lied
Das dreiunddreißigste Lied
Das vierunddreißigste Lied
Das fünfunddreißigste Lied
Das sechsunddreißigste Lied
Das siebenunddreißigste Lied
Das achtunddreißigste Lied
Das neununddreißigste Lied
Das vierzigste Lied
Das einundvierzigste Lied
Das zweiundvierzigste Lied
Das dreiundvierzigste Lied
Das vierundvierzigste Lied
Das fünfundvierzigste Lied
Das sechsundvierzigste Lied
Das siebenundvierzigste Lied
Das achtundvierzigste Lied
Das neunundvierzigste Lied
Das fünfzigste Lied
Nachwort
Das erste Lied,
in welchem die Tochter der Lüfte, müde ihres Daseins in den öden Luftgefilden, sich aufs Urmeer herabsenkt und, von Wind und Wasser geschwängert, zum Wasserweib wird. Die Ente baut ein Nest auf dem Knie des Wasserweibs und legt ihre Eier hinein. Die Eier fallen ins Wasser und zerbersten. Aus ihren Splittern formen sich Erde und Himmel, Sonne und Mond und die Wolken. Das Wasserweib schafft Inseln und Buchten und Küsten dazu. Schließlich gebiert das Wasserweib den Wäinämöinen.
Ich habe große Lust, ich habe lang daran gedacht,
ans Singen mich zu machen, sprechend Verse herzusagen,
mich alter Weisen zu erinnern, altes Wissen aufzufrischen.
Schon formen Wörter sich im Mund, Verse kommen wieder,
eilen auf die Zunge zu, teilen sich an meinen Zähnen.
Lieber Bruder und Gefährte, der du mit mir aufgewachsen bist,
komm doch, sing mit mir, komm, sprechend Verse herzusagen,
jetzt, da wir beisammen sind, von weitem her gekommen sind.
Nur selten finden wir zusammen, kommt der eine zu dem andern,
in dieser elendiglichen Gegend, hier im düsteren Norden.
Beide Hände wollen wir uns reichen, Finger ineinanderhaken,
die guten alten Weisen singen, die besten Verse von uns geben,
daß die sie lernen können, die gewillt sind zuzuhören
unter der sprießenden Jugend, den künftigen Geschlechtern –
althergebrachte Verse, die zu uns gekommen sind
aus des Alten Wäinämöinen Gürtel, aus der Esse Ilmarinens,
aus Fernmuts spitzer Klinge, Joukahainens Bogensehne,
von den Fluren tief im Norden, den Wäldern in Kalewas Land.
Mein Vater sang sie einst beim Schnitzen eines Axtschafts,
meine Mutter bracht sie mir beim Kreisen ihrer Spindel bei,
als ich noch auf allen vieren am Boden vor ihr kroch,
ich noch ein kleiner Milchbart war, ein lüttes Milchgesicht.
Von Sampo war in ihnen viel die Rede, von Louhis Zauberei;
verwittert sind die Sampo-Verse, verflogen Louhis Zauberworte,
Wipunen verblich mit seiner Weisheit, Achti mit seinen Scherzen.
Doch hab ich andere Worte auch gelernt, anderes Wissen –
hab’s am Wegrand aufgelesen, vom Farnkraut abgerupft,
von Zweigen abgezupft, als Schößling aus der Erde gezogen,
hab’s von Gräsern abgestreift, aufgelesen an den Wegen,
als ich als Kind das Vieh noch auf die Weide hüten ging,
auf honigreichen Hügeln, auf goldschimmernden Höhen,
hinter der schwarzen Kuh und der scheckigen Färse her.
Die Kälte hat mir Lieder gesungen, der Regen Verse gebracht,
andere Weisen trugen die Winde, trieben die Wellen herbei,
die Vögel legten Wörter dazu, die Baumwipfel ganze Sätze.
Die hab ich dann aufgewickelt, das Knäuel im Bündel verstaut,
das Bündel mit dem Knäuel in meinen Schlitten getan
und bin im Schlitten auf den Hof bis zur Tenne gefahrn,
es auf dem Speichersöller in den kupfernen Kasten gelegt.
Lang haben die Lieder im Kalten und Dunkeln gelegen.
Soll ich die Lieder jetzt aus dem Kalten und Dunkeln,
den Kasten in die Stube holen, auf der hölzernen Bank abstellen
unter dem weitbekannten Gebälk, der häuslichen Decke?
Soll ich die Zaubertruhe aufmachen, den wortgefüllten Kasten,
und das Knäuel abwickeln, den Knoten am Bündel lösen?
Dann könnt ein schönes Lied ich singen, eine gute alte Weise,
für ein Mahl aus Roggengrütze, ein Bier aus guter Gerste.
Bringt man mir kein gutes Bier, bringt man wäßriges Gebräu,
sing ich mit schmalerem Mund, bring ich wäßrige Verse dar,
unserem Abend zur Freude, unserem herrlichen Tag zur Ehre,
dem kommenden Tag zum Lob, der Morgenröte zum Gruß.
So hab ich sagen hören, hab in Liedern singen hören:
Allein kommen hier die Nächte, allein bricht der Tag an.
Allein kam auch Wäinämöinen, der alte Zauberer, zur Welt,
vom Schöpferweib geboren, von seiner Mutter Ilmatar.
Eine Jungfrau war sie, Tochter der Lüfte, schöne Schöpferin.
Lange blieb sie unberührt, behielt sie ihre Jungfernschaft
in den öden Luftgefilden, auf den weiten Feldern.
Müde war sie ihres Daseins, überdrüssig ihres Lebens,
die ganze Zeit allein zu sein, als Jungfer zu verkümmern
in den öden Luftgefilden, auf den weiten Feldern.
Darum ließ sie tiefer sich herab, auf die Wasserwellen,
auf den klaren Wasserspiegel, auf die grenzenlose See,
als ein großer Windstoß kam, ein arges Wetter aus Osten,
daß das Meer sich schäumend bäumte, daß die Wellen tosten.
Die Jungfrau wurde vom Wind gewiegt, von den Wellen getrieben
über das blauschimmernde Meer, die schaumgekrönten Wogen –
und der Wind befruchtete sie, das Meer schwängerte sie.
Siebenhundert ganze Jahre lang, neun Mannesalter,
behielt sie ihre Leibesfrucht, trug sie ihren festen Schoß,
und es kam nicht zur Geburt des ungezeugten Kindes.
Die Jungfer trieb als Wasserweib. Sie trieb nach Osten, Westen,
nach Norden und nach Süden, bis an alle Himmelsgrenzen,
gequält von heftigen Wehen, von brennenden Schmerzen im Leib,
und es kam nicht zur Geburt des ungezeugten Kindes.
Leise fing sie an zu weinen. Dann sagte sie die Worte:
Ich Arme, was für ein Leben, ich Elende, was für ein Dasein!
Wo bin ich doch bloß hingeraten – ewig unter freiem Himmel
von den Winden gewiegt, den Wellen getrieben zu werden
über diese weiten Wasser, diese grenzenlose See!
Besser hätt ich’s gehabt als Tochter der Lüfte,
denn mich hier als Wasserweib herumzutreiben.
Kalt ist es hier zu leben, qualvoll sich zu bewegen,
in den Wellen zu wohnen, auf den Wogen zu treiben.
Obergott Ukko, du Träger aller Himmel!
Komm, du wirst gebraucht, beeil dich, du wirst gerufen!
Erlös die Magd aus ihrer Not, das Weib von seinen Schmerzen!
Komm schnell, komm schneller noch, als du gebraucht wirst!
Eine kleine Weile nur verstrich, bloß wenig Zeit verging,
als eine Ente, schmucker Vogel, geflogen kam mit großen Schlägen,
eine Stelle für ihr Nest zu suchen, einen Nistplatz sich zu wählen.
Sie flog nach Osten, Westen, nach Norden und nach Süden,
doch fand sie keine Stelle, nicht den allerkleinsten Ort,
da ihr Nest zu bauen, sich einen Nistplatz herzurichten.
Sie flog und schwebte, sie dachte, überlegte:
Soll ich mein Haus in den Wind, mein Nest in die Wellen bauen?
Der Wind trägt mir das Haus fort, die Welle meine Wohnung!
Da erhob das Wasserweib, Wasserweib, Tochter der Lüfte,
ein Knie aus dem Meer, eine Schulter aus den Wogen,
der Ente als Ort für ihr Nest, für ihre Wohnung.
Und die Ente, schmucker Vogel, flog und schwebte umher.
Sie fand das Knie des Wasserweibs auf dem blauschimmernden Meer,
sah einen Grashöcker darin, einen frischgewachsenen Rasen.
Sie flog und schwebte darauf zu, sie setzte sich aufs Knie.
Da baute sie ihr Nest, legte ihre goldnen Eier hinein,
sechs goldene Eier legte sie, ein siebentes aus Eisen.
Die Ente begann die Eier zu brüten, die Kniescheibe erwarmte.
Sie brütete einen Tag, einen zweiten, einen dritten Tag.
Da fühlte das Wasserweib, Wasserweib, Tochter der Lüfte,
wie es heiß in ihr wurde, ihre Haut zu glühen begann –
sie dachte, es brenne ihr Knie, ihre Adern schmelzen dahin.
Sie ließ ihr Knie erzittern, sie rührte ihre Glieder –
die Eier rollten ins Wasser, sanken in die Wogen des Meers,
am Boden zerschellten die Eier, sie zerbarsten in Stücke.
Sie sanken nicht in den Schlamm, gingen nicht im Wasser verloren.
Die Stücke wandelten sich in Gutes, in Schönes die Splitter –
aus der unteren Hälfte der Eier entstand die Erde,
aus der oberen Hälfte der Eier der Himmel darüber;
aus dem inneren Teil, dem Dotter, entstand die strahlende Sonne,
aus dem äußeren Teil, dem Weißen, entstand der leuchtende Mond,
was bunt im Ei gewesen, das wurden die Sterne am Himmel,
was schwarz im Ei gewesen, das wurden die Wolken der Lüfte.
Weiter verstrich die Zeit, weiter gingen die Jahre dahin
im Schein der neugeborenen Sonne, im Schimmer des neuen Monds.
Immerfort schwamm das Wasserweib, Wasserweib, Tochter der Lüfte,
in den stillen Wassern umher, auf den nebelumhüllten Wellen,
vor sich das weite Meer, den klaren Himmel im Rücken.
Im neunten Jahr dann, im zehnten Sommer endlich
erhob sie ihr Haupt, reckte sie den Kopf über die Wellen.
Sie begann mit ihrer Schöpfung, sie machte sich ans Werk,
auf dem klaren, endlosen Wasser, in der weit offenen See.
Wo sie ihre Hand hinstreckte, ordnete sie Inseln an,
wo sie ihren Fuß aufsetzte, grub sie Grotten für die Fische,
wo sie ins Wasser blies, machte sie tiefe Stellen tiefer.
Sie wandte ihre Seite dem Land zu – Küsten waren geformt.
Sie wandte ihre Füße dem Land zu – Lachsgründe waren geschaffen.
Sie wandte ihren Kopf dem Land zu – Buchten waren gerundet.
Sie schwamm weiter aufs Wasser hinaus, hielt auf der offenen See.
Da schuf sie Klippen im Meer, da ließ sie Riffe entstehn,
an denen Schiffe zerschellen, Seeleute ihr Leben verlieren.
Bald waren die Inseln geordnet, die Klippen geschaffen im Meer,
aufgestellt die Pfeiler des Himmels, beschworen Erde und Festland,
eingegraben die Muster im Stein, die Adern im Fels.
Noch aber war Wäinämöinen nicht geboren, der alte Zauberer.
Dreißig Sommer lang und genauso viele Winter
wanderte der wackre Alte Wäinämöinen im Schoß seiner Mutter
auf den stillen Wassern umher, auf den nebelumhüllten Wellen.
Er dachte, überlegte: Was ist das für ein Dasein, was für ein Leben
in diesem finsteren Versteck, in dieser engen Behausung,
wo man noch nie den Mond gesehn, nie die Sonne bemerkt hat?
Und dann sagte er die Worte: Mond, befrei mich,
Sonne, laß mich heraus, zeig mir, Himmelswagen,
den Weg von den fremden Pforten, den unbekannten Toren,
aus diesem kleinen Nest, der engen Behausung heraus!
Geleite den Wanderer hinaus, das Menschenkind in die Welt,
daß es den Mond sehen, die Sonne bestaunen kann,
den Himmelswagen kennenlernen, die Sterne begucken kann!
Als der Mond ihn nicht befreite, die Sonne nicht herausließ,
verdroß ihn das Dasein, verstimmte ihn das Leben.
Mit dem Ringfinger bewegte er das Tor seiner Festung,
mit einem Zeh schob er das knöcherne Schloß zur Seite,
kopfüber verließ er die Schwelle, auf Knien die Flurtür.
Dann stürzte er naseüber ins Wasser, kopfüber in die Dünung
und war dem Meer ausgeliefert, in den Wellen gefangen, der Kerl.
Da trieb er dann fünf Jahre lang, wenigstens fünf, wenn nicht sechs,
sieben Jahre oder acht. Endlich hielt er auf dem offenen Meer,
an einer Insel ohne Namen, vor einem Festland ohne Bäume an.
Auf Knien strebte er an Land, auf Händen kroch er hinauf,
um endlich mal den Mond zu sehen, die Sonne zu bestaunen,
den Himmelswagen kennenzulernen, die Sterne zu begucken.
Das war der Ursprung Wäinämöinens, des mutigen Zauberers,
vom Schöpferweib geboren, von seiner Mutter Ilmatar.
Das zweite Lied,
in welchem Wäinämöinen das unbekannte Land besteigt. Er sät Bäume und auch die Eiche, die erst nicht wachsen will, dann aber so groß wird, daß ihr Wipfel schließlich den ganzen Himmel verdeckt und niemand mehr Mond und Sonne sieht. Ein kleiner Mann kommt aus dem Meer und fällt die Eiche. Vögel singen in den Bäumen, Blumen und Beeren wachsen auf der Erde; nur die Gerste will nicht gedeihen. Wäinämöinen findet ein paar Körner am Strand, er fällt Bäume, um Schwendland zu gewinnen; eine große Birke läßt er stehen, damit die Vögel ihr Nest darauf bauen. Der Adler, darüber erfreut, bringt Wäinämöinen das Feuer zum Abbrennen der Schwende. Wäinämöinen sät die Gerste und fleht Ukko um Saatglück an.
Wäinämöinen betrat zum erstenmal Festland,
die Insel draußen im Meer, die baumlose Heide.
Fünf Jahre lebte er jetzt vor sich hin,
auf der unbekannten Insel, dem baumlosen Land.
Er dachte, überlegte, wiegte lange den Kopf:
Wer bestellt das Land, bringt die Saat in die Erde?
Der Ackerpeter, Sampsa Pellerwoinen, der kleine Wicht,
der bestellt das Land, bringt die Saat in die Erde!
Sampsa bestellte und säte, besäte Felder und Moore,
kahle Böden und Brachen, besäte auch das Felsenmeer.
Auf Hügel säte er Kiefern, auf Anhöhen Fichten,
auf Heiden Heidekraut, in Niederungen Sträucher.
Birken säte er in die Täler, Erlen in lockere Erde,
Faulbäume auf grasige Böden, Pappeln auf junge Böden,
Ebereschen auf umfriedeten Grund, Weiden auf nasses Land,
Wacholder auf steiniges Land, Eichen an die Flußufer.
Die Bäume sprossen aus der Erde, ihre Triebe wuchsen.
Fichten trieben Blütenwipfel, Kiefern breiteten sich aus.
Birken wuchsen in den Tälern, Erlen in lockerer Erde,
Faulbäume auf grasigen Böden, Wacholder auf steinigem Land,
am Wacholder liebliche Beeren, an der Ahlkirsche schöne Früchte.
Der wackre Alte Wäinämöinen kam, sich das Land zu besehn,
das von Sampsa Pellerwoinen bestellt und besät worden war.
Er sah die Bäume wachsen, die jungen Triebe sprießen;
nur die Eiche hatte nicht gekeimt, Gottes Baum nicht gewurzelt.
Er überließ den kläglichen Baum seinem Schicksal
und wartete noch drei Nächte, genauso viele Tage.
Dann, nach einer Woche, ging er wieder nachzusehn –
die Eiche hatte nicht gekeimt, Gottes Baum nicht gewurzelt.
Er gewahrte vier weibliche Wesen, fünf Meerjungfrauen.
Sie schnitten Gras, mähten taufrische Halme
am Ende einer dunstigen Landzunge, einer nebligen Insel.
Sie harkten die Mahd zu Haufen, zogen sie zu Schwaden.
Dann entstieg Tursas, das Ungeheuer, dem Meer,
zündete das Heu an, steckte das Gras in Brand,
verbrannte alles zu Asche, verwandelte alles in Staub.
Zurück blieb ein Haufen Asche, ein Berg trockenen Staubs.
Auf den fiel ein Blatt, ein Keimblatt, eine Eichel,
aus der ein hübscher Trieb schoß, eine grüne Gerte –
sproß wie die Erdbeere mit zweigeteiltem Stengel.
Sie streckte ihre Äste aus, ihr grünes Laubwerk –
ihr Wipfel stieß in den Himmel, ihr Laubwerk füllte den Raum.
Das hinderte die Wolken zu ziehen, die Wölkchen zu sprühen,
hinderte die Sonne zu scheinen, den Mond daran zu leuchten.
Da dachte der Alte Wäinämöinen, sann und überlegte:
Wer bezwingt mir die Eiche, fällt mir den überheblichen Baum?
Trist haben’s die Menschen hier, schlimm die Fische im Wasser,
wenn die Sonne nicht scheint, der Mond hier nicht leuchtet.
So einen Kerl, einen so tapferen, gibt es ja gar nicht,
der die Eiche bezwingt, die Hundertwipflige fällt!
Dann sagte der wackre Alte Wäinämöinen laut:
Schöpferweib, Gebärerin, Schöpferin, Ernährerin!
Schick das Wasservolk – im Wasser lebt ja viel Volk –,
die Eiche zu knicken, den bösen Baum zu vernichten,
der die Sonne vom Scheinen, den Mond vom Leuchten abhält!
Da entstieg ein Mann dem Meer, kam ein Kerl aus den Wellen.
Der war nicht gerade groß, aber auch nicht eben klein –
lang wie der Daumen eines Manns, wie die Spanne einer Frau.
Er hatte eine eherne Gugel auf und eherne Stiefel an,
Hände in ehernen Fäustlingen mit ehernen Mustern,
er trug einen ehernen Gürtel, im Gürtel eine eherne Axt –
ihr Schaft lang wie ein Daumen, ihre Klinge fingerbreit.
Der wackre Alte Wäinämöinen dachte im stillen:
Sieht doch aus wie ein Kerl, könnte schon ein Mann sein –
lang wie ein Daumen, hoch wie die Klaue eines Ochsen!
Dann sagte der wackre Alte Wäinämöinen laut:
Was bist du für ein Kerl, bist du überhaupt ein Mann?
Nicht schöner als ein Toter, kaum besser als ein Leichnam!
Der Kleine aus dem Meer sagte, der Wicht aus den Wellen:
Ich bin ein Mann, ein kleiner Kerl, ich bin vom Wasservolk.
Ich werde die Eiche da knicken, den morschen Baum zerstücken.
Der wackre Alte Wäinämöinen entgegnete dem Wicht:
Du scheinst mir nicht dazu geschaffen, nicht geeignet,
die große Eiche zu fällen, den schrecklichen Baum da!
Kaum hatte er gesprochen, er schaute noch einmal hin,
da war der Kerl verändert, ein neuer Mann stand vor ihm –
sein Fuß auf die Erde gestemmt, sein Kopf trug die Wolken,
der Bart vorn bis zum Knie, das Haar hinten bis zur Ferse,
klafterbreit zwischen den Augen, klafterweit das Hosenbein,
anderthalb Klafter ums Knie, zwei Klafter am Hosenbund.
Der Mann strich über die Axt, er wetzte die Klinge,
verbrauchte sechs Schleifsteine, sieben Wetzsteine dabei.
Er schritt tänzelnd und mit schwingendem Gang
in den weiten Hosen, den flatternden Beinkleidern.
Er nahm einen Schritt und stand im feinen Sand,
einen zweiten Schritt und stand in der braunen Erde,
nach dem dritten Schritt stand er vor der mächtigen Eiche.
Er hieb die Axt ins Holz, schlug mit der Klinge hinein.
Schlug einmal, ein zweites Mal, machte einen dritten Versuch,
Funken sprühten aus der Axt, Flammen züngelten aus der Eiche –
die Eiche begann sich zu neigen, der Riesenbaum sich zu beugen.
Beim dritten Mal gelang es ihm, die Eiche zu fällen,
den Riesenbaum, den hundertwipfligen, zu Fall zu bringen.
Nach Osten lag das Wurzelende, nach Westen der Wipfel,
nach Süden das Laubwerk, nach Norden das Astwerk.
Wer sich einen Zweig davon brach, brach sich ewiges Glück,
wer sich vom Wipfel brach, brach sich ewigen Zauber,
wer sich vom Laubwerk brach, brach sich ewige Liebe.
Eichenspäne flogen umher, Baumsplitter stoben hinaus
auf das klare, weite Meer, auf die grenzenlose See.
Dort wiegte sie der Wind, schaukelten die Wellen sie
wie Kähne auf dem weiten Meer, wie Schiffe auf der Dünung.
Der Wind trug sie nach Nordort, wo eine kleine Magd
beim Spülen ihrer Tücher, beim Waschen ihrer Wäsche war
an einem Stein am Ufer, am Ende einer spitzen Landzunge.
Ein Span kam ihr zugeschwommen, den steckte sie ein
in den langlaschigen Ranzen und trug ihn nach Haus,
daß sich der Hexer einen Pfeil, der Schütze ein Geschoß mache.
Als die Eiche gefällt, der schlimme Baum gefallen war,
konnte die Sonne wieder scheinen, der Mond wieder leuchten,
konnten Wolken am Himmel ziehn, der Regenbogen sich wölben
über der dunstigen Landzunge, der nebligen Insel.
Da begannen Bäume zu sprießen, Wälder zu wachsen,
Laub an den Bäumen, Gräser am Boden, Vögel begannen zu singen,
Drosseln zu zwitschern, der Kuckuck begann zu rufen.
Beeren gediehen am Boden, Gräser auf der goldenen Wiese,
allerlei Kräuter wuchsen in vielerlei Formen.
Nur die Gerste wollte nicht sprießen, die Saat wollte nicht keimen.
Der wackre Alte Wäinämöinen ging nachdenklich
am Ufer des blauen Meers, an der Küste des ewigen Wassers.
Er fand sechs Körner, sieben Samenkörner sah er liegen
in dem feinen Sand an der Küste des Meers;
die steckte er in sein Marderfell, in den Beutel aus Eichhorn.
Dann ging er, das Land zu bestellen, die Samen zu säen
auf Kalewas Äcker, sein eigenes Gartenland.
Die Meise lachte im Baum: Im Garten keimt keine Gerste,
auf der Scholle kein Hafer, wenn nicht erst geschwendet wird,
wenn nicht Bäume gefällt und vom Feuer verbrannt werden.
Der wackre Alte Wäinämöinen ließ sich eine Axt machen.
Er fällte Bäume und schwendete den unwilligen Boden.
Alle schönen Bäume fällte er, nur eine Birke ließ er stehn,
den Vögeln als Ruheplatz, dem Kuckuck zum Rufen.
Vom Himmel kam ein Adler, durch die Luft kam ein Vogel,
sich das Werk zu besehn: Warum blieb die Birke da stehn,
warum wurde der schöne Baum nicht auch gefällt?
Der Alte Wäinämöinen gab zur Antwort: Der blieb stehn,
daß die Vögel darauf ruhn, der Adler seinen Horst bauen kann.
Da sprach der Adler, der Himmelsvogel: Gut hast du getan!
Hast die Birke wachsen, den schönen Baum stehn lassen,
daß die Vögel darauf ruhn, der Adler sich seinen Horst baut.
Der Himmelsvogel schlug Feuer, entfachte die Flammen.
Nordwind blies in die Schwende, Ostwind heulte arg,
brannte die Bäume zu Asche, verwandelte alles zu Staub.
Dann nahm der Alte Wäinämöinen die sechs Körner,
holte die sieben Samen aus seinem Marderfell,
dem Beutel aus Eichhorn, der Tasche aus Hermelin,
und ging, das Land zu bestellen, die Samen zu säen.
Dazu sprach er die Worte: Ich bestelle und säe
durch die Finger des Schöpfers, die Hand des Allmächtigen,
in die fruchtbare Erde, den sprießenden Boden.
Akka unter der Erde, Erdweib, Erdherrin!
Mach die Krume treiben, mach den Boden keimen!
Es wird dem Boden an Kraft nicht fehlen,
wenn Bilwisse und Alben es nur gnädig erlauben!
Reg dich, Gottesboden Erde, erheb dich vom Schlaf!
Mach die Halme wachsen, entwickel die Stengel!
Laß tausendfach keimen, hundertfach verzweigen,
was ich gepflügt, gesät, was ich geackert habe!
Obergott Ukko, alter Mann in den Himmeln,
Verwalter der Himmel, Herr über die Wolken!
Sitze Thing in den Wolken, halte Rat in den Himmeln!
Hol eine Wolke aus Osten, ein paar aus Westen,
schick eine aus Norden, laß eine aus Süden kommen!
Laß Regen herabfallen, Honig aus den Wolken triefen,
auf die wachsenden Keime, die rauschende Saat!
Obergott Ukko, der alte Mann in den Himmeln,
saß Thing in den Wolken, hielt Rat in den Himmeln.
Holte eine Wolke aus Osten, ein paar aus Westen,
schickte eine aus Norden, ließ eine aus Süden kommen,
stieß ihre Ränder zusammen, vermengte die Wolken.
Ließ Regen fallen, Honig aus den Wolken triefen,
auf die wachsenden Keime, die rauschende Saat.
Da trieb ein stachliger Sproß, wuchs ein sandfarbener Halm
aus der Krume, die Wäinämöinen geackert hatte.
Am folgenden Tag dann, nach zwei, drei Nächten,
nach einer Woche schließlich ging der Alte Wäinämöinen
nachzusehen, was er gepflügt, was er gesät,
was er geackert hatte. – Da wuchs die Gerste ganz gefällig,
hatte Ähren mit sechs Kanten, Halme mit drei Knoten.
Der wackre Alte Wäinämöinen ging und sah sich um.
Da kam der Frühlingskuckuck, sah die Birke wachsen:
Warum blieb die Birke stehn, wurde der Baum nicht auch gefällt?
Der Alte Wäinämöinen sagte: Die Birke blieb stehn,
sie wurde nicht gefällt – als ein Baum für dich zum Rufen!
Du kannst da kuckuck rufen, du kannst jodeln, Goldbrust,
singen kannst du, Silberbrust, zwitschern, Zinnbrust!
Abends kannst du rufen, morgens, mittags, wann du willst,
für die Herrlichkeit meiner Länder, die Freude meiner Wälder,
für den Wohlstand meiner Küsten, das Wachstum meiner Fluren!
Das dritte Lied,
in welchem sich Wäinämöinens Ruhm als Zauberkundiger verbreitet. Der Lappenbursche Joukahainen zieht aus, sich mit Wäinämöinen im Zaubern zu messen. Als er unterliegt, schlägt er statt dessen einen Zweikampf vor, aber Wäinämöinen weigert sich zu kämpfen; er singt Joukahainen ins Moor. Joukahainen verspricht Wäinämöinen seine Schwester Aino zur Frau, wenn dieser ihn aus dem Morast befreit. Dann fährt Joukahainen nach Hause, wo er betrübt seiner Mutter erzählt, wie es ihm ergangen war. Diese freut sich, einen so berühmten Mann zum Schwiegersohn zu bekommen, doch Aino beweint ihr Schicksal.
Der wackre Alte Wäinämöinen lebte ruhig dahin
auf seinen Fluren, in den Wäldern in Kalewas Land.
Er raunte seine Verse, murmelte seine Sprüche,
Tag auf Tag, Nacht auf Nacht, ununterbrochen –
geheime Worte der Erinnerung an den Ursprung der Dinge,
wie Kinder sie nicht wissen können, Männer kaum verstehen
in dieser bösen Zeit, hier am Rand unseres Abgrunds.
Weithin eilte die Kunde, weit drang die Nachricht
von den Künsten des Alten, von Wäinämöinens Zauberei.
Kunde drang nach Süden, Nachricht bis nach Nordort.
Da war der junge Joukahainen, ein jämmerlicher Lappe.
Der ging einmal in den Ort, da hörte er seltsame Dinge,
daß jemand Zauberworte wisse auf Kalewas Fluren,
in den Wäldern in Kalewas Land, bessere noch dazu,
als er selber wußte, von seinem Vater gelernt hatte.
Das ärgerte Joukahainen gar mächtig, er neidete es
dem Wäinämöinen, daß dieser ein besserer Zauberer war.
Darum trat er vor seine Mutter und Erzieherin
und sagte, daß er hinaus wolle, daß er fahren wolle
in Wäinämöinens Land, sich mit dem Alten zu messen.
Mutter wollte es dem Sohn wehren, Vater verbot es ihm,
zu Wäinämöinen zu fahren, sich mit dem Alten zu messen:
Dort verwünscht man dich, dort verzaubert man dich,
daß du – Maul im Schnee, Kopf im Matsch, Fäuste im Wetter –
weder deine Hände noch Füße mehr rühren kannst.
Doch der junge Joukahainen entgegnete: Vater weiß es,
Mutter weiß es besser, ich aber weiß es am besten.
Wenn ich mich messen, nach Männerart vergleichen will,
sag ich selber meine Verse, selber meine Sprüche her,
dann sing ich den besten Seher in den schlechtesten Seher,
sing ich ihm Steinschuhe an die Füße, Holzhosen um die Hüften,
Steinklotz an die Brust, Steinblock in den Nacken,
Steinfäustlinge an die Hände, Steinhelm auf den Kopf!
Dann fuhr er los. Er gehorchte nicht. Er nahm sein Pferd,
aus dessen Maul Feuer stob, von dessen Hufen Funken sprühten;
er schirrte das feurige Roß vor seinen goldenen Schlitten.
Er setzte sich in den Schlitten, bestieg sein Gefährt,
gab dem Roß die Peitsche, ließ die Perlenschmitze knallen.
Das Pferd kam in Bewegung, der Gaul begann zu laufen.
Er fuhr dahin. Fuhr einen Tag, einen zweiten,
fuhr noch am dritten Tag. An diesem Tage endlich
erreichte er Wäinämöinens Fluren, die Wälder von Kalewas Land.
Der weise Wäinämöinen, der alte Zauberer,
war unterwegs in seinem Schlitten, er fuhr umher
auf seinen weiten Fluren, in den Wäldern von Kalewas Land.
Der junge Joukahainen kam ihm auf dem Weg entgegen –
Deichsel krachte gegen Deichsel, Geschirr gegen Geschirr,
Kummet blieb am Kummet hängen, Krummholz am Krummholz!
Da standen die zwei nun, sie standen und überlegten.
Wasser tropfte von den Krummhölzern, die Deichseln dampften.
Dann fragte der weise Wäinämöinen: Was bist du für einer,
der du dich frech und dreist mir in den Weg stellst?
Du zerbrichst mir mein Kummet, mein neues Krummholz,
verdirbst meinen Schlitten, fährst ihn zu Trümmern!
Der junge Joukahainen antwortete trotzig dem Alten:
Ich bin der junge Joukahainen. Sag du, wer du bist!
Von wo kommst du, Elender, von wem stammst du?
Der wackre Alte Wäinämöinen nannte seinen Namen.
Dann sagte er: Wenn du der junge Joukahainen bist,
dann tritt zur Seite! Du bist doch jünger als ich!
Der junge Joukahainen antwortete trotzig dem Alten:
Wer jünger ist oder älter, spielt doch keine Rolle!
Wer über größeres Wissen verfügt, wer mehr kann,
dem soll der Weg frei sein, der andere soll weichen!
Du bist doch der weise Wäinämöinen, der alte Zauberer,
laß uns also zaubern, unsere Beschwörungen hersagen,
bis der eine vom andern gelernt, den andern besiegt hat!
Der wackre Alte Wäinämöinen aber sagte dazu:
Was bin ich schon für ein Zauberer, was für ein Seher!
Ich verbringe mein Leben auf diesen einsamen Fluren
und höre auf meinen Feldern dem Kuckuck zu.
Doch wie dem auch sei, sag zu, laß mich hören –
was weißt du mehr, was kannst du besser als andere?
Der junge Joukahainen sagte: Ich weiß schon einiges!
Ich weiß zum Beispiel, ich bin dessen ganz sicher,
der Rauchfang ist an der Decke, doch die Flamme im Ofen.
Gut lebt der Seehund im Wasser, schwimmt der Hecht;
sie fressen vor allem Lachse, manchmal auch Felchen.
Der Felchen liebt ruhige Seen, der Lachs blanken Himmel.
Der Hecht laicht bei Frost, die Quappe bei kaltem Wetter.
Der scheue Barsch, der bucklige, schwimmt tief im Herbst,
laicht im Sommer im Trocknen, zappelt an den Ufersteinen.
Wenn dir das nicht reicht, weiß ich noch mehr,
kann ich noch anderes: Im Norden pflügt man mit dem Rentier,
im Süden nimmt man Stuten, im hinteren Lappland wilde Elche.
Ich weiß die Bäume auf dem Teufelsberg, die Föhren auf dem Höllenstein,
hoch sind die Bäume auf dem Teufelsberg, die Föhren auf dem Höllenstein!
Drei reißende Wildwasser gibt es, drei große Seen,
drei hohe Berge stehn unter dem Himmelsdach –
Höllenstrudel im Hämeland, Entenfälle im Karelischen,
unbezwungen der Wuoksenstrom, die brausenden Fälle des Imatra.
Darauf der Alte Wäinämöinen: Kinderwissen, Weiberwissen!
Das steht einem Bartkerl, einem beweibten Mann schlecht an!
Sag geheime Worte vom Ursprung! Sag ewige Dinge!
Da sagte der junge Joukahainen noch folgende Worte:
Ich weiß den Ursprung der Meise, die Meise ist ein Vogel,
die grüne Natter eine Schlange, der Kaulbarsch ist ein Fisch.
Ich weiß, daß Eisen spröde, schwarze Erde sauer ist,
daß heißes Wasser gefährlich ist, Feuer verbrennen kann!
Wasser ist die älteste Salbe, Schaum die älteste Arznei,
Schöpfer der älteste Zauberer, Gott der älteste Schamane!
Wasser hat seinen Ursprung im Berg, Feuer im Himmel,
das Eisen kommt aus dem Rost, das Erz aus dem Felsen.
Nasse Bülte war ältester Boden, die Weide erster Baum,
Kiefernwurzel erste Behausung, hohler Stein der erste Topf.
Der wackre Alte Wäinämöinen aber antwortete darauf:
Weißt du nicht mehr als das? War das wirklich alles?
Der junge Joukahainen sagte dann: Ich weiß noch einiges!
Ich entsinne mich der Zeiten, als ich die Meere pflügte,
als ich ihre Buchten eggte, Grotten für die Fische grub,
als ich die Wassertiefen tiefer machte, die Teiche zu Seen,
als ich die Hügel türmte, aus den Felsen Berge schuf.
Ich war ja der sechste, siebte in der Mannschaft,
die die Erde erschuf, die Himmel darüber spannte,
die Himmelspfeiler errichtete, den Regenbogen hinstellte,
die den Mond hochhievte, die Sonne und die Sterne
mitsamt dem Himmelswagen an die Himmel hängte.
Da sagte der Alte Wäinämöinen: Ein Lügner bist du!
Niemand hat dich gesehn, als man die Meere pflügte,
als man ihre Buchten eggte, Grotten für die Fische grub,
als man die Wassertiefen tiefer machte, die Teiche zu Seen,
als man die Hügel türmte, aus den Felsen Berge schuf.
Auch hat niemand dich gesehn, niemand dich gehört,
als man die Erde erschuf, den Himmel spannte,
die Himmelspfeiler errichtete, den Regenbogen hinstellte,
als man den Mond hochhievte, die Sonne und die Sterne
mitsamt dem Himmelswagen an den Himmel hängte.
Der junge Joukahainen sprach noch folgende Worte:
Wenn mein Wissen nicht reicht, weiß es mein Schwert.
Auf, weiser Wäinämöinen, du großmäuliger Zauberer!
Wir messen unsere Schwerter, prüfen unsere Klingen!
Der Alte Wäinämöinen entgegnete: Ich fürchte weder
Schwert noch Wissen, weder Pickel noch Absichten.
Dennoch will ich mein Schwert nicht messen,
nicht mit dir, du Elender, nicht mit dir, du Tropf!
Da verzog der junge Joukahainen Mund und Gesicht,
daß sein schwarzer Schnauzbart bebte. Dann sagte er:
Wer sein Schwert nicht messen, seine Klinge nicht prüfen will,
den mach ich zum Schwein, verwandel ich in ein Rüsselvieh.
Solche Kerle schmeiß ich bald hierhin, bald dahin,
die kommen auf den Mist, die landen im Stallwinkel!
Da wurde Wäinämöinen böse, ganz ärgerlich und böse.
Begann dann selber seinen Singsang, leierte seine Sprüche her.
Und das waren keine Ammenverse, wahrlich keine Weiberweisen,
sondern was für Männerohren, wovon Kinder noch nichts wissen,
Buben kaum die Hälfte kennen, Freier nicht einmal ein Drittel
in dieser bösen Zeit, hier am Rand unsres Abgrunds.
Als Wäinämöinen sang, schwappten Seen über, bebte die Erde,
eherne Berge begannen zu wanken, große Felsen barsten,
Felsblöcke platzten, am Ufer gingen Steine in Trümmer.
Er sang dem Joukahainen Triebe ans Krummholz,
Weidenbüsche ans Kummet, Pappeln ans Geschirr,
zauberte das goldene Gefährt in morsches Moorholz,
die Peitsche mit der Perlenschmitze in Uferschilf am Meer,
die Blesse in einen Stein am brausenden Fluß.
Er sang das goldene Schwert in einen Blitz am Himmel,
den buntverzierten Bogen in den Regenbogen überm Wasser,
die gefiederten Pfeile in schnellfliegende Falken,
den schiefmäuligen Hund in einen Stein auf dem Acker.
Joukahainens Mütze sang er in einen Wolkenballen,
Joukahainens Fäustlinge in Seerosen auf dem Teich,
Joukahainens grauen Rock in dahinziehende Wolken,
Joukahainens schönen Wollgurt in einen Stern am Himmel.
Joukahainen selber sang er bis zum Gürtel ins Ried,
bis zur Hüfte in den Bruch, bis zur Achsel ins Moor.
Jetzt wußte der junge Joukahainen, jetzt begriff er’s,
daß er tatsächlich sich auf einen Zauberwettkampf
mit dem Alten Wäinämöinen eingelassen hatte.
Er versuchte, den Fuß zu heben – der rührte sich nicht.
Versuchte den anderen Fuß – an dem hing ein Steinschuh.
Da fühlte der junge Joukahainen sich arg bedrängt,
seine Lage gar verdrießlich. Darum sagte er flehend:
Ach, du weiser Wäinämöinen, du alter Zauberer,
nimm deine Zauberworte zurück, sag die Sprüche rückwärts her!
Entlaß mich aus meiner Not, befrei mich aus der Drangsal!
Ich entgelt’s dir, ich zahl dir ein fürstliches Lösegeld.
Der weise Wäinämöinen entgegnete: Was gibst du, wenn ich
die Zauberworte zurücknehme, die Sprüche rückwärts hersage,
dich aus deiner Not entlasse, aus der Drangsal befreie?
Der junge Joukahainen sagte: Ich, ich habe zwei Bogen,
zwei wundervolle Bogen – einer schießt mit schnellem Pfeil,
der andere trifft ins Schwarze. Nimm dir einen davon!
Der Alte Wäinämöinen: Ich mach mit deinen Bogen nichts,
brauche dein Schießzeug nicht! Habe selber Bogen genug,
alle Wände sind voll davon, an jedem Pflock hängt einer –
die gehen allein auf die Jagd, schießen von selber.
Den jungen Joukahainen sang er noch tiefer ins Moor.
Der junge Joukahainen sagte: Ich, ich habe zwei Boote,
zwei wunderbare Nachen – einer wendig im Wettkampf,
der andere gut zu beladen. Nimm dir einen davon!
Der Alte Wäinämöinen: Ich mach mit deinen Booten nichts,
brauche deine Nachen nicht! Habe selber Kähne genug,
an jeder Helling liegen sie, jede Bucht ist voll davon,
die widerstehn allen Stürmen, segeln gegen alle Winde.
Den jungen Joukahainen sang er noch tiefer ins Moor.
Der junge Joukahainen sagte: Ich, ich habe zwei Hengste,
zwei wirklich schöne Pferde – eins ist besser im Rennen,
das andre besser vorm Schlitten. Nimm dir eines davon!
Der Alte Wäinämöinen: Ich mach mit deinen Mähren nichts,
brauche deine Klepper nicht! Habe selber Pferde genug,
an jeder Raufe steht eins, jeder Stall ist voll davon –
Rücken glatt wie Wasser, Kruppen glänzend wie Fett!
Den jungen Joukahainen sang er noch tiefer ins Moor.
Der junge Joukahainen sagte: Ach, du weiser Wäinämöinen!
Nimm deine Zauberworte zurück, sag die Sprüche rückwärts her!
Ich geb dir einen Helm voll Gold, einen Hut voller Silber,
das mein Vater erbeutet, aus dem Krieg mitgebracht hat.
Der Alte Wäinämöinen: Ich mach mit deinem Silber nichts,
brauche auch dein Gold nicht! Habe selber genug;
jeder Speicher ist voll, jede Truhe bis zum Rand gefüllt
mit Gold alt wie der Mond, Silber alt wie die Sonne.
Den jungen Joukahainen sang er noch tiefer ins Moor.
Der junge Joukahainen sagte: Ach, du weiser Wäinämöinen!
Entlaß mich aus meiner Not, befrei mich aus meiner Drangsal!
Ich geb dir meine Schober daheim, meine sandigen Felder,
wenn ich meinen Kopf damit retten, mich erlösen kann.
Der Alte Wäinämöinen: Ich will deine Schober nicht,
du Schlingel, auch deine Felder nicht! Habe selber genug,
Felder liegen um jede Ecke, Schober stehn an jeder Wiese.
Meine Felder sind viel besser, meine Schober sind mir lieber.
Den jungen Joukahainen sang er tiefer und tiefer.
Da wurde dem jungen Joukahainen nun wirklich bange,
als er bis zum Kinn im Morast, bis zum Bart im Sumpf stand,
bis zum Mund im Ried, mit den Zähnen im Moorholz.
Der junge Joukahainen flehte: O weiser Wäinämöinen,
du alter Zauberer! Nimm doch deinen Zauber zurück,
schenk mir mein elendes Leben, laß mich raus von hier!
Der Strom saugt an meinen Füßen, der Sand kratzt mir die Augen.
Nimm doch die Zauberworte zurück, löse den Bann!
Ich geb dir meine Schwester Aino, das Kind meiner Mutter,
dir deine Stube zu kehren, deine Böden zu fegen,
dir deine Kästen zu säubern, deine Tücher zu waschen,
deine goldenen Decken zu weben, dein Honigbrot zu backen.
Das nun gefiel dem Alten Wäinämöinen gar mächtig,
daß Joukahainen ihm für seine alten Tage ein Mädchen versprach.
Er setzte sich auf einen Stein, seinen Zauberstein.
Murmelte eine Weile, noch eine Weile, dann noch eine –
nahm seine Zauberworte zurück, sagte die Sprüche rückwärts her.
So kam Joukahainen frei, rettete er sein Kinn aus dem Morast,
seinen Bart aus dem Sumpf. Sein Pferd war kein Stein,
sein Schlitten kein Moorholz, seine Peitsche kein Schilf mehr.
Er bestieg seinen Schlitten, stürzte in sein Gefährt
und fuhr gar traurigen Mutes, mit Trübsal im Herzen
zu seiner lieben Mutter, seiner Erzieherin nach Haus.
Er fuhr, daß der Schlitten krachte, fuhr auf seltsame Weise,
stieß gegen die Tennenwand, zerbrach die Deichsel am Vorhaus.
Die Mutter dachte es, aber der Vater sprach es aus:
Grundlos zerbrichst du den Schlitten, unnötig die Deichsel!
Merkwürdig kommst du nach Haus, als wärst du ganz außer dir!
Da zerfloß der junge Joukahainen in Tränen,
er war niedergeschlagen, traurig, mit hängendem Kopf,
die Lippen zusammengekniffen, mit triefender Nase.
Da fragte die Mutter, die ihn zur Welt gebracht:
Was weinst du, mein Sohn, was heulst du, den jung ich geboren,
was flennst du mit verkniffenen Lippen und triefender Nase?
Der junge Joukahainen sagte: O Mutter, meine Gebärerin!
Ich hab schon Grund zu weinen, man hat mich verzaubert,
ich hab guten Grund, über den Zauber zu weinen!
Ich werde ewig darum trauern, mein Leben lang weinen!
Ich gab meine Schwester Aino weg, versprach meiner Mutter Kind
dem Wäinämöinen als Hilfe, dem Zauberer zum Weib,
dem Tattergreis als Stütze, dem Nichtsnutz als Beistand.
Doch Joukahainens Mutter rieb erfreut ihre Hände
und sagte vergnügt: Weine doch nicht, mein Sohn!
Es gibt nichts zu weinen, es gibt keinen Grund zur Trauer!
Das hab ich mir doch mein Leben lang gewünscht,
daß ich den Helden, den großen Mann in meine Familie bekäme,
den Wäinämöinen zum Schwiegersohn, den Zauberer zum Eidam.
Joukahainens Schwester aber fing an zu weinen.
Zwei Tage saß sie auf dem Boden im Vorhaus und weinte –
vor großer Trauer weinte sie, vor Trübsal im Herzen.
Endlich sprach ihre Mutter: Tochter Aino, was weinst du?
Du kommst zu einem großen Bräutigam in ein großes Haus,
da kannst du am Fenster sitzen, auf der Bank und plaudern!
Die Tochter aber entgegnete: O Mutter, die mich geboren!
Warum ich weine? Ich weine um meine schönen Zöpfe,
um mein dichtes, junges Haar, meine schönen Flechten,
weil ich sie so früh bedecken, so jung schon verhüllen soll.
Ewig werd ich die Lieblichkeit der Sonne beweinen,
die Anmut des leuchtenden Monds, die Herrlichkeit des Himmels,
wenn ich sie so jung schon vergessen, als Kind zurücklassen muß
auf dem Schreinerplatz des Bruders unter Vaters Fenster.
Da sagte die Mutter zu Aino, ihrem ältesten Kind:
Dummes Ding mit deinen Sorgen, Tränenliese mit deinem Geheul!
Es gibt keinen Grund zur Trauer, keine Ursache für Trübsal.
Gottes Sonne scheint auch anderswo auf der Welt,
nicht bloß vor Vaters Fenster, an deines Bruders Gatter.
Du kannst im Wald und auf Wiesen Beeren pflücken
unter genau demselben Himmel, nur an einem anderen Ort,
nicht bloß auf Vaters Wiesen, an deines Bruders Acker.
Das vierte Lied,
in welchem Wäinämöinen im Wald Joukahainens Schwester Aino begegnet und um ihre Hand anhält, das Mädchen aber weinend nach Hause läuft und ihrer Mutter von dem Begebnis erzählt. Die Mutter fordert Aino auf, nicht zu klagen, sondern sich nett anzuziehen und sich im Dorf sehen zu lassen. Aino sagt, sie werde den alten Mann nie heiraten. Weinend verläßt sie das Haus, verirrt sich im Wald und gelangt an die Küste des Meers, in das sie hinausschwimmt und dabei im Wasser untergeht. Die Mutter beweint Tag und Nacht ihre tote Tochter.
Die junge Aino, Joukahainens Schwester,
ging in den Wald, Reiser zu schneiden, Birkenbüschel fürs Bad.
Schnitt ein Büschel für den Vater, eines für die Mutter,
schnürte ein drittes Büschel für den jungen Bruder.
Sie war auf dem Heimweg, ging gemächlich durch die Erlen,
als Wäinämöinen kam und das Mädchen in den Büschen sah,
den Schönrock auf der Wiese, und er es ansprach:
Nur für mich, du junge Magd, nie für andere
trag die Perlen um den Hals und leg dein Brustkreuz an,
steck deine Zöpfe auf, binde dir Seidenbänder ins Haar!
Das Mädchen aber sagte: Nie für dich, nie für andere
trag ich mein Brustkreuz, bind ich mir Seidenbänder ins Haar.
Mich verlangt nicht nach fremdem Tuch und Brot aus Weizen;
mir reichen die einfachen Kleider, die Schwarzbrotkanten
bei meinem guten Vater, meiner lieben Mutter.
Sie riß ihr Kreuz von der Brust, die Ringe vom Finger,
nahm die Perlen vom Hals, die roten Bänder aus dem Haar,
warf sie auf die Erde, ließ sie im Walde zurück.
Weinend lief sie nach Haus, schluchzend auf den Hof.
Ihr Vater saß am Fenster, schnitzte einen Axtschaft:
Warum weinst du, armes Mädchen, junges Ding?
Ich hab schon Grund zu weinen, mein Leid zu beklagen!
Warum ich weine, lieber Vater, was ich beklage?
Mir fiel das Kreuz von der Brust, der Schmuck vom Gürtel,
von der Brust das Silberkreuz, eherne Litzen vom Gürtel.
Ihr Bruder saß am Gatter, er schnitzte ein Krummholz:
Warum weinst du, arme Schwester, junges Ding?
Ich hab schon Grund zu weinen, mein Leid zu beklagen!
Warum ich weine, lieber Bruder, was ich beklage?
Mir fiel der Ring vom Finger, die Perlen fielen vom Hals,
vom Finger der goldene Ring, die Silberperlen vom Hals.
Ihre Schwester saß in der Stube, webte einen goldenen Gürtel:
Warum weinst du, arme Schwester, junges Ding?
Ich hab schon Grund zu weinen, mein Leid zu beklagen!
Warum ich weine, liebe Schwester, was ich beklage?
Mir fiel Gold von den Schläfen, Silber aus den Haaren,
blaue Seide von der Stirn, rote Bänder vom Haupt.
Ihre Mutter stand vorm Speicher und schöpfte Rahm:
Warum weinst du, armes Mädchen, junges Ding?
Ach liebe Mutter, meine schöne Gebärerin, Ernährerin!
Ich hab schon Ursache, schlimme Gründe zu trauern!
Warum ich weine, liebe Mutter, was ich beklage?
Ging in den Wald, Reiser zu schneiden, Birkenbüschel fürs Bad.
Schnitt ein Büschel für den Vater, eins für die Mutter,
schnürte ein drittes Büschel für den jungen Bruder.
Auf dem Heimweg ging ich über die Felder,
als mein Freier, mein Versprochener kam und sagte:
Nur für mich, du junge Magd, nie für andere
trag die Perlen um den Hals und leg dein Brustkreuz an,
steck deine Zöpfe auf, binde dir Seidenbänder ins Haar!
Ich riß das Kreuz von der Brust, nahm die Perlen vom Hals,
die blaue Seide von der Stirn, die roten Bänder aus dem Haar,
warf sie auf die Erde, ließ sie im Walde zurück.
Und dann sagte ich ihm: Nie für dich, nie für andere
trag ich mein Brustkreuz, bind ich mir Seidenbänder ins Haar.
Mich verlangt nicht nach fremdem Tuch und Brot aus Weizen;
mir reichen die einfachen Kleider, die Schwarzbrotkanten
bei meinem guten Vater, meiner lieben Mutter.
Da tröstete die Mutter ihr ältestes Kind:
Weine nicht, meine Tochter, die jung ich geboren!
Ißt du ein Jahr nur Butter, wirst du gewandter als andere,
ißt du ein Jahr Schweinefleisch, wirst du sanfter als andere,
ißt du ein Jahr Sahnepasteten, wirst du schöner als andere.
Geh ins Vorratshaus hinauf, in den größten Speicher.
Dort steht Truhe neben Truhe, Kasten auf Kasten.
Mach die schönste Truhe auf, heb den Bunten Deckel;
dort liegen sechs goldene Gürtel, sieben blaue Röcke.
Die hat die Mondfee gewebt, die Sonnenfee vollendet.
Als ich noch ein junges Mädchen war, eine Jungfer wie du,
ging ich einmal in den Wald, nach Himbeeren am Hang.
Da hörte ich die Mondfee weben, die Sonnenfee spinnen
bei den blauen Wäldern, am Rand meines Lieblingshains.
Ich näherte mich ihnen, ging ganz nahe heran.
Und dann flehte ich sie an, ich sagte zu ihnen:
Mondfee, Sonnenfee, gebt von euerm Gold, euerm Silber
dem armen Mädchen hier, dem Kind, das euch anfleht!
Da gab die Mondfee Gold, die Sonnenfee gab Silber.
Das Gold tat ich an die Schläfen, das Silber ins Haar!
Kam stolz wie eine Blume, frohen Mutes auf den Vaterhof.
Ich trug’s einen Tag, einen zweiten. Am dritten Tag
nahm ich das Gold von den Schläfen, das Silber aus dem Haar,
brachte es in den Speicher, legte es in die Truhe.
Da hat es seither gelegen, nicht mal angeschaut hab ich’s.
Leg du die Seide um die Stirn, das Gold an die Schläfen,
die Perlen um den Hals, das Goldkreuz an die Brust!
Zieh ein Leinenhemd an, nimm ein Tuch aus feinstem Linnen.
Zieh einen bunten Rock an, dazu einen seidenen Gürtel,
zieh feine seidene Strümpfe an und schöne Lederschuhe!
Steck deine Zöpfe auf, flicht dir Seidenbänder ins Haar,
steck Goldringe an die Finger, Goldreifen an die Arme!
Dann kommst du vom Speicher in die Stube zurück,
deiner Familie zur Zier, der ganzen Sippe zum Stolz.
Gehst wie eine Blume durchs Dorf, schön wie eine Beere,
prächtiger und schmucker, als man dich je gesehn hat.
Solche Worte sagte die Mutter zu ihrem Kind.
Doch dies hörte nicht hin, es gehorchte der Mutter nicht,
es ging weinend hinaus, gramerfüllt aus dem Haus.
Draußen dann sagte das Mädchen zu sich:
Wie denken die Seligen, wie ist der Glücklichen Sinn?
So denken die Seligen, so ist der Gücklichen Sinn –
wie wallendes Wasser, wie ein Schwappen im Trog.
Wie denken arme Geschöpfe, wie ist der Elenden Sinn?
So denken arme Geschöpfe, so ist der Elenden Sinn –
wie harscher Schnee am Hang, Wasser im tiefen Brunnen.
Oft wandert mein Sinn, ach, ich glückloses Kind,
durch welkes, vorjähriges Gras, stapft durch den Wald,
streift über die Wiesen, kriecht durchs Gebüsch –
wie Pech ist mein Sinn, mein Herz kaum weißer als Kohle.
Besser hätt ich’s gehabt, besser wär es gewesen,
wär ich nicht geborn, nicht gewachsen, nicht groß geworden
für diese schlimmen Tage, in dieser freudlosen Welt.
Wär ich nach sechs Nächten, acht Nächten gestorben,
hätt es nicht viel bedurft – eine Spanne Leinwand,
ein Fleckchen Ackerrain, Mutter hätte ein wenig geweint,
Vater schon weniger, Bruder hätte keine Träne verloren.
Sie weinte zwei Tage in einem. Dann fragte ihre Mutter:
Warum weinst du, armes Mädchen, was beklagst du?
Darum wein ich armes Mädchen, das beklage ich,
daß du mich weggegeben, dein Kind versprochen hast,
dem Alten zur Hilfe befohlen, dem Schlohkopf zur Freude,
dem Tattergreis als Stütze, dem Nichtsnutz als Beistand.
Hättest mich doch lieber den Wogen anbefohlen,
den Felchen als Schwester, als Freundin den Fischen im Wasser!
Besser lebt man im Meer, wohnt man unter den Wellen,
den Felchen als Schwester, als Freundin den Fischen im Wasser,
denn als Hilfe dem Alten, als Stütze dem Tattergreis,
der über die eigenen Socken stolpert, über trockene Äste fällt.
Dann ging sie zum Vorratshaus, betrat sie den Speicher.
Sie machte die schönste Truhe auf, hob den Bunten Deckel.
Darin fand sie sechs goldene Gürtel, sieben blaue Röcke;
die zog sie an, schmückte ihren Körper damit.
Sie tat Gold an die Schläfen, tat Silber ins Haar,
blaue Seide um die Stirn, rote Bänder in die Flechten.
Dann ging sie über Felder, lief andere Felder entlang,
lief über Moore, über Wiesen, durch finstere Wälder.
Beim Gehen sang sie, beim Laufen sprach sie:
Mein Herz ist schwer, mein Kopf ist schwerer als Stein.
Nicht schwerer wäre das Herz, nicht mehr schmerzte der Kopf,
wenn ich Arme sterben würde, wenn ich zerbrechen würde
an diesem großen Kummer, an diesem trüben Sinnen.
Vielleicht wär’s an der Zeit, aus der Welt zu scheiden,
nach Tuonela zu gehn, das Totenland aufzusuchen!
Vater würde nicht weinen, Mutter wär mir nicht böse,
Schwester würde nicht greinen, Bruder keine Träne vergießen,
wenn ich ins Wasser fiele, zu den Fischen ins Meer ginge,
tief unter die Wellen, auf den schwarzen Bodengrund.
Sie ging einen Tag, einen zweiten. Am dritten Tag
erreichte sie das Meer, hielt am schilfigen Ufer an,
als die Nacht sie überraschte, die Finsternis sie festhielt.
Das Mädchen weinte den Abend, klagte die ganze Nacht
auf einem Stein am Ufer, an einer weitläufigen Bucht.
Am frühen Morgen sah es über die Landspitze hinaus,
sah drei Jungfrauen an ihrem Ende – sie badeten im Meer!
Aino wollte die vierte sein, die fünfte junge Gerte!
Sie warf ihr Hemd über die Weide, den Rock über die Erle,
die Strümpfe auf die Erde, die Schuhe auf den Uferstein,
legte die Perlen in den Sand, die Ringe auf den Strand.
Im Meer war der Bunte Stein, eine goldschimmernde Klippe;
zu dem Stein wollte sie hinaus, zu der Klippe hin fliehn.
Als sie draußen auf dem Wasser war, setzte sie sich
auf den Bunten Stein, auf die schimmernde Klippe.
Da tauchte der Stein ins Wasser, da versank die Klippe.
Das Mädchen versank mit dem Stein, Aino mit der Klippe.
Dahin schwand das Vögelchen, starb das arme Mädchen.
Sie sagte noch im Sterben, sprach beim Ertrinken:
Ich ging baden im Meer, schwamm aufs weite Wasser hinaus,
da starb ich Vögelchen, ich armes, einen frühen Tod.
Möge mein Vater nie mehr, um nichts in der Welt,
an diesem großen Meer Fische aus dem Wasser ziehn!
Ich ging mich waschen am Ufer, ging baden im Meer,
da starb ich Vögelchen, ich armes, einen frühen Tod.
Möge meine Mutter nie mehr, um nichts in der Welt,
aus dieser weiten Bucht Wasser in den Brotteig rühren!
Ich ging mich waschen am Ufer, ging baden im Meer,
da starb ich Vögelchen, ich armes, einen frühen Tod.
Möge mein Bruder nie mehr, um nichts in der Welt,
am Ufer dieses Meers sein Schlachtroß tränken!
Ich ging mich waschen am Ufer, ging baden im Meer,
da starb ich Vögelchen, ich armes, einen frühen Tod.
Möge meine Schwester nie mehr, um nichts in der Welt,
am Steg dieser weiten Bucht ihre Augen spülen!
Alles, was an Wasser im Meer ist, ist mein Blut,
was an Fischen im Meer ist, ist mein Fleisch,
was an Reisern am Ufer ist, sind meine Rippen,
was an Gräsern am Ufer ist, ist aus meinem Haar gerauft.
So fand das Mädchen den Tod, das Vögelchen sein Ende.
Wer soll die Nachricht melden, die Botschaft bringen
ins weitbekannte Haus der Jungfrau, auf den stolzen Hof?
Der Bär soll die Nachricht melden, die Botschaft bringen!
Der Bär meldet’s nicht – der läuft hinter den Kühen her!
Wer soll die Nachricht melden, die Botschaft bringen
ins weitbekannte Haus der Jungfrau, auf den stolzen Hof?
Der Wolf soll die Nachricht melden, die Botschaft bringen!
Der Wolf meldet’s nicht – der läuft hinter den Schafen her!
Wer soll die Nachricht melden, die Botschaft bringen
ins weitbekannte Haus der Jungfrau, auf den stolzen Hof?
Der Fuchs soll die Nachricht melden, die Botschaft bringen!
Der Fuchs meldet’s nicht – der läuft hinter den Gänsen her!
Wer soll die Nachricht melden, die Botschaft bringen
ins weitbekannte Haus der Jungfrau, auf den stolzen Hof?
Der Hase soll die Nachricht melden, die Botschaft bringen!
Der Hase mit fester Stimme: Ich werd die Worte nicht verlieren!
Da begann der Hase zu laufen, das Langohr zu hoppeln,
das Krummbein zu eilen, das Kreuzmaul zu rennen
ins weitbekannte Haus der Jungfrau, auf den stolzen Hof.
Er lief bis zur Saunatür, kauerte vor der Schwelle.
Das Bad voller Mädchen mit Birkenbüscheln, sie sagten:
Kommst du in den Topf gelaufen, Schielauge, in die Pfanne,
dem Bauern zum Abendessen, der Bäurin zum Mittagessen,
der Tochter zum Imbiß, dem Sohn zur Vesper?
Da sagte der Hase, machte Schielauge sich groß:
Mir scheint, im Topf will der Teufel gekocht werden!
Ich kam, Nachricht zu melden, Botschaft zu bringen,
daß unsere Schöne tot ist, die Zinnbrust zerbrochen ist,
der Silberschmuck verschwunden, der eherne Gürtel versunken.
Sie ging in das launische Meer, tief unter die Wellen,
den Felchen als Schwester, als Freundin den Fischen im Wasser!
Mutter begann zu weinen, Tränen flossen in Strömen.
Endlich konnte sie sagen, konnte die Arme es klagen:
Tut nie und nimmer, arme Mütter, um nichts in der Welt,
eure Töchter hinschaukeln, eure Kinder hingaukeln
gegen ihren Willen in die Ehe, wie ich arme Mutter
meine Tochter geschaukelt, mein Vögelchen verzogen hab!
Mutter weinte, Tränen rollten, strömten wie Bäche
aus den blauen Augen auf die vergrämten Wangen.
Eine Träne rollte, eine zweite, sie strömten wie Bäche
von den vergrämten Wangen auf die blühende Brust.
Eine Träne rollte, eine zweite, sie strömten wie Bäche
von der blühenden Brust auf den bunten Rocksaum.
Eine Träne rollte, eine zweite, sie strömten wie Bäche
von dem bunten Rocksaum auf die roten Strümpfe.
Eine Träne rollte, eine zweite, sie strömten wie Bäche
von den roten Strümpfen auf die goldenen Schuhe.
Eine Träne rollte, eine zweite, sie strömten wie Bäche
von den goldenen Schuhen auf den Boden unter den Füßen;
die Bäche flossen auf die Erde, sie strömten ins Wasser.
Auf der Erde schwollen die Wasser zu Flüssen an,
drei Flüsse entstanden aus dem herausgeweinten Wasser,
das durch den Kopf geströmt, aus den Augen geflossen war.
In jedem Fluß bildeten sich drei schäumende Schnellen,
aus der Gischt jeder Schnelle erhoben sich drei Klippen,
bei jeder Klippe erhob sich ein goldener Hügel,
auf der Kuppe jedes Hügels wuchsen drei Birken,
im Wipfel jeder Birke saßen drei Kuckucke.
Die drei Kuckucke riefen. Einer rief: Liebe, Liebe!
Einer: Geliebte, Geliebte! Der dritte: Freude, Freude!
Der, der Liebe, Liebe! rief, rief drei Monate
für das Mädchen ohne Liebe, das unter den Wellen lag.
Der, der Geliebte, Geliebte! rief, rief sechs Monate
für den Freier ohne Gegenliebe, der in seiner Trübsal saß.
Der, der Freude, Freude! rief, rief das ganze Leben lang
für die Mutter ohne Freude, die unaufhörlich weinte.
Die Mutter sagte, als sie den Kuckuck hörte:
Ach, ich Arme kann den Kuckuck nicht hören!
Wenn der Kuckuck ruft, dann sinkt mir das Herz,
füllen sich die Augen, rinnt das Wasser über die Wangen,
in Tränen größer als Erbsen, dicker als Bohnen;
sie kürzen eine Elle das Leben, altern eine Spanne den Leib;
wenn der Frühlingskuckuck ruft, siecht der Körper dahin.
Das fünfte Lied,
in welchem Wäinämöinen versucht, Joukahainens Schwester aus dem Meer zu angeln, aber nur einen merkwürdigen Fisch fängt. Als er seinen Fang zerlegen will, gleitet ihm dieser aus den Händen und zurück ins Wasser; dabei teilt der Fisch seine wirkliche Identität mit. Vergeblich versucht Wäinämöinen, den Fisch ein zweites Mal zu fangen. Betrübt kehrt er nach Hause zurück, wo seine verstorbene Mutter ihm rät, statt dessen nach Nordort zu fahren und um die Tochter dort zu freien.
Die Nachricht war gemeldet, die Botschaft überbracht
vom Tod des jungen Mädchens, dem Ende der schönen Jungfrau.
Der wackre Alte Wäinämöinen war zutiefst betrübt;
er weinte abends, morgens, weinte nächtens noch mehr,
über den Tod des jungen Mädchens, der schönen Jungfrau,
die ins launische Meer gegangen war, tief unter die Wellen.
Trauernd, seufzend, düster im Herzen ging er
an die Küste des blauen Meers. Dort sagte er laut:
Untamo, Schläfer unter der Welt, sag deine Gesichte:
Wo hausen die Söhne des Nöck, tummeln sich Wellamos Töchter?
Untamo, der Schläfer unter der Welt, sagte seine Gesichte:
Da hausen die Söhne des Nöck, tummeln sich Wellamos Töchter,
am Ende der dunstigen Landzunge, der nebligen Insel,
tief unter den Wellen, auf dem schwarzen Bodengrund.
Da hausen die Söhne des Nöck, tummeln sich Wellamos Töchter,
in einem winzigen Häuschen, in einer ganz kleinen Kammer
an dem Bunten Stein, gleich neben dem mächtigen Felsen!
Der Alte Wäinämöinen ging zum Bootshafen hinunter,
suchte sich eine Angelschnur, wählte eine passende Angel,
steckte die Angel in den Ranzen, den Haken in den Beutel.
Dann ruderte er aufs Meer hinaus und erreichte das Eiland,
das Ende der dunstigen Landzunge, der nebligen Insel.
Dort begann er zu angeln, warf er die Angelschnur aus,
schwenkte er den Kescher. Er senkte den Köder ins Meer,
angelte, prüfte den Köder. Die eherne Rute zitterte,
die silberne Leine schwirrte, die goldene Angelschnur sauste.
Bis nach einigen Tagen dann, an einem Morgen endlich
ein Fisch anbiß, eine Forelle am Angelhaken hing.
Die hievte er in den Kahn, auf den Boden des Boots.
Er besah und wendete den Fisch. Dann sprach er erstaunt:
Was ist das für ein Fisch, daß ich den gar nicht kenne!
Zu glatt für einen Felchen, zu bleich für eine Forelle,
zu hell für einen Hecht, zu flossenlos für eine Quappe;
zu seltsam für einen Menschen, hat kein Stirnband wie ein Mädchen,
keinen Gürtel wie eine Meerjungfrau, keine Ohren wie ein Weib.
Zu sanft für einen Lachs, für einen Barsch der tiefen Wellen.
Wäinämöinen trug im Gürtel ein Messer mit silbernem Knauf.
Er zog das silberne Messer aus der ledernen Scheide,
um den Fisch in Stücke zu schneiden, den Lachs zu zerlegen,
daß er ihn zum Frühstück esse, als Imbiß zur Vesper,
als Gericht zum Mittagsbrot, zum großen Nachtmahl.
Er wollte den Lachs mit dem Messer zerlegen –
der glatte Fisch schnellte in die Höhe, ins Wasser zurück
vom Boden des roten Boots, aus Wäinämöinens Nachen heraus.
Dann hob der Fisch seinen Kopf, reckte die rechte Schulter
beim fünften Windstoß aus dem sechsten Wellenkamm,
hob den rechten Arm, streckte das linke Bein
aus der siebten Welle, der neunten Dünung hervor.
Von dort dann ließ der Fisch sich vernehmen:
O weiser Wäinämöinen! Ich sollte doch nicht zu dir kommen
um von dir in Stücke geschnitten, als Lachs zerlegt,
zum Frühstück gegessen zu werden, als Imbiß zur Vesper,
als Gericht zum Mittagsbrot, zum großen Nachtmahl.
Wäinämöinen entgegnete: Als was solltest du denn kommen?
Als Vögelchen sollte ich kommen in deine Arme,
um immer bei dir zu sein, deine lebenslange Gefährtin,
die dir das Lager bereitet, dir die Kissen aufschüttelt,
dir dein Häuschen reinigt, dir den Boden fegt,
dir den Ofen in der Stube heizt, dir das Feuer schürt,
dir das feste Brot bereitet, dir das Honigbrot backt,
die dir den Bierkrug reicht und das Essen hinstellt.
Ich war kein Lachs, kein Barsch der tiefen Wellen.
Ich war das junge Weib, Joukahainens Schwester,
die du immer gewollt, dein Leben lang begehrt hast.
O du elender Alter, du närrischer Wäinämöinen,
es gelang dir nicht, Wellamos Wasserjungfrau zu halten,
das teure Kind des Nöck!
Der Alte Wäinämöinen sagte, betrübt und niedergeschlagen:
Ach, Joukahainens Schwester! Komm doch ein zweites Mal!
Sie kam kein zweites Mal, sie wurde nie mehr gesehn,
sie zog sich in die Tiefe, verschwand vom Wasserspiegel,
ins Innere des Bunten Steins, in einen braunen Spalt hinein.
Der wackre Alte Wäinämöinen dachte lange, überlegte,
wie zu sein, wie zu leben. Dann knüpfte er ein Seidennetz
und zog es durchs Wasser, Sund hin, Sund her,
zog es durch seichte Wasser, durch lachsreiche Klippen,
durch alle Meerengen und Wasserläufe in Kalewas Land,
zog es durch dunkle Tiefen, über große Wasserweiten,
durch Joukahainens Flußlandschaft und Lapplands Buchten.
Er fing andere Fische genug, allerlei Wassergetier,
nur diesen einen Fisch nicht, den er im Sinn hatte –
Wellamos Wasserjungfrau, das teure Kind des Nöck.
Der Alte Wäinämöinen sagte, betrübt und niedergeschlagen,
mit hängendem Kopf beklagte er sein Schicksal:
Ach, ich Narr, ich Dummkopf, was bin ich für ein Mann!
Ich war doch bei Verstand, hab doch denken können,
hab ein Herz mit Gefühlen gehabt – so war es früher.
Doch heute, jetzt in dieser schlimmen Zeit,
am Abend meines Mannesalters ist der Kopf mir durcheinander –
nichts, wie es gewesen, alles anders, als es sein soll!
Wellamos Wasserjungfrau, die jüngste Tochter des Nöck,
auf die ich immer gewartet, die ich mein halbes Leben
zur Gemahlin, zur ewigen Gefährtin begehrte,
sie hing mir an der Angel, sie fiel mir ins Boot!
Es gelang mir nicht, sie zu halten und heimzuführen,
ich ließ sie ins Wasser fallen, tief unter die Wellen!
Wäinämöinen ging seines Wegs, trauernd, seufzend
wanderte er heimwärts. Er grübelte und sagte:
Ehmals rief mir der Kuckuck, mein Freudenkuckuck,
rief ehmals am Abend, am Morgen, manchmal auch mittags.
Was hat ihm die Stimme, die schöne Stimme genommen?
Kummer hat ihm die Stimme, die liebe Stimme genommen;
man hört ihn nicht mehr bei Sonnenuntergang rufen,
meinem Abend zur Freude, meinem Morgen zur Linderung.
Ich weiß nicht, was ich soll mit meinem Leben,
wie ich sein soll in der Welt, durch die Lande wandern soll.
Wäre meine Mutter am Leben, meine Erzieherin noch da,
könnte sie mir sagen, wie ich mich aufrecht halten kann,
ohne vor Kummer zu zerbrechen, vor Trauer zu vergehn
in diesen schlimmen Zeiten, mit Trübsal im Herzen!
Seine Mutter erwachte im Grab, ließ sich aus der Tiefe vernehmen:
Noch lebt deine Mutter, noch ist deine Erzieherin da,
um dir zu sagen, wie du dich aufrecht halten kannst,
ohne vor Kummer zu zerbrechen, vor Trauer zu vergehn
in diesen schlimmen Zeiten, mit Trübsal im Herzen!
Hol dir ein Mädchen aus Nordort! Die sind dort hübscher,
die Jungfrauen doppelt so schön, fünfmal, sechsmal lebhafter
als Joukahainens Schlafmützen, die Transusen in Lappland.
Heirate, mein Sohn, die beste der Töchter von Nordort,
eine, die dir gefällt, die anzusehn eine Freude ist,
die wendig ist und immer flink auf den Beinen!