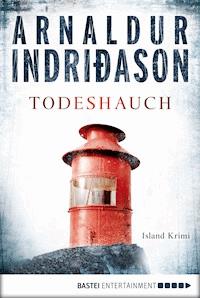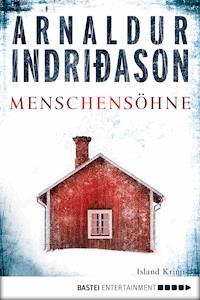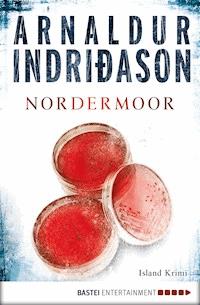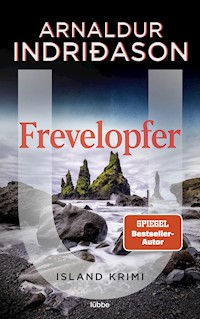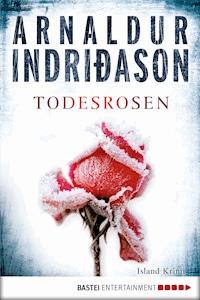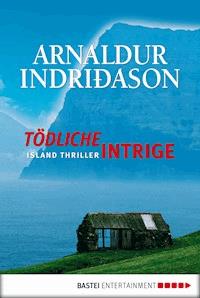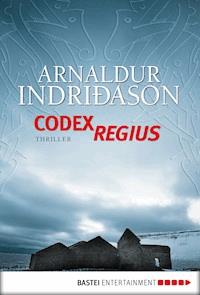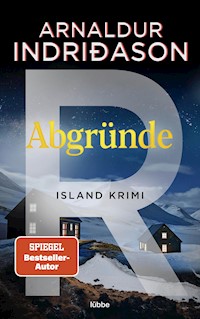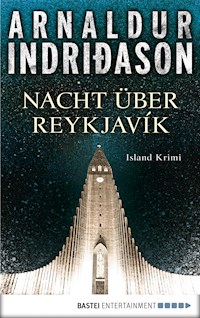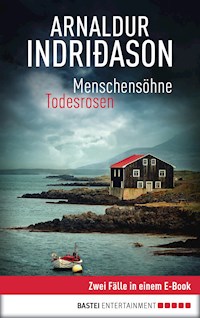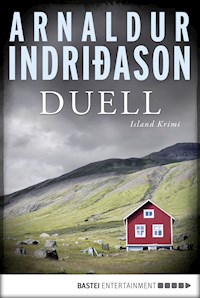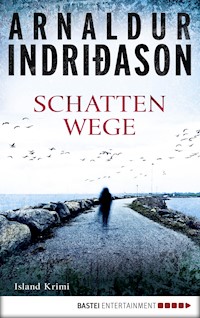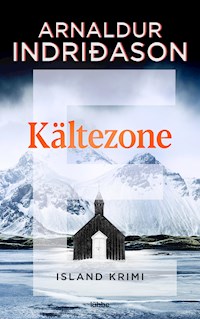
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar Erlendur
- Sprache: Deutsch
In einem See südlich von Reykjavík wird ein Toter entdeckt. Der Wasserspiegel hatte sich nach einem Erdbeben drastisch gesenkt und ein menschliches Skelett sichtbar werden lassen, das an ein russisches Sendegerät angekettet ist. Ein natürlicher Tod ist ausgeschlossen. Hat man sich hier eines Spions entledigt? Erlendur, Elínborg und Sigurður Óli von der Kripo Reykjavík werden mit der Lösung des Falls beauftragt. Ihre Nachforschungen führen sie in das Leipzig der Nachkriegsjahre, wo eine tragische Geschichte um Liebe, Verlust und berechnender Grausamkeit ihren Anfang nahm ... Kommissar Erlendur Sveinsson ermittelt in seinem sechsten Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorbemerkung
Zitat
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Arnaldur Indriðason
Kältezone
Island-Krimi
Aus dem Isländischen vonColetta Bürling
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der isländischen Originalausgabe: Kleifarvatn
erschienen bei Vaka-Helgafell, Reykjavík
© 2004 by Arnaldur Indriðason
© für die deutschsprachige Ausgabe 2005 by Bastei Lübbe AG, Köln
All rights reserved
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel
Titelillustration: Jonathan Andrew/Corbis
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1266-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorbemerkung:
In Island duzt heutzutage jeder jeden. Man redet sich nur mit dem Vornamen an. Dies wurde bei der Übersetzung beibehalten.
Namen, Personen und Begebenheiten in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Schlafe – ich liebe dich.AUS EINER VOLKSWEISE
Eins
Sie blieb wie angewurzelt stehen und starrte auf die Knochen, die nicht dort hätten sein sollen. Genauso wenig wie sie selbst.
Zunächst glaubte sie, dass es sich wieder um ein Schaf handelte, das im See ertrunken war, aber als sie näher kam, sah sie nicht nur den Schädel auf dem Boden des Sees, der halb eingegraben war, sondern auch die Umrisse eines menschlichen Skeletts. Einige Rippen ragten aus dem Sand heraus, und unterhalb davon zeichneten sich die Konturen des Beckens und der Schenkelknochen ab. Das Skelett lag auf der linken Seite, und sie sah die rechte Hälfte des Schädels, die leere Augenhöhle und drei Zähne im Oberkiefer, einer davon mit einer großen Amalgam-Füllung. Am Schläfenbein klaffte ein großes Loch. Ihr erster Gedanke war, ob es wohl von einem Hammer herrührte. Sie bückte sich und starrte auf den Schädel. Zögernd steckte sie einen Finger in das Loch. Es war voll Sand.
Sie wusste nicht, wieso ihr ein Hammer einfiel, und die Vorstellung, dass jemand einen Hammer mit solcher Wucht an den Kopf bekommen hatte, war entsetzlich. Außerdem war das Loch viel zu groß für einen Hammer, es hatte ungefähr die Größe einer Streichholzschachtel. Sie beschloss, das Skelett nicht mehr anzurühren. Sie zog ihr Mobiltelefon aus der Tasche und wählte die dreistellige Nummer.
Sie überlegte, wie sie sich ausdrücken sollte. Das Ganze war irgendwie unwirklich – ein Skelett so weit draußen im See und halb im sandigen Boden vergraben. Und sie war alles andere als in Topform. Ihr fiel nichts anderes ein als Hämmer und Streichholzschachteln. Sie konnte sich kaum konzentrieren. Die Gedanken schwirrten in ihrem Kopf herum, und sie hatte enorme Probleme, sie zu bändigen.
Es lag bestimmt daran, dass sie so verkatert war. Eigentlich hatte sie vorgehabt, heute zu Hause zu bleiben, dann aber hatte sie sich kurzfristig umentschieden und war zum See gefahren. Sie redete sich ein, dass sie den Wasserstandsanzeiger kontrollieren musste. Sie war Wissenschaftlerin. Das hatte sie immer werden wollen, und sie wusste, dass es bei solchen Messungen um Genauigkeit ging. Aber sie war einfach furchtbar verkatert und weit davon entfernt, logisch denken zu können. Am Abend vorher hatte die jährliche Betriebsfeier des Energieforschungsinstituts stattgefunden, und sie hatte zu tief ins Glas geschaut. Das kam hin und wieder vor.
Sie dachte an den Mann, der zu Hause bei ihr im Bett lag, und wusste, dass sie sich seinetwegen hierher zum See geschleppt hatte. Sie wollte unter keinen Umständen mit ihm in ihrer Wohnung aufwachen und hoffte inständig, dass er sich verkrümelt haben würde, wenn sie zurückkam. Er hatte sie von der Feier nach Hause begleitet, war aber ein völlig uninteressanter Typ. Genau wie die anderen, die sie nach der Scheidung kennen gelernt hatte. Er sprach kaum über etwas anderes als seine Plattensammlung, und auch als sie schon längst aufgehört hatte, Interesse dafür vorzutäuschen, fuhr er unbeirrt fort. An diesem Punkt war sie auf dem Sessel im Wohnzimmer eingeschlafen. Als sie aufwachte, sah sie, dass er in ihr Bett gestiegen war und dort mit offenem Mund schnarchte, bekleidet mit einem knappen Slip und schwarzen Socken.
»Notruf«, sagte eine Stimme am Telefon.
»Ja, ich möchte melden, dass ich ein Skelett gefunden habe. Einen Schädel mit einem Loch drin.«
Sie zog eine Grimasse. Dieser verfluchte Kater! Wer drückte sich so aus? Ein Schädel mit einem Loch drin. Ihr fielen nur die Witze über dänische Münzen mit Loch ein, war es das Zehn-Öre-Stück, oder waren es 25 Öre?
»Wie ist dein Name?«, fragte die neutral klingende Stimme der Notrufzentrale.
Es gelang ihr, ihre flatterigen Gedanken zur Ordnung zu rufen, und sie nannte ihren Namen.
»Und wo ist das?«
»Am Kleifarvatn. An der Nordseite.«
»Hast du es mit dem Netz eingefangen?«
»Nein, es liegt auf dem Seeboden.«
»Bist du da getaucht?«
»Nein. Es ragt aus dem Seeboden heraus. Die Rippen und der Schädel.«
»Aus dem Seeboden heraus?«
»Ja.«
»Und wieso kannst du es sehen?«
»Ich stehe direkt daneben, und es liegt vor mir.«
»Hast du es ans Ufer gebracht?«
»Nein, ich habe nichts angerührt«, log sie.
Die Leitung blieb eine Weile stumm.
»Was soll denn der Blödsinn?«, erklärte die Stimme auf einmal ärgerlich. »Soll das vielleicht ein Witz sein? Weißt du, was dich so ein blöder Scherz kosten kann?«
»Kein Scherz. Ich stehe direkt daneben und sehe es.«
»Also mit anderen Worten, du bist imstande, auf dem Wasser zu wandeln?«
»Der See ist weg«, sagte sie. »Hier ist kein Wasser mehr, nur trockener Seeboden. Da, wo das Skelett liegt.«
»Was meinst du damit, der See ist weg?«
»Nicht der ganze See, aber da, wo ich stehe, ist kein Wasser mehr. Ich bin Hydrologin und arbeite am Energieforschungsinstitut. Ich habe den Wasserstand kontrolliert und das Skelett gefunden. Es hat ein Loch im Schädel und ist größtenteils im Sand vergraben. Ich habe zuerst gedacht, es handelte es sich um ein Schaf.«
»Ein Schaf?«
»Wir haben neulich schon mal eins gefunden, das vor langer Zeit im See ertrunken ist. Als er noch größer war.«
Wieder Schweigen in der Leitung.
»Bleib da, wo du bist«, sagte die Stimme zögernd. »Ich schicke einen Wagen vorbei.«
Nachdem sie eine Weile unbeweglich bei dem Skelett gestanden hatte, ging sie in Richtung Wasser und maß die Entfernung. Sie war sich sicher, dass die Knochen noch nicht zum Vorschein gekommen waren, als sie vor zwei Wochen den Wasserstand abgelesen hatte. Sie wären ihr bestimmt aufgefallen. Die Wasseroberfläche war also in dieser Zeit um einen weiteren Meter gesunken.
Dieses Rätsel hatte die Experten am Energieforschungsinstitut beschäftigt, seitdem feststand, dass sich der Wasserspiegel so rasch senkte. Das Institut hatte dort bereits 1964 ein Gerät aufgestellt, das den Wasserstand fortlaufend aufzeichnete, und eine der Aufgaben der Hydrologen bestand darin, die Messungen zu kontrollieren. Im Sommer 2000 schien das Messgerät auf einmal kaputt zu sein. Unglaubliche Mengen von Wasser gingen Tag für Tag verloren, doppelt so viel wie normalerweise.
Sie kehrte wieder zu dem Skelett zurück. Sie hatte größte Lust, es näher zu untersuchen, den Sand wegzuschaufeln und es freizulegen. Aber ihr war klar, dass die Polizei nicht sehr erfreut darüber sein würde. Sie überlegte, ob es ein Mann oder eine Frau war, denn sie erinnerte sich, irgendwann einmal gelesen zu haben, wahrscheinlich in einem Krimi, dass es bis auf die Beckenknochen praktisch keinen Unterschied zwischen dem Skelett eines Mannes und dem einer Frau gibt. Gleichzeitig fiel ihr aber ein, dass jemand anderes ihr gesagt hatte, man solle nichts darauf geben, was in Kriminalromanen steht. Das Becken selbst sah sie nicht, es war von Sand bedeckt, und sie dachte, dass sie den Unterschied sowieso nicht erkennen könnte.
Der Kater verschlimmerte sich, und sie setzte sich neben dem Skelett in den Sand. Es war ein Sonntagmorgen, und vereinzelt fuhren Autos am See entlang. Sie stellte sich eine Familie auf einem Sonntagsausflug nach Herdísarvík und Selvogur vor. Eine populäre Sonntagstour durch Lavafelder und Berglandschaft, und dann am Kleifarvatn entlang zur Küste. Sie dachte an die Familien in den Autos. Ihr Mann hatte sie verlassen, als sich herausgestellt hatte, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Kurze Zeit später heiratete er wieder und war inzwischen Vater von zwei reizenden Kindern. Er hatte das Glück gefunden.
Das Einzige, was sie dagegen gefunden hatte, war einen Mann, den sie kaum kannte und der mit Socken bei ihr im Bett lag. Je mehr Zeit verstrich, desto schwieriger wurde es, anständige Männer zu finden. Die meisten waren geschieden wie sie selbst, oder – was noch schlimmer war – sie hatten keine Frau abgekriegt.
Sie fühlte sich elend und war den Tränen nahe, während sie auf das Skelett im Sand starrte.
Etwa eine Stunde später näherte sich ein Streifenwagen aus Hafnarfjörður. Die Polizeibeamten schienen es nicht eilig zu haben, sondern fuhren ganz gemächlich die Straße entlang, die zum See führte. Es war Mai, die Sonne stand hoch am Himmel und spiegelte sich auf der glatten Wasseroberfläche. Sie saß im Sand, behielt die Straße im Auge, und als das Auto näher kam, winkte sie. Das Auto fuhr an den Straßenrand und stoppte. Zwei Polizisten stiegen aus, blickten in ihre Richtung und setzten sich dann in Bewegung.
Sie betrachteten das Skelett geraume Zeit, ohne ein Wort zu sagen. Dann stieß der eine mit der Fußspitze gegen eine Rippe.
»Ob der wohl hier geangelt hat?«, sagte er zu seinem Begleiter.
»Du meinst von einem Boot auf dem Wasser aus?«, sagte der Kollege.
»Oder er ist bis hierher gewatet.«
»Da ist ein Loch«, sagte sie und schaute von einem zum anderen. »Im Schädel.«
Einer der beiden beugte sich hinunter.
»Nanu«, sagte er.
»Er kann gefallen sein und sich den Schädel aufgeschlagen haben«, sagte sein Kollege.
»Der Schädel ist voller Sand«, sagte derjenige, der zuerst gesprochen hatte.
»Sollten wir vielleicht den Kollegen von der Kripo Bescheid sagen?«, fragte der andere nachdenklich.
»Sind nicht die meisten von denen gerade in Amerika?«, fragte sein Kollege zurück und blickte zum Himmel. »Auf so einer internationalen Konferenz über Kriminalität.«
Der andere Polizist nickte zustimmend. Die beiden standen wieder eine ganze Weile schweigend neben dem Skelett, bis der eine sich an sie wandte.
»Wo ist eigentlich das ganze Wasser hin?«, fragte er.
»Darüber gibt es die verschiedensten Theorien«, antwortete sie. »Was wollt ihr jetzt machen? Kann ich vielleicht nach Hause fahren?«
Sie blickten einander an, notierten dann ihren Namen und bedankten sich bei ihr, entschuldigten sich jedoch nicht, dass sie so lange hatte warten müssen. Ihr war es egal. Sie hatte keine Eile. Es war ein schöner Tag am See, sie hätte ihren Kater hier nur wesentlich besser auskurieren können, wenn sie nicht auf das Skelett gestoßen wäre. Sie überlegte, ob der Mann mit den schwarzen Socken wohl das Weite gesucht hatte, und hoffte es inständig. Sie freute sich darauf, ein Video auszuleihen und sich am Abend vor dem Fernseher unter eine Decke zu kuscheln.
Sie warf einen letzten Blick auf die Knochen und das Loch im Schädel.
Vielleicht wäre ein guter Krimi angebracht.
Zwei
Die Polizisten meldeten den Skelettfund auf dem Boden des Sees beim Polizeirevier in Hafnarfjörður, und sie brauchten einige Zeit, um den Tatbestand zu erklären, dass sie trockenen Fußes mitten im See stehen konnten. Der Hauptwachtmeister setzte sich telefonisch mit dem zuständigen Beamten beim Isländischen Landeskriminalamt in Verbindung, gab die Meldung über den Skelettfund weiter und wollte wissen, ob der Fall nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen würde.
»Das ist ein Fall für die Identifizierungskommission«, erklärte der zuständige Beamte. »Ich glaube, ich weiß den richtigen Mann dafür.«
»Und wer ist das?«
»Wir mussten ihn zwingen, Urlaub zu nehmen. Soweit ich weiß, hat er fünf Jahre Urlaub angesammelt, aber ich bin mir sicher, dass er froh sein wird, etwas zu tun zu bekommen. Er ist spezialisiert auf Vermisstenfälle. So eine Kleinarbeit macht ihm Spaß.«
Nachdem sich der Polizeikommissar von seinem Kollegen in Hafnarfjörður verabschiedet hatte, griff er wieder zum Telefon und veranlasste, dass Erlendur Sveinsson benachrichtigt und mitsamt seinem Team zum Kleifarvatn im Süden von Reykjavík geschickt wurde.
Erlendur war in seine Lektüre vertieft, als das Telefon klingelte. Die schweren Vorhänge vor den Fenstern im Wohnzimmer waren zugezogen, denn Erlendur versuchte, die helle Maisonne, so gut es ging, auszusperren. Da es in der Küche keine richtigen Gardinen gab, hatte er die Tür dorthin zugemacht. Auf diese Weise war es im Wohnzimmer dunkel genug um ihn herum, dass er Grund hatte, seine Stehlampe beim Sessel anzuschalten.
Erlendur kannte die Geschichte gut, denn er hatte sie schon mehrmals gelesen. Im Herbst 1868 hatten sich einige Männer aus dem Skaftártunga-Bezirk auf den Weg gemacht. Sie wollten in den Südwesten zur Halbinsel Reykjanes, um von dort aus zum Fischen hinauszurudern. Sie nahmen die kürzeste Strecke »Hinter den Bergen«, an der nördlichen Seite des Mýrdal-Gletschers entlang. Mit dabei war ein junger Bursche von 17 Jahren, der Davið hieß. Die Männer waren an solche Reisen gewöhnt, und sie kannten die Strecke, aber bald nachdem sie in die Berge aufgebrochen waren, brach ein Unwetter herein, und sie kehrten nie wieder in bewohnte Gebiete zurück. Eine umfangreiche Suche nach ihnen wurde eingeleitet, aber man fand nicht die geringste Spur. Erst zehn Jahre später wurden ihre Knochen aus purem Zufall bei einer großen Sanddüne südlich von Kaldaklof entdeckt. Sie hatten eine Plane über sich gebreitet und lagen dicht nebeneinander.
Erlendur blickte im dämmrigen Licht hoch und sah im Geiste den jungen Burschen in der Gruppe vor sich, besorgt und ängstlich. Vor der Abreise schien er zu spüren, worauf es hinauslaufen würde; die ganze Gegend sprach darüber, dass er seine alten Spielsachen an seine Geschwister verteilt und gesagt hatte, dass er sie nicht wieder zurückfordern werde.
Erlendur legte das Buch weg, stand mit steifen Gliedern auf und nahm den Hörer ab. Es war Elínborg.
»Du kommst doch, oder?«, war ihre erste Frage.
»Mir bleibt wohl nichts anderes übrig«, sagte Erlendur. Elínborg hatte ein Kochbuch zusammengestellt, das jetzt endlich erscheinen sollte.
»Mein Gott, was bin ich nervös. Was glaubst du, wie es wohl ankommen wird?«
»Ich kann noch nicht mal richtig mit der Mikrowelle umgehen«, sagte Erlendur, »deswegen bin ich vielleicht nicht …«
»Beim Verlag sind sie sehr angetan«, unterbrach Elínborg ihn. »Und die Fotos von den Gerichten sind fantastisch. Dafür wurde sogar ein spezieller Beleuchter hinzugezogen. Und dann gibt es ein Extrakapitel über Weihnachtsessen …«
»Elínborg.«
»Ja.«
»Hattest du einen bestimmten Grund, mich anzurufen?« »Irgendwelche Knochen im Kleifarvatn«, sagte Elínborg und senkte die Stimme, als es nun nicht mehr um ihr Kochbuch ging. »Ich soll dich abholen. Der See ist kleiner geworden oder irgendsowas, und deswegen hat man dort heute morgen Knochen gefunden. Sie möchten, dass du dir das anschaust.«
»Der See ist kleiner geworden?«
»Ja, ich habe das allerdings nicht so richtig mitgekriegt.«
Sigurður Óli stand bei dem Skelett, als Erlendur und Elínborg am See eintrafen. Man erwartete die Spezialisten von der Spurensicherung. Die Polizisten aus Hafnarfjörður fummelten mit dem gelben Absperrband herum, um die Fundstelle abzugrenzen, mussten aber feststellen, dass sie nichts hatten, woran sie es befestigen konnten. Sigurður Óli beobachtete ihre Bemühungen und versuchte vergeblich, sich an irgendwelche typischen Witze zu erinnern, die man sich über die Einwohner von Hafnarfjörður erzählte. »Hast du nicht Urlaub?«, fragte er Erlendur, der ihm auf dem sandigen Seegrund entgegenkam.
»Doch«, sagte Erlendur. »Was gibt’s Neues bei dir?«
»Same old …«, sagte Sigurður Óli. Er blickte zur Straße hoch, wo in diesem Augenblick ein klotziger Jeep von einer der Fernsehanstalten am Rand hielt. »Sie haben ihr gestattet, nach Hause zu fahren«, fuhr er fort und nickte in Richtung der Polizisten aus Hafnarfjörður. »Der Frau, die die Knochen gefunden hat. Sie hat hier irgendwelche Messungen durchgeführt. Wir können uns später mit ihr unterhalten, falls wir in Erfahrung bringen müssen, weshalb der See verschwunden ist. Wenn alles mit rechten Dingen zuginge, wären wir hier an dieser Stelle jetzt auf Tauchstation.«
»Was ist mit deiner Schulter, ist sie wieder in Ordnung?« »Ja. Wie geht es deiner Tochter?«
»Eva Lind ist noch nicht aus der Therapie abgehauen. Ich glaube, dass sie es bereut, aber im Grunde genommen weiß ich das nicht.« Er kniete sich hin und betrachtete das, was vom Skelett zu sehen war. Er steckte seinen Finger in das Loch im Schädel und strich über eine der Rippen.
»Jemand hat ihm den Kopf eingeschlagen«, sagte er und stand wieder auf.
»Das könnte kaum offensichtlicher sein«, sagte Elínborg mit spöttischem Unterton. »Falls es denn ein er ist«, fügte sie hinzu.
»Sieht ein bisschen nach einer Schlägerei aus, oder?«, sagte Sigurður Óli. »Das Loch ist direkt hinter der rechten Schläfe. Möglicherweise hat ein einziger kräftiger Hieb gereicht.«
»Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass er hier ganz allein auf einem Boot unterwegs war und dabei ausgerutscht und auf die Bordkante gefallen ist«, sagte Erlendur und blickte Elínborg an. »Dieser Ton, den du anschlägst, findet man den auch in deinem Kochbuch?«
»Die Bruchsplitter sind natürlich schon längst weggewaschen worden«, sagte Elínborg, ohne auf seine Frage einzugehen.
»Wir müssen die Knochen jetzt freischaufeln lassen«, sagte Sigurður Óli. »Wann kommen die Techniker?«
Erlendur sah, dass weitere Autos am Straßenrand geparkt wurden, und ging davon aus, dass der Knochenfund sich bereits bei den Nachrichtenredaktionen herumgesprochen hatte.
»Sollte hier nicht ein Zelt aufgeschlagen werden?«
»Natürlich«, sagte Sigurður Óli, »die bringen bestimmt ein Zelt mit.«
»Meinst du, dass er hier ganz allein geangelt hat?«, fragte Elínborg.
»Das ist nur eine Möglichkeit«, sagte Erlendur.
»Aber wenn er tatsächlich einen Hieb gegen den Kopf bekommen hat?«
»Dann war es jedenfalls kein Unfall«, sagte Sigurður Óli. »Wir wissen nicht, was passiert ist«, sagte Erlendur. »Vielleicht hat er einen Hieb bekommen. Vielleicht war er mit jemand anderem auf dem See, und auf einmal zieht dieser andere einen Hammer hervor. Vielleicht waren es bloß zwei. Vielleicht waren sie auch zu fünft.«
»Oder«, warf Sigurður Óli ein, »er kriegt ganz woanders, beispielsweise in Reykjavík, eine verpasst, und dann bringt man ihn hierher und versenkt ihn.«
»Und wie hat man ihn versenkt?«, fragte Elínborg. »Dazu braucht man etwas Schweres, um die Leiche unten zu halten.«
»Ist es ein erwachsener Mensch?«, sagte Sigurður Óli.
»Sag ihnen, sie sollen sich in gebührender Entfernung halten«, sagte Erlendur, der sah, wie die Reporter von der Straße zum See herunterkamen. Von Reykjavík her näherte sich ein kleines Flugzeug, das im Niedrigflug über sie hinwegbrummte, und sie sahen einen Mann, der eine Kamera auf sie gerichtet hielt.
Während Sigurður Óli den Reportern entgegenging, begab Erlendur sich zum Wasser. Kleine Wellen plätscherten träge auf den Sand, und die Nachmittagssonne glitzerte auf der Wasseroberfläche. Er überlegte, was hier vor sich ging. Verschwand das Wasser aufgrund von menschlichem Einwirken, oder war die Natur am Werk? Es hatte ganz den Anschein, als wolle der See von sich aus ein Verbrechen aufdecken. Verbargen sich in seinen Tiefen, wo immer noch Dunkelheit und Schweigen herrschten, womöglich weitere düstere Freveltaten?
Er blickte wieder zur Straße. Die Spurensicherung in weißen Overalls eilte über den Sand auf ihn zu. Sie hatten ein kleines Zelt dabei − und die Taschen voller Berufsgeheimnisse. Als er zum Himmel aufschaute, spürte er die Wärme der Sonne im Gesicht.
Vielleicht war sie es, die den See austrocknete.
Das Erste, was die Leute von der Spurensicherung entdeckten, als sie das Skelett mit kleinen Schaufeln und weichen Pinseln vom Sand befreiten, war ein Seil. Es hatte sich zwischen die Rippen gelegt, führte an der Wirbelsäule vorbei nach unten und verschwand im Sand.
Die Hydrologin Sunna hatte es sich auf dem Sofa mit einer Decke gemütlich gemacht. Die Kassette steckte im Videogerät, ein amerikanischer Thriller, der The Bone Collector hieß. Der Mann mit den schwarzen Socken war weg. Er hatte zwei Telefonnummern hinterlassen, die sie im Klo hinunterspülte. Der Filmanfang lief gerade, als es an der Tür klingelte. Sie beschloss, so zu tun, als sei sie nicht zu Hause. Dauernd wurde man gestört. Entweder versuchten die Leute, einem am Telefon etwas aufzuschwatzen, oder es standen Typen vor der Tür, die mit getrocknetem Fisch hausierten, oder kleine Jungs, die Pfandflaschen sammelten und schwindelten, der Erlös sei für das Rote Kreuz. Es klingelte wieder, und sie zögerte immer noch. Dann seufzte sie laut und schleuderte die Decke zur Seite.
Als sie die Tür öffnete, standen zwei Männer vor ihr, der eine, der vielleicht etwas über fünfzig war, sah nicht gerade fröhlich aus, er ließ die Schultern hängen und hatte einen seltsam traurigen Gesichtsausdruck. Der andere sah sehr viel sympathischer aus, eigentlich ein attraktiver Mann.
Als Erlendur bemerkte, wie interessiert sie Sigurður Óli anstarrte, konnte er sich eines Lächelns nicht erwehren.
»Es ist wegen Kleifarvatn«, sagte er.
Als sie bei ihr im Wohnzimmer Platz genommen hatten, erklärte sie ihnen, was nach Meinung der Experten aus der hydrologischen Abteilung des Energieforschungsinstituts geschehen war.
»Der See hat keinen oberirdischen Abfluss«, erklärte Sunna, »sondern das Wasser sickert durch den Grund des Sees ins Erdreich, in den letzten Jahrzehnten ungefähr ein Kubikmeter pro Sekunde, und deswegen blieb ein gewisser Gleichstand erhalten.«
Erlendur und Sigurður Óli sahen sie an und versuchten, interessiert zu wirken.
»Ihr erinnert euch doch an das große Erdbeben in Südisland am 17. Juni 2000?«, fragte sie, und beide nickten. »Fünf Sekunden nach diesem großen Beben wurde der See von einem scharfen Erdstoß erschüttert, was dazu führte, dass sich die Abflussgeschwindigkeit verdoppelte. Als der See immer kleiner wurde, dachte man zunächst, dass es mit geringeren Niederschlagsmengen zu tun hätte, aber dann stellte sich heraus, dass das Wasser durch Spalten auf dem Seeboden nach unten rauscht. Die Spalten gibt es zwar schon seit Jahrzehnten, aber sie haben sich durch diesen Erdstoß noch mehr geöffnet, und die Folgen habe ich gerade geschildert. Der Wasserspiegel hat sich um mindestens vier Meter gesenkt.«
»Und deswegen ist das Skelett zutage gekommen«, sagte Erlendur.
»Als sich der Wasserspiegel um zwei Meter gesenkt hatte, fanden wir das Gerippe eines Schafs«, sagte Sunna. »Aber dem hatte niemand eins mit dem Hammer übergezogen.« »Was meinst du damit, eins mit dem Hammer übergezogen?«, fragte Sigurður Óli.
Sie blickte ihn an. Sie hatte versucht, unauffällig auf seine Hände zu schielen, um zu sehen, ob er einen Ehering trug. »Ich habe das Loch im Kopf gesehen«, sagte sie. »Wisst ihr schon, wer es ist?«
»Nein«, entgegnete Erlendur. »Er muss wohl ein Boot gehabt haben, nicht wahr? Um so weit hinaus aufs Wasser zu gelangen …«
»Wenn du damit fragen willst, ob jemand zu Fuß dorthin gegangen sein könnte, wo das Skelett liegt, dann ist die Antwort nein. An dieser Stelle war der See bis vor nicht allzu langer Zeit mindestens vier Meter tief. Wenn das vor vielen Jahren passiert ist, was ich natürlich nicht weiß, könnte der See dort sogar noch tiefer gewesen sein.«
»Also muss jemand mit einem Boot unterwegs gewesen sein«, sagte Sigurður Óli. »Gibt es Boote da am Kleifarvatn?«
»Es gibt dort in der Nähe ein paar Sommerhäuser«, sagte sie und schaute ihm in die Augen. Er hatte schöne, dunkelblaue Augen unter schmalen Brauen. »Vielleicht gibt es da Boote. Ich habe allerdings nie eins auf dem See gesehen.« Mit ihm müsste man rudern gehen, dachte sie bei sich.
Erlendurs Handy klingelte. Es war Elínborg.
»Du solltest noch mal herkommen«, sagte sie.
»Was ist denn?«, fragte Erlendur.
»Komm selbst und sieh es dir an. Das ist äußerst merkwürdig. So etwas habe ich noch nie gesehen.«
Drei
Er stand auf, schaltete die Fernsehnachrichten aus und seufzte tief. Es hatte eine ausführliche Berichterstattung über den Knochenfund im Kleifarvatn gegeben, und ein Interview mit dem zuständigen Beamten, der erklärte, dass der Fall eingehend untersucht würde.
Er ging zum Fenster und schaute Richtung Meer. Auf dem Bürgersteig bemerkte er das Ehepaar, das jeden Abend an seinem Haus vorbeispazierte, der Ehemann wie immer einen Meter voraus, während die Frau versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Sie unterhielten sich während des Spaziergangs, er sprach nach hinten und sie mit seinem Rücken. Seit vielen Jahren schon kamen sie an seinem Haus vorbei und hatten längst aufgehört, ihrer Umgebung irgendwelche Beachtung zu schenken. Früher allerdings hatten sie manchmal zu seinem Haus hochgeblickt und zu den anderen Häusern in der Straße am Meer, und in die Gärten. Manchmal waren sie sogar stehen geblieben, um sich neue Spielgeräte vor den Häusern anzuschauen oder neue Zäune und Sonnenterrassen. Bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit unternahmen sie nachmittags oder abends diesen Spaziergang, immer zu zweit.
Seine Blicke schweiften über das Meer, und am Horizont sah er ein großes Frachtschiff. Die Sonne stand immer noch hoch am Himmel, obwohl es schon Abend war. Die hellste Zeit des Jahres stand bevor, aber danach würden die Tage wieder kürzer werden, bis schließlich kaum noch etwas von ihnen übrig blieb. Das Frühjahr war schön gewesen. Mitte April waren die ersten Goldregenpfeifer auf der Wiese vor seinem Haus herumspaziert. Sie waren mit den Frühlingswinden aus Europa gekommen.
Als er zum ersten Mal mit dem Schiff ins Ausland reiste, war der Sommer gerade zu Ende gewesen. Damals waren die Frachtschiffe nicht so groß, und es gab keine Container. Er erinnerte sich an die Seeleute, die im Laderaum mit Säcken hantierten, die einen halben Zentner wogen. Erinnerte sich an ihre derben Sprüche und ihr Seemannsgarn. Sie kannten ihn, weil er im Sommer am Hafen gearbeitet hatte, und sie machten sich einen Spaß daraus, zu erzählen, wie sie die Zollbeamten austricksten. Einige von diesen Geschichten waren so abenteuerlich, dass er genau wusste, dass sie erfunden waren. Andere waren spannend und dramatisch, auch ohne dass etwas hinzugedichtet werden musste. Und einige Geschichten bekam er nie zu hören, obwohl sie sagten, dass er bestimmt nichts weitererzählen würde, er, der Kommunist mit Abitur!
Nichts weitererzählen.
Sein Blick fiel wieder auf den Fernseher. Es kam ihm so vor, als habe er sein ganzes Leben lang auf diese Nachricht gewartet.
Solange er zurückdenken konnte, war er Sozialist gewesen, wie alle anderen Familienmitglieder mütterlicher- und väterlicherseits. Unpolitisch zu sein wäre undenkbar gewesen, und er wuchs mit dem Hass auf alle Reaktionäre auf. Sein Vater hatte sich schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im Arbeiterkampf engagiert. Bei ihm zu Hause wurde viel über Politik diskutiert, meist ging es um das amerikanische Militär in Keflavík, das von der kleinen Schicht der Begüterten gehätschelt und getätschelt wurde. Es waren die isländischen Kapitalisten, die am meisten von der Anwesenheit der Soldaten profitierten.
Und dann seine Freunde, die alle einen ähnlichen Hintergrund hatten. Ihre Ansichten waren radikal, und einige von ihnen waren rhetorisch äußerst begabt. Er erinnerte sich gut an die politischen Zusammenkünfte. An ihre Hitzigkeit und Leidenschaft, wenn sie das Wort ergriffen. Er besuchte diese Veranstaltungen zusammen mit seinen Schulkameraden, die genau wie er in der Jugendorganisation der Partei aktiv waren. Sie lauschten ihrem Vorsitzenden, der mitreißende, markige Reden gegen die Kapitalisten vom Stapel ließ, die das Proletariat ausbeuteten − und gegen das amerikanische Militär, das diese Bonzen in der Tasche hatte. Wie oft hatte er sich das angehört, und immer aus der gleichen tiefen und glühenden Überzeugung heraus. Er ließ sich von alldem, was er hörte, begeistern und mitreißen, denn er war als patriotischer Isländer und aufrechter Sozialist erzogen worden, der genau wusste, was er zu glauben hatte. Er wusste, dass die Wahrheit auf seiner Seite war.
Bei diesen Zusammenkünften diskutierten sie häufig über die amerikanischen Streitkräfte in Keflavík und die abgefeimten Winkelzüge der isländischen Kapitalisten, die um jeden Preis den Amerikanern die Genehmigung zuschanzen wollten, auf isländischem Boden einen militärischen Stützpunkt einzurichten.
Er wusste genau, wie das Land an die Amerikaner verschachert worden war, damit die isländischen Kapitalisten so fett werden konnten wie die Maden im Speck. Er hatte als Jugendlicher am Austurvöllur miterlebt, wie die Söldner des Kapitalismus mit Tränengas und Keulen aus dem Allthinghaus herausstürzten und auf die Demonstranten einknüppelten. Diese Landesverräter sind Lakaien des amerikanischen Imperialismus! Wir stehen unter der Knute amerikanischer Plutokraten!
Dem Nachwuchs mangelte es nicht an schlagkräftigen Parolen.
Er gehörte selber dem unterdrückten Volk an. Er ließ sich von der Begeisterung, von den zündenden Reden und der gerechten Idee, dass alle gleich seien, mitreißen. Der Direktor sollte mit seinen Arbeitern in der Fabrik stehen. Weg mit der Klassengesellschaft! Er glaubte aufrichtig und unerschütterlich an den Sozialismus. Er spürte ein inneres Bedürfnis, für die Sache einzutreten, um andere zu überzeugen und für diejenigen zu kämpfen, die schlechter gestellt waren, die Arbeiter und die Unterdrückten.
Völker, hört die Signale.
Er beteiligte sich mit viel Engagement an den Diskussionen bei diesen Zusammenkünften und beschaffte sich einschlägige Lektüre bei der Jugendorganisation oder suchte in Bibliotheken und Buchläden danach. Es gab genug davon. Er steckte voller Tatendrang und war in seinem Herzen zutiefst davon überzeugt, dass die Wahrheit seine Waffe war. Vieles von dem, worüber in der Jugendorganisation diskutiert wurde, erfüllte ihn mit dem Gefühl der gerechten Sache.
Nach und nach erlernte er die Antworten auf die Fragen nach dem dialektischen Materialismus, dem Klassenkampf und den bewegenden Kräften der Geschichte, nach Kapital und Proletariat. Je mehr er las und sich für das, was er las, begeisterte, desto versierter wurde er darin, seine eigenen Beiträge auszuschmücken, indem er die geistige Elite der Revolution zitierte. Nach einiger Zeit war er seinen Altersgenossen nicht nur in Bezug auf die Texte der marxistischen Theorie, sondern auch rhetorisch so weit voraus, dass der Vorstand der Jugendorganisation auf ihn aufmerksam wurde. Wenn es um die Wahlen in den Vorstand und die einzelnen Kommissionen ging oder wenn Resolutionen verfasst werden mussten, wurde viel Pulver verschossen. Er wurde gefragt, ob er bereit sei, sich im Vorstand zu engagieren. Er war damals in der Unterprima, wo sie einen Debattierclub gegründet hatten, der »Rote Fahne« hieß. Sein Vater hatte entschieden, dass er als Einziger der vier Geschwister eine höhere Schulbildung erhalten sollte. Dafür war er ihm sein ganzes Leben dankbar gewesen.
Trotz allem.
Die Jugendorganisation war sehr aktiv, sie gab ein Mitteilungsblatt heraus, und es fanden viele Veranstaltungen statt. Der Vorsitzende wurde sogar nach Moskau eingeladen. Als er von dort zurückkam, konnte er aus eigener Anschauung über den Proletarierstaat berichten. Der Aufbau war grandios. Die Leute waren so zufrieden. Alle hatten genug von allem. Kolchosen und Planwirtschaft ließen einen Fortschritt erkennen, der alles andere in den Schatten stellte. Der Aufbau der Industrie nach dem Krieg übertraf die kühnsten Erwartungen. Fabriken schossen aus dem Boden, die im Besitz des Staates, der Arbeiter selber waren und von ihnen geführt wurden. Neue Wohnsiedlungen entstanden in den Außenvierteln der Stadt. Und die ärztliche Versorgung war kostenlos. Alles, was sie gelesen, alles, was sie gehört hatten, war also wahr. Was für Zeiten!
Zwar waren auch andere Genossen nach Russland gereist und hatten von ganz anderen und schlimmen Erfahrungen berichtet, aber davon ließ sich der Nachwuchs der Partei nicht beeinflussen. Solche Leute waren Handlanger des Kapitals. Sie begingen Verrat an der Sache, am Kampf um eine gerechtere Gesellschaft.
Die Veranstaltungen des Debattierclubs »Rote Fahne« waren gut besucht und bewirkten, dass sich weitere Leute der Bewegung anschlossen. Er wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt, was die Aufmerksamkeit von einflussreichen Mitgliedern der Sozialistischen Partei weckte. In seinem letzten Jahr am Gymnasium, das er mit Bravour absolvierte, stand fest, dass er das Zeug dazu hatte, einer der führenden Köpfe in der Partei zu werden.
Er wandte sich vom Fenster ab und ging zum Klavier, über dem sein Abiturfoto hing. Die Jungen in schwarzen Anzügen, die Mädchen in schwarzen Kleidern. Er betrachtete die Gesichter unter den weißen Mützen. Das Schulgebäude glänzte in der Sonne, und die weißen Mützen leuchteten. Er hatte den zweitbesten Notendurchschnitt beim Abitur gehabt, und es hatte nicht viel zum ersten Platz gefehlt. Er strich über das Bild und dachte wehmütig an die Jahre im Gymnasium zurück. An die Zeit, als seine Überzeugung so felsenfest war, dass nichts sie erschüttern konnte.
In seinem letzten Jahr auf dem Gymnasium wurde ihm die Mitarbeit beim Parteiorgan angeboten. In den Sommerferien hatte er im Hafen beim Löschen der Schiffe mitgeholfen, Arbeiter und Seeleute kennen gelernt und mit ihnen diskutiert. Viele von ihnen vertraten reaktionäre Ansichten und nannten ihn einen Kommunisten. Schon bevor er seine Arbeit bei der Zeitung aufnahm, hatte er sich bereits für den Journalismus interessiert und wusste, dass das Parteiorgan eine wichtige Grundlage für die Parteiarbeit als solche bedeutete. Zusammen mit dem Vorsitzenden der Jugendorganisation trafen sie sich im Haus des stellvertretenden Parteivorsitzenden. Der schmächtige Vize saß in einem tiefen Sessel, putzte sich die Brille mit einem Taschentuch und dozierte mit leiser Stimme über einen sozialistischen Staat auf Island. Alles, was er da in dem kleinen Wohnzimmer zu hören bekam, war so wahr und so richtig, dass er jedes Wort in sich aufsaugte und ihn bis ins Mark erschaudern ließ.
Er war ein begabter Schüler. Was auch immer er sich vornahm, Geschichte, Mathematik, er brauchte sich nie anzustrengen. Was er einmal im Kopf hatte, blieb darin und war jederzeit verfügbar. Gedächtnis und Lernfähigkeit kamen ihm bei seiner journalistischen Arbeit zustatten, und er gewöhnte sich rasch an seine neue Tätigkeit. Er arbeitete zügig, hatte eine schnelle Auffassungsgabe und konnte lange Interviews führen, bei denen er sich abgesehen von ein paar Sätzen nichts zu notieren brauchte. Ihm war klar, dass er in seiner journalistischen Arbeit nicht objektiv war, aber wer war das schon.
Er hatte vor, sich im Herbst an der Universität einzuschreiben, war aber gebeten worden, weiterhin für die Zeitung tätig zu sein. Das brauchte er sich nicht zweimal zu überlegen. Mitten im Winter bestellte der stellvertretende Vorsitzende ihn zu sich nach Hause. Die Sozialistische Einheitspartei der Deutschen Demokratischen Republik bot einigen isländischen Studenten Stipendien zum Studium an der Universität Leipzig an. Falls er das Stipendium annähme, müsste er selbst für die Reisekosten aufkommen, aber Unterkunft und Lebenshaltungskosten würden vom Gastland getragen.
Er war gespannt darauf, nach Osteuropa oder in die Sowjetunion gehen, um mit eigenen Augen den Aufbau nach dem Krieg zu sehen. Er wollte reisen und andere Länder kennen lernen − und Sprachen lernen. Er wollte den real existierenden Sozialismus erleben. Vor dem Abitur hatte er mit dem Gedanken gespielt, sich um einen Studienplatz an der Universität Moskau zu bewerben, aber er hatte immer noch nichts in die Wege geleitet, als er zu diesem Treffen bestellt wurde. Der stellvertretende Parteivorsitzende putzte sich wieder die Brille mit dem Taschentuch und wies ihn darauf hin, dass ein Studienplatz in Leipzig eine einmalige Chance für ihn sei, einen kommunistischen Staat von innen heraus kennen zu lernen, mit eigenen Augen den Sozialismus in der Realität zu sehen und eine Ausbildung zu machen, mit der er dem Land später von Nutzen sein konnte.
Der stellvertretende Parteivorsitzende setzte seine Brille auf.
»Und unseren Zielen. Du wirst dich dort wohl fühlen. Leipzig ist historisch bedeutsam und steht auch in Verbindung mit unserer eigenen Kulturgeschichte. Halldór Laxness reiste dorthin, um seinen Freund Jóhann Jónsson zu besuchen. Und unsere isländischen Volkssagen, die Jón Árnason gesammelt hat, wurden 1862 in Leipzig bei J.C. Hinrichs herausgegeben.«
Er nickte zustimmend. Er hatte alles gelesen, was Halldór Laxness über den Sozialismus im Ostblock geschrieben hatte, und er bewunderte ihn für seine Überzeugungskraft.
Die Familie überlegte, ob er auf einem Frachtschiff anheuern sollte, um sich das Geld für die Überfahrt zu verdienen. Einer seiner Onkel väterlicherseits kannte einen Mann bei der Schifffahrtsgesellschaft und hatte ihm bislang auch immer die Ferienarbeit am Hafen beschafft. Es gab keine Probleme mit der Schiffspassage, und die ganze Familie war im siebten Himmel. Keiner war in der Welt herumgekommen. Keiner von ihnen war jemals im Ausland gewesen, und schon gar nicht zu einem Universitätsstudium. Es schien alles wie in einem Märchen zu sein. Das Wunder wurde in Telefongesprächen und Briefen ausgiebig diskutiert. Aus ihm wird noch was werden, sagten die Leute. Zum Schluss wird er wohl gar noch Minister!
Zuerst legte das Schiff auf den Färöern an, dann in Kopenhagen, Rotterdam und Hamburg, wo er abmusterte. Von da aus nahm er den Zug nach Berlin und schlief ein paar Stunden nachts auf dem Bahnhof. Noch in derselben Nacht bestieg er den Zug nach Leipzig. Er wusste, dass niemand ihn in Empfang nehmen würde. Auf einem Zettel in seiner Jackentasche stand eine Adresse, und er würde so lange nach dem Weg fragen, bis er am Ziel war.
Er stand vor dem Abiturfoto, seufzte tief auf und betrachtete das Gesicht seines Freundes, mit dem er in Leipzig war. Im Gymnasium waren sie in dieselbe Klasse gegangen. Wenn er damals nur schon gewusst hätte, was geschehen würde!
Er überlegte, ob die Polizei tatsächlich die Wahrheit über den Mann im See herausfinden würde. Er tröstete sich damit, dass viel Zeit verstrichen war und niemand mehr ein Interesse an dem hatte, was damals passiert war.
Der Mann im Kleifarvatn ging niemanden mehr etwas an.
Vier
Das Zelt war über dem Skelett aufgeschlagen worden. Elínborg stand davor und beobachtete, wie Erlendur und Sigurður Óli mit raschen Schritten über den ausgetrockneten Boden des Sees auf sie zukamen. Der Abend war bereits fortgeschritten, und die Reporter waren weg. Nachdem bekannt wurde, dass ein Skelett auf dem Grund des Sees gefunden worden war, hatte der Verkehr auf der Straße zunächst zugenommen, aber jetzt war es wieder ruhiger geworden.
»Na, endlich«, sagte Elínborg, als sie eintrafen.
»Sigurður Óli musste sich unbedingt noch einen Hamburger reinziehen«, erwiderte Erlendur gereizt. »Was ist los?« »Kommt mit«, sagte Elínborg und öffnete das Zelt. »Die Gerichtsmedizinerin ist auch hier.«
Als Erlendur zum See hinüberschaute, der in der Abendstille ruhig dalag, dachte er an die Spalten auf dem Grund des Sees. Er schaute zum Himmel, wo die Sonne immer noch so hoch stand, dass es taghell war. Er starrte auf ein weißes Wolkenknäuel direkt über sich und musste unentwegt daran denken, dass der See dort, wo er jetzt stand, früher vier Meter tief gewesen war.
Die Mitarbeiter der Spurensicherung hatten das Skelett inzwischen freigelegt, und es war jetzt ganz sichtbar. Es gab keinerlei Reste von Haut oder Kleidung. Daneben kniete eine Frau von etwa vierzig Jahren, die mit einem gelben Stift etwas auf den Hüftknochen kritzelte.
»Es handelt sich um einen Mann«, sagte sie. »Mittelgroß und höchstwahrscheinlich so um die vierzig, aber das muss ich noch genauer feststellen. Ich weiß nicht, wie lange er im See gelegen hat, vierzig, fünfzig Jahre vielleicht. Möglicherweise sogar länger, aber das sind nur Spekulationen. Wenn ich die Knochen im Labor untersucht habe, kann ich vielleicht etwas präziser Auskunft geben.«
Sie stand auf und gab ihnen die Hand. Erlendur wusste, dass sie Matthildur hieß und gerade erst als Gerichtsmedizinerin angefangen hatte.
Er hätte sie gerne gefragt, warum sie sich auf Verbrechen spezialisiert hatte. Warum sie nicht einfach Ärztin war wie all die anderen und am isländischen Wohlfahrtssystem verdiente.
»Hat er einen Hieb an den Kopf bekommen?«, fragte Erlendur.
»So sieht es aus«, antwortete Matthildur. »Aber schwer zu sagen, was für eine Schlagwaffe verwendet wurde, weil sämtliche Spuren um das Loch herum nicht mehr vorhanden sind.«
»Es geht also um einen vorsätzlichen Mord?«, fragte Sigurður Óli.
»Alle Morde sind vorsätzlich«, sagte Matthildur. »Sie sind bloß unterschiedlich stupide.«
»Es steht außer Frage, dass es sich um Mord handelt«, sagte Elínborg, die dem Gespräch schweigend gelauscht hatte. Sie stieg auf die andere Seite des Skeletts und deutete in ein großes Loch, das dort gegraben worden war. Erlendur trat an ihre Seite und sah, dass sich in dem Loch ein massiver schwarzer Metallkasten befand, der mit einem Seil an dem Skelett befestigt war. Der Kasten steckte noch zum größten Teil im Sand, aber an der Seite, die nach oben wies, befanden sich so etwas wie zerbrochene Armaturen mit schwarzen Scheiben und schwarzen Knöpfen. Der zerkratzte und verbeulte Kasten war mit Sand gefüllt, weil er sich geöffnet hatte.
»Was ist denn das?«, fragte Sigurður Óli.
»Weiß der Himmel«, sagte Elínborg, »aber damit ist er versenkt worden.«
»Ist das ein Messgerät?«, fragte Erlendur.
»So was habe ich noch nie gesehen. Die von der Spurensicherung meinen, dass es vielleicht ein Sender sein könnte. Sie sind gerade zum Essen.«
»Ein Sender?«, wiederholte Erlendur. »Was für ein Sender?«
»Das wussten sie nicht. Sie müssen das Ding ja auch erst noch ausgraben.«
Erlendur betrachtete das Seil, das an dem Skelett festgebunden war, und den schwarzen Kasten, den man dazu verwendet hatte, die Leiche zu versenken. Vor seinem inneren Auge schleppten sich Männer mit der Leiche ab, zerrten sie aus einem Auto und banden sie an das Gerät, ruderten damit auf den See hinaus und warfen alles zusammen über Bord.
»Er ist also versenkt worden?«
»Er hat das ja wohl kaum selber so arrangiert«, stieß Sigurður Óli hervor. »Er rudert doch nicht mitten auf den See raus, bindet sich an diesen Apparat an, nimmt ihn in den Arm, lässt sich dann fallen, und achtet dabei nicht nur darauf, dass er auf die Bordkante knallt, sondern auch, dass er anschließend über Bord geht, damit um jeden Preis gewährleistet ist, dass er verschwindet. Das wäre ja wohl der idiotischste Selbstmord der Menschheitsgeschichte.«
»Ob das Gerät wohl schwer ist?«, fragte Erlendur und versuchte, sich nicht von Sigurður Óli irritieren zu lassen.
»Mir kommt es so vor, als wäre es bleischwer«, sagte Matthildur.
»Ob es wohl sinnvoll wäre, hier auf dem Grund des Sees nach der Mordwaffe zu suchen?«, fragte Elínborg. »Mit einem Metalldetektor, falls es ein Hammer oder so was Ähnliches war? Vielleicht wurde das zusammen mit der Leiche über Bord geworfen.«
»Dafür ist die Spurensicherung zuständig«, sagte Erlendur, kniete neben dem schwarzen Kasten nieder und strich den Sand weg.
»Vielleicht handelt es sich um einen Funkamateur«, sagte Sigurður Óli.
»Du kommst doch zu der Party, wenn das Buch erscheint?«, fragte Elínborg ihn.
»Das muss man ja wohl«, entgegnete Sigurður Óli.
»Ich will dich natürlich nicht zwingen.«
»Wie heißt das Buch?«, erkundigte sich Erlendur.
»Von Gerichten und Schichten«, sagte Elínborg. »Das soll ein bisschen witzig klingen, eine Anspielung auf Schichten, wie ich sie in der Arbeit habe, aber auch die im Schichtkuchen, und anderen Gerichten …«
»Wirklich genial«, sagte Erlendur und sah Sigurður Óli verwundert an, der laut losprustete.
Eva Lind saß ihm in weißem Bademantel im Schneidersitz gegenüber und zwirbelte wie hypnotisiert mit dem Zeigefinger eine Strähne ihres Haars. Normalerweise durften Patienten während der Therapie keinen Besuch bekommen, aber das Personal kannte Erlendur gut und erhob keine Einwände, als er darum bat, sie besuchen zu dürfen.
Geraume Zeit saßen sie schweigend im Aufenthaltsraum für die Patienten. An den Wänden klebten Plakate gegen Alkohol- und Drogenkonsum.
»Triffst du dich immer noch mit dieser alten Schnepfe?«, fragte Eva und drehte weiter an ihren Haaren.
»Hör auf, sie alte Schnepfe zu nennen«, sagte Erlendur. »Valgerður ist zwei Jahre jünger als ich.«
»Eben, dann passt es doch gut. Triffst du dich immer noch mit ihr?«
»Ja.«
»Und? Besucht diese Valgerður dich auch zu Hause?«
»Das hat sie einmal gemacht.«
»Und sonst trefft ihr euch im Hotel.«
»So in der Art. Wie geht es dir? Schöne Grüße von Sigurður Óli. Er sagt, dass seine Schulter so langsam wieder in Ordnung kommt.«
»Ich hab daneben getroffen. Ich hatte auf seine Birne gezielt.«
»Nicht zu fassen, wie verdammt bescheuert du dich aufführen kannst.«
»Hat sie ihren Kerl denn jetzt verlassen? Die war doch verheiratet, diese Valgerður? Das hast du irgendwann mal gesagt.«
»Das geht dich nichts an.«
»Sie geht also fremd? Was bedeutet, dass du eine verheiratete Frau vögelst. Was denkst du dir dabei?«
»Wir haben nicht miteinander geschlafen. Das geht dich überhaupt nichts an. Und red nicht so ordinär daher!«
»Echt der Killer, dass ihr angeblich noch nicht gevögelt habt.«
»Ich dachte, du würdest hier irgendwelche Medikamente kriegen, beispielsweise gegen deine saumäßige Laune?«
Er stand auf, und sie schaute zu ihm hoch. »Ich habe nicht darum gebeten, hier eingeliefert zu werden. Ich habe dich nicht gebeten, dich um mich zu kümmern. Ich will, dass du mich in Ruhe lässt. Total in Ruhe.«
Er verließ den Aufenthaltsraum, ohne sich zu verabschieden.
»Schöne Grüße an die alte Schnepfe«, rief Eva Lind hinter ihm her und fummelte völlig ungerührt weiter an ihren Haaren. »Schöne Grüße an diese verdammte alte Schnepfe«, wiederholte sie leise.
Erlendur parkte den Wagen vor seinem Wohnblock und betrat das Treppenhaus. Auf seiner Etage angekommen, bemerkte er einen schlaksigen jungen Mann vor der Tür zu seiner Wohnung. Er hatte lange Haare und rauchte. Der Oberkörper befand sich im Schatten, sodass Erlendur sein Gesicht nicht erkennen konnte. Erst dachte er, dass es irgendein Krimineller war, der eine Rechnung mit ihm begleichen wollte. Er bekam manchmal Anrufe, vor allem, wenn die Betreffenden betrunken waren, und sie drohten ihm mit allem Möglichen, weil er ihnen auf die eine oder andere Weise in ihrer tristen Existenz in die Quere gekommen war. Aber es gab auch immer wieder welche, die sich bei ihm zu Hause blicken ließen und ihn zulaberten. Auf so etwas machte er sich jetzt hier im Treppenhaus gefasst. Der junge Mann richtete sich auf, als er Erlendur sah.
»Kann ich bei dir übernachten?«, fragte er und wusste nicht, was er mit dem Zigarettenstummel machen sollte. Erlendur bemerkte zwei Stummel auf dem Linoleum.
»Wer …?«
»Sindri«, sagte der junge Mann und trat aus dem Schatten. »Dein Sohn. Kennst du mich nicht?«
»Sindri?«, fragte Erlendur verwundert.
»Ich bin jetzt wieder in der Stadt«, sagte er. »Mir fiel ein, dass ich mal bei dir vorbeischauen könnte.«
Sigurður Óli hatte sich gerade neben Bergþóra ins Bett gelegt, als das Telefon auf seinem Nachttisch klingelte. Er schaute auf das Display und wusste, wer der Anrufer war. Er hatte nicht vor, zu antworten. Beim siebten Klingeln knuffte Bergþóra ihn in die Seite.
»Geh dran«, sagte sie. »Es tut ihm gut, wenn du mit ihm redest. Er hat das Gefühl, dass du ihm hilfst.«
»Ich will nicht, dass er davon ausgeht, dass er mich zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Hause anrufen kann«, sagte Sigurður Óli.
»Mensch, hab dich doch nicht so«, sagte Bergþóra und griff über Sigurður Óli hinweg nach dem Telefon auf seinem Nachttisch.
»Ja, er ist zu Hause«, sagte sie. »Einen Moment.«
Sie reichte Sigurður Óli den Hörer.
»Für dich«, sagte sie lächelnd.
»Hast du schon geschlafen?«, sagte die Stimme in der Leitung.
»Ja«, log Sigurður Óli. »Und ich hatte dich gebeten, nicht bei mir zu Hause anzurufen. Ich möchte das nicht.«
»Entschuldige«, sagte die Stimme. »Ich kann nicht schlafen. Ich nehme Psychopharmaka und Beruhigungsmittel und Schlaftabletten, aber nichts hilft.«
»Du kannst nicht einfach hier anrufen, wann es dir passt«, sagte Sigurður Óli.
»Entschuldige«, sagte der Mann. »Es geht mir nicht gut.«
»In Ordnung«, sagte Sigurður Óli.
»Es ist genau ein Jahr her. Heute.«
»Ja«, sagte Sigurður Óli. »Ich weiß.«
»Ein ganzes Jahr in der Hölle.«
»Versuch doch, nicht daran zu denken«, sagte Sigurður Óli. »Höchste Zeit, dass du aufhörst, dich so zu quälen. Das hilft überhaupt nichts.«
»Das lässt sich leicht sagen«, sagte der Mann.
»Ich weiß«, sagte Sigurður Óli. »Aber versuch es doch einmal.«
»Was habe ich mir bloß mit diesen verfluchten Erdbeeren gedacht?«
»Wir sind das tausend Mal durchgegangen«, sagte Sigurður Óli. Er schaute Bergþóra an und schüttelte den Kopf. »Es war nicht deine Schuld. Das musst du doch einsehen. Hör auf, dich so zu quälen.«
»Nein«, beharrte der Mann. »Es war meine Schuld. Es war alles meine Schuld.«
Dann legte er auf.
Fünf
Die Blicke der Frau wanderten von Elínborg zu Erlendur, sie lächelte schwach und bat sie einzutreten. Elínborg ging vor, und Erlendur machte die Tür hinter ihnen zu. Sie hatten sich vorher angemeldet, und deswegen hatte die Frau den Tisch gedeckt und Schmalzgebäck und Sandkuchen hingestellt. Aus der Küche drang Kaffeegeruch. Sie befanden sich in einem Reihenhaus in Breiðholt. Elínborg hatte bei ihr angerufen.
Sie hatte wieder geheiratet. Ihr Sohn aus erster Ehe studierte Medizin in den Vereinigten Staaten. Mit ihrem zweiten Mann hatte sie zwei Kinder. Sie hatte einen Schreck bekommen, als Elínborg sie anrief, und sie hatte sich von der Arbeit freigenommen, weil sie lieber zu Hause mit Elínborg und Erlendur sprechen wollte.
»Ist er es?«, fragte die Frau, nachdem sie ihre Gäste gebeten hatte, Platz zu nehmen. Sie hieß Kristín, war schon über sechzig und hatte mit den Jahren ein paar Pfunde zugelegt. Sie hatte in den Nachrichten vom Skelettfund im Kleifarvatn erfahren.
»Wir wissen es nicht«, entgegnete Erlendur. »Wir wissen bisher nur, dass es sich um einen Mann handelt, und wir warten noch auf eine genaue Altersanalyse.«
Einige Tage waren seit dem Fund vergangen. Ein Teil der Knochen wurde zur Karbonanalyse eingesandt, aber die Gerichtsmedizinerin versuchte es auch mit einer anderen Methode, von der sie annahm, dass es damit schneller gehen würde. Elínborg stand mit ihr in Verbindung.
»Inwiefern schneller?«, hatte Erlendur Elínborg gefragt.
»Es hat mit dem Aluminiumwerk in Hafnarfjörður zu tun«, sagte Elínborg.
»Mit dem Aluminiumwerk?«
»Das Aluminiumwerk ist mit seiner Umweltverschmutzung bereits in die Geschichte eingegangen. Es geht um Schwefeldioxid und Fluorid und ähnliche Schadstoffe. Hast du nichts darüber gehört?«
»Nein.«
»Dioxid beispielsweise geht in die Atmosphäre und legt sich über Wasser und Land, und man findet es in den Seen in der Umgebung des Werks, wie beispielsweise im Kleifarvatn. Mit besseren Filteranlagen hat sich der Ausstoß im Laufe der Zeit verringert. Sie sagt, sie habe eine bestimmte Menge in den Knochen gefunden und nach ihren vorläufigen Schätzungen ist die Leiche vor 1970 im See versenkt worden.«
»Wie genau sind solche Angaben?«
»Plus/minus fünf Jahre«, sagte Elínborg.
Die Ermittlungen, was das Skelett im Kleifarvatn betraf, konzentrierten sich zu diesem Zeitpunkt auf Männer, die im Zeitraum zwischen 1965 und 1975 als vermisst gemeldet worden waren. Es gab insgesamt acht Fälle in ganz Island. Krístins erster Mann war einer davon. Sie hatten sich die Protokolle vorgeknöpft. Kristín selbst hatte sein Verschwinden gemeldet, als er eines Tages nicht von der Arbeit nach Hause gekommen war. Sie wartete mit dem Essen auf ihn. Ihr kleiner Sohn spielte auf dem Fußboden. Der Abend verging. Sie badete den Jungen und räumte die Küche auf. Sie hätte den Fernseher angemacht, wenn es nicht Donnerstag gewesen wäre, aber zu dieser Zeit war der Donnerstag ein fernsehfreier Tag in Island.
Das alles hatte sich im Herbst 1969 zugetragen. Sie lebten in einem Mehrfamilienhaus in einer kleinen Wohnung, die sie sich kurze Zeit zuvor gekauft hatten. Er arbeitete als Verkaufsleiter bei einem Maklerbüro, und deswegen hatten sie sie zu günstigen Konditionen bekommen. Sie war gerade mit der Handelsschule fertig geworden, als sie sich kennen lernten. Zwei Jahre später hatten sie mit allem Drum und Dran geheiratet, und ein Jahr nach der Hochzeit kam ihr kleiner Sohn zur Welt, den ihr Mann vergöttert hatte. »Deswegen habe ich es nie verstanden«, sagte Kristín und ließ ihre Blicke zwischen Erlendur und Elínborg hin und her wandern.
Erlendur kam es so vor, als würde sie immer noch auf diesen Mann warten, der so plötzlich und so unbegreiflich aus ihrem Leben verschwunden war. Er sah im Geiste vor sich, wie sie in der herbstlichen Dämmerung auf ihn wartete. Sah vor sich, wie sie Leute anrief, die ihn kannten, ihre Freunde, die Familie, die sich in den darauf folgenden Tagen in der kleinen Wohnung einfand, um sie zu trösten und ihr beizustehen.
»Wir waren glücklich«, sagte sie. »Der kleine Benni war unser Ein und Alles, und ich hatte gerade eine Stelle beim Handelsverband bekommen. Soweit ich wusste, lief bei der Arbeit alles bestens. Er war bei einem großen Maklerbüro angestellt. In der Schule war er nicht besonders gut gewesen, mit dem Gymnasium hörte er nach drei Jahren auf, aber er war tüchtig, und ich glaube, dass er zufrieden mit seinem Leben war. Den Eindruck machte er jedenfalls.«
Sie schenkte ihnen Kaffee ein.
»Mir ist an diesem letzten Tag auch nichts Besonderes aufgefallen«, sagte sie und hielt ihnen die Schale mit Schmalzgebäck hin. »Morgens verabschiedete er sich von mir, mittags rief er an, einfach so, und dann noch einmal am späten Nachmittag, um mir zu sagen, dass es ein wenig später werden würde. Danach habe ich nie wieder etwas von ihm gehört.«
»Er war aber doch nicht so erfolgreich an seinem Arbeitsplatz, er hat dir nur nichts davon erzählt, nicht wahr?«, sagte Elínborg. »Wir haben die Protokolle gelesen, und …« »Es sollte jemandem gekündigt werden. Darüber hat er in den Tagen vorher gesprochen, er wusste aber nicht, wem. Dann wurde er an diesem Tag zu einer Besprechung gebeten, und ihm wurde mitgeteilt, dass er nicht länger gebraucht würde. Der Chef hat mir das später erzählt. Er sagte mir, dass mein Mann nichts zu der Kündigung gesagt hätte, er habe nicht protestiert oder um eine Begründung gebeten, sondern sei nur ein paar Mal im Raum auf und ab gegangen und hätte sich dann wieder an seinen Schreibtisch gesetzt. Keinerlei Reaktion.«
»Dein Mann hat nicht bei dir angerufen und dir davon erzählt?«, fragte Elínborg.
»Nein«, sagte die Frau, und Erlendur spürte die Trauer, die sie umgab. »Er rief an, wie ich schon gesagt habe, aber die Kündigung hat er mit keinem Wort erwähnt.«
»Weswegen wurde er entlassen?«, fragte Erlendur.
»Ich habe darauf nie eine befriedigende Antwort bekommen. Ich nehme an, der Besitzer hatte Mitleid mit mir und wollte mich schonen, als er mit mir sprach. Er sagte, sie hätten Personal abbauen müssen, weil die Umsätze zurückgingen, aber später ist mir dann zu Ohren gekommen, dass Ragnar kein Interesse mehr für seinen Job aufbrachte. Er interessierte sich einfach nicht mehr für seine Arbeit. Das war, nachdem er zu einem Klassentreffen seiner früheren Mitschüler aus dem Gymnasium gegangen war, danach sprach er darüber, dass er eine richtige Ausbildung machen wollte. Er wurde zu dem Klassentreffen eingeladen, obwohl er von der Schule abgegangen war. Seine ehemaligen Mitschüler waren alle Ärzte, Juristen oder Ingenieure. Er hörte sich an, als bereute er es, damals die Schule ohne Abschluss verlassen zu haben.«
»Hast du das irgendwie mit seinem Verschwinden in Verbindung gebracht?«, hakte Erlendur nach.
»Nein, eigentlich nicht«, sagte Kristín. »Genauso gut hätte ich es mit einem kleinen Streit in Verbindung bringen können, den wir einen Tag vorher hatten. Oder damit, dass der Junge nachts schwierig war. Oder dass Ragnar sich kein neues Auto leisten konnte. Ich weiß im Grunde genommen nicht, was ich denken soll.«
»War er depressiv veranlagt?«, fragte Elínborg, der auffiel, dass die Frau sich so anhörte, als sei das alles erst kürzlich passiert.
»Nicht mehr und nicht weniger als alle anderen Isländer. Er verschwand im Herbst, falls das etwas zu sagen hat.«
»Seinerzeit hast du ausdrücklich erklärt, dass ein Verbrechen ausgeschlossen sei«, sagte Erlendur.
»Ja«, erwiderte sie. »Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Er hatte nichts mit solchen Dingen zu tun. Es wäre dann ein purer Zufall gewesen, also dass er jemanden getroffen hat, der ihn aus unerfindlichen Gründen umbrachte. Ich habe nie in Erwägung gezogen, dass so etwas passiert sein könnte, und die Polizei auch nicht. Ihr habt sein Verschwinden nicht als Verbrechen behandelt. Er blieb noch im Büro, als alle anderen gingen, und da hat man ihn zuletzt gesehen.«
»Das Verschwinden wurde also nie unter dem Aspekt untersucht, dass es sich um einen Kriminalfall handeln könnte?«, fragte Elínborg.
»Nein«, sagte Kristín.
»Sag mir etwas ganz anderes«, warf Erlendur ein. »War dein Mann möglicherweise Funkamateur?«
»Funkamateur? Was ist das denn?«
»Eigentlich weiß ich das auch nicht so genau«, sagte Erlendur und blickte Hilfe suchend zu Elínborg hinüber. Die saß da und schwieg. »Das sind Leute, die irgendwelche Funkgeräte besitzen und sich mit Leuten in aller Welt unterhalten«, fuhr Erlendur fort. »Dazu braucht oder brauchte man ziemlich große Geräte und Antennen, um eine möglichst große Reichweite zu erlangen. Hat er so ein Gerät besessen?«
»Nein«, sagte die Frau. »Funkamateur?«
»Oder hatte er sonst irgendwas mit Fernmeldesachen zu tun?«, fragte Elínborg. »Besaß er ein Funkgerät?«
»Was habt ihr da eigentlich im Kleifarvatn gefunden?«, fragte die Frau mit verwunderter Miene. »Er hat nie ein Funkgerät besessen. Was für ein Funkgerät denn?«
»Hat er jemals im Kleifarvatn geangelt?«, fragte Elínborg, ohne auf diese Frage einzugehen. »Kannte er sich dort aus?«
»Nein, nie. Fürs Angeln interessierte er sich nicht. Mein Bruder ist leidenschaftlicher Angler und wollte ihn unbedingt mit auf eine Lachsangeltour nehmen, aber Ragnar hatte keine Lust. Da war er genau wie ich, darin waren wir uns einig. Wir waren dagegen, ohne Not oder sogar nur aus Spaß Tiere zu töten. Am Kleifarvatn sind wir nie gewesen.«
Erlendur fiel ein schön gerahmtes Foto auf einem Regal im Wohnzimmer ins Auge. Es zeigte Kristín mit einem kleinen Jungen, den er für ihren vaterlosen Sohn hielt. Er musste an seinen eigenen Sohn Sindri denken. Erlendur hatte nicht gleich begriffen, warum er gekommen war. Sindri war ihm bisher immer aus dem Weg gegangen, ganz anders als Eva Lind, die ihn dafür zur Verantwortung ziehen wollte, dass er sich nicht um seine Kinder gekümmert hatte, als sie klein waren. Erlendur hatte sich nach kurzer Ehe von ihrer Mutter scheiden lassen, und je mehr Jahre ins Land gingen, desto mehr bereute er es, keinen Kontakt zu seinen Kindern gehabt zu haben.
Sie hatten sich verlegen wie zwei Unbekannte auf dem Etagenflur die Hand gegeben. Er ließ Sindri in die Wohnung und setzte Kaffee auf. Sindri erklärte, auf der Suche nach einem Zimmer oder einem Appartement zu sein. Erlendur sagte, dass er von keiner Wohnung wüsste, versprach aber, sich umzuhören und sich mit ihm in Verbindung zu setzen und ihm Bescheid zu sagen, falls er von etwas erfuhr. »Vielleicht kann ich ja in der Zwischenzeit hier bei dir bleiben«, sagte Sindri und seine Blicke wanderten an den Bücherregalen entlang.
»Hier?«, echote Erlendur und erschien in der Küchentür. Ihm ging ein Licht auf, was Sindri mit seinem Besuch bezweckte.
»Eva hat mir gesagt, dass du ein Zimmer hast, wo nur irgendwelcher Kram drinsteht.«
Erlendur schaute seinen Sohn an. Er hatte ein ungenutztes Zimmer in seiner Wohnung. Der Kram, über den Eva gesprochen hatte, waren Dinge, die im Besitz seiner Eltern gewesen waren und die er aufbewahrte, weil er es nicht übers Herz brachte, sie wegzuwerfen. Sachen aus seiner Kindheit. Eine Truhe mit Briefen seiner Eltern und Ahnen, ein handgeschnitztes Wandregal, Stapel von Zeitschriften, Bücher, Angelruten, eine alte, bleischwere Schrotflinte seines Großvaters, die nicht mehr funktionierte.
»Was ist mit deiner Mutter?«, fragte Erlendur, »kannst du nicht zu ihr?«
»Ja, natürlich«, entgegnete Sindri. »Ich versuch’s bei ihr!« Sie schwiegen.
»Nein, da in dem Zimmer ist kein Platz«, sagte Erlendur. »Und dann … ich weiß nicht …«
»Eva hat aber doch auch hier übernachtet«, sagte Sindri.
Seinen Worten folgte tiefes Schweigen.
»Sie hat gesagt, dass du dich geändert hast«, sagte Sindri schließlich.
»Was ist mit dir?«, fragte Erlendur. »Hast du dich geändert?«
»Ich hab schon ein paar Monate keinen Alkohol mehr angerührt«, erklärte Sindri. »Falls du darauf anspielst.«
Erlendur kam wieder zu sich und trank einen Schluck Kaffee. Seine Blicke glitten von dem Foto hinüber zu Kristín. Jetzt verlangte es ihn nach einer Zigarette.
»Der Junge hat also nie seinen Vater gekannt«, sagte er. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, dass Elínborg ihn scharf ansah, aber er ließ sich nicht beirren. Er wusste ganz genau, dass er in die Privatsphäre der Frau eingedrungen war, die vor mehr als dreißig Jahren ihren Mann auf so rätselhafte Weise verloren und nie eine befriedigende Erklärung erhalten hatte. Erlendurs Frage hatte nichts mit den Ermittlungen zu tun.
»Sein Stiefvater ist immer sehr gut zu ihm gewesen, und zwischen ihm und seinen Brüdern herrscht ein gutes Verhältnis«, erwiderte sie. »Ich verstehe aber nicht, was das mit dem Verschwinden meines Mannes zu tun hat.«
»Nein, entschuldige bitte«, sagte Erlendur.
»Das war’s dann wohl, denke ich«, erklärte Elínborg.
»Glaubt ihr, dass er es ist?«, fragte Kristín und stand auf. »Meiner Meinung nach spricht wenig dafür«, sagte Elínborg. »Aber wir müssen uns erst noch eingehender mit der Sache befassen.«
Sie blieben einen Augenblick stehen, ohne sich zu rühren, so als sei noch etwas unausgesprochen, als läge etwas in der Luft, das erwähnt werden musste, bevor sie auseinander gingen.
»Ein Jahr nachdem er verschwunden war«, sagte Kristín, »wurde auf Snæfellsnes eine Leiche an Land getrieben. Man glaubte zuerst, dass er es sei, aber dann stellte sich heraus, dass es nicht stimmte.«
Sie rieb sich nervös die Hände.
»Manchmal glaube ich sogar heute noch, dass er noch am Leben sein könnte. Dass er keinesfalls gestorben ist. Manchmal glaube ich, dass er uns verlassen hat und vielleicht aufs Land oder ins Ausland gezogen ist, ohne uns Bescheid zu geben, und dass er vielleicht eine neue Familie gegründet hat. Mir kam es sogar einmal so vor, als hätte ich ihn hier in Reykjavík gesehen. Vor vier oder fünf Jahren habe ich zuletzt das Gefühl gehabt, ich hätte ihn gesehen. Ich bin wie ein Idiot hinter dem Mann her. Das war im Kringlan-Einkaufszentrum. Ich habe ihm so lange nachspioniert, bis ich merkte, dass er es nicht war.«
Sie sah Erlendur an.
»Er ist verschwunden, aber trotzdem … verschwindet er eigentlich nie«, sagte sie, und ein trauriges Lächeln spielte um ihre Lippen.