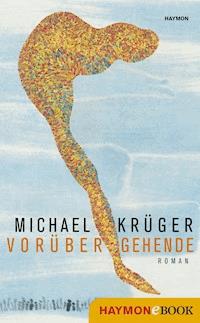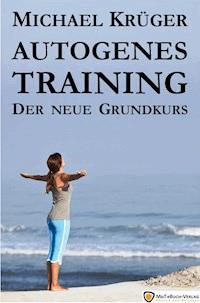Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der auf die Bekämpfung von Korruption und Wirtschaftskriminalität spezialisierte Schweizer Richter Urs Conradt wird den politischen und wirtschaftlichen Eliten des Landes gefährlich. Wegen vermeintlichen Amtsmissbrauches wird er suspendiert. Seiner Möglichkeiten der Strafverfolgung beraubt, entschließt er sich, im Verborgenen weiter zu arbeiten. Durch Zufall erfährt Conradt von der Steuerbetrugsaffäre um den Hamburger Architekten Jacob Verheyen. Unterstützt von CHIP, einem ehemals von Urs Conradt verurteilten Hacker, versucht er, den steuerflüchtigen Architekten zu überwachen und dessen Flucht und das Verschwinden des unversteuerten Vermögens in Panama zu verhindern. Aber sie sind nicht die Einzigen, die den Architekten jagen. Sowohl ein Schweizer Pharmakonzern als auch Verheyens panamaische Geschäftspartner zögern nicht, ihre Interessen mit allen Mitteln durchzusetzen. Ein riskanter Wettlauf beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ina, Oscar und Emily
Die wichtigsten und wunderbarsten Menschen in meinem Leben
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden. Gleichwohl habe ich mich an aktuellen Nachrichten orientiert, die aus einer ersten Idee das Konzept für diesen Roman entstehen ließen. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und unbeabsichtigt.
Wollen wir wirklich faire Prozesse? Nein, wir wollen Gerechtigkeit, und das schnell. Und was ist Gerechtigkeit? Das, was wir von Fall zu Fall dafür halten.
John Grisham, Der Gerechte
Inhaltsverzeichnis
Buch I: Fiasko von Chiasso
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Buch II: Anklage im Informatikskandal des Bundes
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Buch III
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Buch IV
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Epilog
Buch I
Fiasko von Chiasso
Ein ungewöhnlicher Finanzskandal, bei dem eine Züricher Großbank einige hundert Millionen Franken verlor, brachte das Schweizer Geldgewerbe ins Gerede.
Ihre Solidität galt als unübertrefflich, ihre Seriosität, Grundlage des Geschäfts, schien untadelig: Die Bankiers der Schweiz wurden jahrzehntelang weltweit als Vorbilder ihres Standes gefeiert. Seit einiger Zeit allerdings leiden die „Gnome von Zürich“ unter ernsten Rufschäden. Pleiten von Privatbanken und Fehlspekulationen selbst erster Adressen lädierten das einst makellose Ansehen.
Angefangen hatte das „Fiasko von Chiasso“ (Neue Zürcher Zeitung) offenbar schon vor Jahren, als die Banken im Tessin immer heftiger darum wetteiferten, Fluchtgelder in Milliardenhöhe aus dem krisengebeutelten Italien in die sichere Schweiz zu schleusen.
36 Banken sind seit 1970 wegen Pleiten und Übernahmen vom Finanzplatz Schweiz verschwunden, rund 20 Bankinstitute waren in Affären verwickelt.
Der Spiegel, 18/1977
Kapitel 1
Es liegt in der Natur der Dinge, dass einer Stichprobe etwas Zufälliges anhaftet. Und so war es reiner Zufall, dass Jacob Verheyen bei seiner Ankunft am Flughafen Hamburg einer Stichprobenkontrolle des Zolls unterzogen wurde. Sein Flug aus Zürich hatte leichte Verspätung, aber er nahm es gelassen, er war nicht in Eile.
Seine Reise von Panama nach Zürich war sehr angenehm verlaufen. Nach einem schmackhaften, von einem ordentlichen Rotwein begleiteten Abendessen hatte er mehrere Stunden gut geschlafen und die Annehmlichkeiten des Fluges in der First Class in vollen Zügen genossen. Der dreistündige Aufenthalt am Flughafen Zürich hatte ihm genügend Zeit gelassen, zu duschen und in frische Kleidung zu wechseln. Und nun sah er einem ruhigen Nachmittag in seinem Apartment mit Blick über die Außenalster entgegen. Für den Abend war im east Restaurant in St. Pauli reserviert und er freute sich auf den gemeinsamen Abend mit Patricia.
„Haben Sie etwas zu verzollen?“
„Entschuldigung? – Wie bitte?“
„Haben Sie etwas zu verzollen?“, fragte der Zollbeamte erneut und sah Verheyen aufmerksam an.
„Nein, habe ich nicht“, antwortete Verheyen gedehnt und zwang sich, an etwas anderes zu denken.
„Sie kommen aus …?“
„Zürich, ich komme aus Zürich.”
„Darf ich bitte Ihre Bordkarte und Ihren Ausweis sehen?“
Wortlos reichte Verheyen dem Beamten Pass und Bordkarte, der sie sich kurz anschaute.
„Sie kommen ursprünglich aus Panama. Darf ich fragen, was Sie nach Panama geführt hat?“
„Ich war geschäftlich dort.”
„Welche Art von Geschäften?“
„Immobilien. Ich bin Architekt und plane ein Freizeitressort im Süden des Landes.“
„Dürfte ich einen Blick in Ihr Gepäck werfen?“
Verheyen nickte kurz. Er wollte die Sache schnell hinter sich bringen und hoffte, dass der von ihm vorab bestellte Fahrer abfahrtbereit auf ihn wartete.
Der Zollbeamte öffnete sein Fluggepäck, das nur aus einem Kleidersack und seinem Aktenkoffer bestand. Zügig und professionell wurden Reißverschlüsse und Taschen des Kleidersackes geöffnet, kurz der Inhalt begutachtet und alles wieder ordentlich zurückgelegt. Das gleiche Prozedere folgte bei Verheyens Aktenkoffer: einige Zeitschriften, Laptop, Tablett, Projektunterlagen aus Veracruz, Reisedokumente und Belege. Alle Taschen und Fächer wurden geöffnet, ein kurzer Blick, dann wieder verschlossen.
Plötzlich stockte der Zollbeamte und öffnete die kleine Innentasche ein zweites Mal, schaute hinein und zog einen Reisepass heraus, einen panamaischen Reisepass.
„Ist das Ihr Pass?“
„Ja, ähm, nein“, antwortete Verheyen irritiert. Das ihm das passieren konnte! Leichtsinn, ein Fehler!
Der Zollbeamte winkte einen Kollegen herbei, und als dieser erschien, öffnete er den panamaischen Reisepass und schaute hinein. Dann blickten sie beide Jacob Verheyen an, der Blick wanderte wieder zurück in das Reisedokument und schließlich wurden der vor wenigen Minuten überreichte deutsche Reisepass und die Bordkarte zu Rate gezogen. Sorgfältig durchblätterten die Beamten beide Dokumente. Immer wieder kehrten ihre Blicke zu Verheyen und zu den Passbildern zurück.
„Herr Verheyen? Wenn wir das richtig verstehen, besitzen Sie zwei Reisepässe?“
Jacob Verheyen antwortete nicht, es fehlten ihm schlicht die Worte. Gedanken rasten in seinem Kopf hin und her und er begann, nervös zu werden. Er spürte erste Schweißtropfen in einem dünnen Rinnsal langsam seinen Rücken hinabsickern.
„In beiden Pässen ist das identische Passfoto abgebildet“, fuhr der Beamte fort, „aber in Ihrem deutschen Pass sind Sie als Jacob Verheyen geführt, in dem panamaischen Reisepass“, er schlug wieder die erste Seite des Dokumentes auf, „sind Sie als Raoul Garcia, wohnhaft in Panama City eingetragen. Wollen Sie uns das erklären?“
Verheyen wusste, dass er in Schwierigkeiten steckte, in großen Schwierigkeiten, und er hoffte, mit einem Bluff die Angelegenheit klären zu können.
„Ich besitze beide Staatsangehörigkeiten“, schoss es aus ihm heraus, in der Hoffnung, die beiden jungen Beamten würden ihn ziehen lassen.
„Das ist schon möglich“, sagte der Beamte, der sein Gepäck durchsucht hatte, „aber doch nicht mit einem zweiten Namen“, ergänzte er mit einem leichten Lächeln. „Das gibt es nicht, auch nicht in Südamerika. – Ich glaube, wir sollten dieses Gespräch an anderer Stelle fortsetzen.”
Sein Kollege griff bereits zum Telefon, wandte sich dann zur Seite, sodass Verheyen nicht mithören konnte, und legte nach nur wenigen Augenblicken wieder auf.
„Bitte nehmen Sie Ihr Gepäck und folgen Sie uns.“
Der Flughafen Hamburg verfügt über drei moderne, freundlich und offen gestaltete Abfertigungsgebäude, die durchaus einen gewissen Charme ausstrahlen. Sobald man diesen offiziellen Fluggastbereich jedoch verlässt, wird die Atmosphäre schnell sachlicher. Jacob Verheyen öffneten sich typische Behördenflure mit Linoleumbelag, ockergelb gestrichenen Wänden, deren letzter Anstrich schon eine ganze Weile zurückliegen musste, Anschlagtafeln mit Dienstplänen, Fahndungsfotos, besonderen Hinweisen und einer langen Reihe grün gestrichener, verschlossener Türen.
Er folgte den beiden Beamten, die sich seiner Reisedokumente bemächtigt hatten, ahnend, dass dieser Nachmittag noch lange nicht zu Ende war. Sein Mobiltelefon vibrierte in seiner Jackentasche, ein kurzer Blick zeigte ihm, dass es der Limousinen-Service war, der ihn zu seiner Wohnung fahren sollte. Er unterdrückte den Anruf und folgte den Beamten weiter, die schließlich eine, wie es Verheyen vorkam, völlig beliebige Tür öffneten und ihn hereinbaten. Drinnen ein Schreibtisch mit Computer, zwei Stühle auf beiden Seiten, ein Telefon, kein Fenster, dafür eine in die Decke eingelassene Tageslichtlampe, die den Raum hell erleuchtete, weißes Licht, die Wände kahl.
„Bitte nehmen Sie Platz.“
Verheyen ließ sein Gepäck neben einem der Stühle zu Boden sinken und nahm Platz, ihm gegenüber, mit Blick auf den Bildschirm, der Beamte, der sein Gepäck untersucht hatte, vor sich die Reisedokumente. Er registrierte sich auf einer zoll-internen Plattform, hangelte sich durch einige Menüs und öffnete schließlich eine Seite zur Verifizierung biometrischer Daten. Sorgfältig scannte er die Passbildseite des deutschen Reisepasses über das verbundene Lesegerät ein, drückte noch einige Befehlstasten und wartete auf das Ergebnis.
„Also, Herr Verheyen, der deutsche Pass ist echt. Sie sind Jacob Verheyen, geboren am 17.7.1964 in Hamburg, wohnhaft Harvestehuder Weg 12, ebenfalls in Hamburg, Beruf: Architekt. Stimmt das soweit?“
„Ja, korrekt. Hören Sie“, sein Mobiltelefon vibrierte erneut, er unterdrückte den Anruf ein zweites Mal, „ich will Ihnen das erklären. Es ist alles völlig harmlos, das hat mit meinen Geschäften in Südamerika zu tun. Es ist manchmal einfacher“, er stockte und suchte nach den passenden Worten. „Es ist manchmal sicherer, in diesen Ländern nicht als Ausländer aufzutreten. Sie wissen schon“, mit einem gewinnenden Lächeln, „das ist halt anders als bei uns. Wenn Sie da als Europäer auftreten, zahlen Sie mindestens die doppelten Preise, werden an allen Ecken betrogen und laufen eventuell sogar Gefahr, überfallen und ausgeraubt zu werden. Ich spreche fließend Spanisch, ich gehe rein äußerlich durchaus als Südamerikaner mit spanischen Wurzeln durch, es macht das Leben einfacher und sicherer. Es entsteht ja kein Schaden. Sie verstehen schon? Ich reise dort viel herum wegen der Bauprojekte, für die ich als Architekt zuständig bin. Da muss nicht jeder wissen, dass ich Deutscher bin.“
Langsam kam er in Fahrt und seine anfängliche Nervosität begann, von ihm abzufallen. Er richtete sich auf seinem Stuhl auf, sein Rücken straffte sich. Es war ein vorübergehender Moment der Schwäche gewesen, verursacht durch den langen Flug und die Aussicht auf einen schönen Abend mit Patricia. Jetzt würde sich aber alles schnell aufklären und dann konnte er endlich nach Hause fahren.
„Der panamaische Pass ist nur ein Fake, den benutze ich hier natürlich nie und auch nicht beim Grenzübergang. Schauen Sie im deutschen Pass, Einreisestempel … Ausreisestempel … Alles ganz offiziell, da ist nichts falsch. Das ist doch nicht illegal, solange ich den Panama-Pass hier gar nicht benutze? Eine Bagatelle. Höchstens eine Ordnungswidrigkeit, vielleicht ein Bußgeld, dann ist die Sache erledigt?”
Er versuchte, die positive Stimmung irgendwie über den Tisch zu bringen. Bloß nicht wieder nervös werden! Bloß nicht die Nerven verlieren oder irgendwie versuchen, die Beamten zu bestechen, wie das in Südamerika Gang und Gäbe war und üblicherweise auch funktionierte. Jeder profitierte davon, die Maschinerie musste geölt werden. Aber nicht hier. Keine Andeutungen in diese Richtung.
Einige Zeit lang herrschte Schweigen im Raum. Schließlich fragte der Beamte: „Nur damit wir das richtig verstehen, Sie geben zu, einen gefälschten panamaischen Pass zu besitzen, um damit in Südamerika unter einer falschen Identität sicherer reisen zu können? Ist das ungefähr der Kern der Geschichte? Und Sie führen weiterhin aus, dass dieser gefälschte Pass nicht außerhalb Panamas verwendet wurde? Sind Sie auch bereit, dies schriftlich gegenüber der Polizei zu bestätigen? Denn ich glaube nicht, dass der Zoll hierfür zuständig ist, sondern die Bundespolizei.“
Verheyen wusste, dass er jetzt nicht den Rückzug antreten konnte. Wollte er hier erst einmal herauskommen, dann musste er das jetzt durchfechten.
„Ja, natürlich“, antwortete er ruhig.
Die Beamten wechselten einen kurzen Blick, sammelten die Reisedokumente ein, erhoben sich und bewegten sich in Richtung Tür.
„Sie warten hier bitte, wir verständigen unsere Kollegen von der Bundespolizei. Die werden entscheiden, wie es weitergeht.”
Die Tür schloss sich fest hinter ihnen. Jacob Verheyen war endlich alleine. Die Anspannung fiel etwas von ihm ab. Schnell nahm er sein Handy und schickte eine SMS an den Limousinen-Service: Komme verspätet an, bitte Auftrag stornieren, melde mich später. Das würde fürs Erste reichen, er war ein guter Kunde und es würde unter Kulanz laufen.
Problem gelöst.
Dann eine zweite SMS an Patricia: Komme verspätet an. Lass uns bei mir essen. Sushi vorm Kamin? Er wusste, er hatte etwas gutzumachen, denn sie hatte sich schon sehr auf diesen Restaurantbesuch gefreut. Melde mich, sobald ich zu Hause bin.
Problem gelöst.
Tischreservierung storniert.
Problem gelöst.
Verheyen fühlte seine Energie und Kontrolle zurückkehren. Er war ein Mann der Tat.
Eine Viertelstunde später kamen die Zollbeamten in Begleitung einer Polizistin zurück. Offensichtlich hatten die Behörden den Fall bereits miteinander besprochen und so ging alles zügig vonstatten: ein Protokoll wurde aufgesetzt, das die wesentlichen Eckpunkte festhielt, der panamaische Reisepass wurde einbehalten zwecks weiterer Ermittlungen und Abstimmung mit den panamaischen Behörden. Jacob Verheyen unterzeichnete das Protokoll und durfte etwa zwei Stunden nach seiner Ankunft das Flughafengebäude verlassen. Ein Taxi fuhr ihn zu seinem Appartement, auf dem Weg benachrichtigte er Patricia und bestellte danach das beste Sushi der Stadt.
Problem gelöst.
Kapitel 2
„Kaltgestellt.“
Seit dem Gespräch im Großen Rat des Kanton Zürich in der vorvergangenen Woche beherrschte dieses eine Wort das Leben von Oberrichter Urs Conradt. Es dominierte sein gesamtes Fühlen, Denken und Handeln. Er lebte mit diesem Wort, er erwachte morgens mit ihm, er träumte es, er konnte es schmecken und riechen, sehen, fühlen und hören. Es war kalt, emotionslos und allgegenwärtig.
„Kaltgestellt“, bestätigte Maike Kaldenhoff lapidar, wenn auch nicht ohne Mitgefühl, am Telefon, als er ihr von dem Gespräch erzählte. Als ob er das nicht schon verstanden hätte! Dr. Maike Kaldenhoff, Staatsanwältin am Oberlandesgericht Hamburg, war eine der wenigen Personen seines Vertrauens, die die ganze Tragweite dieses Vorganges erfassen konnten. Unglauben schwang in ihrer Stimme mit und Unglauben beherrschte die ersten Tage nach der Freistellung. Doch inzwischen war aus dem Unglauben schiere Gewissheit geworden.
„… haben wir uns entschieden, Sie mit sofortiger Wirkung … und in Anbetracht Ihrer ohne jeden Zweifel enormen Verdienste … natürlich bei vollen Bezügen … freizustellen.“
Es war nicht so, dass er das Risiko nicht gekannt hätte. Sie hatten irgendwann reagieren müssen. Aber als es kam, traf es ihn doch unerwartet. Freigestellt! Ab sofort!
Das System steht über allem. Das System gebiert seine eigene Führung und diese wird alles daransetzen, das System, das sie nährt, am Leben zu erhalten. Es ist ein sozialwirtschaftliches Perpetuum Mobile. Führen kann nur, wer das System fördert. Das System infrage zu stellen heißt, das System zu gefährden. Das System ändern zu wollen, heißt, das Gleichgewicht zu stören, und Störungen sind zu beseitigen.
Urs Conradt war eine Störung. Die Art, wie er sein Richteramt ausübte, seine unnachgiebige Ahndung gesellschaftlichen Fehlverhaltens, seine Kompromisslosigkeit, ja, sein Unwille, „politische“ Lösungen zu finden oder ihnen zuzustimmen, war eine Störung. Es ging ihm gar nicht um die Abschaffung oder Zerstörung des Systems, sondern um die Beseitigung systemischer Störungen. Diese waren in seinen Augen die eigentliche Gefahr für das von ihm grundsätzlich geschätzte Wertesystem Schweiz mit all seinen für Außenstehende vielleicht skurril wirkenden Besonderheiten. Systemische Störungen waren in seinen Augen die zunehmende Verfilzung von Staat und Wirtschaft, die Korruption, die geheimen Absprachen bei öffentlichen Ausschreibungen, die Besetzung öffentlicher Ämter als Gefälligkeit und für Gefälligkeiten, die stetige Durchsetzung der politischen und wirtschaftlichen Führung des Landes mit Profiteuren dieses Filzes. Die Schweiz ist mit ihren etwa acht Millionen Einwohnern ein vergleichsweise kleines Land. Die Führungsschicht rekrutiert sich aus einer kleinen Clique. Man kennt sich. Aus dem Lyceum, dem Studium, der Militärzeit, familiärer Verbundenheit. Da weiß man, auf wen man sich verlassen kann.
Das Anprangern solcher Missstände gilt als Verrat am System an sich.
Er verstand, dass „freigestellt“ der ziemlich durchsichtige Versuch war, seine Kooperation für die Zukunft sicherzustellen.
Es war nicht so, dass er die nun unfreiwillig gewonnene Zeit nicht sinnvoll nutzen konnte und zu nutzen bereit war. Mit Mitte fünfzig fühlte er sich auf dem Höhepunkt seines beruflichen Schaffens. Er würde sein Leben nicht dem Golfspiel oder einem allgemeinen Müßiggang widmen. Ganz im Gegenteil. Aber seine Veröffentlichungen, die Kommentare und Kolumnen in der New York Times, Le Monde, in der FAZ oder der Nihon Keizai Shimbun, die Vorträge und Beratungsleistungen für diverse Think Tanks hatten doch längst nicht die direkte, die unmittelbare Wirkung auf unrechtmäßiges Handeln wie sein Richteramt. Allenfalls eine mittelbare, wobei sich auch diese vermutlich auf die Befriedigung eines vagen allgemeinen gesellschaftlichen Bedürfnisses nach Gerechtigkeit beschränkte.
Er fühlte sich seiner wirksamsten Waffen beraubt. Die Nadelstiche, die er der Wirtschaftskriminalität in der Schweiz, in Italien, Deutschland und Frankreich hatte versetzen konnte, waren schmerzhaft gewesen. Gegen käufliche Politiker, illegale Parteienfinanzierung, Korruption und Verdacht auf Geldwäsche war er erfolgreich vorgegangen: Rücktritte namhafter korrupter Beamter und Manager, Inhaftierung, öffentliche Bloßstellung undurchsichtiger Machenschaften und Verbindungen. Je tiefer er gebohrt hatte, je höhergestellt die betroffenen Personen waren, desto schärfer war der Gegenwind gewesen.
Auch sozial hatte er sich durch seine Beharrlichkeit und Kompromisslosigkeit ins Abseits manövriert. Er wurde respektiert, aber bei allen Zusammenkünften schwang stets eine gewisse Zurückhaltung mit. Das hatte er billigend in Kauf genommen. Zufrieden und von der Richtigkeit seines Handelns und des Nutzens für die Allgemeinheit zutiefst überzeugt, suchte er nicht nach öffentlicher Anerkennung. Die Freundschaft einiger weniger war ihm unendlich wichtig, aber den Rest? Brauchte er nicht.
Das sollte nun alles ein Ende finden? Bestimmt nicht. Es musste andere Wege geben.
Das System glaubte, ihn mit diesem goldenen Löffel ruhigstellen zu können. Es wollte ein Exempel statuieren. Er sollte eine Warnung für andere sein. Aber für diese Rolle wollte er nicht zur Verfügung stehen. Wenn er offiziell seines Einflusses beraubt wurde, dann musste er einen anderen Weg gehen.
„Ich stelle das System über seine Eliten. Ich werde einen Weg finden, Missstände aufzudecken oder zu beseitigen. Die Wirkung wird wahrscheinlich ebenso begrenzt sein wie in meinem Richteramt, aber ich werde einzelne Geschwüre beseitigen. Ich werde nicht grundsätzlich verhindern können, dass Geschwüre entstehen. Aber damit werde ich leben können.“
Diese Sätze wiederholte er immer wieder, wenn er, durch die Freistellung schlagartig mit sehr viel Zeit ausgestattet, entschlossenen Schrittes die Wanderwege oberhalb von Küsnacht und Meilen am Nord-Ost-Ufer des Zürichsees ablief. Arbeitete sich an den Sätzen, Gedanken und Formulierungen ab, bis sie für ihn stimmig wurden.
Ein großer, fast athletischer Mann, mit wachem Blick, aufrecht und raumgreifend das Gelände erobernd. Er war für diese Wanderungen adäquat, nicht modisch gekleidet. Auf den gelegentlichen Spaziergänger wirkte er in seiner Zielstrebigkeit, hin und wieder halblaut vor sich hinsprechend, etwas befremdlich. Es war erkennbar, dass hier jemand mit sich ins Reine kommen musste. Die kühle und feuchte Herbstluft, nur selten von wärmenden Sonnenstrahlen durchbrochen, störte ihn nicht. Vielmehr gab sie den passenden Rahmen für seine ernsten, das Grundsätzliche seiner Existenz berührenden Gedanken.
Im Laufe der Tage und langen Wanderungen wuchs in ihm aus den ersten Bruchstücken möglicher Handlungsalternativen eine „Jetzt-erst-recht-Haltung“ heran, die ihn zu einer Grundsatzentscheidung zwang. Es waren nicht Rache oder Zorn, die ihn antrieben, sondern Trotz und die Gewissheit, an dem entscheidenden Wendepunkt seines Lebens zu stehen. Es gab nur eine mögliche, für ihn tragbare Richtungsentscheidung, auch wenn er noch nicht genau erkannte, wie er diesen Weg gehen sollte oder welche Risiken damit verbunden sein würden.
******
Beat Glauser leitete die kantonale Baudirektion. Er hatte in den vergangenen Jahren die Liberale Partei der Schweiz – kurz LPdS – mit massiver Unterstützung aus der Industrie von einer kaum beachteten Splitterpartei zu einer stark positionierten Kraft im Kantonsrat geführt. Er galt als eloquent, rücksichtlos und extrem ehrgeizig. Er kam aus einer Molkereidynastie, die heute von seinem Bruder geleitet wurde. Glauser hatte früh den Weg in die Politik gesucht und, da er bei den existierenden Parteien keine politische Heimat gefunden hatte, seine eigene Partei gegründet. Das Programm war ein wenig diffus, sehr wirtschafts- und industriefreundlich, ein wenig ausländerfeindlich, ein wenig nationalistisch. Es gab eine ganze Reihe von Gerüchten über seine engen Beziehungen zu einzelnen Bauunternehmen, die von den Aufträgen der öffentlichen Hand abhingen. Aber nie konnte etwas bewiesen werden.
Die Staatsanwaltschaft war auf ihn aufmerksam geworden, als bei Untersuchungen wegen möglicher Konkursverschleppung eines kleineren Bauunternehmens, das sich bei der Ausführung eines Straßenbauprojektes verhoben hatte, Unterlagen auftauchten, die den Anfangsverdacht einer illegalen Parteienfinanzierung ergaben. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln. Je länger diese Ermittlungen dauerten, desto deutlicher zeichnete sich ein Geflecht gegenseitigen Gebens und Nehmens im Dreieck aus kantonaler Baudirektion, LPdS und Bauindustrie ab. Aber es fehlten die konkreten Beweise, die eine Anklage ermöglicht hätten. Anscheinend wurden die Absprachen ausschließlich mündlich getroffen.
Beat Glauser gehörte der sogenannten Sauna-Connection an. Regelmäßig traf sich eine ausschließlich aus Männern bestehende kleine Gruppe aus Politik, Wirtschaft und Industrie in einem exklusiven und etwas anrüchigen Spa auf der deutschen Seite des Bodensees. Dort wurden zunächst hinter verschlossenen Türen nackt und schwitzend geschäftliche und politische Kungeleien ausgehandelt, bevor die Herren sich zu fortgeschrittener Stunde den Zuwendungen junger Damen hingaben, die nur für diese Anlässe aus München und anderen Teilen der Bundesrepublik an den Bodensee eingeladen wurden.
Im Laufe der Zeit war es immer frustrierender für die Ermittlungsbehörden geworden. Es hatte sich nichts hieb- und stichfest nachweisen lassen. In einem vertraulichen und informellen Treffen zwischen Staatsanwaltschaft, beteiligten Ermittlern und Conradt als zuständigem Richter, waren mögliche Vorgehensweisen besprochen worden. Entweder mussten die Ermittlungen eingestellt, oder stichhaltige Beweise gefunden werden.
Martin Gruber, der Leiter des Ermittlerteams, hatte deshalb eine Abhöraktion in der Sauna vorgeschlagen. Aber ohne konkrete Hinweise auf eine bevorstehende Straftat hatte Conradt dem Antrag auf eine entsprechende Abhöraktion nicht zustimmen können. Die Diskussion war immer hitziger geworden, die Frustration war allen deutlich ins Gesicht geschrieben gewesen.
„Und wenn wir es ohne Genehmigung durchführen?“, hatte Gruber nach einer Weile gefragt.
Schlagartig war es sehr still im Raum geworden. Urs Conradt glaubte noch heute, dass Gruber nur ausgesprochen hatte, was alle anderen lange schon gedacht hatten. Es war ein gewagter Vorstoß gewesen.
Sowohl der Staatsanwalt als auch er hatten ihre Besorgnis ausgedrückt: „Sie wissen, dass das ein Verstoß gegen geltendes Recht ist?“
„Absolut“, hatte Gruber bestätigt.
„Und es wäre nicht verwendbar vor Gericht“, hatte Conradt ergänzt.
„Ganz sicher nicht“, hatte Gruber zugegeben, „aber wenn wir wüssten, dass diese Absprachen stattfinden, wüssten wir vielleicht auch, wo wir verwertbare Beweise finden.“
„Und es gibt Ärger mit Deutschland, wenn das herauskommt“, hatte der Staatsanwalt zu Bedenken gegeben.
„Ganz sicher“, hatte Gruber erneut bestätigt.
In der entstehenden Pause hatten die Teilnehmer fragend in die Runde geblickt. Niemandem war wohl bei diesem Vorschlag gewesen, aber keiner hatte eine bessere Idee vorgebracht.
„Ist es technisch machbar?“, hatte der Staatsanwalt schließlich wissen wollen.
„Absolut“, hatte Gruber geantwortet, „kein Problem.“
Wieder war eine Pause entstanden.
„Also?“, Gruber hatte nicht lockergelassen. Ein Teilnehmer nach dem anderen hatte zustimmend genickt. Die Runde hatte sich aufgelöst.
Im Verlauf der folgenden Wochen und Monate hatten die Mitschnitte der Gespräche aus der Sauna zu einer deutlichen Verbesserung der Erkenntnislage für eine mögliche Anklage geführt.
Leider hatte ein Teilnehmer des Ermittlerteams kalte Füße bekommen oder hatte, aus welchen Gründen auch immer, die Seiten gewechselt und die ganze Sache war aufgeflogen. Oberrichter Conradt hatte die Abhöraktion zwar nicht autorisiert, aber stillschweigend gebilligt. Das hatte als Vorwand gereicht, ihn aus dem Verkehr zu ziehen.
So funktionierte Politik.
Kapitel 3
Paris ist zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter eine Reise wert. Conradt landete in Paris am frühen Freitagnachmittag. Die heißen Sommermonate waren vorbei, und der übliche Touristentrubel war ein wenig verebbt. Es versprach, ein angenehmes Herbstwochenende zu werden, gelegentlicher leichter Regen, aber nicht zu kühl. Perfekt für das Wiedersehen mit Maike Kaldenhoff nach nahezu fünf Wochen.
Das Hotel George V ist ein Ort der Tradition, verbunden mit allen Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts. Maike würde erst gegen 19:00 Uhr eintreffen und so genoss er einen kurzen Gang durch die Nebenstraßen der Avenue George V. Dann setzte er sich in Erwartung ihrer Ankunft in die hoteleigene Bar La Galerie und ließ sich von der Atmosphäre dieses Empire-Juwels einfangen.
Kurz nach 19:00 Uhr kam sie ihm mit langen Schritten durch die Bar entgegen. Conradt erhob sich und versank im Anblick dieser schönen, selbstsicheren Frau, die er schon so lange kannte und mit der er seit fast drei Jahren eine wunderbare, intensive und leidenschaftliche Beziehung führte, eine Beziehung tiefer gegenseitiger Achtung, die beiden viel Raum für ihre jeweiligen beruflichen Ambitionen ließ und nicht an gemeinsames Wohnen gebunden war.
„Du hast mir gefehlt“, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln und ließ ihre Tasche auf den Sessel gleiten, bevor sie ihn umarmte und sich an ihn schmiegte. Conradt, einen halben Kopf größer als Maike, spürte ihren Körper, vergrub sein Gesicht in ihrem kastanienbraunen Haar; ein Hauch von Parfum, aber so dezent, dass er ihre zarte Haut am Hals riechen konnte, ein Geruch, der durch die Feuchtigkeit seines Atems intensiviert wurde.
Es war ein wunderbarer kurzer Augenblick, der sie beide die Mühen der langen Anreise vergessen ließ. Die Welt um sie herum versank für einen Moment in vollständiger Bedeutungslosigkeit. Als sie sich aus der Umarmung lösten, gab sie ihm einen zarten Kuss, dann trennten sie sich, um in die gegenüberliegenden Sessel zu sinken. Ihre Hand ließ er nicht los.
„Madame. Monsieur, bonjour, vous désirez?“
Der Kellner hatte sich während ihrer Begrüßung dezent im Hintergrund gehalten.
Sie bestellten zwei Gläser Champagner und wurden wieder vertraut miteinander. Auch wenn sie viel telefonierten und Nachrichten aller Art austauschten, schaffte das Fehlen körperlicher Nähe eine Leere, die sie nun behutsam wieder füllten. Die Art, sich zu bewegen, die Fältchen im Gesicht, der Glanz der Augen, die Worte, die Gesten. Alles wurde an der Skala der Summe aller bisherigen Eindrücke überprüft und kleine Abweichungen sorgsam registriert. Was hatte sich geändert, was war neu und wie war Neues einzuordnen?
„Du hast mir gefehlt“, sagte erneut und diese vier Worte implizierten, „ … so, wie du bist.”
„Du mir auch“, antwortete Conradt, jedem Wort sein angemessenes Gewicht gebend.
Sie hoben die Gläser, die der Kellner zurückhaltend auf einen kleinen Serviertisch neben ihren Sesseln abgestellt hatte. „Auf dich und auf Paris“, ergänzte er und sie wussten, dass ein wunderbares Wochenende auf sie wartete.
Diese zwei Tage gehörten ihnen ganz alleine. Die berufliche Situation des Richters klammerten sie zunächst aus, ohne dass es einer Absprache bedurft hätte. Das Hotel verließen sie erst spät am Samstagvormittag. Sie schlenderten durch die Straßen, begutachteten die Auslagen der Geschäfte in der Galerie Vivienne, stöberten nach Neuausgaben in den Buchläden und pausierten in kleinen Cafés, um fünf Wochen Trennung vergessen zu machen. Am späten Nachmittag brachten sie ihre Einkäufe zurück ins Hotel und ruhten ein wenig aus.
Für den Abend hatten Conradt in der Brasserie Flo reserviert. Nach Aperitif und Aufgabe der Bestellungen ließen sie die Atmosphäre auf sich wirken. Es war ein angenehmer Ort, lebhaft, ohne laut zu sein, angeregte Gespräche in den verschiedensten Landessprachen, Wortfetzen und Sätze, die gleichzeitig eine angenehme Anonymität und eine familiäre Situation entstehen ließen. Ein guter Ort für ein vertrautes Gespräch.
„Ich danke dir für diesen wunderbaren Tag“, begann Conradt schließlich, „und dass du mir Zeit gegeben hast, meine Gedanken zu sammeln. In meinem Kopf geht alles drunter und drüber.“
Maike ergriff seine Hand und drückte sie fest.
„Na ja, was soll ich auch machen? Eine überstürzte Reaktion meinerseits ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Ich muss zunächst einmal meine Optionen prüfen. Arbeitsrechtlich werde ich vermutlich nicht gegen die Beurlaubung angehen. Das erscheint mir nicht der richtige Weg. Und ich muss mir auch erst einmal darüber klarwerden, ob ich wirklich zurück will.“
„Gibt es Alternativen?“
„Klar. Ich könnte als Rechtsanwalt arbeiten, in die Industrie gehen, oder mich aufs Schreiben konzentrieren. Es gibt durchaus eine Reihe interessanter Optionen. Obwohl ich sagen muss, dass mich keine wirklich fesselt. Es ist vielleicht am besten, wenn ich erst einmal einige Zeit ins Land gehen lasse. Es wird sich herumsprechen, dass ich verfügbar bin. Unsere Netzwerke arbeiten leise, aber effizient.“
„Sicherlich ist es keine schlechte Idee, erst einmal abzuwarten“, sagte Kaldenhoff nachdenklich. „Eigentlich ein schöner Gedanke, Zeit zu haben und in Ruhe über die bisherige Karriere nachzudenken, Dinge zu hinterfragen und Optionen für die Zukunft zu prüfen. Eigentlich bist du in einer beneidenswerten Situation.“
„Nun übertreib aber nicht“, wandte er lachend ein, „immerhin bin ich auf Eis gelegt worden, und das ist üblicherweise kalt.“
Als sie das Restaurant verließen, hatte ein leichter Nieselregen eingesetzt. Conradt öffnete den großen, schwarzen Schirm, den ihm der Concierge beim Verlassen des Hotels gereicht hatte, und sie schlenderten Arm in Arm durch die regennassen Straßen der Seine-Metropole.
-----------
Das Frühstück ließen sie sich am Sonntag aufs Zimmer bringen, sie wollten die Außenwelt so lange wie möglich ausschließen. Der Blick schweifte durch die geöffneten Vorhänge über die Dächer von Paris bis zum Eiffelturm.
Maike sortierte ihre Lektüre für den Rückflug. Conradt, mit einer Zeitung auf dem Bett liegend, schaute ihr dabei zu.
„Was liest du?“, fragte er.
„Oh, das sind Hintergrundinformationen zu einem aktuellen Fall. Es geht um vermeintlichen Steuerbetrug. Wir sind davon überzeugt, dass uns vor einigen Monaten ein ziemlich großer Fisch ins Netz gegangen ist. Der mutmaßliche Täter hatte Befürchtungen, dass aufgrund der in letzter Zeit häufiger aufgetauchten Steuer-CDs sein Vermögen in der Schweiz oder in Liechtenstein nicht mehr sicher sein könnte. Er hat daher sein Vermögen in einen Panama-Trust verschoben, den er unter einem falschen Namen dort registriert hatte. Unser Glück war, dass der Zoll bei einer Routine-Stichprobe den zweiten Reisepass mit der falschen Identität entdeckte.“
„Autsch“, sagte Conradt amüsiert, „das wird vermutlich teuer, wenn ihr ihm das wirklich nachweisen könnt.“
„Na ja, es ist noch ein weiter Weg und es hängt auch davon ab, ob die panamaischen Behörden und Banken mitspielen, sonst wird es schwierig.“
Conradt kannte das Problem. Immer wieder mussten Beweise in akribischer Kleinarbeit gesammelt und vor Gericht verwertbar gemacht werden. Die Wichtigkeit der lückenlosen Beweisführung gegenüber reinen Indizien hatte er immer wieder in seinen Vorlesungen an der Juristischen Fakultät in Lausanne unterstrichen.
In Lausanne hatten Maike Kaldenhoff und er sich ursprünglich kennengelernt. Sie war Assistentin an der Fakultät gewesen und schon damals hatte er ihren scharfen Verstand bewundert. Doch erst als sie sich viele Jahre später auf einem Kongress wiedertrafen, war zunächst Zuneigung und dann Liebe daraus entstanden.
„Das kennen wir ja“, sagte er leichthin und wandte sich wieder der Sonntagsausgabe der Le Monde zu. Mehr war dazu nicht zu sagen.
Am Flughafen Charles-de Gaulle sagten sie schweren Herzens, aber auch voller Vorfreude Adieu. Sie würden sich bereits in zwei Wochen wiedersehen. Und mit der Aussicht auf ein weiteres gemeinsames Wochenende traten sie ihre Heimreise an.
Aber irgendwie war die kurze Information über den Panama-Trust und die damit verbundene Steuerhinterziehung bei Conradt hängengeblieben. Es beschäftigte ihn auf dem Rückflug in die Schweiz und ging ihm auch in den folgenden Tagen nicht mehr aus dem Kopf.
Kapitel 4
Der Bernleitner Matthias überragte Urs Conradt um mindestens zehn Zentimeter. Sie waren vielleicht acht oder neun Jahre alt. Urs nicht klein, nicht schwach, aber doch dem Matthias physisch unterlegen. Auf dem Lande galt allgemein das Recht des Stärkeren; Survival of the fittest! Reiner Darwinismus. Als Städter geboren, war Urs von jeher Außenseiter in dieser engen Welt der Berge und Höfe gewesen. Wer hier aufwuchs, musste irgendwann in der Lage sein, den Hof in der rauen Bergwelt zu führen und die Familie zu ernähren. Latein und Algebra waren da eher hinderlich. Ein notwendiges Übel, das man irgendwie überstehen musste.
Viel wichtiger war es, frühzeitig den angestrebten Platz in der Gemeinschaft zu reklamieren und zu festigen. In der Schule funktionierte das über physische Macht, Kraft, Schnelligkeit, körperliche Geschicklichkeit, Reaktionsgeschwindigkeit. Der Instinkt war die treibende Kraft der Berge. Nachdenklichkeit war hinderlich und wurde belächelt. Das war allenfalls etwas für das Altenteil.
Der Matthias hatte seinen zukünftigen Platz in der Dorfgemeinschaft bereits fest ins Auge gefasst: mächtigster Bauer im Tal wollte er werden, wie schon sein Vater und dessen Vater vor ihm. Dass dazu mehr gehören könnte als blanke Gewalt, hatte ihm noch niemand beigebracht. Man nahm an, dass sich das mit der Zeit schon legen würde. Bis dahin quälte er jeden und jedes. Und wenn etwas herauskam, sorgten er und seine dümmlichen Mitläufer dafür, dass es nicht auf den Matthias zurückfiel. Schuld war immer jemand anderes. Da trotz gegenteiliger, clever fingierter Beweise jeder Lehrer fast sicher Matthias als Schuldigen vermutete, wurde ein armer Tropf pro forma bestraft, recht milde allerdings. Dann kehrte vorübergehend wieder Ruhe ein.
Dieses Mal hatte es Tobias, den Kleinsten der Klasse, erwischt. Die grausam getötete und verstümmelte Katze der Witwe Frieda, einem alten Weiblein, das jahraus jahrein durch die Berge streifte, um Kräuter zu sammeln und diese dann zu verkaufen, lag entstellt am Dorfbrunnen. Der strangulierende Gürtel wurde eindeutig als Tobias’ identifiziert. Dass er diesen bereits vor Tagen nach dem Sportunterricht als entwendet reklamiert hatte, wurde ignoriert. Tobias wurde öffentlich vor der versammelten Schülerschaft und dem gesamten Lehrerkollegium gescholten, er musste die Katze begraben und für die kommenden vier Wochen den Latrinendienst übernehmen.
Es war allen klar, wer hinter dieser Tat steckte. Aber man legte sich nur ungern mit Matthias’ Familie an. Der Apfel fiel nicht weit vom Stamm.
Tobias litt. Urs sah ihn weinend am Grab der toten Katze, das die gramgebeugte Witwe in dem kleinen Vorgarten ihres Hauses mit den weit heruntergezogenen Dachschrägen ausgehoben hatte. Er sah Tobias’ gequältes Gesicht bei der Latrinenreinigung, begleitet vom höhnischen Gelächter und Spott von Matthias und seinen Gefolgsleuten. Was ihn dazu trieb, dem Tobias am zweiten Tag beim Latrinendienst zu helfen, konnte er selber nicht genau sagen. Er folgte einfach einem tief empfundenen Gerechtigkeitssinn. Es war völlig klar, dass Tobias nicht der Schuldige war.
Sobald Matthias zugetragen wurde, dass Tobias einen Mitstreiter gefunden hatte, machte er sich, gefolgt von einer größer werdenden Schar Schüler, auf den Weg sich dieses Schauspiel anzuschauen.
Nun baute er sich unangenehm nah vor Urs auf, der nicht nur wegen der körperlichen Präsenz, sondern auch wegen des strengen, leicht säuerlichen Geruches hastig einen Schritt zurücktrat.
„Was machst du hier, Conradt“, ranzte Matthias ihn an. „Ich helfe Tobias“, antwortete der Angesprochene leise.
„Das darfst du nicht! Die Strafe ist allein für ihn. Verschwinde!“
Matthias versetzte Urs einen derben Rippenstoß, sodass er etwas nach hinten stolperte, sich aber rechtzeitig fing.
„Du weißt genau, dass der Tobias die Katze nicht getötet hat“, rief er aufgeregt, „er war’s nicht!“ Matthias sah ihn scharf an. „Wenn er es nicht war, wer denn dann?“, fragte er amüsiert und drohend.
Es wurde still auf dem Schulhof. Jeder wusste, dass Tobias nicht schuldig war. Aber es offen und laut zu sagen, kam einem Sakrileg nahe.
Urs nahm seinen ganzen Mut zusammen, vielleicht war es auch nur Naivität, und zeigte auf den großen Jungen. „Du warst es!“, rief er mit hoher, sich überschlagender Stimme. „Du hast die Katze getötet!“
Matthias’ Faustschlag kam so schnell, dass Urs nicht einmal ansatzweise Zeit hatte, sich zu ducken. Er lag schon auf dem Boden, als Matthias’ Gehilfen kamen und weiter auf ihn eintraten. Dann wandten sie sich ab und verschwanden durch eine sich zügig öffnende Gasse in der Mauer des Schweigens, die sich um sie herum gebildet hatte.
Tobias kam Urs zu Hilfe. Sie richteten den Geschlagenen, so gut es ging wieder her, denn in diesem Zustand im Klassenraum zu erscheinen, hieß erneuten Ärger mit dem Lehrer heraufzubeschwören. Es war ein raues Leben in den Bergen.
Die Sache schien damit erledigt.
Nicht aber für Urs. Wochen vergingen, in denen er über seine Rache nachgrübelte. Es stand außer Frage, Matthias körperlich anzugreifen, dabei würde er stets den Kürzeren ziehen. Deshalb versuchte er, sich auf seine Stärken zu besinnen, denn er war ohne Zweifel cleverer als Matthias. Also nahm sich Urs Zeit, um einen sicheren Plan auszutüfteln.
Der Sommer kam und ging. Der Herbst färbte bereits die Blätter gelb und rot. Bald würde der erste Schnee fallen.
Der genaue Hergang des tragischen Ereignisses wurde nie ganz geklärt. Allgemein wurde akzeptiert, dass es das Matthias’ eigenes Missgeschick gewesen war. Er war in der einsetzenden Dämmerung mit seinen Truppen zum Rauchen hinter einem kleinen Heuschober am Rande des väterlichen Hofes verschwunden. Einer nach dem anderen verschwand, nur Matthias blieb zurück Mitstreiter in Richtung des eigenen Zuhause. Der Matthias blieb noch eine Weile dort stehen, paffte eine letzte Zigarette und drückte den Stummel sorgfältig in einer kleinen Metalldose aus.
Er wollte sich gerade Richtung Haus auf den Weg machen, als er den Geruch von Feuer wahrnahm, in unmittelbarer Nähe. Überrascht suchte er nach der Quelle des Rauches. Es musste direkt hinter der Bretterwand des Heuschobers sein. Wie konnte denn da eine Zigarette landen? Er rannte um das kleine Gebäude herum und öffnete den Schober. Das kleine Feuer, dass durch einen Zigarettenstummel entfacht worden war, sog den durch die Türöffnung hereinströmenden Sauerstoff begierig auf, das trockene Stroh flammte auf wie Zunder und in Windeseile, bevor sich der Matthias in Sicherheit bringen konnte, brannte es lichterloh. Die Strohballen explodierten beinahe, überall flogen Funken herum.
Der bullige Junge fuhr herum, suchte panisch den Ausgang und stolperte hustend und keuchend nach draußen. Sein Wams war an einigen Stellen angekokelt, seine Haare und Augenbrauen durch die sengende Hitze verbrannt. Ansonsten war er gesund und unversehrt.
Bis ihn sein Vater erwischte und ihn vor den Augen der herbeieilenden Nachbarschaft verprügelte. Der Schober war schnell gelöscht, der materielle Schaden hielt sich in Grenzen. Die blauen Flecken durch die Prügel seines Vaters heilten schnell wieder aus, aber seine Gesichtshaut hatte auf der linken Seite dauerhaften Schaden genommen. Ihm würden dort nie wieder Haare wachsen, weder auf dem Kopf, noch Wimpern, noch auf den Brauen.
Diese Schmach führte zu einer Änderung seines Verhaltens. Er wurde vorsichtiger und weniger gewaltsam. Er war gezeichnet. Aber er war auch gewarnt, denn ihm war klar, dass die Zigarette nicht aus Unachtsamkeit im Schober gelandet war.
Urs, Tobias und einige der anderen Jungen, die unter Matthias Gewaltausbrüchen gelitten hatten, steckten sich ab sofort bei jeder passenden Gelegenheit eine Zigarette hinters Ohr und stellten sicher, dass der Matthias sie sah. Er schaute dann immer besonders grimmig drein. Aber er ließ die Jungen seit diesem Tag in Frieden.
Kapitel 5
Antonio Gonzales galt als äußerst geschäftstüchtiger und umtriebiger Mittelsmann in allen Südamerika-Fragen. Einen willfähriger Gesprächspartner in einem Ministerium, um Ausfuhrgenehmigungen, glaubwürdige Zollpapiere oder Herkunftsbestätigungen zu erhalten? – Kein Problem.
Registrierung und Errichtung von Briefkastenfirmen in der Karibik? – Kein Problem.
Kontakte zu Geschäftsbanken, die es mit der Herkunft der ihnen überstellten Gelder nicht ganz so genau nahmen? – Kein Problem.
Alles nur eine Frage des Preises und der war nicht unerheblich, aber wirkte auch nicht prohibitiv. Und solange Gonzales wie vereinbart lieferte, beinahe ein Schnäppchen, wenn man die möglichen Risiken bei Geschäften mit Südamerika mit hineinrechnete.
Antonio Gonzales liebte seine Tätigkeit, die ihm jederzeit und nahezu unbegrenzt Zugang zu wichtigen Persönlichkeiten in fast allen Ländern Südamerikas und in fast allen Gesellschaftsbereichen verschaffte. Gefallen und Gegengefallen. Er hatte ein sehr präzises Gedächtnis und wusste jederzeit, wer ihm noch einen Gefallen schuldete und wer aufgrund welcher Lebensumstände besonders empfänglich für lukrative Gefälligkeiten war.
Er schätzte gutes Essen, gute Weine, schöne Frauen. Dafür hielt er sich fit. Tägliche Work-Outs halfen, die lästigen Folgen seines exzessiven Lebensstils im Griff zu behalten.
Jetzt lehnte er sich in froher Erwartung eines exzellenten Essens in angenehmer Umgebung zurück und schaute Jacob Verheyen neugierig an. Sie kannten sich seit Jahren und vertrauten einander. Als Verheyen am Telefon gefragt hatte, wohin er Gonzales einladen dürfte, hatte er spontan das Strauchs Falco vorgeschlagen. Er schätzte die helle, offene Atmosphäre und die Kobe-Steaks waren unvergleichlich gut und teuer.
„Also kommt ihr mit eurem Projekt in Veracruz voran?“, fragte er.
Er ahnte, dass Verheyen ihn nicht eingeladen hatte, um über das Projekt zu reden, aber es war das Vorgeplänkel.
„Ganz wunderbar“, antwortete Verheyen. „Nach allem was ich weiß, sind die Grundstücksverträge unterzeichnet und notariell beurkundet. Sobald der Kaufpreis überwiesen ist, kann die Grupo Constantin mit den vorbereitenden Landarbeiten beginnen. Die Finanzierung steht ebenfalls. Geld spielt keine Rolle, die Banken sind sehr hilfsbereit“, er lächelte, „was auch nicht weiter verwunderlich ist bei der Marge und bei den Sicherheiten der Grupo Constantin.”
Gonzales lächelte ebenfalls. Er kannte die Details nicht, sie interessierten ihn nicht. Er ahnte aber, dass das Kapital der Grupo Constantin aus einer Reihe nur bedingt legaler Tätigkeiten stammte.
„Du Glücklicher“, sagte er nicht ohne einen gewissen Stolz, denn er hatte Verheyen mit der Grupo Constantin zusammengebracht und würde an diesem Projekt ebenfalls gut verdienen, „dann ist ja alles in Ordnung.”
Er hob sein Glas Rioja und sie stießen auf dieses Geschäft an. „Eigentlich ja“, antwortete Verheyen und widmete sich seinem fast noch rohen Steak.
„Eigentlich?“, hakte Gonzales nach. „Wo liegt das Problem?“
„Nun“, Verheyen wählte seine Worte mit Bedacht, „das hat eigentlich direkt nichts mit dem Projekt zu tun, eher mit meinen privaten Geschäften.“
„Wie das?“
„Du weißt, dass ich in Panama einen Trust gegründet habe und dort eine ganze Menge Kapital investiert habe.“
Gonzales nickte. „Ja klar, wir haben Dich doch bei der Registrierung und Eintragung ins Handelsregister unterstützt.“
„Genau, und wie Du weißt“, er senkte die Stimme, „unter dem Namen Raoul Garcia.“
„Und wo liegt das Problem?“, fragte Antonio erstaunt, er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, was da schief gelaufen sein sollte.
„Das Problem ist“, Verheyen senkte die Stimme und beugte sich vor, „das Problem ist, dass ich in eine Zollkontrolle hier in Hamburg am Flughafen geraten bin, und dass ich nun die Hamburger Staatsanwaltschaft am Hacken habe, denn sie haben dabei meinen Pass auf den Namen Raoul Garcia gefunden.“
Stille trat ein, Gonzales lehnte sich zurück, wischte sich mit der Serviette vorsichtig über den Mund. „Das gibt es doch gar nicht“, stöhnte er schließlich.
Konnte der Pass zu ihm zurückverfolgt werden? Er glaubte es nicht, aber sein Name konnte natürlich im Zusammenhang mit den von Garcia in Panama getätigten Geschäften in Erscheinung treten. Das gute Essen schmeckte ihm plötzlich nicht mehr, seine Stimmung erlitt einen gehörigen Dämpfer.
„Und was nun?“
Verheyen zuckte resigniert mit den Schultern. „Ich muss warten, wie die Staatsanwaltschaft reagiert.“ Dann blickte er Gonzales direkt an.
„Ich brauche einen neuen Pass, mein ganzes Kapital liegt in Panama auf der Bank unter dem Namen Raoul Garcia. Ohne Pass komme ich nicht mehr an mein Geld heran.“
„Ich verstehe.“ Gonzales schwieg einige Minuten und schob dann genüsslich nach: „Das wird teuer.“
„Das weiß ich“, kommentierte Verheyen trocken. Ihm gefiel der selbstgefällige Ausdruck in Gonzales’ Gesicht überhaupt nicht. „Die Frage ist, was es mich kostet und wie schnell kann ich den Pass bekommen?“
„Das kann ich dir aus dem Stegreif nicht sagen“, antwortete Gonzales nachdenklich. „Ein Pass kostet normalerweise etwa Fünfzehntausend, aber hier handelt es sich um einen, der von den deutschen Behörden eingezogen wurde, und die werden Nachforschungen anstellen. Das heißt, ich muss in Panama dafür sorgen, dass solche Anfragen adäquat behandelt werden. Dann muss der alte Pass bei den lokalen Behörden, also irgendeiner kleinen Polizeistation, als gestohlen gemeldet werden und ein Ersatzpass erstellt werden. Da sind ein Menge Leute involviert und diese wollen alle bezahlt werden.”
„Ich weiß“, fiel ihm Verheyen ungeduldig ins Wort. „Wann?“
„Ich muss erst Erkundigungen einziehen. Gib mir ein paar Tage Zeit, ich melde mich.“
„Danke“, quetschte Verheyen heraus. Er wusste, dass er Gonzales ausgeliefert war und konnte es nicht riskieren, ihn zu verärgern.
Gonzales winkte ab und damit war die Sache erledigt. Verheyen ließ die Rechnung kommen, zahlte und sie verließen gemeinsam das Restaurant.
Kapitel 6
Maike Kaldenhoff schaute Lars Peters fragend an. „Wie stehen denn nun unsere Chancen? Kommen Sie weiter?“
„Naja, schon“, antwortete Peters und fixierte Kaldenhoff über seinen Brillenrand. Er war ein hochgewachsener, schlanker, immer etwas nachdenklich gestimmter, sehr verlässlicher Mitarbeiter. Vielleicht nicht der schnellste, aber immer gewissenhaft, gründlich, unaufgeregt und angenehm im Umgang.
„Wir wissen jetzt Folgendes: Jacob Verheyen ist in der Tat Architekt und entwirft vornehmlich internationale Freizeit-Immobilien: Ressorts, vier Sterne und mehr, speziell östliches Mittelmeer und arabische Länder sowie Südamerika. Teuer und extravagant. Die hinter diesen Projekten stehenden Investoren oder Investorengruppen sind uns größtenteils unbekannt. Bei einigen handelt es sich vermutlich um ziemlich dubiose Kapitalquellen, aber bisher nichts, was eindeutig kriminell wäre, jedenfalls nicht für uns.
Hier in Deutschland hat er relativ wenig gebaut. Auf seiner Webseite ist nur ein einziges Projekt für Hamburg gelistet, eine alte Stadtvilla in Othmarschen. Wirklich spektakulär. Eine ansprechende Kombination von alt und modern.“
„Gut, und warum benötigt er dafür einen falschen Pass mit falscher Identität?“
„Für diese Projekte wohl nicht. Ich glaube seiner Aussage laut Protokoll vom Hamburger Flughafen nicht. Ich glaube, das geht viel weiter. Jacob Verheyen gehört entfernt zur Benicke-Familie …“
„Die Benicke-Familie?“, fragte Kaldenhoff mit der Betonung auf „die”. „Die Pharmaleute aus der Schweiz?“
„Genau“, bestätigte Peters. „Jacob ist Enkel des Firmengründers. Ihm gehören, oder besser gesagt: gehörten offiziell einmal 5,7 Prozent der Anteile. Er ist aber in Deutschland geboren und besitzt einen deutschen Pass.“
„Gehörten?“
„Ja, er hat sich anscheinend mit der Familie überworfen. Er war kurz Vorstandsmitglied in einer der Tochtergesellschaften, aber das lief nicht gut, warum auch immer. Jedenfalls lastete die Familie es ihm an und sein Temperament hat wohl nicht gerade zur Beruhigung beigetragen. Da er Architekt ist, haben sie ihn aus der Geschäftsführung rausgenommen und ihn quasi als Hausarchitekt beschäftigt. Er hat rund um die Welt Produktionsbetriebe und Niederlassungen für die Gruppe entworfen. Manches durchaus okay. Aber es gab erneut Schwierigkeiten. Seine Entwürfe wurden zunehmend teuer und zwar deutlich kostspieliger, als Entwürfe anderer renommierter Architekten. Und dann gab es Hinweise auf Payback-Klauseln mit regionalen Wirtschaftsförderern, die unbedingt wollten, dass die Fabriken in ihren Regionen entstehen und dafür Fördergelder lockermachten. Ein Teil dieser Gelder ist wohl direkt in Verheyens Tasche geflossen.“
„Das scheint ja ein interessanter Mann zu sein“, warf Kaldenhoff sarkastisch ein.
„Durchaus. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass die Familie ihn endgültig loswerden wollte. Zumindest geschäftlich. Man hat die Zusammenarbeit beendet. Er hat sein eigenes Architekturbüro aufgebaut, hier in Hamburg. Die Familie hat ihm ein lukratives Angebot für seine Anteile unterbreitet, das er nach einigem Hin und Her auch angenommen hat. – Soweit gehen unsere Recherchen bisher.“
„Worüber reden wir denn, was sind oder waren 5,7 Prozent der Anteile wert?“