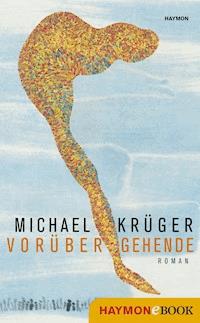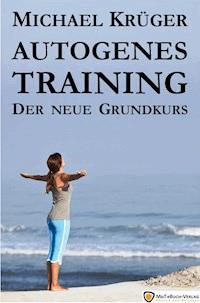Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ungleicher könnten sie nicht sein: Hier Mark Schlitter, erfolgreicher und weltläufiger Kriegsberichterstatter, und dort sein hasserfüllter, gewalttätiger Bruder Heinz, Landwirt in der Lüneburger Heide, der vor dem persönlichen und wirtschaftlichen Untergang steht. Sie haben sich nie gesehen. Als Heinz sich zunehmend radikalisiert und in die Attentatspläne einer rechten Verschwörung verwickeln lässt, kreuzen sich ihre Wege. Zwei Welten stoßen auf einander. Gelingt es Mark, seinen Bruder umzustimmen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschehnisse, Handlungen, Personen und Orte dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Ina, Oscar, Emily und Frida
Es war in unsres Lebensweges Mitte, Als ich allein in dunklem Wald mich fand, Der keinen Pfad mehr zeigte meinem Schritte. Denk’ ich zurück, wie dort in Nacht ich stand, Nur Dickicht greifend rings bei jedem Tritte, Fasst mich das Graun, das damals mich umwand. Wohl litt ich Todespein, doch fand ich Leben: Von meinem Gang will drum ich Kunde geben.
Dante Alighieri Göttliche Komödie
Inhaltsverzeichnis
Mark
Lena
Heinz
Lena
Heinz
Heinz
Heinz
Mark
Heinz
Lena
Mark
Lena
Heinz
Lena
Hermann
Heinz
Lena
Heinz
Lena
Heinz
Heinz
Mark
Mark
Heinz
Mark
Lena
Mark
Heinz
Lena
Heinz
Mark
Heinz
Mark
Heinz
Mark
Amir
Heinz
Mark
Mark
Heinz
Mark
Lena
Mark
Lena
Mark
Mark
Amir
Heinz
Mark
Amir
Heinz
Heinz
Mark
Heinz
Heinz
Heinz
Lena
Amir
Hermann
Amir
Hermann
Heinz
Mark
Heinz
Heinz
Heinz
Lena
Heinz
Lena
Mark
Lena
Heinz
Epilog
1. Mark
»Verdammt noch `mal wo steckst Du? Ich brauche einen Beweis!«
Mit zusammengepressten Lippen fluchte Mark Schlitter vor sich hin. Hinter einer zerschossenen Häuserwand Schutz suchend, wünschte er, er könnte das alles übertönende Inferno aus abgehackten Gewehrsalven und dem Kreischen überfliegender Artilleriegeschosse ausschalten. Explosionen erschütterten den Boden. Irgendwo kreisten Kampfhubschrauber, jagten Raketen in berstende Häuserfassaden.
Nur in den sporadischen Gefechtspausen war das menschliche Leid zu hören, das Schreien der Verletzten, die Rufe nach Sanitätern, das Wehklagen der Mütter, die ihre Kinder vor ihren Augen sterben sahen. Es gab nicht annähernd genug Worte, um diese Töne zu beschreiben.
Vorsichtig versuchte er, sich einen Überblick zu verschaffen. Von den Dächern und aus den schwarz gähnenden Fensterlöchern schossen Scharfschützen auf alles, was sich bewegte. Brennende Autowracks, Lehmziegel und Strom- und Telefonkabel übersäten die Straßen; dazwischen vereinzelt Leichen, die erloschenen Gesichter grau, die jüngsten Opfer sinnlosen Mordens unter Brüdern. Junge und alte Männer, nahezu identisch gekleidet. Nach wenigen Stunden Häuserkampf verblichen alle Farben, hüllte sich alles in den beige-grauen Farbton aus Lehm- und Betonstaub, vermischt mit Blut, Schweiß und Tränen.
Langsam hob Schlitter seine Kamera über die Mauerkrone. Auf dem Monitor suchte er das entscheidende Motiv, den endgültigen Beweis. Schweiß brannte in den Augen, der Atem kam stoßweise.
»Let’s go!«, drängte Chaled, sein Führer. »Wir sind zu nah dran, Mark. Sie können uns sehen.«
»Gib mir eine Minute. Ich brauche noch den Beweis!«
Und dann fand er endlich das gesuchte Motiv, die Silhouette eines T90 Panzers, das Rohr der 125mm Kanone in der Fensterhöhle kaum zu erkennen; aber der hintere Teil des Gebäudes war bereits weggebombt und das Heck des Kolosses war zwar staubübersät, aber deutlich identifizierbar und darauf das Zeichen der Russischen Föderation: weiß, blau, rot. Der Beweis!
Das Geschütz zuckte einmal zurück. Die Information, dass auf ihn geschossen wurde, wollte irgendwie einen Weg zu einer Handlung bahnen, aber er war wie gelähmt. Er versuchte aufzuspringen, er schrie und sah wie in Zeitlupe die oberste Ziegelreihe in einer Staubfahne zerbarst, die Kamera in kleinste Splitter zersprang, gefolgt von einer ohrenbetäubenden Explosion. Erst jetzt konnte er reagieren, aber anstatt zu rennen, erhob er sich unendlich langsam, stand erstarrt auf dem Schutthaufen, und schaute mit Neugier auf die Stummel seiner Unterarme, aus denen das Blut in rhythmischen Kaskaden herauspumpte.
Schreiend, nach Luft ringend und schweißgebadet schreckte Schlitter aus seinem Alptraum auf. Der Puls raste. Tränen liefen über sein Gesicht. Er ließ den Kopf in seine Hände sinken, spürte erleichtert die körperliche Unversehrtheit, bewegte vorsichtig seine Finger, richtete sich dann mit einem Ruck auf, strich fahrig durch die nassen Haare. Sein Mund war ausgetrocknet, er schmeckte Blut.
Zitternd tastete er nach dem Schalter der Nachttischlampe. Das Licht beruhigte ihn. Er war zuhause, auf der Mahagonny. Das T-Shirt klebte an seinem Oberkörper. Die Bettlaken waren feucht. Er stand auf, fischte aus dem Schrank ein trockenes Hemd und zog sich an. Dann trat er aufs Deck des Schiffes und sog die kalte Herbstluft ein.
Langsam verblassten die Schreckensvisionen des Alptraumes. Er stand an der Reling, rauchte und lauschte den Geräuschen der Nacht. Fröstelnd blickte er noch einmal um sich und trat zurück in das Innere des Bootes.
Die Flasche Whisky in der Hand setzte sich Schlitter an den Tisch, auf dem aufgeschlagene Zeitungen der vergangenen Tage lagen. Rezensionen kürzlich erschienener Dokumentationen über die Kriege und Bürgerkriege im Vorderen Orient. An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken. Er wusste, was kommen würde. Der Absturz.
2. Lena
Schläfrig zögerte Lena das endgültige Erwachen hinaus. Das Zimmer war bitterkalt. Eine leichte Atemwolke schwebte in den das erste Tageslicht andeutenden Lichtkegel, um sich dann in der Dunkelheit des Raums aufzulösen. Pro Sekunde ein Atemzug. Pro Sekunde eine Wolke.
»Besser ich stehe auf«, dachte sie resigniert, »bevor er wieder zu brüllen anfängt«. Was würde sie dafür geben, liegen bleiben zu können! Sie schlug die Decke zurück, setzte sich aufrecht, ihre Füße vorsichtig auf den abgeranzten Teppich setzend. Eine fadenscheinige Pyjamahose, ein weißes Unterhemd.
»Fuck, es regnet schon wieder!«
Seit Tagen lag dieser graue Schleier aus morgendlichem Nebel und tief liegenden Wolken über den abgeernteten Feldern. Überall tropfte es, war es feucht und klamm. Insbesondere hier zuhause, falls man es denn ein Zuhause nennen konnte; dieses Loch, eine Bruchbude, ein stinkender und langsam verfallender Haufen Müll.
»Nicht einmal das Haus kann er in Ordnung halten.«
Sie nahm ihre Sachen vom Stuhl, entriegelte leise die Tür, vergewisserte sich, dass niemand zu sehen war, trat in den Flur und verschwand im Bad, sorgsam die Tür hinter sich abschließend. Nicht, dass das nutzen würde, wenn es darauf ankam, aber bisher hatte es funktioniert.
Mit einer entschlossenen Bewegung drehte sie den Wasserhahn an der Badewanne auf. Der Badeofen setzte sich in Gang. Ein Schwall heißen Wassers spritzte in die Wanne. Dampf breitete sich in dem kalten Raum aus. Schnell streifte sie ihre Kleider ab und stieg in das nur wenige Zentimeter hoch stehende Wasser. Sie seifte sich ein, wusch die Haare und beeilte sich, Schaum und Shampoo wieder abzuspülen, bevor das warme Wasser zur Neige ging.
Auf dem Flur näherten sich schwere Schritte. Ein Schlag gegen die Tür ließ sie zusammenzucken.
»Beeil dich«, brüllte ihr Vater ungehalten, »ich muss los!«
»Bin schon fertig«.
Sie trocknete sich oberflächlich ab, sprang in frische Kleider und hastete zur Tür. Der übellaunig wartende Vater wurde von dem plötzlichen Aufreißen der Tür überrascht und wich einen Schritt zurück. Lena nutzte den schmalen Spalt, huschte durch einen ekelerregenden Dunst aus Alkohol, Nikotin, kaltem Schweiß und ungewaschener Kleidung an ihm vorbei und eilte zurück in ihr Zimmer. Sie hörte die Badezimmertür laut ins Schloss krachen und ging davon aus, dass sie jetzt einige Minuten Zeit haben würde. Körperpflege war sein Ding nicht.
»Arschloch«.
Dunkle Jeans, schwarzes T-Shirt, verschlissenes Hoody, ausgetretene Springerstiefel.
»Raus hier.«
Ein kurzer Blick in die Küche im Erdgeschoss bestätigte ihr, dass ihr Vater und seine Kumpane die ganze Nacht durchgesoffen hatten. Es stank nach schalem Bier und überquellenden Aschenbechern.
3. Heinz
Die Arme auf dem schmutzigen Waschbecken aufgestützt stand Heinz Fiedler schwer atmend in dem noch nebligen Bad und stierte in den beschlagenen Spiegel. Mit dem üppig behaarten Unterarm wischte er sich eine Fläche frei, groß genug, um sein aufgedunsenes Gesicht und einen Teil seines Oberkörpers sehen zu können; die ungekämmten Haare, fettig am Kopf klebend, das graufahle Gesicht mit den schweren dunklen Tränensäcken, Bartstoppeln, das schmutzige Unterhemd, dass sich über seinem über den Hosenbund hängenden Bauch spannte.
»Was soll’s? - Leck mich!«, brüllte er seinem Spiegelbild entgegen, »geht dich gar nichts an!«, schlug mit der flachen Hand auf den Beckenrand und schlingerte zur Toilette. Er erleichterte sich geräuschvoll im Stehen.
Zurück am Waschbecken starrte er erneut in sein Gesicht, ließ etwas Wasser in seine Hände fließen und spritzte es ins Gesicht. Das reichte. Er schüttelte den massigen Kopf, strich die Haare aus der Stirn, trocknete die Hände an der fleckigen Hose, die er gestern schon getragen hatte und vorgestern und wahrscheinlich auch schon letzte Woche. Fast aus dem Bad herausgetreten, blieb er stehen und versuchte, der Alkoholschwaden in seinem Hirn Herr zu werden.
»Heinz«, hatte Hermann gesagt, »Heinz, Mensch reiß dich zusammen. Du stinkst, du siehst aus wie einer dieser Penner in Hamburg, am Bahnhof, wie diese dreckigen Typen aus dem Kosovo, aus dem Irak, Afghanistan.«
Hermann, sein Idol. So groß und klar. Soldat durch und durch, auch wenn er das inzwischen nicht mehr war.
»Heinz, wir brauchen deine Hilfe. Du bist der richtige Mann für uns. Wir brauchen dich, Kamerad«, und Heinz hatte beinahe stramm gestanden vor ihm, vor Hermann.
»Du musst dich in den Griff bekommen, dein Leben. Wasch dich mal und zieh dich ordentlich an. Dein Hof sieht aus wie eine Müllhalde und verkommt immer mehr. Du siehst aus wie ein Wrack. Wir zählen auf dich. Wir sind besser als dieses Asylantenpack, wir sind stärker als diese Weicheier, diese Sozis und die liberalen Schwuchteln.«
»Ich weiß, ich weiß.«
»Dann reiß dich am Riemen. Es geht um den Sieg. Und du musst deinen Teil beitragen. Das fängt schon beim Äußerlichen an. Du musst dich in den Griff kriegen. Sonst müssen wir uns anderweitig umschauen.«
»Das müsst ihr nicht«, hatte Heinz hastig hervorgestoßen.
»Ich zähle auf dich.«
Das hatte noch nie jemand zu ihm gesagt.
»Jawoll!«
Zwei Tage war das her. Und gestern hatte er sich dennoch so richtig die Kante gegeben. Der Kopf dröhnte. Reumütig kehrte er um. Betrat das Bad erneut und unterzog sich einer gründlichen Reinigung, rasierte sich, versuchte, das struppige Haar zu bändigen, und entsorgte die schmutzigen Kleidungsstücke in einen Waschkorb. Nur mit dem Handtuch um die Hüfte gebunden humpelte er durch den Hausflur, die Treppe hinab, raus aus dem Haus und hinüber zu seinem Verschlag in der Scheune. Fand nach einigem Suchen eine zwar alte, aber leidlich saubere Jeans, ein verblichenes T-Shirt und einen dunkelblauen Pullover.
Er betrachtete sich zum ersten Mal seit Jahren komplett im Spiegel und fand, dass Hermann stolz auf ihn sein könnte.
»Du kannst auf mich zählen, Hermann«, murmelte er.
4. Lena
Zügig näherte sie sich dem langsam erwachenden Ort. Das Tretlager ihres alten Rades gab ein ungesundes Quietschen von sich. Für ein neues Rad fehlte das Geld. Vereinzelt nahm sie Geräusche von den an der Straße liegenden Gehöften wahr. Hier das Scheppern von Milchkannen, dort die unruhig auf das Melken wartenden Kühe, vereinzeltes Muhen, stotternde Traktoren. Jeden Morgen das Gleiche.
Von hinten näherte sich ein Trecker, hupte und fuhr nur knapp an ihr vorbei. Hinnerk, Saufkumpan ihres Vaters, grinste sie schmierig und anzüglich aus der hell erleuchteten Kanzel herab an, leckte sich über seine fleischigen Lippen. Lena streckte den linken Arm aus und winkelte den Mittelfinger nach oben. Hinnerk lachte meckernd und brüllte zu ihr herunter.
»Du mich auch.«
»Notgeile Sau!«, brüllte sie zurück. »Ich sag’s meinem Vater.«
»Mach das«, lachte er erneut.
Hinnerk gab Gas. Der Motor des aufgemotzten John Deer dröhnte auf und das schwere Gerät beschleunigte. Ein feiner Nebel aus hochgewirbeltem Wasser sprühte über Lena.
Der Markt lag am Ortseingang. Licht schimmerte aus den noch verschlossenen Schiebetüren. Carsten Knoop, der Marktleiter, nickte ihr freundlich zu.
*****
»Kann ich noch was bleiben?«, fragte Lena, nachdem der Markt um 18:30 Uhr geschlossen hatte. Zwischen den Regalreihen hörte sie das Summen der Bohnermaschine, im Warenlager pfiff Christian, der Lagerist, irgendeine Melodie, völlig schief, aber voller Begeisterung. Carsten schaute von seinen Abrechnungen auf.
»Klar, Mädchen, nimm Björns Rechner. Da hast du deine Ruhe.«
Lena verschwand in dem kleinen Nebenraum, in der die IT-Infrastruktur und die Steuerungsanlagen für Klima, Kühlung, Überwachungskameras und andere technische Gerätschaften des Marktes untergebracht waren. Dies war Björns Reich. Er kam alle paar Tage für einige Stunden aus Lüneburg rüber, um Carsten bei den technischen Fragen zu helfen. Inzwischen war sie so etwas wie seine Assistentin vor Ort.
Mit geübten Fingergriffen loggte sie sich in das System ein, öffnete den Browser und überflog die Web-Seiten einiger Nachrichtenportale. Schließlich öffnete sie ein neues Fenster und gab die Web-Adresse von Ragnarök ein.
Die Web-Seite war mit germanischen und keltischen Symbolen bestückt. Sie richtete sich offensichtlich an eine vorwiegend landwirtschaftliche Zielgruppe. Es gab Hinweise auf Ackerbau und Viehzucht und einen Marktplatz für gebrauchte Gerätschaften. Es gab einen Veranstaltungskalender, in dem die Winter- und Sommersonnenwendfeiern eingetragen waren, Julfeiern und zwei bevorstehende Eheleiten, die anstelle der christlichen Hochzeit gefeiert wurden.
Lena klickte sich zur „Blog“-Seite durch. Dort wurden „nicht-völkische Einwohner“ mit Hass-Tiraden überzogen, wurde zu Boykott-Aktionen gegen Veranstaltungen der Atomkraftgegner aufgerufen, Politiker jeglicher Couleur aufs Übelste beschimpft. Da war vom Verrat am deutschen Volk die Rede, von Verschwörungen des „Welt-Judentums“ aber auch des „Islam“ den deutschen Staat zu vernichten und das deutsche Volk auszurotten.
Es war unerträglich. Gequält durchkämmte sie die Einträge auf der Suche nach Hinweisen zu Aktionen in unmittelbarer Nähe. Sie wusste, dass ihr Vater irgendwie mit Ragnarök verbandelt war. Wenn sie am Wochenende nachts in ihrem Bett lag, konnte sie die Schwachköpfe in der Küche grölen hören, wenn sie ihren Hass auf die Gesellschaft im Allgemeinen und Ausländer insbesondere lautstark heraus-brüllten, und wie sie drohten, dem ganzen Spuk ein Ende zu bereiten.
In den letzten Monaten hatte sich die Lage zuhause jedoch etwas geändert. Es fanden jetzt häufiger „Besprechungen im kleinen Kreis“ statt, die wesentlich gesitteter abliefen. Es gab weniger Alkohol, es herrschte eine gewisse Pünktlichkeit. Schlag fünf Uhr trafen sich etwa acht Männer mittleren Alters auf dem väterlichen Hof, verschwanden wortlos in der Küche und kamen nach einigen Stunden wieder heraus. Lena kannte sie nicht alle. Klar, Hinnerk, Arschloch No. 2 war natürlich dabei. Aber die anderen Teilnehmer kannte sie nicht. Ein Mann stach aus der Ansammlung von Landwirten in tarnfarbenen Hosen, ausgemusterten Bundeswehrparkas und Landser-Mützen heraus. Er kam als Letzter, ging als Erster. Immer schwarz gekleidet. Bürsten-Haar-schnitt. Etwa 1,90 m groß. Er fuhr einen matt-schwarz lackierten Chrysler 3000 C Kombi mit Lüneburger Kennzeichen. Ein Geschoss von einem Wagen mit einem mächtigen Kühlergrill und dunklen Scheiben. Auf der Rückscheibe klebte irgendein Schriftzeichen und daneben das Wort Ragnarök.
Sie scrollte durch die Einträge. Endlich fand sie das Gesuchte:
„Ragnarök 3. Oktober“.
Sie war sich fast sicher, dass dieser Eintrag auf das nächste Treffen mit dem großen schwarz gekleideten Mann auf dem Hof hinwies.
Vor einigen Monaten hatte sie zum ersten Mal ein Heft mit dem Aufdruck ‚Ragnarök‘ in der Küche herumliegen sehen. Eine Art Wikinger mit Streitaxt und unter einem Helm hervorquellenden schulterlangen Locken war auf dem Deckblatt abgebildet. Neugierig hatte sie durch das Heft geblättert. Da war von einer epischen Schlacht zwischen Göttern und den Mächten der Unterwelt die Rede. Von Thor und Odin. Reich bebildert, vermittelte das Heft den Eindruck einer Heldensage. Irgendwie wie das Nibelungenlied, das sie mal in der Schule besprochen hatten.
Sie fand insgesamt fünf Einträge im Blog. Immer das gleiche Format: Ragnarök und ein Datum. Lena öffnete den Kalender und suchte die entsprechenden Daten heraus. Sie war sich sicher, dass sie zeitlich mit den Besuchen des großen schwarzen Mannes auf dem Hof zusammenfielen.
Im Internet fand sie reichlich Informationen zu dem Begriff Ragnarök. Kurz gefasst war es die Götterdämmerung in der nordischen Mythologie, der finale Kampf, an dessen Ende eine neue, gereinigte Welt aus dem Meer emporsteigt. Wieso beschäftigte sich ihr Vater, der sich für gar nichts außer Kartoffeln, Saufen und Brüllen interessierte, mit der nordischen Mythologie? Und diese anderen Männer?
5. Heinz
Stoßartig schnaufend schielte er an dem langen schwarzen Lauf entlang. Reichlich unbequem bei dem stark nach hinten gebogenen Nacken. Die Mündungsöffnung drückte hart ins unrasierte Kinn. Schweiß rann von Stirn und Schläfen, und fand seinen Weg durch geschlossene Lider, brannte in den angestrengt zusammengekniffenen Augen, sodass er immer wieder blinzeln musste.
Drück’ ab!
Mach endlich Schluss!
Vor dem geschlossenen Auge Bildfetzen des selbst gerichteten Vaters: Blut, Hirn und Splitter des zerborstenen Schädels an der Scheunenwand.
- Pause –
Marie, die ihn anschrie, er solle endlich aufhören zu saufen - Oh ja, das konnte sie wirklich gut. - Maries Kopf in Zeitlupe gegen den Türrahmen schlagend, die platzende Kopfwunde – Mehr Blut.
Mach Schluss!
Jetzt!
Sein rechter Daumen tastete nach dem vom Schweiß glitschigen Abzug, fuhr das angewärmte gekrümmte Eisen entlang. - Vor und zurück, vor und zurück.
Was, wenn ich mich nur verletze? Schieß ich mir am Ende nur den halben Kopf weg und lande als gelähmte Lachnummer des ganzen Dorfes im Rollstuhl! - Nich’ mal das kann er richtig!
Nahm die Flinte zur Seite, rollte den verspannten Nacken über die klatschnassen Schultern, fröstelte, blickte um sich, erkannte, dass er den richtigen Moment wieder einmal verpasst hatte, stütze den sich nicht erschießen lassen wollenden Kopf in die linke Hand, atmete tief ein, tief aus, wurde ruhiger.
Ich kann es nicht!
Verzweiflung und Hass stiegen auf. Wie oft hatte er so schon hier gesessen, Flinte am Kinn? Voller Abscheu warf er schließlich den wieder gesicherten Vatertöter auf das ungemachte Bett, nahm mit flattrigen Händen die Flasche Korn und fing an zu trinken, systematisch, Zug und Zug, löschte alles Denken, löschte Bilder, löschte Hass und Schmerz, bis er frühmorgens vom Stuhl kippte und an Ort und Stelle in bleiernen Schlaf fiel.
6. Heinz
»Fünftausendzweihundert Euro jeden Monat!«, stöhnte Hinnerk. »Stell dir das doch nur mal vor, was man mit dem Geld anfangen könnte.«
Hinnerk, Heinz Fiedler und drei weitere Kumpels saßen auf leeren Bierkästen und einem altersschwachen Campingstuhl um das Feuer herum, das Heinz in einer Ecke des Hofes angezündet hatte. Die Nacht war recht kühl für Ende Oktober. Aber an dem lodernden Feuer und mit dem gesicherten Nachschub an alkoholischen Getränken ließ es sich ganz gut aushalten.
»Stand so in der Zeitung.«
»Seit wann kannst Du lesen?«
»Halt die Klappe, Blödmann.«
Es wurde still, die zweite Flasche Wodka machte die Runde.
»Für die blöden Flüchtlinge.«
»Ich freu’ mich, wenn ich im Monat Tausend hab‘.«
»Kannste wohl laut sagen«.
Der Wodka kreiste.
»Is‘ doch nich‘ fair. Das is’ unser Geld.«
»Naja, wohl kaum.«
»Natürlich is’ das unser Geld, unsere Steuern geh’n da drauf.«
»Seit wann zahlst Du Steuern?«
»Na klar zahl’ ich Scheiß-Steuern. Und dann streichen die auch noch Zuschüsse, weil wir ja auch noch die Portugiesen und Itaker und so unterstützen müssen, mit Brüssel und so. - Jedes Jahr hab’ ich weniger übrig.«
Heinz Fiedler dachte voller Zorn an das letzte Gespräch vor einigen Wochen mit diesem Berater von der Volks- und Raiffeisen-Bank. Sein Hof sei zu klein, die Erträge zu gering, er sei nicht wettbewerbsfähig, auf dieser Basis könne es keine neuen Darlehen geben. Er habe ja schon den ganzen Hof als Sicherheit verpfändet. Warum er denn nicht verkaufe? An wen denn verkaufen, hatte Heinz gefragt. Wer solle denn diesen Hof kaufen und was würde dann aus ihm werden? Fügte nach einer Weile hinzu: und aus meiner Tochter? Dieser geschniegelte Typ, in seinem eng anliegenden dunkelblauen Anzug und den spitz zulaufenden Städterschuhen hatte ihn mit einem glatten Lächeln angeschaut und ruhig geantwortet, einen Käufer habe er schon. Wer denn? Und kannte die Antwort, bevor er die Frage gestellt hatte. Marc de Fries! Klar, der könnte und würde kaufen. Der kaufte Kartoffelanbauflächen auf, wo auch immer er konnte. Hatte sich schon rumgesprochen. Der stieg überall ein mit seinem belgischniederländischen Konglomerat völlig unübersichtlicher Firmen und Unternehmen. Wie ein Krake breitete der sich über Norddeutschland aus. In Belgien war er Marktführer, in den Niederlanden war er die Nummer zwei und mit dem Rückenwind aus Brüssel, Förderzusagen, Verbindungen und den guten Kontakten zu den Veredlern und Verarbeitern, seinem modernen Maschinenpark, konnte er die kleinen Landwirte unterbieten. Immer nur ein paar Cent pro Kilo, aber es reichte, um die lukrativen großen Aufträge an Land zu ziehen. Marc de Fries selber sah sich eher als Weißer Ritter, als Retter in der Not, der den Kleinen zur Seite sprang, wenn sie nicht mehr konnten. Er half, hier mit einem Überbrückungs-darlehen, dort mit einem Ersatztrecker, wenn mal etwas kaputt ging. Die Empfänger nahmen - nolens volens - dankten und wussten oder ahnten doch zumindest voller Groll, in welche Abhängigkeit sie sich begaben. Noch hatte er nicht klein beigegeben, aber Heinz Fiedler machte sich keine Illusionen, lange würde er nicht mehr durchhalten können. Du kriegst mich nicht. Nicht heute und nicht jetzt.
Heinz nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche. Er drehte sich mit klammen Fingern eine weitere Zigarette, zündete sie sich mit einem glühenden dünnen Ast an und sog den beißenden Rauch ein. Der Puls raste, der hohe Blutdruck verursachte Kopfschmerzen.
Ich muss eine Lösung finden. Für alles. Endgültig.
»Und dann klauen die uns auch noch die Frauen.«
»Nee, echt jetzt?«
»Na haste doch gehört im Radio, mit dem Antanzen und so. Da machen sich die Schweine an dich ran und tanzen um dich rum und wenn da’n Mädchen ist, dann grabschen die die an und so.«
Bis auf das Prasseln des Feuers kehrte Ruhe ein. Still tranken sie ihr Bier. Der Wodka drehte eine weitere Runde.
»Müsste man mal was gegen machen.«
»Was willste denn da machen? Das hab’n die in Berlin so beschlossen.«
»Und die Schweine in Brüssel.«
»Genau, die in Brüssel. Nehmen uns unser Geld wech, und geben’s den Asylanten.«
»Scheiß Asylanten.«
»Scheiß Sozis.«
Irgendeiner brüllte dann noch unter allgemeinem Gelächter: »Nieder mit den Schweinen. Früher hätte es das nicht gegeben. Da hätte man das ganze Zigeunerpack …«. Der Satz verlor sich in der Nacht. Bis in den frühen Morgen hatten sie gesoffen, über das harte Schicksal der deutschen Bauern in einer globalen Wirtschaft geklagt.
*****
Tage später trafen sie sich zufällig an der Tankstelle.
»Müsste man echt was machen«, meckerte Hinnerk.
»Watt’n?«
»Naja, mit den Asylanten-Schweinen.«
Heinz schaute sich vorsichtig um.
»Was meinste denn jetzt genau?«
»Naja, die nehmen uns alles weg, unser Geld, uns’re Arbeit.«
»Und was willst du da machen?«
»Vergraulen. Vom Acker jagen.«
»Aber hier gibt’s doch gar keine?«
»Nee hier nich’. Aber in Lüneburg, in Celle, Hamburg. Das werden immer mehr. Und die Scheiß Berliner Regierung, die lassen immer mehr rein. Irgendwann sind sie auch hier und dann nehmen sie uns alles wech’.«
Heinz nickte. »Scheiß-Zigeuner«.
»Also, biste dabei? Wir jagen denen mal so richtig Angst ein.«
»Klar, bin ich dabei.«
*****
Auf einem Feldweg in der Nähe des geplanten Flüchtlingsheims parkten sie und schlichen im Schutz der Dunkelheit näher. Das frisch getünchte Gebäude war von einem Gerüst umgeben. Im zweiten Stockwerk waren die Fenster noch nicht eingesetzt.
Hinnerk hatte das Ziel „ausspioniert“, wie er sagte.
»Da is’ kein Wachsschutz, keine Polizei. `Is ganz einfach.«
Vorsichtig kletterten sie das Gerüst hinauf und stiegen durch eine der schwarzen Fensterhöhlen in das Gebäude. Es roch feucht und nach frischen Farben. Hinnerk stolperte über eine auf dem Boden liegende Dachlatte und fluchte leise vor sich hin.
Im Schein einer Taschenlampe fanden sie dann im dritten Raum den passenden Ort, einen Stapel alter Holzpaletten und ausgemusterter Fensterrahmen, schön nahe an der alten Fachwerkstruktur. Heinz kramte einige mitgebrachte alte Stofffetzen und eine Flasche Benzin aus seinem Rucksack. Die alten Stoffreste stopfte er zwischen die Paletten und aus einem schmutzigen Unterhemd drehte er einen Docht. Dann tränkte er alles mit Benzin und trat einen Schritt zurück, um sein Werk zu betrachten.
‚DEUTSCHLAND DEN DEUTSCHEN’
Hinnerk sprühte die Parole in allen Zimmern des zweiten Stockwerkes auf die Wände. Der Sprühnebel hing noch in der Luft.
»Okay, mach zu!«, mahnte Hinnerk und deutete auf den Palettenhaufen.
Heinz zögerte nur kurz und hielt dann ein extra langes Streichholz an den geflochtenen Wäschefetzen, der sich in den wenigen Minuten ordentlich vollgesogen hatte. Gelbblau fing er Feuer und beleuchtete flackernd die frisch gestrichenen Wände mit der schwarzen Parole.
»Raus hier!«
So schnell sie konnten, kletterten sie durch die Fensterhöhle, das Gerüst hinunter, hasteten durch den Garten. Am Gartenzaun hielten sie kurz inne und betrachteten ihr Werk. Deutlich war der Feuerschein im zweiten Stock zu sehen. Vereinzelt leckten bereits einzelne Flammenspitzen an den alten Fachwerkbalken empor. Sie warteten im Schatten der Büsche noch einige Minuten, um sicherzugehen, dass das Feuer tatsächlich um sich griff und suchten, sobald die Flammen den Dachstuhl erreicht hatten, das Weite.
Als sie aus dem Feldweg auf die Landstraße einbogen, erhellte der Feuerschein schon den nächtlichen Himmel und sie hörten von weitem das leise Anschwellen von Sirenen.
»Deutschland den Deutschen«, brüllte Hinnerk und brach in ein hysterisches Lachen aus.
»Deutschland den Deutschen«, kläffte Heinz und erstarrte im Wegdrehen.
»Mensch Hinnerk! Da!«, er streckte den Arm. »Da ist einer auf’m Dach!«
Hinnerk stieß ihn grob beiseite.
»Quatsch nicht! Da war niemand im Haus«, und versuchte Heinz zum Auto zu ziehen.
»Aber da war einer!« Panik lag in seiner Stimme.
»Ich seh’ nichts!«
Und dann sahen sie es doch. Ein Schatten erhob sich vom Dachrand, brennend und sprang die drei Stockwerke, einen Funkenregen hinter sich herziehend, in die Tiefe. Dann war nichts mehr zu sehen.
»Mensch, komm jetzt!«, Hinnerk zerrte an Heinz Ärmel. »Gleich sind die Bullen hier! Weg jetzt!«
Widerwillig folgte Heinz.
»Hier nimm einen Schluck!«
Dankbar griff Heinz zur Flasche Korn, die Hinnerk ihm entgegenstreckte und hörte nicht mehr auf zu saufen, bis die Bilder der Nacht im Nebel verschwanden.
Ein Damm war gebrochen.
7. Heinz
Bahn für Bahn zog Heinz Fiedlers roter Trecker den alten Roder über die knapp zweieinhalb Hektar große Anbaufläche für Kartoffeln der Sorten Celena, Linda und Allians. Die starken Frontscheinwerfer und das Arbeitslicht fraßen sich durch den morgendlichen Dunst, doch der würde schnell verfliegen, sobald die Sonne den Boden aufheizte. Noch stand sie knapp über dem Horizont. Es würde ein langer Tag werden. Die Kartoffeln mussten vor den ersten Nachtfrösten geerntet sein. Etwa 1500 Zentner Kartoffeln würde es geben. Das bedeutete zehn Tage harte Arbeit.
Das monotone Dröhnen der Maschine versetzte Heinz, wie immer, in einen sonst nicht gekannten Zustand tiefer innerer Zufriedenheit. Er war Landwirt aus Überzeugung. Solange er sich seinen Feldern und Maschinen widmete, war er ruhig und konzentriert. Dann verspürte er so etwas wie Glück. Wenn nur das Leben drum herum nicht wäre. Seine Felder waren bestens gepflegt, die Maschinen, wenn auch älterer Bauart, immer in ordentlichem Zustand. Er kümmerte sich.
Doch wenn das Tagwerk vollbracht war, stürmte das Leben mit aller Macht auf ihn ein, forderte und zerrte an ihm. Das hatte schon früh in seiner Jugend angefangen. Der Vater hatte sich, da war Heinz gerade zwölf Jahre alt, mit einer Ladung Schrot das Leben genommen. Den Grund kannte Heinz nicht. Die Mutter hatte nie darüber gesprochen, keine Antworten gegeben, wohl auch nicht gesucht, vermutlich erleichtert. Der spät aus russischer Gefangenschaft Heimgekehrte hatte nie über den Krieg geredet. Voller Begeisterung hatte er sich schon mit sechzehn Jahren freiwillig zur Wehrmacht gemeldet, war 1943 an die Ostfront gekommen. Die folgenden sechs Jahre verhüllte eine Mauer des Schweigens, galt es Gesehenes wie auch Geschehenes zu verdrängen, Massaker, Gräueltaten, hastig in Gruben verschüttete Körper, ungezählt, niedergemäht.
Die Rückkehr in das zerstörte, das untergegangene Reich war entbehrungsreich, Hungerwinter, von der Welt, den Siegern schuldig gesprochen für alle Zukunft. Der stetige Kampf gegen den wirtschaftlichen Untergang. Die Ehe in wenigen Jahren verloren.
Die Mutter musste die Frucht feuchtschwüler Scheunen-Nächte mit dem Erntehelfer vergessen machen. Heinz hatte den dicken Leib registriert und verstanden. Atemlos lauschend hatte er die nächtliche Ankunft der Hebamme, die unterdrückten Rufe der kreißenden Mutter und dann, nach endlosen Stunden, die ersten Schreie des Neugeborenen verfolgt. Wie ein Traum war der Säugling am nächsten Morgen verschwunden, entsorgt. Der Vater hatte es gewusst und schwieg. Beide kämpften schweigend mit der Schuld, dem Versagen.
Das Leben, wie Heinz es kannte, hart, entbehrungsreich, aber durchaus lebenswert, hatte nach dem tödlichen Schuss mit einem Schlag eine andere Richtung eingeschlagen. Die Mutter verfiel in einen Zustand fortschreitender Lethargie. Seine Jugend war von einem Tag zum Anderen beendet. Heinz musste auf dem Hof helfen, was er grundsätzlich gerne tat, aber für einen Zwölfjährigen, nach der Schule, war es belastend. Er tat was er konnte. Nie war es genug. Die Mutter nörgelte ständig, auch wenn sie sich in der Hochsaison zwei Hilfsarbeiter leisten konnten, die den Großteil der harten Arbeit erledigten.
In der Schule wurde er zum Außenseiter. Der Selbstmord seines Vaters hing wie ein Makel über ihm. Hatte er vor dem Tod eine gewisse Achtung vor dem schweigsamen, in sich gekehrten, hart arbeitenden Mann gehabt, schwang sie jetzt um in Hass. Heinz machte ihn für seine missliche Lage verantwortlich.
Zu allem Überfluss geriet er mit seinem rechten Bein bei der Kartoffelernte unter den Roder und hätte es um ein Haar verloren. Seitdem hinkte er beim Gehen. Er wurde gehänselt, zog sich mehr und mehr zurück, wurde zum Einzelgänger. Missmutig und voller Neid betrachtete er das vermeintlich einfachere Leben seiner ehemaligen Freunde; suchte Streit, der immer häufiger in wüste Schlägereien ausartete.
Nach dem Hauptschulabschluss absolvierte er die dreijährige Ausbildung zum Landwirt, um den elterlichen Hof zu übernehmen. Die Mutter war heilfroh, die Verantwortung abzugeben. Für einige Jahre half sie noch etwas mit, fortwährend über alles und jeden klagend.
Alle paar Wochen verschwand Mutter, ohne einen Grund zu nennen nach Hannover. Heinz insistierte wütend. Schließlich gestand sie während eines heftigen Streites, dass sie seinen längst vergessenen Halbbruder besuchte, der noch in der Nacht der Geburt zu Pflegeeltern abgeschoben worden war. Knapp acht Jahre jünger als Heinz, besuchte er dort das Gymnasium und wuchs in behüteten, großbürgerlichen Verhältnissen auf, von den Pflegeeltern weltoffen und liberal erzogen. Heinz hasste Mutter wie Bruder.
Als sie Jahre später starb, war er erleichtert, hoffte, dass es jetzt besser werden würde. Doch die ständige Nörgelei und das andauernde Schlechtreden waren ihm inzwischen selbst zur Gewohnheit geworden. Der Alkohol tat sein Übriges.
Die meisten Nachbarn hatten sich abgewendet. Lediglich Hinnerk und einige andere hielten ihm die Stange.
In bittere Tagträume versunken steuerte Heinz Fiedler die Maschine Furche um Furche über das Ackerland. Fünfhundert Meter hin, fünfhundert Meter zurück, Schritttempo. Hinter ihm stapften die polnischen Erntehelfer durch den tiefen, schweren Boden und klaubten die Kartoffeln auf, die durch die Roste des Roders fielen. Obwohl sie hart arbeiteten, mochte er sie nicht. Sie kamen in der Früh und verschwanden nach getaner Arbeit. Wortlos. Grußlos. Heinz war es recht so.
Alle sechs Furchen, wurden die geernteten Kartoffeln auf einen Anhänger verladen und dann ging es erneut los.
Er klemmte das große Lenkrad zwischen seinen Oberschenkeln fest und drehte sich mit öligen Fingern eine Zigarette, schob sie zwischen rissige Lippen, zündete sie an und inhalierte tief. Aus dem immer gefüllten Flachmann nahm er einen kräftigen Schluck. Sorgfältig verstaute er alles wieder. Rechts der Schnaps, links der Tabak.
Die Sonnenstrahlen wärmten die Kabine auf. Zufrieden blickte er auf den abgeernteten Teil des Feldes. Sie machten Fortschritte. Das Pensum des Tages würden sie schaffen. Langsam hob sich seine Stimmung.
»Du kannst auf mich zählen«, murmelte er. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel bestätigte ihm, dass er sich tatsächlich Mühe gegeben hatte, sein äußeres Erscheinungs-bild zu verbessern. Hermann hatte ihn ausgesucht. Ausgerechnet auf Heinz Fiedler, nicht auf Hinnerk oder einen der anderen, war sein Blick gefallen. Was auch immer er da gesehen haben mochte.
»Du bist unser Mann, Heinz! Enttäusch mich nicht.«
Für den Bruchteil einer Sekunde erschien das Bild des rauchenden Dachstuhls. Er glaubte eine menschliche Figur, eine mit den Armen rudernde Fackel springen, für einen Moment in der Luft schweben und dann zu Boden stürzen zu sehen.
Geschockt riss er den Kopf zurück und öffnete die Augen. Er hatte scharf gebremst und den Motor abgewürgt. Bogdan und Pjetr waren ebenfalls stehen geblieben und schauten aus etwa fünfzehn Metern Entfernung erstaunt zu ihm auf. Heinz sah die fragenden Gesichter im Rückspiegel.
»Reiß Dich zusammen!«
Steif vom langen Sitzen kletterte er vorsichtig rückwärts vom Trecker.
»Pause. Viertel Stunde.«
Missmutig stapfte er über die abgeernteten Furchen zum Feldrand, pinkeln.