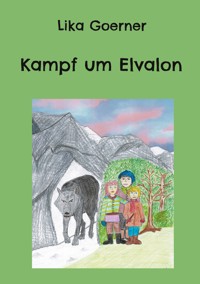
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
In einem Tal, umgeben von steilen Bergen, liegt das Zwergendorf Elvalon. Wie jedes Jahr bezieht im Herbst ein Wolfsrudel sein Winterrevier im Tal. Der Waldaufseher Willi Wumpdickel möchte Schutzmaßnahmen für Elvalon, doch der Dorfherr hat eigene Pläne. Auch im Wolfsrudel gibt es unterschiedliche Meinungen, die bald zur Gefahr für die Zwerge werden. Schaffen es Willis Kinder Digo, Luja und Mischa ihre besonderen Fähigkeiten richtig einzusetzen, um mit ihren Eltern und Freunden das Dorf zu retten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 1
Der Zwergenjunge Digo Wumpdickel marschierte gut gelaunt den breiten Waldweg entlang. Bald würde er den großen See in der Mitte des Tales erreichen. Dort war er mit seinen Freunden zum Angeln verabredet. Der Wind spielte übermütig mit den Zweigen und ließ die bunten Herbstblätter tanzen. Ihre Schatten huschten über den Boden.
Digo blieb für einen Moment stehen und atmete tief ein. Dann zog er sich seine blaue Wollmütze vom Kopf und ließ den frechen Wind seine schwarzen Locken zerzausen.
Plötzlich schoben sich dunkle Wolken über die Berggipfel, die das Tal umgaben. Sie flossen wie zäher Honig von allen Seiten über den Himmel, bis sie in der Mitte, genau über Digos Kopf, zusammenprallten. Blitze zuckten und die ersten heftigen Sturmböen zerrten an den Ästen der schwankenden Bäume.
„Ich muss schnell zu meinen Freunden und sie vor dem Gewitter warnen!“, schoss es Digo durch den Kopf. Er warf seine Angelrute weg und rannte los. Der See konnte nicht mehr weit entfernt sein.
Jetzt begann es wie aus Eimern zu schütten. In kurzer Zeit war die Kleidung des Jungen völlig durchweicht. Nahm der Weg denn gar kein Ende? Es schien Digo, als würden seine ohnehin schon kurzen Beine bei jedem Schritt schrumpfen.
Da sah er endlich den See vor sich. Am Ufer hockten seine Freunde, hielten ihre Angeln ins stille Wasser und lachten fröhlich miteinander. Hatten sie denn noch nichts von dem Unwetter bemerkt? So laut er konnte, schrie Digo ihnen seine Warnung zu, doch sie hörten ihn nicht.
Der Regen war inzwischen in Schnee übergegangen. Dicke, schmutzige Flocken stürzten vom Himmel herab. Digo kämpfte sich vorwärts, doch es war, als hielten Eisenketten seine Füße am Boden fest.
Plötzlich sprang ein schwarzer Schatten aus dem Dickicht und blockierte ihm den Weg. Glühende Augen starrten ihn an. Es war ein Wolf. Aus seiner Kehle drang dumpfes Knurren. Schritt für Schritt kam das Ungeheuer auf den wehrlosen Zwerg zu, der weiter verzweifelt gegen die unsichtbaren Fesseln an seinen Beinen ankämpfte.
Digo konnte weder fliehen noch schreien. Er war verloren. Genau wie seine Freunde, die er nun nicht mehr rechtzeitig warnen konnte. Panik schnürte ihm den Hals zu. Verzweifelt rang er nach Luft und hörte das langgezogene Siegesheulen des schwarzen Wolfes wie aus weiter Ferne…
Ruckartig setzte sich Digo im Bett auf. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass alles nur ein Traum gewesen war. Langsam wurde sein Atem ruhiger. Mit dem Handrücken wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Dann wickelte er sich fest in seine Bettdecke und schloss die Augen. Doch sofort kamen die schrecklichen Bilder zurück.
Unsicher blickte sich Digo in der Dunkelheit um. Im Bett auf der gegenüberliegenden Zimmerseite lag sein kleiner Bruder Mischa und schnarchte friedlich. Ansonsten war im ganzen Haus kein Laut zu hören.
„Das hat man nun davon, wenn man sich jeden Abend die alten Wolfsgeschichten anhören muss!“, dachte Digo wütend. Er war jetzt vierzehn Jahre alt und seit er denken konnte, kam jedes Jahr im Herbst ein Wolfsrudel hier ins Tal und bezog sein Winterquartier weit im Norden in einer Berghöhle.
Normalerweise waren die Wölfe für die Zwerge keine Bedrohung, da sie im Wald genug Beutetiere fanden. Doch das war auch schon einmal anders gewesen. Wie oft hatte ihm sein Vater die alte Legende vom großen Kampf der Zwerge gegen die Wölfe erzählt. Jedes Mal schloss er seinen Bericht mit den Worten: „Wir wissen nicht, wann sich das nächste Mal ein Rudel gegen uns wenden wird. Darauf müssen wir immer vorbereitet sein!“
Digo erhob sich und schlich auf Zehenspitzen zu dem kleinen Dachfenster in der Mitte des Zimmers. Er starrte lange zu den Baumschatten des angrenzenden Waldes, der hinter der baufälligen Steinmauer des Zwergendorfes Elvalon mit der Nacht verschwamm.
Elvalon, das bedeutete in der alten Zwergensprache so viel wie „Eulengrund“. Das Dorf war schon viele hundert Jahre alt und einige Familien, die hier lebten, konnten die Linie ihrer Vorfahren bis in die Gründungszeit zurückverfolgen. Hier im Tal wohnten die Zwerge, die die Abgeschiedenheit und Ruhe dem Trubel der zahlreichen Zwergenstädte vorzogen, die jenseits der steilen Bergwände die Landschaft überzogen.
Digo stützte seine Ellbogen auf das schmale Fensterbrett und beobachtete die dünnen Nebelschleier, die sich am Waldrand um die Sträucher schlängelten. Ein starker Wind jagte schwarze Wolken über den Himmel und schüttelte die Baumkronen, bis er ihnen die zappelnden Herbstblätter entreißen konnte. Im fahlen Licht des Vollmondes, der von Zeit zu Zeit zwischen den Wolken auftauchte, erkannte er jetzt sogar die gezackten Gipfel der Berge im Norden.
„Ich sollte noch einmal versuchen einzuschlafen“, dachte Digo und wandte sich vom Fenster ab. Hinter ihm lag eine anstrengende Woche. Alle Zwerge von Elvalon hatten bei Kartoffellese und Rübenernte helfen müssen.
Plötzlich riss eine heftige Sturmböe das Fenster auf. Der Metallrahmen krachte gegen den alten Kleiderschrank, der neben seinem Bett stand. Eisige Nachtluft verbreitete sich im Raum.
Digo sprang schnell zurück zum Fenster und drückte es zu. Dann entzündete er die kleine Laterne, die auf dem Tisch in der Mitte des Zimmers stand, um besser sehen zu können, und werkelte an dem verbogenen Eisenriegel herum, bis er sich endlich wieder schließen ließ. Es war ein Wunder, dass die Glasscheibe nicht zersplittert war.
Und sein kleiner Bruder Mischa schnarchte friedlich weiter in seinem Bett. Digo schüttelte den Kopf, löschte die Lampe und kroch wieder unter seine warme Federdecke. Vorsichtig schloss er die Augen. Die Bilder seines Albtraumes waren inzwischen verblasst und hatten ihren Schrecken verloren. Sollten die Wölfe nur kommen!
Kapitel 2
Es war Mitternacht, als das Rudel die Höhle am Nordhang des Tales erreichte. Die dunkelbraune Leitwölfin Granda näherte sich aufmerksam schnüffelnd dem schmalen Eingang ihres Verstecks. Die Luft war rein. Sehr rein. Kaum ein Lebewesen hatte sich in den vergangenen Monaten in der Nähe der Höhle aufgehalten. Normalerweise siedelten sich hier über den Sommer Steinkrähen zum Nisten an. Einmal mussten sie auch die Hinterlassenschaften einer Fuchsfamilie beseitigen. Doch dieses Jahr war die Höhle vollkommen verlassen geblieben.
Granda durchschritt mit andächtiger Miene den Eingang. Der schmale Spalt war hoch und gezackt, als hätte ein Blitz in die Bergfront eingeschlagen. Je weiter man voranging, umso breiter wurde der Gang, bis er sich nach zwei Metern zu einem hohen und weiten Raum wölbte. Im linken Teil der Höhle befanden sich mehrere Felsvorsprünge, die teilweise mit weichen Moospolstern bewachsen waren. Sie boten ideale Schlafplätze.
Nach Granda betraten weitere sieben Wölfe ihre Winterbehausung. Sie waren müde von dem tagelangen Fußmarsch und hungrig. Ein schmaler, grauer Wolf trottete zum hinteren Teil der Höhle. Dort sickerte Wasser von der Bergwand und sammelte sich in einer Vertiefung am Boden. Gierig schleckte er die kühle Flüssigkeit.
„Legt euch hin und ruht aus. Morgen gehen wir jagen.“ Granda spürte jeden einzelnen Muskel und war froh, dass sie jetzt die Beine ausstrecken konnte. Mittlerweile hatten sich ihre Augen an die Dunkelheit der Höhle gewöhnt. Sie ließ den Blick schweifen. Nach und nach fand jeder Wolf einen geeigneten Liegeplatz. Bei den meisten war es derselbe, wie im letzten Winter. An Grandas linker Seite hatte sich ihr jüngster Sohn Segbas zusammengerollt. Die alte Wölfin spürte jedoch, dass der Platz zu ihrer Rechten noch frei war. Hierher gehörte eigentlich ihr ältester Sohn Majoras. Granda konnte ihn in der Höhle weder sehen noch wittern. Also erhob sie sich noch einmal und schlich um die ruhenden Wölfe herum bis zum Ausgang der Höhle.
Am Rande des Felsvorsprungs stand ihr Sohn. Sein schwarzes Fell verschmolz vollständig mit der Dunkelheit. Nur im flackernden Schein des Vollmondes konnte man das leichte Zittern seiner gut trainierten Muskeln erkennen. Majoras stand wachsam auf dem Vorsprung, jederzeit angriffsbereit gegen seinen Feind, den er mit funkelnden Augen ins Visier genommen hatte.
Granda folgte seinem Blick, obwohl sie genau wusste, worauf dieser gerichtet war. Weit entfernt im südlichen Teil des Tales standen auf einer Lichtung mehrere kleine Holzhütten, die von einer alten Steinmauer umgeben waren. Zarte Rauchschwaden wehten aus den Schornsteinen. Dort lag das Zwergendorf Elvalon.
„Sie stellen für uns keine Gefahr dar“, versuchte sie ihren Sohn mit ruhiger Stimme aus den finsteren Gedanken zu reißen.
„Das sehe ich anders. Sie sind die einzige Gefahr, die es hier für uns im Tal überhaupt gibt!“
Granda spürte Majoras‘ tiefen Hass auf die Zwerge. Sie mochte die kleinen Männer und Frauen und hatte schon viele Stunden damit zugebracht ihr fröhliches Treiben im Dorf zu beobachten.
„Wenn wir ihnen nichts tun, dann werden sie uns auch in Ruhe lassen.“
„Wir müssen uns diese Bedrohung ein für alle Mal vom Hals schaffen!“ Wütend hatte sich Majoras zu seiner Mutter umgedreht. Die aufgestellten Nackenhaare ließen ihn noch mächtiger wirken. Seine Augen blitzten und er musterte die alte Wölfin abfällig von oben bis unten. Dabei entdeckte er auch die weißen Flecken, die sich an mehreren Stellen schon in ihr kastanienfarbenes Fell mischten und für ihn nur ein weiteres Zeichen der zunehmenden Schwäche seiner Mutter waren.
„Dieses Jahr sind wir zu neunt. Es wäre kein Problem diesen halben Portionen endlich den Garaus zu machen!“
Grandas Stimme enthielt nun einen deutlich warnenden Unterton: „Du weißt genau, was der Fluch sagt. Das Blut eines Zwerges, vergossen durch Wolfszähne, bedeutet den Untergang des Rudels.“
„Fluch! Pah! Dass ich nicht lache! Jetzt komm mir bloß nicht mit diesem schwachsinnigen, alten Märchen! Du warst doch bei dem großen Kampf vor einhundert Jahren überhaupt nicht dabei!“
„Nein, aber unsere Vorfahren. Und sie haben genau das erlebt.“
„Wahrscheinlich hatten sie damals auch nur so einen schwachen Leitwolf wie du es bist und konnten deshalb die Kurzbeine nicht besiegen.“
Ein zynisches Grinsen umspielte Majoras‘ Mundwinkel. Er wollte seine Mutter mit dieser Äußerung verletzen und wusste, dass es ihm gelungen war.
Granda kehrte ihm den Rücken zu und schritt langsam und mit betont erhobenem Haupt zum Höhleneingang zurück. Kurz bevor sie im Felsspalt verschwand, drehte sie sich noch einmal zu ihrem Sohn um. Seine Ablehnung und Verachtung brannten wie Feuer in ihrem Herzen.
„Das Blut eines Zwerges, vergossen durch Wolfszähne, bedeutet den Untergang des Rudels“, wiederholte sie den Fluch und ihr drohender Ausruf hallte als durchdringendes Geheul von den Bergwänden wider.
Kapitel 3
Willi Wumpdickel streifte sich den grauen Wollhandschuh von der rechten Hand und zeichnete mit dem Zeigefinger die markanten Ränder des Pfotenabdrucks im weichen Waldboden nach. Auch die Krallenspitzen waren gut erkennbar.
„Karlo, komm her! Hier ist eine Spur!“
Sein kleiner Begleiter stand etwa zwanzig Meter links von ihm und hob überrascht den Kopf.
„Eine Wolfsspur?“, fragte er seinen Freund.
„Schau es dir selbst an.“ Willi richtete sich auf und sah sich genauer in der näheren Umgebung um. Bei einer Körpergröße von nur einem Meter war es nicht gerade einfach, hier im dichten Gebüsch des Waldes einen Überblick zu bekommen. Seine erfahrenen Augen achteten daher auf jede Kleinigkeit. Tatsächlich entdeckte der Zwergenmann in der Nähe des Abdrucks ein paar abgeknickte Zweige. Vielleicht war hier einer der Wölfe kurz ins Straucheln geraten und hatte dabei mit seinem Körper den Busch gestreift? Karlo Kieferich stellte sich neben ihn.
„Lass mal sehen, Willi. Hm. Die Spur ist eindeutig und ganz frisch. Jetzt sind sie also doch noch gekommen. Und ich dachte schon, wir würden dieses Jahr vor den Plagegeistern verschont bleiben.“
Karlo zog sich den flachen Filzhut tiefer ins Gesicht, sodass unter der breiten Hutkrempe fast nur noch sein heller Vollbart zu sehen war. Die Morgenluft war eisig, obwohl die Sonne von einem wolkenlosen, blauen Himmel strahlte und einen schönen Tag verhieß.
„Schau, hier ist noch ein Abdruck. Die Spur führt nach Norden.“ Willi runzelte die Stirn. Als Waldaufseher war es seine Aufgabe, dem Dorfherrn später über die Anwesenheit der Wölfe Bescheid zu geben. Dann würde die jährliche Bürgerversammlung folgen. Welche Empfehlung sollte er dieses Mal geben? War es klug, darauf zu vertrauen, dass die Wölfe wieder Abstand halten würden? In seinen fünfzig Lebensjahren hatte es noch keinen Winter ohne ein Wolfsrudel im Tal gegeben.
Plötzlich wurden die zwei Männer von einem schrillen Schrei aus den Gedanken gerissen. Der Todesschrei eines Rehs, kurz gefolgt von einem Zweiten.
„Sie haben ihre ersten Opfer gefunden.“ Karlo strich sich die zerknitterten Ärmel seiner dicken Felljacke glatt und ergänzte andächtig: „Arme Rehe. Doch wenn es Rehe sind, ist es wenigstens kein Zwerg.“
„Hoffen wir, dass es dabei auch bleibt“, antwortete Willi Wumpdickel zähneknirschend.
„Komm, wir haben unsere Arbeit hier getan. Jetzt brauche ich erstmal einen warmen Tee.“ Karlo stapfte voran und bahnte sich geradlinig seinen Pfad durch das Dickicht, indem er die Zweige vor seinem Kopf zur Seite wegdrückte. Willi musste aufpassen, dass er nicht von den zurückschnellenden Ruten getroffen wurde.
Als sie den offenen Weg erreicht hatten, schlugen die Männer die südliche Richtung ein, welche sie vorbei am großen Rünkelsee zurück zum Zwergendorf Elvalon führte. Der breite Waldweg war übersät mit Zweigen und Zapfen, die der Wind von den Bäumen gerissen hatte.
Eine Stunde später erreichten Karlo und Willi den Eingang des Dorfes. Beim Durchqueren des Torbogens streifte Willis Blick das Wappen von Elvalon – eine dicke Eule mit großen runden Augen, die in den oberen Querbalken geschnitzt war. Gedankenverloren strich er sich über seinen brustlangen, braunen Bart. Die Eule war das Zeichen für Weisheit und Adel. Sie war das Wappen der Familie des Dorfherrn, dessen Vorfahren damals das erste Haus im Tal gebaut hatten.
„Ich gehe zuerst zum Dorfherrn“, brummte Willi.
„Na, dann viel Vergnügen.“ Karlo konnte sich das Grinsen kaum verkneifen, denn er wusste aus eigener Erfahrung, wie kompliziert eine Unterhaltung mit dem selbstverliebten Herrn Howin von Pilznockel werden konnte.
Vom Torbogen aus führte ein breiter gepflasterter Weg zum Dorfplatz ins Zentrum von Elvalon. Dort stand die Hütte des Dorfherrn, die mit aufwendigen Schnitzereien verziert war, gleich neben dem Versammlungshaus. Der Platz teilte das Dorf in einen vorderen und einen hinteren Teil. Er war mit kleinen, runden Blumenbeeten bepflanzt, die für den Winter schon mit Stroh und Reisig abgedeckt waren. Außerdem schmückten ihn mehrere lustige Tierfiguren aus Holz.
Vom Dorfplatz aus verliefen viele kleine Trampelpfade zu den zehn Hütten der Zwergenfamilien. Nur ein weiterer Weg war gepflastert. Auf ihm gelangte man zum Stall im hinteren Teil des Dorfes, in dem die Pferde und Schafe untergebracht wurden.
Willi Wumpdickel ging den Hauptweg entlang und stand kurz darauf vor der Hütte des Dorfherrn. Schon aus einiger Entfernung hörte er laute Stimmen. Regolas, der einzige Sohn der Familie von Pilznockel diskutierte wohl gerade mit seiner Mutter. Der Junge kam ganz nach seinem Vater und ließ sich von niemandem etwas sagen. Willi klopfte extra kräftig an die dunkelgrün-lackierte Eichentür. Die Stimmen in der Stube verstummten schlagartig und eilige Schritte näherten sich der Tür, die kurz darauf von Mina, der Frau des Dorfherrn aufgerissen wurde.
„Willi Wumpdickel! Welch schöne Überraschung! Was verschafft uns die Ehre deines Besuchs?“ Mina trug ein einfaches blaues Wollkleid mit einer gelben Schürze. Die langen blonden Haare hatte sie ordentlich zu einem Kranz um ihren Kopf geflochten. Während sie mit Willi sprach, rieb sie ihre Hände an einem karierten Handtuch trocken.
„Ich muss mit Howin sprechen“, sagte Willi.
„Oh, der ist gerade beim Professor. Die beiden setzen sich doch jeden Samstagvormittag zusammen und besprechen die Angelegenheiten für die nächste Woche.“
Natürlich. Das hatte Willi ganz vergessen. Schnell murmelte er einen kurzen Dank und eine Verabschiedung.
Zum Haus des Professors Ludowig Hausassel musste Willi bis in den hinteren Teil des Dorfes gehen. Er öffnete das kleine geschmiedete Gartentörchen und betrat das Grundstück der Hausassels. Sinate, Ludowigs Frau, liebte Blumen und in ihrem Garten konnte man fast alles finden, was Blüten hatte, in den verschiedensten Formen und Farben. Jetzt im späten Herbst schmückten allerdings nur noch ein paar bunte Astern ihre Beete.
Willi lief eilig den kurzen Kieselweg entlang bis zur Haustür und klopfte zweimal. Diesmal dauerte es einen Moment, bis die Tür geöffnet wurde. Ludowig stand vor ihm und zwinkerte ihn durch seine alte Nickelbrille an.
„Guten Morgen, Willi Wumpdickel! Komm rein, komm rein.“ Sein Atem verriet, dass die Besprechung mit dem Dorfherrn schon durch ein paar Schnäpschen aufgelockert worden war.
„Ist Howin auch da?“, fragte Willi, obwohl er die Antwort schon kannte.
„Jawohl! Wir sind hinten im Arbeitszimmer.“ Ludowig führte Willi durch das Haus, vorbei an der Küche, wo seine beiden Söhne Aleko und Torat über ihren Schulbüchern saßen und schwitzten. Sie mussten sogar am Wochenende noch Aufgaben machen. Aleko wurde bald sechzehn und sollte im nächsten Sommer in die große Zwergenstadt Baruk auf der anderen Seite des Gebirges zu seinem Onkel ziehen, um dort die Universität besuchen zu können.
Ludowigs Frau Sinate hockte in der Stube vor dem Ofen und wollte gerade ein dickes Holzscheit quer in die rechteckige Öffnung des Kamins schieben, aber es passte nicht, so sehr sie auch drückte und schob.
Ludowig sah ihr ein paar Sekunden zu, dann rief er kopfschüttelnd: „Du musst es drehen! Drehen!“
Sinate blickte kurz zu ihm, dann drehte sie das Holzscheit und schob es problemlos in den Ofen.
„Na, so was!“, rief sie ihrem Mann sichtlich erleichtert zu und wischte sich die Hände an der blauen Schürze ab.
Ludowig Hausassel schüttelte den Kopf und zwirbelte mit den dünnen Fingern der linken Hand die Spitze seines eingedrehten Schnurrbartes. Er war der einzige Zwergenmann im Dorf, der keinen Vollbart trug.
Als sie gemeinsam das Arbeitszimmer betraten, saß der Dorfherr wohlig ausgestreckt in einem abgenutzten, roten Ohrensessel. Seine graue Seidenweste spannte sich viel zu eng um den dicken Bauch. In der linken Hand hielt er ein halb gefülltes, bauchiges Glas, mit dem er den beiden Eintretenden gespielt zuprostete und es dann mit einem Zug leerte.
„Nur herinn, Willi Wummdickel! Erzähl unsch doch. Wie war die Suhuche heut? Gibt esch örgendwelsche Spuhuren von unscheren schauherigen Feinden? Hicks!“
Howin füllte sein Glas schnell aus einer braunen Flasche, die auf dem kleinen runden Holztisch vor ihm stand, wieder auf. Ludowig ließ sich auf einem der beiden Ledersessel, die auch um das Tischchen standen, nieder und forderte Willi mit einem kurzen Nicken auf, sich ebenfalls hinzusetzen.
Willi nahm Platz und hob ablehnend die Hand, als der Dorfherr ihm auch von dem Schnaps anbot.
„Alscho, isch höre deinenen Berischt von der heuteligen Waldbeschischtigung“, lallte Howin von Pilznockel.
„Was für einen Sinn hat es, dem Dorfherrn in diesem Zustand von unserer Entdeckung zu berichten?“, fragte sich Willi. Er wäre auf jeden Fall nicht in der Lage, eine „nüchterne“ Betrachtung der Ereignisse vorzunehmen.
Während der Waldaufseher noch nach den richtigen Worten suchte, um seinen Bericht zu beginnen, hatte Howin eine Schachtel Pralinen im Bücherregal entdeckt und machte sich über deren Inhalt her, ohne seinen Freund Ludowig um Erlaubnis zu bitten.
„Wir haben heute Morgen frische Wolfsspuren im Wald gefunden“, begann Willi schließlich seinen Bericht.
„Dann schind sie alscho doch wieder daaa?“ Howin wurde plötzlich weiß um die Nase und seine schwulstigen Lippen begannen so zu zittern, dass sein langer, grauer Bart bis in die äußersten Haarspitzen wackelte.
„Es waren nur zwei Pfotenabdrücke. Die Wölfe haben sich sehr angestrengt, nicht entdeckt zu werden.“
Der Dorfherr schwenkte sein Glas behutsam im Kreis, bis sich der Schnaps darin drehte. Plötzlich stoppte er die gleichmäßige Bewegung und starrte in das Gefäß, wo die klare Flüssigkeit unter seinem verschwommenen Blick unruhig hin und her schwappte. Geräuschvoll sog er frische Luft durch die Nase ein und fragte Willi dann mit gespielter Freundlichkeit und klaren, gezischten Worten:
„Warum konntest du die Anzeichen für ihr Kommen nicht eher erkennen? Schließlich bist du doch der oberste Waldaufseher, Willi, oder? Aber da lässt du lieber Unsereins im Glauben, wir könnten dieses Jahr von den Biestern verschont bleiben! Es ist immerhin schon Ende Oktober!“
Howin warf Willi die haltlosen Anschuldigungen wie faule Eier an den Kopf und der war so verdutzt, dass ihm auf die Schnelle gar keine Antwort einfiel. Da ergriff erstaunlicherweise Ludowig für ihn Partei.
„Aber Howin, guter Freund. Wie soll denn ein Zwerg die Ankunft von Wölfen im Voraus erkennen. Das ist wissenschaftlich unmöglich!“
Zum ersten Mal war Willi Professor Ludowig für seine Liebe zur Wissenschaft dankbar. Dieses Argument würde den Dorfherrn sicherlich überzeugen. Aber da hatte er sich getäuscht.
„Was weiß isch denn, vielleischt erkennt man esch an den Wolken oder Vöhögln? Ich bin hier ja nüsch der Fachmann!“
Die Nase des Dorfherrn hatte sich inzwischen von Weiß in Rot verfärbt. Er blinzelte nervös mit den Augen. Willi spürte Zorn in sich aufsteigen und musste die Zähne fest zusammenbeißen, um nicht loszubrüllen. Daher klang seine Erwiderung wie durch eine Kaffeemühle gepresst:
„Es ist nicht möglich das Kommen der Wölfe vorherzusagen. Wenn sie da sind, sind sie da. Und sie kommen, seit die Zwerge unserer Generation denken können, jedes Jahr wieder. Man sollte also mit ihnen auch jedes Jahr rechnen!“ Willi ballte seine Hände, die vor Wut zitterten, zu Fäusten.
Da sammelten sich in Howins Augenwinkeln plötzlich Tränen.
„So ischt man nu als Dorfherr Tach un Nacht darauf bedacht fühür die Schischerheit und das Wohl scheiner Leut tschu schorgen und esch wird einem nischt gedankt. Im Gegenteil! Die, die man alsch scheine gröschten Stützen erachtet hatte, stellen schich auch noch gehegen einen.“
Howin von Pilznockel rutschte wimmernd ein Stück in seinem Sessel nach unten, nahm einen gierigen Schluck aus dem Glas und blickte in Selbstmitleid versunken vorwurfsvoll zu seinem Freund Ludowig. Dieser versuchte die brenzlige Lage zu entschärfen.
„Mein lieber Freund, niemand stellt sich gegen dich! Willi hat uns doch nur von seiner Beobachtung im Wald berichtet, wie es seine Pflicht ist. Und nun ist es deine Aufgabe einen Termin für die Bürgerversammlung festzulegen.“
„Montag, gleisch am Montag“, murmelte der Dorfherr mit gesenktem Kopf. Seine geschlossenen Augen waren inzwischen stark geschwollen. Das leere Glas in seiner Hand hing schräg zur Seite.
„Gut, dann werde ich gleich die Bekanntmachung schreiben und am Versammlungshaus anhängen. Willi, du kannst gehen. Vielen Dank für deinen Bericht.“
Ludowig und Willi erhoben sich, schüttelten einander die Hände und Willi verließ das Arbeitszimmer und das Haus des Professors so schnell ihn seine kurzen Beine tragen konnten.
Währenddessen wandte sich Ludowig Hausassel seinem schnarchenden Freund zu, löste behutsam das Glas aus dessen Hand und stellte es auf den Tisch. Danach ging er zu seinem Schreibtisch, nahm ein sauberes Blatt Papier, tauchte den Federhalter ins Tintenfass und schrieb mit großen Buchstaben:
MONTAG DORFVERSAMMLUNG
Seit Ludowig denken konnte, war Howin von Pilznockel sein bester Freund und er kannte dessen wechselhafte Launen. Aber heute konnte er ihn nicht verstehen. Sein grobes Verhalten gegenüber Willi war unnötig gewesen. Stattdessen hätte er sich lieber selbst um die nächsten nötigen Schritte kümmern müssen. Wahrscheinlich lag es am vielen Alkohol. Das Türchen mit den verschiedenen bunten Flaschen würde Ludowig wohl bei ihrem nächsten Treffen lieber verschlossen lassen.
Kopfschüttelnd streute der Professor etwas Schreibsand über das Papier. Nachdem sich die kleinen Körnchen mit der überflüssigen Tinte vollgesaugt hatten, hob er den Zettel vorsichtig an und schüttete den Sand langsam zurück in die kleine Tonschale auf seinem Schreibtisch. Ludowig rollte die Bekanntmachung ein und band sie mit einer roten Schnur fest zusammen.
„Howin soll sie nachher gleich mitnehmen und am Versammlungshaus aufhängen“, dachte er sich.
Dann verließ der Professor das Arbeitszimmer und ließ seinen laut schnarchenden Freund im großen Lehnsessel sitzend allein zurück.
Kapitel 4
Willi Wumpdickel stapfte mit zusammengekniffenen Lippen durch das Dorf. Vor Wut hätte er sich am liebsten die Haare unter dem braunen Filzhut gerauft, aber die wurden in letzter Zeit sowieso schon immer weniger.
Die Hütte seiner Familie befand sich neben dem Eingangstor. Daher musste er nun mit seiner schlechten Laune ganz Elvalon durchqueren. Wenn er von einem anderen Zwerg gegrüßt wurde, hob er nur kurz die Hand.
„Dieser Howin treibt mich noch in den Wahnsinn! Wie kann so jemand der Anführer eines ganzen Dorfes sein? Er wird uns noch alle ruinieren. Das kann ja bei der Versammlung am Montag lustig werden. Da wird der liebe Herr von Pilznockel wieder mir die ganze Schuld zuschieben.“
Willis Gedanken ratterten wie Faustschläge in seinem Kopf, bis der schmerzte. Es war schon erstaunlich. Immer wenn er mit dem Dorfherrn zu tun hatte, war er hinterher schlecht gelaunt und bekam Schuldgefühle. So auch jetzt. Er begann plötzlich darüber nachzudenken, ob er nicht wirklich das Kommen der Wölfe hätte eher erkennen müssen. Doch wie? Seltsamerweise half ihm die Bemerkung des Professors, um nicht an sich selbst zu zweifeln: wissenschaftlich absolut unmöglich!
Willi hatte den Professor noch nie besonders gut leiden können und war ihm in der Regel aus dem Weg gegangen. Vielleicht lag es daran, dass er als Kind von Ludowigs Vater unterrichtet worden war und daran keine besonders schönen Erinnerungen hatte. Ein Gutes hatte das Treffen mit dem Dorfherrn heute also gehabt: Er sah den Professor mit anderen Augen.
Willi konnte seine Frau Lene schon von weitem sehen. Sie stand auf einer kleinen Holzleiter, die an der Südseite ihres Hauses lehnte, und erntete Weintrauben. Dieses Jahr waren die dunklen Beeren besonders süß, es hatte viel Sonne und regelmäßig Regen gegeben.
„Guten Tag, mein Schatz“, rief Lene ihrem Mann zu, als sie ihn entdeckte. Die geflochtenen schwarzen Haare fielen ihr wie ein langes Seil über den Rücken. Sie trug eine hellbraune Stoffhose und hatte die Knöpfe der bunten Wolljacke geöffnet.
Erst jetzt bemerkte Willi, wie warm es inzwischen geworden war. „Von wegen gut!“, brummte er, zog die Haustür auf und ließ sie etwas zu schwungvoll hinter sich zuschlagen. Rumms.
Lene schüttelte den Kopf und legte ihre Schere zusammen mit der Rispe, die sie gerade abgeschnitten hatte, in den Eimer, der mit einem Haken an der obersten Sprosse der Leiter angehängt war. Dann stieg sie nach unten, rieb die Hände an den Hosenbeinen ab, was kleine, schmutzige Abdrücke hinterließ, und folgte ihrem Mann in die Hütte.
Es dauerte einen Moment, bis sie Willi gefunden hatte. Er saß tief versunken in einem Sessel im Wohnzimmer. Seine Augen starrten zu dem schmalen Fenster auf der gegenüberliegenden Zimmerseite, durch das man den Torbogen von Elvalon sehen konnte. Es störte ihn nicht, dass das Feuer im Kamin nur noch mit schwacher Glut glomm und eigentlich Holz nachgelegt werden müsste.
„Wie ein Häuflein Elend“, dachte Lene. Sie trat leise näher und legte ihrem Mann von hinten eine Hand auf die Schulter. „Sind die Wölfe gekommen?“, fragte sie den entmutigten Zwergenmann.
„Oh, ja! Und ich bin daran schuld!“, kam die zerknirschte Antwort.
„Bei Howin von Pilznockel warst du also auch schon“, bemerkte Lene. „Und du gibst immer noch etwas auf seine Meinung? Sehr geehrter Herr Wumpdickel, du kennst den Dorfherrn und seine besondere, liebevolle Art jetzt schon seit vielen Jahren! Und immer noch gelingt es ihm, dich in so einen Miesepeter zu verwandeln? Was soll ich dazu nur sagen?“
„Du bist eben nicht so wie ich für das verantwortlich, was im Wald passiert.“
„Verantwortlich?“, sie zog das Wort bewusst in die Länge. „Du bist als Waldaufseher doch nicht verantwortlich für das, was im Wald passiert, du sollst es nur beobachten und davon berichten! Und das hast du ja wohl getan!“
Willi dachte einen Moment lang nach. Natürlich hatte seine Frau Recht, aber das konnte leider so schnell nichts daran ändern, wie er sich fühlte.
Lene redete inzwischen weiter auf ihn ein: „Kein Zwerg hier im Dorf wird dir die Schuld dafür geben, dass die Wölfe da sind!“
„Ich weiß ja…“, murmelte Willi.
„Komm jetzt, wir brauchen neues Feuerholz. Schnapp dir die Kiste und bring dich auf andere Gedanken!“ Lene gab ihrem Mann einen aufmunternden Klaps auf den Arm und wandte sich zur Tür.
„Wo sind denn die Kinder?“, fragte Willi seine Frau, bevor sie das Zimmer verließ.
„Bei ihren Freunden“, antwortete Lene und senkte den Kopf. Das Rudel war ins Tal zurückgekehrt und würde den ganzen Winter lang nach Beute suchen. Wie jedes Jahr begann jetzt für sie die Zeit der Sorge um ihre Familie.
Lene spürte, wie ein Teil von Willis schlechter Stimmung auf sie abzufärben begann und wandte sich schnell wieder ihrer Arbeit im herrlichen Mittagssonnenschein auf der Leiter zu. Die Trauben dieses Jahr waren einfach herrlich. Sie würde sie zu Saft pressen und Gelee kochen.
Lene pflückte eine dicke lila Beere und steckte sie in den Mund. Dann zerdrückte sie die Frucht mit der Zunge am Gaumen, bis sich der wässrig-süße Saft in ihrer Kehle sammelte. Genussvoll schluckte sie und streckte den Kopf in den Nacken. Am strahlenden Himmel über ihr sammelten sich die Stare und tauchten wie ein riesiger Fischschwarm wild durch die Luft. Sie waren dieses Jahr lange im Tal geblieben. Doch jetzt war für sie und viele andere Vögel die Zeit gekommen, weiter nach Süden zu ziehen.
Willi blieb noch einen Moment in der Stube sitzen, den Kopf nachdenklich in die Hände gestützt. Dann erhob er sich, nahm die Holzkiste, die neben dem Kamin stand und nur noch ein paar letzte dünne Späne enthielt.
Müde und enttäuscht verließ er die Hütte, um die Kiste mit neuen Scheiten vom Holzstoß hinter dem Haus aufzufüllen.
Kapitel 5
Es war schon heller Sonntagvormittag, als Digo Wumpdickel die Weide hinter dem Dorf erreichte. Fünf Ponys und ein Dutzend Schafe rupften eifrig die letzten grünen Grashalme. Bald würden sie ihr Winterquartier im Stall beziehen.
„Na, das wird ja ein toller Morgen!“ Wütend sah sich Digo zu seiner zwölfjährigen Schwester Luja um, die auf dem ausgetretenen Pfad zur Koppel nur wenige Schritte hinter ihm herlief. Das rothaarige Mädchen war ihm von zu Hause aus gefolgt, obwohl er versucht hatte, die Hütte so unauffällig wie möglich zu verlassen.
„Die hat ihre Nase auch überall. Ein Streit vor meinen Freunden hat mir gerade noch gefehlt.“ Digo schaute nach vorn zu den vier jungen Zwergen, die am Weidezaun lehnten und auf ihn warteten. Alle hielten schon ihre Halfter bereit. Kurz entschlossen drehte er sich zu seiner Schwester um.
„Was machst du hier? Wieso bist du mir schon wieder nachgelaufen?“, warf Digo ihr entgegen.
Lujas dunkelblaue Augen funkelten ihn zornig an. „Du weißt genau, dass ich mit euch reiten will. Nie nimmst du mich mit!“
„Und du weißt genau warum – du nervst!“, zischte Digo.
„Aber ich kann gut reiten, das weißt du!“
„Jeder hier im Dorf kann reiten. Aber es gibt nur fünf Ponys, auf denen man reiten kann, und die sind leider alle von den älteren Zwergen belegt. Oder kannst du etwa nicht zählen?“ Digo schaute Luja triumphierend von oben herab an und verschränkte die Arme vor der Brust.
„Du bist echt gemein!“ Luja drehte sich so ruckartig auf dem Absatz um, dass die roten Locken wie Feuerblitze um ihren Kopf zuckten und stapfte wütend den Weg zum Dorf zurück.
„Na, die bin ich endlich los“, dachte Digo und wandte sich wieder der Koppel zu.
Zuerst wurde er von Regolas, dem fünfzehnjährigen Sohn des Dorfherrn begrüßt: „Was wollte denn die Tomate hier?“, fragte dieser, sichtlich belustigt über Lujas dramatischen Abgang. Digo schüttelte erst seinen besten Freunden Benek Grünzweig und Laurell Kieferich die Hand.
„Sie will bei der Fuchsjagd mitmachen“, antwortete er dann so beiläufig wie möglich.
„Also ich würde sie mitmachen lassen. Hab` sie letztens beim Reiten gesehen. Das könnt ihr nicht glauben, wie sicher sie die engen Wendungen beherrscht.“ Die Unterstützung für Luja kam von dem einzigen Mädchen in der Runde. Floris Pfefferwurz saß seitlich abgestützt auf der obersten Zaunlatte und ließ die Beine baumeln. Sie war schlank und über ihrer Stupsnase schauten zwei freche braune Augen zu Digo.
„Na, du hast gut Reden, Floris. Dein Platz beim Reiten ist dir ja auch sicher, weil du die Einzige bist, die auf Pitu reiten kann.“ Aus Regolas Stimme klang deutlich der Neid darüber, dass sich der stolze schwarze Ponyhengst, der gerade am hinteren Ende der Koppel graste, nur von dem Zwergenmädchen reiten ließ. Als Pitu noch ein Fohlen war, hatte er sich beim Toben auf der Weide das Bein schwer verletzt. Alle hatten ihn schon aufgegeben, aber Floris nahm den Kleinen mit zu sich nach Hause und pflegte ihn voller Hingabe gesund. Seither vertraute Pitu nur ihr.
Von der alten Verletzung war inzwischen nichts mehr zu merken. Der junge Hengst strotzte nur so vor Kraft und Übermut.
„Wer hat, der hat.“ Floris grinste Regolas an und schwang sich mit einem lockeren Satz über den Zaun auf die Weide.
Digo blickte ihr mit klopfendem Herzen nach, wie sie die Koppel überquerte und ihrem Pony kurz den Hals kraulte. Sie legte Pitu geschickt das Halfter an und landete mit einem geübten Sprung auf seinem Rücken. Das Pony schnaubte kurz auf, schüttelte den Kopf und trabte dann mit seiner Reiterin auf die vier Zwergenjungen zu.
Seit einiger Zeit spürte Digo, wenn er Floris sah, ein plötzliches Kribbeln im Bauch. Es gab so viel, was man an ihr bewundern konnte: das hübsche, freundliche Gesicht, die Sportlichkeit, ihre trotzige Stärke und Wildheit. Digo hatte von seinen Gefühlen für das Mädchen noch nicht einmal seinen besten Freunden Benek und Laurell erzählt. Und Floris musste davon auch erst einmal nichts wissen.
„Wollen wir heute noch Fuchsjagd spielen, oder soll ich allein eine Runde im Wald drehen?“, rief Floris den Jungen zu, die immer noch am Zaun standen und den Hengst, beziehungsweise dessen attraktive Reiterin bewunderten.
Regolas hängte sich sein Halfter über die Schulter, kletterte über den Zaun und ging auf die kleine grasende Ponyherde in der Mitte der Weide zu. Digo und Laurell folgten ihm. Benek nahm lieber den Umweg durch das Gatter. Bei seinen bisherigen Versuchen den Zaun sportlich zu überwinden, war er jedes Mal auf der Nase gelandet und hatte sich einmal sogar die Hose zerrissen, was ihm zu Hause eine Menge Ärger eingebracht hatte.
Digo steckte Daumen und Zeigefinger in den Mund und pfiff. Eine schwarz-weiß gescheckte Stute hob neugierig den Kopf, wieherte kurz und trabte auf ihn zu. Digo liebte dieses Pony. Dolla war zwar schon etwas älter, aber immer noch stark und wendig. Liebevoll streichelte er der Stute über die Nüstern.
Nach ein paar Minuten hatten alle Zwerge ihre Ponys aufgehalftert. Einen Sattel brauchten sie nicht, der war für das schnelle Spiel durch den Wald nur hinderlich.
Laurell öffnete das Gatter, damit alle die Weide verlassen konnten. Dann holte er aus einer abgewetzten Ledertasche, die über dem Torpfosten hing, eine kleine Holzkiste heraus.
„Wir brauchen drei rote und zwei schwarze Kugeln“, befahl Regolas.
„Danke, aber ich kann auch schon rechnen“, zischte Laurell zurück.
Mit den Kugeln wurden die Rollen für das Fangspiel ausgelost. Es gab immer nur zwei Jäger. Alle anderen Mitspieler waren die Füchse. Sie mussten sich ein rotes Tuch am Arm befestigen. Wenn ein Jäger einen Fuchs einholte und das rote Tuch abriss, war der Fuchs gefangen und durfte nicht mehr mitspielen. Das Spiel war zu Ende, wenn es keinen Fuchs mehr gab oder ein Fuchs bis Mittag nicht gefangen werden konnte.
Benek hielt die Ledertasche auf, während Laurell die entsprechenden Kugeln hineinwarf. Jetzt musste jeder eine Kugel ziehen.
Floris hoffte, dass sie mit Digo zusammen Jägerin sein würde. Es war für sie langweilig, Fuchs zu sein, da keiner ihren schwarzen Hengst einholen konnte und Digo war mit Abstand der beste Reiter unter den Jungen. Sie mochte ihn sehr, auch wenn er manchmal ganz schön gemein zu seiner Schwester war.
Regolas zog wie immer als Erster. Er drehte die schwarze Kugel zwischen Daumen und Zeigefinger und grinste zufrieden. Laurell und Benek zogen jeweils eine rote Kugel.
„Hoffentlich bist du auch ein Fuchs“, flüsterte Benek Digo zu, als dieser in die Ledertasche griff. Rot. Benek machte einen Freudensprung und klopfte seinem Freund überschwänglich auf den Rücken.
„Na dann. Heute haben wir zwei also das Vergnügen, Regolas“, sagte Floris enttäuscht und zog die letzte schwarze Kugel aus der Tasche, warf sie in die Luft und fing sie geschickt wieder auf.
„Dann haben die anderen keine Chance. Leute, in einer halben Stunde ist das Spiel vorbei!“, rief Regolas verheißungsvoll und warf Benek, Digo und Laurell jeweils ein rotes Band zu.
„Das werden wir noch sehen“, murmelte Laurell und zog Benek und Digo für eine kurze Absprache eng an sich heran. „Unser Ziel ist die alte Burg am Osthang“, flüsterte er seinen Freunden zu, die eifrig nickten. „Dort kann man sich herrlich verstecken. Digo, du nimmst die östliche Route, ich nehme die lange über Westen und du, Benek, den direkten Weg, vorbei am Rünkelsee.“
Digo und Benek waren mit dem Vorschlag einverstanden. Unter Laurells blonden Strubbelhaaren steckte ein kluger Kopf und wenn es darum ging, Pläne zu schmieden, war er immer der Erste.
Regolas und Floris saßen schon auf ihren Ponys und warteten ungeduldig, bis die drei Füchse ihre roten Erkennungszeichen an die Arme gebunden hatten. Dann konnte das Spiel beginnen.
„Ihr habt dreißig Sekunden Vorsprung“, sagte Regolas und gab das Startsignal. „Los!“
Die drei Füchse galoppierten in verschiedene Richtungen davon. Regolas zählte. Für Floris‘ Geschmack etwas zu schnell. Das war mal wieder typisch.
„Wir müssen nicht zusammenbleiben! Ich nehme den Weg zum See!“, rief Regolas seiner Partnerin über die Schulter zu und gab seinem Pony einen kräftigen Tritt in die Flanken, worauf die braune Stute in den Wald davonstürmte.
„Danke für die gute Absprache und die tolle Zusammenarbeit!“, rief ihm Floris noch hinterher. Regolas würde Benek schnell fangen. Der Weg zum Rünkelsee war einfach zu offensichtlich. „Na, Pitu, dann werden wir mal schauen, ob wir heute einen Fuchs fangen“, flüsterte Floris ihrem Pony zu. Sie hatte sich die Richtung gemerkt, in die Digo verschwunden war. Bestimmt wollte er Richtung Osten. Dort wuchsen ausschließlich kleine Fichten und der Wald war dicht und dunkel. Ein gutes Versteck. Floris schnalzte mit der Zunge. Der weiche Stoff ihrer grauen Hose schmiegte sich eng an den Bauch des Hengstes, als dieser sich in Bewegung setzte. Bald darauf hüpfte ihr kurzer Pferdeschwanz im Einklang mit Pitus trabenden Schritten auf und ab.
Digo verlangsamte sein Tempo von Galopp in einen gleichmäßigen Trab. Der Weg, auf dem er sich befand, war hart und eben, da er oft benutzt wurde, und würde Dolla keine Schwierigkeiten bereiten.
Immer wieder musste sich der junge Zwerg seitlich am Hals seines Ponys hinunterbeugen, um den herabhängenden Ästen auszuweichen. Erst vor wenigen Wochen hatte er die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass sich ein Zweig in seinen schwarzen Locken verheddert und ihn fast von Dollas Rücken gezogen hatte. Er rieb sich die Stelle am Hinterkopf und erinnerte sich an das fürchterliche Brennen, als ihm ein ganzes Büschel Haare herausgerissen wurde. Seither trug er bei den Reitspielen immer eine Mütze.
Dolla trabte gemütlich vorbei an den kahler werdenden Linden, Eichen und Buchen. Digo gefiel das Rascheln des trockenen Laubes, das unter den Tritten des Ponys wie ein dicker Teppich nachgab. Er atmete den würzigen Duft von alten Blättern und reifen Pilzen tief ein.
So hätte er einfach den restlichen Vormittag durch den Wald reiten können. Aber sein Ziel bestand ja darin, den Jägern zu entkommen. Vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, dass sich alle drei Füchse an derselben Stelle trafen. Dort bei der alten Burg waren sie leichte Beute, wenn jemand den Plan durchschaute. In ihrem Rücken erhob sich die schroffe Bergwand. Nach vorn gab es nur einen leicht zu versperrenden Waldpfad zur Flucht oder den unbequemen Weg quer durch die dichte Fichtenschonung.
Laurells Plan war, dass sie sich dort zwischen den zerfallenen Mauerresten versteckten und abwarteten. Wenn bis zur Mittagsstunde kein Fuchs gefangen war, wurde das Spiel beendet und die Füchse hatten gewonnen. Doch Digo kannte den ehrgeizigen Regolas und Floris‘ guten Instinkt, was mögliche Verstecke anging. Und er kannte Beneks Tollpatschigkeit. Wahrscheinlich war der seinen Verfolgern schon ins Netz gegangen.
Über Digos Kopf pfiff eine Amsel ihre eindringliche Melodie. Ein paar Elstern gaben krächzend Antwort. Vereinzelt stachen helle Sonnenstrahlen wie lange Lanzen durch die Bäume und ließen Millionen kleine Staubkörnchen in ihrem Rampenlicht tanzen.
„Vielleicht sollte ich diesen Tag einfach so gut es geht genießen“, dachte Digo. „Es wird wohl für dieses Jahr mein letzter Ausritt sein.“ Morgen bei der Versammlung würde bestimmt beschlossen werden, dass keine Reitspiele mehr im Wald stattfinden durften.
Digo machte sich wegen der Wölfe keine Sorgen. Zum einen jagten sie nur selten am hellen Vormittag und zum anderen hatten sie noch nie einen Zwerg und sein Pony angegriffen. Das Reitspielverbot war auch eigentlich nicht das Schlimme. Im Winter machte die Fuchsjagd sowieso keinen Spaß, da es aufgrund der kahlen Bäume und der Hufspuren im Schnee viel zu leicht war, die Füchse zu verfolgen. Es ärgerte den jungen Zwerg nur, dass gleichzeitig auch alle Ausritte in den Wald untersagt wurden.
Digo spürte, wie sich Dollas Gangart veränderte. Sie passte ihre Schritte an den neuen Untergrund an. Der breite, ebene Weg war in einen selten benutzten Trampelpfad übergegangen, der kurvig und von vielen Baumwurzeln durchschlungen war.
Digo zog die Zügel leicht an. Es war sicherer, sein Pony hier im Schritt laufen zu lassen. Sie würden bald zu der Stelle kommen, an der die östliche Route ein Stück direkt am Berghang entlangführte.
Bisher konnte der junge Zwerg keinen Verfolger sehen. Regolas und Floris hatten sich bestimmt entschieden, zuerst den Weg zum See abzusuchen. Dass sie sich so früh schon trennen würden, konnte er sich nicht vorstellen.
Digo schaute zurück und betrachtete den Waldboden genauer. An mehreren Stellen waren eindeutig Dollas Hufabdrücke zu erkennen. Es würde also hier nicht schwer sein, ihm zu folgen.
Der Weg machte nun eine scharfe Rechtskurve und wurde etwas breiter. Kurz darauf endete er an einem kleinen Felsvorsprung. Digo drückte Dolla die Schenkel in den Bauch und rief ihr ein aufmunterndes „Los geht’s“ zu. Mit einem kräftigen Satz sprang die Stute auf das schmale Plateau.
In einer Höhe von einem Meter verlief der enge Felsweg. Dolla gefiel der schroffe Untergrund voller Kanten und loser Steine nicht. Ärgerlich schnaubend schüttelte sie ihren Kopf, dass die Mähne flog. „Keine Angst, kleines Mädchen“, beruhigte sie Digo. „Das ist nur ein kurzes Stück. Gleich sind wir wieder im Wald.“
Nach fünf Minuten erreichten sie eine Gabelung. Zur rechten Seite führte der Weg weiter hinauf ins Gebirge. Er wurde deutlich schmaler und steiler. Der Zwergenjunge wählte die linke Seite. Hier mündete der Weg direkt in den Wald. Es gab keinen sichtbaren Pfad mehr.
Sie waren nun nicht mehr weit von der alten Burg entfernt. Digo musste nur noch ein kurzes Waldstück durchqueren und würde dann direkt auf dem Weg zum ausgemachten Versteck ankommen.
In diesem Moment hörte er hinter sich das Knacken eines Astes. Reflexartig schnellte sein Kopf herum, aber er konnte in dem dämmrigen Licht des dichten Nadelwaldes niemanden erkennen. Vorsichtig wendete Digo sein Pony und führte es in einem weiten Bogen um die Stelle herum, aus der er meinte, das Geräusch gehört zu haben. Gleichzeitig erforschte er die nähere Umgebung, um einen schnellen Fluchtweg auszumachen.
Mittelgroße Fichten standen dicht an dicht, so dass sich ihre Zweige berühren konnten. Die Schonung war vor zwanzig Jahren von seinem Vater gepflanzt worden und seither etwas in Vergessenheit geraten. Überall lagen abgebrochene Äste auf dem nadelübersäten Boden herum. Ein schneller Ritt durch diesen dichten Wald würde sowohl für ihn als auch für Dolla schmerzhaft werden.
Gerade hatte Digo eine einigermaßen passierbare Strecke durch die Bäume ausgemacht, als sich sein Pony wiehernd zur Seite drehte. Dolla hatte den schwarzen Hengst gewittert, bevor Digo ihn sehen konnte. Jetzt kam Pitu auf sie zugetrabt.
„Los, stell dich, Fuchs! Hier kommst du nicht mehr lebend raus!“ Floris winkte Digo zu, ein triumphierendes Grinsen auf den Lippen.
„Das werden wir ja sehen!“, rief Digo und drückte seinem überraschten Pony die Stiefelhacken in die Flanken. Gleichzeitig riss er die Zügel herum und hielt sie eisern auf sein neues Ziel gerichtet. Dolla machte einen kurzen Satz und stürmte dann voran. Gehorsam folgte sie den Anweisungen ihres Reiters und galoppierte in vielen Kurven durch die dichten Baumreihen.
„Oh nein!“, stöhnte Floris. „Das kann doch nicht wahr sein!“ Sie drückte Pitu ebenfalls die Schenkel in den Bauch und versuchte Dolla zu folgen. Fichtennadeln flogen in alle Richtungen davon. Zweige zerbrachen und eine krümelige Mischung aus Flechten und Holzstücken regnete von den Bäumen herab. Digo hatte sich schon einen Vorsprung verschafft, da sein kleines Pony gut zwischen den engen Bäumen durchkam, während ihr breiter Hengst noch Mühe hatte, das richtige Gleichgewicht zu finden.
Ein dicker Ast schlug Floris ins Gesicht. Sie war nur für einen kurzen Moment unaufmerksam gewesen. Das Mädchen spürte den brennenden Schmerz auf der linken Wange und presste instinktiv ihre Hand auf die Wunde. „Verdammte Fichten“, fluchte sie und biss die Zähne zusammen.
Digo hörte Pitus laute Hufschläge hinter sich. Er wagte es jedoch nicht, sich umzusehen, da er seine volle Konzentration nach vorn richten musste, um im Labyrinth der Schonung nicht in einer Sackgasse zu landen. Der Weg zur alten Festung konnte jetzt nicht mehr weit sein.
„Ich darf auf keinen Fall nach Osten zur Burg reiten“, überlegte Digo. „Wenn ich dort ankomme, sitze ich in der Falle. Ich muss nach Westen zum See und von dort durch den Wald nach Norden.“ Er wusste, dass er Floris und Pitu auf dem festen Weg niemals entkommen konnte. Im Wald jedoch zählte Wendigkeit mehr als Geschwindigkeit und darin lag die Stärke seiner alten, erfahrenen Stute.
Digo drehte das Bild, das er vom Tal im Kopf hatte wie eine Karte in verschiedene Himmelsrichtungen. Jetzt konnte er den Waldweg vor sich sehen. Rechts oder links, rechts oder links? Noch ehe Digo sich entscheiden konnte, bog Dolla nach links auf den Weg ab. Der junge Zwerg versuchte nicht, sie zurückzuziehen, sondern vertraute dem Instinkt des Ponys, das den Weg zurück zum Dorf bevorzugen würde.
Kurz hinter ihnen stürzten Pitu und Floris aus dem Wald. Digo wischte sich mit der linken Hand ein ganzes Büschel Spinnweben aus dem Gesicht, die er bei seinem Ritt durch den Wald unfreiwillig eingesammelt hatte. Bald konnte er vor sich schon die hohen Schilfbüschel der Seeböschung erkennen.
Floris streckte sich auf Pitus Rücken aus, so wie sie es schon viele Male getan hatte, um seine Geschwindigkeit zu erhöhen. Hier auf dem Weg hatte Digo keine Chance ihr zu entkommen. Floris‘ Fersen klemmten sich fest in den Flanken des Ponys. Ihr Kopf lag eng am Hals des Hengstes. Seine weiten Bewegungen wurden zum Rhythmus für ihren eigenen Körper. Pitu zog an und flog wie ein abgeschossener Pfeil in langen Sätzen nach vorn. Der Abstand zu Dolla und Digo verringerte sich zusehends. Jetzt berührte Pitus Schnauze schon fast die wehenden Schweifhaare der Stute.
Plötzlich riss Digo sein Pony nach rechts und galoppierte ins Dickicht. „Nicht schon wieder“, stöhnte Floris. In vollem Tempo war sie an der günstigen Stelle vorbeigeschossen. Digo wollte im Wald weiterfliehen. Hier standen die Bäume zwar nicht so dicht und das Gelände war wesentlich übersichtlicher, aber Floris war nicht nach weiteren Kratzern zumute. Während sie das Tempo etwas verlangsamte, suchte Floris angestrengt nach einer Möglichkeit, Digo doch noch zu fangen.
Da entdeckte sie einen kleinen Waldweg, der auch nach rechts abbog. Ohne zu zögern, lenkte sie ihr Pony auf den schmalen Pfad und erhöhte erneut das Tempo. Bald konnte sie Dolla etwa einhundert Meter weit rechts von sich rennen sehen. Digo lenkte sie geschickt durch das Unterholz, hatte aber die Jägerin auf seiner linken Seite noch nicht entdeckt. Wahrscheinlich ging er davon aus, dass Floris ihm durch den Wald folgen würde. „Wenn ich noch etwas Vorsprung bekomme, dann kann ich ihm bei der nächsten Abbiegung den Weg abschneiden“, dachte Floris und trieb Pitu weiter voran.
Plötzlich huschte kurz vor ihr ein grauer Schatten über den Weg. Pitu wieherte erschrocken auf und bremste so ruckartig ab, dass Floris den Halt verlor und in hohem Bogen von seinem Rücken flog. Sie schlug mit dem Kopf gegen einen Baumstamm und verlor das Bewusstsein.
Digo hörte das Wiehern und einen kurzen Aufschrei und zog die Zügel an. Dolla wurde langsamer und kam zum Stehen.
„Was war das denn?“, rief er erstaunt. Er schaute hinter sich. Keine Spur von Floris. Der Schrei war von links gekommen. „Los, Kleine. Da müssen wir nachschauen“, ermunterte er sein Pony und trabte los.
Kurz darauf entdeckte er Floris, die reglos auf dem Waldboden lag. „Na, wenn das jetzt nicht der neueste Trick ist. Da stellt sie einen Unfall nach, um mich heranzulocken und hat dann leichtes Spiel mich zu fangen. Aber nicht mit mir!“
Digo wollte mit seiner Stute gerade wieder wenden, da bemerkte er die dünne Schnur frischen Blutes, die an Floris Stirn herunterlief. Außerdem konnte er Pitu nirgends entdeckten. Der Hengst wich seiner Reiterin sonst nie von der Seite. Hier stimmte etwas nicht!
„Floris!“, rief Digo. Auf einmal spürte er Angst in sich aufsteigen. Hastig sprang der junge Zwerg von seinem Pony und rannte auf seine Freundin zu. Er beugte sich zu ihr hinab. Floris‘ Gesicht war kreideweiß. Digo sah, wie sich ihre Brust langsam hob und senkte. Sie lebte noch!
„Floris!“, rief Digo noch einmal eindringlich und rüttelte an ihren Schultern. Was sollte er jetzt nur machen?
In diesem Moment schlug Floris die Augen auf und blinzelte benommen.
„Was ist passiert?“, flüsterte sie und versuchte sich aufzurichten. „Au!“, stöhnend griff sie sich an den Kopf und betrachtete anschließend erschrocken ihre blutigen Finger.
„Ich weiß es nicht“, erwiderte Digo. „Ich habe plötzlich einen Schrei gehört und dann lagst du hier.“
„Wo ist Pitu?“, fragte Floris. Na, das war ja wieder typisch, dass sie sich zuerst Sorgen um ihren Hengst machte!
„Er ist bestimmt zum Dorf zurückgerannt“, versuchte Digo seine Freundin zu beruhigen.
Floris lehnte sich vorsichtig nach hinten an den Baumstamm, der ihr die Verletzung zugefügt hatte. Sie schloss für einen Moment die Augen. Digo sah ihre zitternden Finger, nahm Floris‘ Hände in seine und drückte sie fest. Als das Mädchen die Lider wieder aufschlug, hatten ihre Augen die gewohnte Stärke zurückgewonnen.
„Da war ein Wolf, Digo.“ Floris war plötzlich hellwach. Ihr Oberkörper versteifte sich. „Pitu hat sich erschrocken und ich bin etwas schneller abgestiegen als gewollt.“
Digo spürte, wie sich eine Gänsehaut über seine Arme ausbreitete. Natürlich musste man ab jetzt immer damit rechnen, im Wald einem Wolf zu begegnen. Aber was wäre gewesen, wenn er Floris nicht gleich gefunden hätte und sie längere Zeit bewusstlos hier am Baum gelegen hätte? Diesen Gedanken wollte er lieber nicht zu Ende denken.
„Wie geht es deinem Kopf?“, fragte Digo. Er sah, dass die Wunde nur noch schwach blutete. „Du musst so schnell wie möglich zu deiner Mutter, damit sie dich untersuchen kann.“ Tippa Pfefferwurz, Floris‘ Mutter, war die Heilerin des Dorfes.
Sie durften jetzt nicht mehr viel Zeit mit langen Unterhaltungen verlieren. Digo knotete das rote Fuchsband von seinem Arm ab. In seiner Hosentasche fand er noch ein sauberes Taschentuch, das er zum Schutz auf die Wunde legte. Dann wickelte er das rote Band zweimal um den Kopf seiner Patientin, so dass das Taschentuch fest abgedeckt war.
„Kannst du aufstehen?“, fragte er Floris, worauf diese nickte und sich langsam erhob. Digo stützte ihren Arm mit seiner Hand ab und führte sie zu Dolla, die während der ganzen Zeit geduldig neben ihnen gewartet hatte.
„Du sitzt besser vor mir“, sagte Digo und griff nach Floris Unterschenkel, um ihr beim Aufsteigen zu helfen. Danach schwang er sich hinter dem Zwergenmädchen auf Dollas Rücken, nahm die Zügel in die rechte Hand und legte seinen linken Arm eng um Floris‘ Bauch. Er trieb sein Pony nur zu einem gemächlichen Tempo an, um unnötige Erschütterungen zu vermeiden. So ritten die beiden schweigend in Richtung Elvalon.
Floris spürte ihren Puls als gleichmäßiges Pochen gegen die Stirn. Es war ein schmerzhaftes Pochen und sie musste die Zähne fest zusammenbeißen, um nicht ständig aufzustöhnen. Ihre Finger krallten sich in Dollas Mähne, bis sie taub wurden. Sie spürte Digos Arm um ihren Bauch. Es tat unvorstellbar gut, so festgehalten und gestützt zu werden. Was wäre, wenn Digo nicht sofort zu ihr gekommen wäre? Dann würde sie immer noch hilflos dort im Wald liegen. Selbst, wenn sie ihr Bewusstsein schnell wiederbekommen













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















