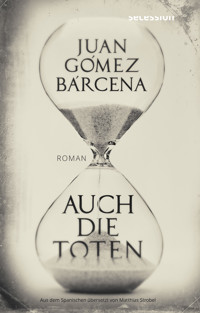17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Secession Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann kehrt zurück in seine zerstörte Heimatstadt. Unfähig an die verlorene Vergangenheit vor dem Krieg anzuschließen, hofft er, auch sein Haus möge in Trümmern liegen. Doch es steht noch, und seine Wohnung darin ist alles, was ihm geblieben ist. Familie, Erinnerung, Hoffnung – alles hat sich aufgelöst. Er schließt sich ein in sein Büro, verlässt es bald gar nicht mehr – versorgt allein von seinem Nachbarn und dessen Frau, von denen kaum zu sagen ist, ob sie seine Retter oder seine Wärter sind, zieht sich immer mehr in sich zurück, in ein zeit- und raumloses Vakuum, in dem die Außenwelt kaum mehr als ein Rauschen ist. Und doch sind ihre Bedrohungen real: der Hunger, die Scham, die Gewalt in den Straßen und immer wieder das Lager – das Lager, das der Mann überlebt hat, das Lager, das ihn beherrscht, das ihn wie ein schwarzes Loch zu verschlucken droht und in das er dennoch zurückkehren muss, um den Trümmern seiner haltlosen Identität wieder eine Ordnung zu geben. Nach seinem gefeierten Romandebüt "Der Himmel von Lima" beweist Juan Gómez Bárcena ein weiteres Mal, dass er zu den hoffnungsvollsten Stimmen der spanischsprachigen Literatur gehört: Kanada ist ein faszinierender und gewaltiger Roman, der sich nicht scheut, in die tiefsten Abgründe menschlicher Scham und Schuld vorzudringen. Bárcena findet für das Grauen so verstörende wie brillante Bilder, die man nicht mehr vergessen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
JUAN GÓMEZ BÁRCENA
KANADA
ROMAN
ÜBERSETZT VON STEVEN UHLY
Die Originalausgabe erschien 2017
unter dem Titel KANADA
bei Editorial Sexto Piso, Mexiko und Madrid.
© der Originalausgabe: Juan Gómez Bárcena
Published by special arrangement with
The Ella Sher Literary Agency,
www.ellasher.com
Erste Auflage
© 2018 by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Steven Uhly
Lektorat: Alexander Weidel
Korrektorat: Kristina Wengorz
www.secession-verlag.com
Gestaltung und Satz:
Erik Spiekermann
Herstellung:
Renate Stefan, Berlin
Druck und buchbinderische Verarbeitung:
Friedrich Pustet, Regensburg
Papier Innenteil: 100g Fly 05
Papier Vor- und Nachsatz: 115g Fly 05
Papier Überzug: f-color glatt, anthrazit
Gesetzt aus FF Casus & INSTITUT
Printed in Germany
ISBN 978-3-906910-34-5eISBN 978-3-906910-35-2
Für Lucía, die diesen Roman kennenlernte, als er bloß eine Handvoll Karteikarten war, die verstreut auf dem Boden herumlagen.
Inhalt
Kanada
»Wer sein Vaterland liebt, der ist nicht mehr als ein unbedarfter Anfänger; mehr Kraft hat bereits der, dem jeder Ort wie der eigene ist; doch nur jener erlangt das volle Maß, für den die ganze Welt ein fremdes Land ist.«
HUGO VON ST. VIKTOR
Dein Haus steht noch. Du hattest die Hoffnung, dass es eingestürzt wäre. Vielleicht ist Hoffnung nicht das angemessene Wort, doch wenn nicht, welches dann? Du hattest, so viel kannst du sagen, die Gewissheit, dass es dein Haus nicht mehr gab, und gleichzeitig die Gewissheit, dass dies überhaupt keine Rolle spielte. Du würdest einfach in die Straße einbiegen und nichts vorfinden. Ein leeres Grundstück, eine Lücke inmitten der Straße, vielleicht ein Türgitter, dessen Stäbe in den Himmel zeigen. Oder aber das Gebäude noch an Ort und Stelle, doch aufgerissen vom Sockel bis zum Dachstuhl, wie jenes Haus, das du eben erst in der Kazinczy-Straße gesehen hast, es erinnerte sehr an das leere Gehäuse eines Schalentiers oder an ein Puppenhaus. Im zweiten Stock, in einer kleinen Ecke dessen, was ein großer Saal gewesen sein musste, trank ein Mann Tee. Die Wanduhr, der Esstisch, sein Armsessel – alles nur einen oder anderthalb Meter vom Abgrund entfernt. Du sahst ihn an, versuchtest, eine menschliche Geste in der rituellen Handlung zu erkennen, die darin bestand, dass er den Teelöffel bewegte, doch der Mann blickte nur auf seine Tasse.
In diesem Moment denkst du an dein Haus, das vielleicht auch von einer Bombe ausgeweidet worden ist, das vielleicht vollständig verschwunden ist, und du fühlst dieses Etwas, das man vielleicht Hoffnung nennen kann. Aber du lässt die letzten Trümmerpyramiden hinter dir, biegst um die Ecke und begreifst, dass sich nichts geändert hat. Dieselben Schriftzüge und dasselbe Schaufenster der Bäckerei, die Hausnummer an der Tür noch immer schief, die Fenster ohne Blumenkästen, ohne Blumen, doch immer noch Fenster, immer noch mit Dingen, die sich hinter den Scheiben verstecken. Sogar die Leute, die vorbeigehen, scheinen dieselben zu sein. Man muss über deine Straße hinausschauen, um zu spüren, dass Zeit vergangen ist, um zu entdecken, was diese Zeit mit der Stadt gemacht hat. Oder aber ins Kleinste hinabsteigen, sich dem Haus nähern und die Einschüsse berühren, von denen die Wand durchsiebt ist, die abgeblätterte Farbe, die winzigen Löcher, wo eine Kugel Platz findet oder dein kleiner Finger.
Jetzt tust du es: dich nähern. Du machst am Portal halt und streichst mit den Fingern über das Schloss. Du lässt dich auf den Boden gleiten, den Rücken gegen die Tür gelehnt. Denn in deinem Leinensack bewahrst du viele Dinge auf: ein Paar Schuhe, ein Hemd und eine Hose, ein Stück Seife und eine Packung Zigaretten der Marke Belomorkanal, ein Seil, ein Feuerzeug und ein Stück Käse. Doch keinen Schlüssel. Eben erst hattest du ein Haus verloren, und es war leichter, einfach weiterzugehen. Jetzt hast du einen Schlüssel verloren, und dir bleibt nichts anderes übrig, als dich vor die Tür zu setzen und zu warten. Die Menschen, die dich umgeben, scheinen alle auf irgendetwas zu warten. Du siehst einen Jungen mit Strümpfen bis zu den Knien, der einen Käufer für seine silberne Uhr sucht. Einen jungen Mann, der auf seine Krücken gestützt raucht. Frauen, die vor dem Lebensmittelgeschäft eine Schlange bilden und wirken, als hätten der Hunger und die Resignation sie fest zusammengenäht. Du siehst die letzten Schwarzbrotlaibe, die im Schaufenster ausliegen. Du siehst den Ladenbesitzer, der sie verkauft. Du siehst, wie er die Augen hebt. Wie er deinen Blick erwidert. Du weißt, wer dieser Mann ist, und er weiß, wer du bist. Jenseits der Scheibe wohnst du seiner Geste des Erkennens bei: diese Art, plötzlich innezuhalten, obwohl er gerade einen Kunden bedient, die Augen weit zu öffnen und ein wenig den Schnäuzer zu verziehen, um dich allein mit dem Mundwinkel anzulächeln. Hinkend kommt er aus dem Geschäft, die Schürze noch umgebunden, und breitet die Arme aus, gastfreundlich oder bittend. Er murmelt deinen Namen und benutzt dazu die Winkel dieses Lächelns. Du nennst ihn nicht beim Namen. Er ist nur ein Nachbar, denkst du, und vielleicht solltest du ihn einfach so nennen: der Nachbar. Und dieser Mann, der Nachbar, sagt, er wolle dich umarmen, und schließlich tut er es.
Letzten Endes sei es ein Glück, dass er hier war, sagt der Nachbar zu dir. In anderen Teilen der Stadt sei es wie hier gewesen oder schlimmer. Manchmal sogar viel schlimmer. Wenn du wüsstest. Er könnte dir viele Geschichten erzählen, doch andererseits, was hättest du davon? Jetzt zähle nur, dass du zurück seist und dein Haus wieder dir gehöre. Das verdankest du Gott, sagt er, und ein wenig auch ihm. Denn viele Familien seien zurückgekommen, ohne zu wissen, wohin. Einige hätten ihre Häuser von den eigenen Nachbarn besetzt vorgefunden, sagt der Nachbar. Andere Unglückliche hätten die Besitzurkunden verloren, und ihre Wohnungen seien zu Zufluchtsorten für Kranke und Spitzbuben geworden. Ganz zu schweigen von den Gebäuden, die eingestürzt seien und die es nicht mehr gebe, und von jenen anderen, die es sehr wohl noch gebe, die aber jetzt dem Büro für Wohnungswesen gehörten – den größten Dieben von allen. Du hingegen müssest dir um nichts Sorgen machen. Denn er und seine Frau hätten ihr Möglichstes getan, wenig sei es nicht gewesen, wenn man die Umstände bedenke, und deshalb habest du ein Haus, in das du zurückkehren könnest, und werdest es immer haben. Ein Jammer, dass die Plünderer die Tür aufgebrochen hätten und nur noch so wenige Sachen da seien.
Der Nachbar redet weiter, während er schwerfällig die Treppe hochsteigt, zwei Stufen voraus. Er spricht völlig regungslos, es wirkt, als rezitiere er ein Buch oder trage im Brustlatz versteckt ein Grammofon. Seine Stimme erinnert an die eines Radiosprechers, als er Straßen aufzählt, die es nicht mehr gibt, und Namen von Personen, die tot sind. Unglücke, die unterstrichen oder betont werden vom Aufstampfen seines rechten Beins auf den Stufen, das wie Holz klingt und so schwer wirkt, als wäre es aus Stein. Denn auch dort, in der Stadt, seien furchtbare Dinge geschehen, sagt er, monatelang habe es keinen Tee und keinen Zucker gegeben, kein Fleisch und keine Margarine. Und während du ihn sprechen hörst, siehst du, wie schwarze Gestalten mit bleichen Gesichtern sich von den oberen Laubengängen herunterbeugen, Kinder auf Zehenspitzen und alte Frauen in Umhängen, die sich am Eisengeländer festhalten. Ihre Gesichter sind hart und ernst, wie aus dem Hintergrund einer Fotografie nach vorn geholt. Von unten hätte man den Innenhof mit dem Parkett eines heruntergekommenen Theaters verwechseln können – einem Theater, das nach gekochtem Kohl und Holzofen riecht, nach altem Taubenschlag und Einreibungen mit Essig –, zwischen Wäscheleinen stehend scheint das Publikum schweigend den Beginn der Aufführung zu erwarten.
Du machst die Geste der Hand, die zum Hut geht – aber du trägst keinen Hut –, und die unbeweglichen Gesichter auf ihren Rängen tun nichts und sagen nichts.
Dein Zuhause ist nicht dein Zuhause. Das begreifst du, als der Nachbar den Schlüssel im Schloss dreht und dir ein Zeichen macht einzutreten. Du machst vorsichtig einen Schritt über die Schwelle. Gehst durch die Diele. Durch den Flur. Schaust durch die offenen Türen zu beiden Seiten. Erinnerst dich plötzlich an die Trümmerpyramiden, die du vor wenigen Stunden erst aus dem Zug gesehen hast. An die Kinderbanden, die mit entfesselter Freude zwischen verbogenen Eisengerüsten und Schutt spielten, erfüllt von einer Begeisterung, der die Ruinen nichts anhaben konnten oder die sich vielleicht sogar den Ruinen verdankte. An die eingestürzten Gebäude, deren Fassaden manchmal noch standen, und an die Fensterreihen, die zu beiden Seiten Rechtecke aus dem Himmel schnitten.
Dein Haus ist wie eines dieser Gebäude, die es nicht mehr gibt. Es ist wahr: Die Wände sehen aus wie immer, die Decke ist dieselbe, irgendjemand hat sich in deiner Abwesenheit die Mühe gemacht, die Zimmer sauber zu halten, die auch unverändert erscheinen. Man könnte, so wie du jetzt, hindurchspazieren und glauben, es handele sich um dieselbe Wohnung, und dass du im Großen und Ganzen sehr viel Glück gehabt hast, ein Wunder. Doch du weißt, dass man sich dann im Irrtum befände. Dass die Landschaft eines Heims weder aus Wänden noch aus dem Fundament besteht, sondern aus Details, aus Gerüchen, aus einer bestimmten Anordnung der Möbel und einer Erzählung, die um diese Möbel herum gewoben ist, aus einer Fotografie, die über dem Eingang zum Salon hängt, oder einer Pendeluhr, die mit gewichtigem Ernst die Stunden zählt, und bei dir zu Hause – in dieser Wohnung – ist nichts davon übrig. Sogar das Echo deiner Schritte klingt anders. Sogar die Lichter, deren Schalter du im Vorbeigehen berührst, werfen ein anderes Licht: das unwirtliche Blinzeln nackter Glühbirnen, den zitternden Glanz im Zwielicht eines Dachbodens oder eines Weinkellers. Und in den Zimmern ist nichts, schlimmer als nichts, ein paar zusammengewürfelte und ärmliche Möbel, die du noch nie gesehen hast, eine Unmenge zusammengerollter Matratzen, leere Wandschränke, Korbstühle, Tische, die aus unmöglichen und einander widersprechenden Welten zu stammen scheinen. Gegenstände, die Geschichten stottern, die du nicht kennst und nicht hören willst. Der venezianische Schrank hat sich in drei schlecht an die Wand geschraubte Bretter verwandelt, der Schreibtisch im Salon in eine Art schiefen Nachttisch, und das Klavier ist einem Armsessel mit stark abgenutztem Filz gewichen. Als wären deine Möbel zu Kadavern geworden, die in der Verwesung andere Lebensformen hervorgebracht hätten. Niedere und irgendwie abstoßende Formen.
An den weißen Wänden schattige Stellen, die aussehen wie zugemauerte Fenster – dort, wo früher einmal Fotografien und Gemälde hingen. Du bleibst vor einem dieser nachgedunkelten Rechtecke stehen und versuchst, dich zu erinnern. Es gelingt dir nicht. Auch der Nachbar schaut auf diesen Punkt, diese Wand, wo es nichts mehr zu sehen gibt. Die Plünderer, diese verfluchten Plünderer, wiederholt er und schüttelt den Kopf. Sie hätten so viel mitgenommen. Vielleicht hätte er etwas tun müssen, um es zu verhindern, doch letztlich habe ihm der Mut gefehlt, was könne ein Einzelner schon gegen bewaffnete Männer ausrichten, gegen Wilde, die vor nichts haltmachten? Nur sich hinter der Tür verstecken und beten, dass die eigene Wohnung nicht als nächste an der Reihe ist. Monatelang sei deine Wohnung leer geblieben, und es habe ihm das Herz gebrochen, sie so zu sehen. Deshalb habe er entschieden, ein paar neue Möbel aufzutreiben, das heißt, diese alten Möbel, die du hier sehest. Nach den Bombenangriffen seien die Straßen voll davon gewesen, und deine Wohnung habe so leer, so nackt gewirkt, dass er keinen Moment gezögert habe, sie einzukleiden. Schließlich würden die Besitzer dieser Möbel sie nicht mehr benötigen, Gott möge ihm vergeben, aber du konntest jeden Moment zurückkehren, würdest es bestimmt tun. Daran habe er nie gezweifelt: dass du früher oder später zurückkehren würdest. Und du wissest gar nicht, wie glücklich es ihn mache, dass es so gekommen sei und dass er dir jetzt alle diese Dinge erzählen könne, ohne selbst die schlimmsten zu verschweigen. Denn er habe die Räuber durch den Spion gesehen, das sollest du wissen, er habe gesehen, wie sie sich die Gewehre über die Schulter hängten, um die Schränke, den Schreibtisch und sogar das Klavier wegzutragen. Er habe gehört, wie sie einander Witze erzählten, und gesehen, wie sie auf der Treppe rangierten, wie sie rauchten und ein Streichholz am goldenen Rahmen eines Gemäldes anstrichen, und als er ihre Gesichter gesehen habe, diese Gesichter, die von der Linse des Spions so entstellt worden seien, dass sie nicht einmal mehr menschlich erschienen, habe er nicht umhingekonnt, sich zu fragen, was für eine Welt eine derartige Würdelosigkeit erlaube, welche Zukunft wir unseren Kindern hinterließen.
Das sagt er dir und schaut dabei unentwegt auf das Bild, das nicht mehr dort hängt, und blickt dir kein einziges Mal in die Augen.
Dann erscheint sie. Zunächst ist sie das Geräusch einer Tür, die genau in eurem Rücken geöffnet wird. Sie ist ein ferner Geruch nach selbst gemachter Seife. Sie ist eine Gestalt, die plötzlich aus dem Bad kommt, mit nassem Haar und einem Körper, den der Dampf nur schemenhaft zeigt. Sie ist ein Mädchen, das in der Tür stehen bleibt und große Augen macht, mit einem Handtuch über dem einen Arm und Wäsche unter dem anderen. Sie ist jemand, der gerade dort gebadet hat, wo sich früher dein Badezimmer befand, mit nackten Füßen steht sie da. Einen Moment lang überkommt dich das absurde Gefühl, dass diese Frau keine Frau ist, sondern ein Bild, herausgelöst aus einem Gemälde, vielleicht sogar aus jenem, das einmal im Flur hing.
Du hörst die Stimme des Nachbarn, als dringe sie von einem weit entfernten Ort zu dir. Der Nachbar, der sie rügt, weil sie da sei und wie blöd herumstehe, da, und ein Bad benutze, das ihr nicht gehöre, da, und erneut gesagt bekomme, was ihr längst hätte klar gewesen sein müssen, was er ihr so oft gesagt habe, dass dies nicht ihre Wohnung sei, sondern die Wohnung des Mannes, der hier vor ihr stehe, dieses Mannes, der endlich zurückgekehrt sei, so, wie er es ihr angemahnt und angekündigt und versichert habe, dieser Mann, dem sie ein wenig Respekt schulde.
Das Mädchen versucht, etwas zu sagen, dann hält sie inne, senkt den Blick, drückt den Wäschehaufen ein wenig fester an sich, als wäre er ein vorgehaltener Schild, grüßt, ohne aufzublicken, und begibt sich fast im Laufschritt zur Tür.
Sie verschwindet.
Das war meine Frau, murmelt der Nachbar verdrießlich.
Du betrachtest noch immer den Boden des Flurs, und auf diesem Boden die feuchten und flüchtigen Fußspuren des Mädchens, die immer schmaler werden, je weiter sie sich entfernen. Die Füße der Gattin, denkst du.
Du müssest ihr verzeihen, fährt der Nachbar fort. Sie sei ein gutes Mädchen, im großen Ganzen. Wie er zu sagen pflege: Der Krieg habe ihm etwas Gutes und etwas Schlechtes gebracht, das Gute sei seine Frau, das Schlechte sein Hinken. Eigentlich zwei schlechte Dinge: Man dürfe die Kommunisten nicht vergessen. Doch dir stehe gewiss nicht der Sinn nach Politik, erst recht nicht nach allem, was du durchgemacht habest. Sie sei, wie gesagt, ein gutes Mädchen, aber sie lasse sich noch immer solche Dummheiten zuschulden kommen, wer weiß, vielleicht ihrer Jugend wegen. Du mögest es nicht als Respektlosigkeit auffassen, es sei nur so, dass es in ihrer Wohnung keine Badewanne gebe und sie, selbstverständlich ohne jede Bosheit, von Zeit zu Zeit deine benutzt habe. Er hoffe, dies sei kein Problem für dich. Die Arme sei in einem Bergdorf aufgewachsen, wo die Leute heißes Wasser nur zum Kochen der Kartoffeln benutzten, sofern es welche gebe, und deshalb sei sie von der Vorstellung besessen, jede Woche ein Bad zu nehmen. Auf jeden Fall könnest du beruhigt sein: Jetzt, da du zurück seist, werde sie dich nicht mehr belästigen.
Du sagst nichts, betrachtest weiterhin die Halbmonde ihrer Fußabdrücke, die immer schmaler werden, bis sie verschwinden.
Bevor er geht, nimmt der Nachbar dir das Versprechen ab, dass ihr heute Abend gemeinsam esst. Es gebe viel zu feiern. Die Gattin werde ein Huhn für dich rupfen und einen guten Wein öffnen, und ihr werdet alle zusammen auf einen Neubeginn anstoßen.
Du spürst die Versuchung, ihm zu entgegnen, dass nichts neu beginnen könne, dass, wenn du eines gelernt habest, es dies sei: dass nichts je ende. Du öffnest den Mund und schließt ihn wieder. Du willst nur allein sein. Und obwohl der Nachbar ohne Unterlass redet und redet, während er sich durch den Flur entfernt, obwohl er sich noch mehrere Male umdreht, um dir Erklärungen zu geben, die du ignorierst, gelingt es dir schließlich.
Du bist allein.
Du gehst durch eine Wohnung, die dir nicht gehört. Sie ist auf dieselbe Weise dein Eigentum, wie der Leichnam eines geliebten Menschen es wäre: Er gehört niemandem sonst, doch er ist auch nicht wirklich dein, du willst ihn so schnell wie möglich mit Erde bedecken und nur die Erinnerungen an ihn behalten. Oder gar nichts behalten – eine leere Stelle. Doch deine tote Wohnung kannst du nicht beerdigen. Du kannst höchstens, ohne anzuhalten, durch diese Räume streifen, die wie die Zimmer einer Pension oder eines Hotels aussehen. Im Vorübergehen mit der Hand über die Wand und die Fensterscheiben streichen, deren Kühle du doch wiedererkennst. Dieselben Fenster, dieselben Türen, dieselben Schalter. Im Bad findest du einen winzigen Trost: Das Waschbecken, die Kacheln an den Wänden, der Spiegel, die Bleirohre, die Wanne – es ist alles unverändert. Ob sie auch die Wanne mitgenommen hätten, wenn sie nicht so schwer wäre? Du lässt die Finger über die weiße Oberfläche der Keramik gleiten auf der Suche nach der Wärme, die der Körper der Gattin nicht zurückgelassen hat.
In diesem Augenblick fällt dir dein Büro ein. Die einzige Tür, die während der gesamten Zeit verschlossen geblieben ist. Nach kurzem Zögern öffnest du sie natürlich. Das Sonnenlicht, das durch das Fenster hereinfällt, blendet dich. Ein gebündeltes Leuchten, durchzogen von dichten Staubbahnen. Dann schaust du dich um und entdeckst, was von deinem Leben übrig geblieben ist: eine Reihe unbestimmbarer Gegenstände, die von weißen Bettlaken bedeckt sind, das zerlegte Eisengestell eines Bettes, deines Bettes, den schwarzen Zimmerofen, eine Menge Bücher mit herausgerissenen Seiten, die auf dem Boden verteilt sind. Einen Haufen Briketts. Einen zusammengerollten Teppich. Am Fenster und noch immer auf dem Dreifuß montiert: dein Teleskop. Du kneifst ein Auge zu, um durch die Linse zu schauen: nur ein diffuses Bild, eine Art grünlicher Nebel, der nichts erkennen lässt. Das Teleskop scheint kaputt zu sein. Du lächelst. Genau das müssen die Plünderer gedacht haben. Und deshalb ließen sie es da, gemeinsam mit all diesen anderen Resten, die sie nicht mitnehmen konnten oder wollten, weil sie nichts wert waren. Wozu benötigt man mitten im Krieg ein Teleskop? Wer würde auch nur einen einzigen Pengő bezahlen, um das Leben vergrößert, verstörend nah zu sehen, wenn alle es so weit wie möglich von sich wegschieben und dorthin fliehen wollen, wo die Wirklichkeit ihnen nichts anhaben kann?
Du stöberst weiter, ziehst die Laken ab, wirbelst Staubwolken in die stickige Luft. Ein zerfranster Lampenschirm, ein verbeulter Waschzuber. Eine durch die Feuchtigkeit grau gewordene Matratze, deren Stoff von oben bis unten zerrissen ist. Durch die offene Naht ergießen sich Daunenfedern, die am Leder deiner Schuhe hängen bleiben, die geringste Bewegung lässt sie durch die Luft tanzen, und es dauert lange, bis sie sich wieder beruhigen. Jemand hat eine Ecke des Büros mit Heu gepolstert, als hätte er ein Bett oder eine Krippe improvisiert. Du stellst dir ein Pferd vor, das auf dem Fußboden liegt. Ein Pferd, das mit weit geöffneten Augen kaut und sich anschließend auf den Balkon begibt, um von hier oben vergeblich bis ans andere Ende des Corvin-Platzes zu schauen. Ein widerspenstiges Pferd, das jemand aus irgendeinem Grund über die Hintertreppe nach oben bugsiert hat. Es ist zwar abwegig, doch nicht allzu sehr. Es gibt andere Dinge, die schwerer zu verstehen sind. Zum Beispiel, wer sich die Mühe gemacht hat, alle Bücher der Bibliothek eines nach dem anderen zu zerlegen, wer weiß, was er zwischen den Quartbögen und unter den Buchrücken gesucht hat. Doch es gibt keine Spuren von Hufeisen auf dem Boden, nur von Herren- und Damenschuhen. Sogar den Abdruck eines nackten Fußes, dessen fünf Zehen sich deutlich im Staub abzeichnen. Eine ganze Armee von Fußabdrücken, die sich in einer schwindelerregenden Choreografie gegenseitig verfolgen und wieder voneinander entfernen. Nur sie können die Berge von Wäsche, die Möbel, Tische, Lampen, Stühle mitgenommen und stattdessen diesen Heuhaufen dagelassen haben. Du widerstehst der Versuchung, ein Inventar der verlorenen Gemälde zu erstellen, der Kristallgläser, aus denen du nie wieder trinken wirst, der Teppichläufer, die du nie wieder betreten wirst. Dein Grammofon suchst du erst gar nicht. Du willst nicht wissen, wo die Bilder aus dem Salon oder die Ottomane aus dem Schlafzimmer hingekommen sind. Und du willst auch nicht wissen, warum der Nachbar in Trümmern gewühlt hat, um diese Möbel, die du nicht haben willst, hier zu versammeln. Das Einzige, was dich nicht loslässt, ist der Heuhaufen, sein Geruch nach verschlossenem Dachboden und getrockneten Exkrementen. Das Geheimnis seiner Herkunft – dieses Stück Land, das wie durch ein Wunder in dieser Stadt aus Eisen und Beton, aus Ziegel und Stein erblüht.
Es wird Nacht. Mit der Dunkelheit kommen Hunger und Kälte. Du rührst dich nicht. Du machst kein Licht. Du verharrst in diesem Moment, der dich nirgends hinbringen wird. Du heizt den Zimmerofen an. Wirfst das Heu hinein, setzt dich davor, die Handflächen zum Feuer, und beobachtest, wie es verbrennt. Du denkst an deinen Leinensack, der vergessen in irgendeiner Ecke der Wohnung liegt, du denkst an das Käsestück darin, das du jetzt nicht suchen wirst. Du hörst den Regen, der erneut gegen die Fenster klatscht. Denkst an Kanada, willst nicht daran denken, tust es trotzdem, und dann schließt du die Augen und siehst dich selbst: ein Gegenstand unter anderen in diesem Büro, nicht wichtiger als der Heizofen oder die ausgeweidete Matratze, die Bücher ohne Einbände oder das Teleskop, das die Straße im Visier hat.
Es läutet an der Tür, erst einmal, dann erneut, dann ein weiteres Mal, schließlich hörst du Schläge gegen die Tür, sie klingen wie ein schwerer, harter Regen, doch du sitzt immer noch mit geschlossenen Augen da, hältst dir die Ohren zu, immer fester, und wartest, bis der Lärm aufhört und das Feuer erlischt.
Wieder das Läuten. Wieder dieselbe Stimme, die mehrmals einen Namen ruft. Auch diesmal bleibst du sitzen. Öffnest nicht einmal die Augen. Hinter den geschlossenen Lidern stellst du dir sämtliche Bewegungen vor, denen du dich verweigerst: dich von der Strohmatratze erheben, fragen, wer da sei, zur Tür gehen. Bis zum Türknauf kommst du nicht. Du erstarrst dort, wo der Flur in die Diele mündet. Nicht einmal im Geist bist du in der Lage, diese Grenze zu überqueren. Und als du die Augen öffnest, stellst du fest, dass es gar nicht mehr nötig ist, denn vor dir steht der Nachbar mit strengem Gesichtsausdruck und dem Schlüssel in der Hand.
Er habe sich große Sorgen gemacht, sagt er. Sie beide, um die Wahrheit zu sagen. Auch seine Frau, die Gattin, die den ganzen Nachmittag damit verbracht habe, das Gulasch und das Hühnerfrikassee zu kochen, das du nicht einmal probiert habest. Zwei Tage, so lange hätten sie an deine Tür geklopft, bis sie schließlich entschieden hätten, den Schlüssel zu benutzen. All das sagt er dir mit einer professoralen, geduldigen Stimme, als wüsstest du es nicht, und man müsste es dir erklären. Weißt du es denn? Was spielt das für eine Rolle. Du willst, dass dieser Lärm aufhört. Mit einem Mal erinnerst du dich an den Traum, aus dem er dich gerissen hat: einen Traum, der durchzogen war von Aromen und Geschmäckern, Roastbeef-Scheiben, weißen Tischdecken, köstlichen Weinen und Brotlaiben, die an der Tafel im Esszimmer dargereicht wurden. Im Traum waren die Möbel deiner Wohnung wieder so wie immer. Und jetzt willst du nur, dass der Nachbar geht, damit du in den Salon zurückkehren und dich erneut an den Tisch setzen kannst, um von den Speisen auf diesen Tellern zu kosten, die es nicht mehr gibt. Aber der Nachbar geht nicht. Oder doch, er geht, doch zuvor schaut er dich schweigend an, als versuche er, etwas zu verstehen, und vielleicht versteht er es nicht. Dennoch verschwindet er und taucht fast unmittelbar danach gemeinsam mit der Gattin auf, die ein Tablett mit einer dampfenden Schale, einem Teller und einem Glas trägt.
Iss, sagt der Nachbar und reicht dir die Schale, während er dir in die Augen schaut. Die Gattin sagt nichts, heftet den Blick auf ihre Schuhspitzen und wartet, die Hände vor dem Bauchnabel gefaltet.
Du gehorchst. Ohne dich von der Matratze zu erheben, beginnst du zu trinken, zunächst in langsamen Zügen und dann immer schneller. Die Wirklichkeit scheint sich genauso aufzulösen wie die Landschaft deines Traums: Plötzlich gibt es nur noch dich und die Schale, die du bis zum letzten Tropfen austrinkst, bevor du dich dem Teller zuwendest und auch ihn leerst.
Als du aufblickst, ist die Gattin bereits gegangen, doch der Nachbar steht noch immer auf der Schwelle. Mit weicher Stimme versichert er dir, er verstehe, was du durchgemacht habest. Der Krieg sei für alle schrecklich gewesen, und alle hätten Dinge erlebt, die sie lieber vergessen würden. Das sagt er dir. Er selbst habe Furchtbares gesehen, und er habe Dinge getan, die er bereue. Obgleich »bereuen« genau betrachtet ein zu starkes Wort sei, verbessert er sich. Ja, gewiss, er habe manches getan, was man anders und sogar etwas besser hätte tun können, doch was könne man schon von einer Zeit erwarten, die bei allen das Schlechteste nach außen gekehrt habe. Jetzt müsse man nach vorn schauen, sagt er, und währenddessen zeigt er auf den Flur und durch den Flur auf die Haustür, die zur Straße führt. Sie seien bereit, dir zu helfen. Er wolle nur, dass du weißt, dass du, bis du wieder auf die Beine kommst, stets einen Teller Suppe und ein Glas Wein haben werdest, denn auch sie seien bereit, zu vergessen, neu zu beginnen. Als wäre nichts geschehen, was in gewisser Weise der Wahrheit entspreche, denn der Herr gebe uns immer eine Chance, und dies sei deine.
Danke, mehr sagst du nicht, als du ihm die leere Schale zurückgibst. Der Nachbar zögert einen Augenblick, bevor er sie entgegennimmt, als wisse er weder, was er mit der Schale anfangen soll, noch, mit deinem Dank.
Du wirst auf die Straße gehen, wenn alles geordnet ist. Das sagst du dir. Doch es ist so schwierig, eine Ordnung zu finden. Da, wo nichts als Chaos ist, einen Sinn zu entdecken. Die Bücher zum Beispiel. Überall verstreut liegen sie herum, zerfleddert und mit kaputten Bindungen. Du müsstest sie nach Themen, nach Autoren, nach Sachgebieten, nach Ländern ordnen, doch dafür wäre es notwendig, sie zu öffnen oder wenigstens ihre Titel oder die Inhaltsverzeichnisse zu lesen, und du fühlst dich nicht in der Lage zu dieser Anstrengung.
Wenn man gründlich darüber nachdenkt, dann ist das Wunder des Lesens sehr erstaunlich. Man betrachtet ein Muster, das aussieht wie Putz, der von einer Wand abblättert, oder wie eine Ameisenstraße, und in einem einzigen Moment der Klarheit erkennt man eine Bedeutung, einen Gedanken. Man verknüpft Zeichen zu einer Kette und bildet damit einen Sinn, der unterhält oder langweilt, der uns bewegen oder unglücklich machen kann. Seit du nach Hause zurückgekehrt bist, hat sich dieses Wunder nicht mehr ereignet. Die Worte, die an dein Ohr dringen, haben ihren Wert verloren, sie sind keine Worte mehr, sondern abwegige Schnörkel, fremde Klänge, die du ratlos wiederholst, ohne ihnen eine Bedeutung zuordnen zu können. Das ist alles, was du hast: willkürliches Gekritzel, das dich durchquert, ohne einen einzigen Gedanken zu säen.
Nur die Hygiene beschäftigt dich. Um bewohnbar zu sein, muss eine Wohnung sauber sein. Die Frau aus dem zweiten Stock fällt dir ein, jeden Tag kniet sie mit dem Feger in der Hand wie niedergeworfen vor dem Boden ihrer Wohnung, als betete sie. Du betest nicht, denkst an nichts. Dich sorgt allein die Hygiene. Wenn alles sauber ist, wirst du endlich auf die Straße gehen. Das sagst du dir. Es ist das Einzige, woran du denkst, während du den Boden des Büros putzt und jede seiner Dielen einzeln scheuerst. Wenn alles sauber ist, gehst du auf die Straße.