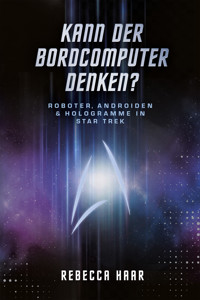
Kann der Bordcomputer denken? Roboter, Androiden & Hologramme in Star Trek E-Book
Dr. Rebecca Haar
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Roboter, Androiden und künstliche Intelligenzen – ohne sie wären die Reisen in die fernen Galaxien des Star Trek-Universums kaum vorstellbar. Als außerirdische Großrechner, fremde Sonden und Hologramme begegnen sie uns in unzähligen Varianten und spielen eine zentrale Rolle in den Abenteuern von Kirk, Picard und Co. Sie sind – wie der Android Data – unersetzbare Helfer, können aber auch – wie die Hyper-KI Control – zur großen Gefahr werden. Rebecca Haar, Expertin in der Betrachtung der Grenzen zwischen (Pop)Kultur und Technologie, betritt die ferne Galaxie des Transhumanismus bei Star Trek. Anhand ausgewählter Filme und Episoden beleuchtet sie das Leben, die Kunst und die kuriosen künstlichen Lebewesen, die uns zu Fragen über unsere Realität und das Menschsein an sich inspirieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
It’s so very lonely,you’re a hundred light years from home.
The Rolling Stones*
*Album: Their Satanic Majesties Request, Seite B, Lied 4: 2000 Light Years from Home. Großbritannien 1967.
INHALT
Vorwort
Das Labor der Zukunft
Computer und Maschinenwesen
Androiden
Holodecks und Hologramme
Missionsbericht
Endnoten
VORWORT
»Ich habe mich nie richtig fürScience-Fiction interessiert.Irgendwie finde ich keinen Bezug dazu.«
Jean-Luc Picard1
Anders als Jean-Luc Picard war ich schon immer fasziniert von Science-Fiction. Aber im Gegensatz zu ihm, dem Captain eines Raumschiffs im 24. Jahrhundert, lebe ich auch nicht in einer Zeit, die den Weltraum weit über das eigene Sonnensystem hinaus bereist und erforscht hat. Was für Picard Alltag ist, bedeutet für mich das Nachdenken darüber, wie mögliche Zukünfte gestaltet werden können: Wie entwickeln sich Technologie und Technik? Wofür werden sie im Alltag eingesetzt? Und welche Rolle spielt dabei künstliche Intelligenz? Technikdarstellungen in der Science-Fiction reflektieren immer, wo eine Gesellschaft steht, und bieten ein Gedankenspiel über die künftige Menschheit und deren Möglichkeiten. Star Trek ist in dieser Hinsicht besonders interessant, denn der Serienkosmos beschäftigt sich in inzwischen über 55 Jahren Seriengeschichte immer wieder damit, was neue Technologien ermöglichen können. Mich interessieren dabei besonders künstliche Intelligenzen verschiedenster Art, die in diesem Buch eine große Rolle spielen werden.
Wer hätte 1966 gedacht, dass Star Trek so langlebig sein und bis heute eine Vielzahl an weiteren Serien und Filmen hervorbringen würde und noch immer bringt? Die Neugier endet nicht im Entdecken neuer Welten, es ist auch eine Reise in das innere Selbst. Star Trek blickt in den menschlichen Kern, betrachtet, wie sich Gesellschaften verändern und welche (technischen) Entwicklungen unsere kulturelle, ethische und künstlerische Wahrnehmung bestimmen. Star Trek zeigt eine Welt, die viele Probleme unserer Gegenwart längst hinter sich gelassen zu haben scheint, um dann doch wieder auf gänzlich unerwartete Schwierigkeiten zu stoßen, die einen Bezug auf unser Jetzt ermöglichen. Science-Fiction ist ohne Gegenwart nicht denkbar und lässt sich von den Grenzen der Realität nicht einschränken, sondern entfaltet sich frei. Sie dient als Spiegel realer Entwicklungen und kommentiert aus der Ferne das, was sie längst zurückgelassen zu haben scheint. Erst das ermöglicht uns den Blick ins Unbekannte: eine Retrospektive des bereits Bekannten.
Rebecca Haar
April 2024
DAS LABOR DER ZUKUNFT
»Wir sind so weit geflogen, Captain, da wäre es doch unverantwortlich, etwas Unbekanntes nicht zu erforschen.«
Michael Burnham2
Sternzeit 1207,3: Als die Shenzhou eine ungewöhnliche Verzerrung im Raum entdeckt, spricht sich Commander Michael Burnham sofort dafür aus, der Ursache dieser Anomalie auf den Grund zu gehen. Das Unbekannte fasziniert sie und so überzeugt sie Captain Philippa Georgiou, eine Außenmission starten zu dürfen. Diese endet zwar in der Star Trek: Discovery-Episode »Das Leuchtfeuer« nicht wie geplant mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, greift in dieser Szene aber dennoch einen Gedanken auf, der für Star Trek seit Anbeginn zentral ist: Der sense of wonder, die Neugierde auf das Unbekannte, die Faszination am Neuentdeckten. Dieser insbesondere in der Originalserie von 1966, Star Trek: Raumschiff Enterprise, manchmal fast schon charmant naive Blick auf mögliche Zukünfte macht dieses Serienuniversum zeitlos und gleichzeitig zum spannenden Zeitgeistphänomen.
Nicht nur Star Trek, sondern die Science-Fiction generell blickt auf eine vielseitige Entwicklungsgeschichte zurück. Das Interesse an der Science-Fiction wuchs durch die zunehmende Präsenz der Raumfahrt und schließlich die Mondlandung im Jahr 1969. Der reale Weltraum war plötzlich zum Greifen nah. Nichts schien mehr unmöglich, wenn erst das eigene Sonnensystem erkundet wäre. Der Beginn von Star Trek als Serienuniversum fällt genau in diese Euphorie und nimmt diese positive Aufbruchsstimmung ad astra auf. Sowohl in der Science-Fiction als auch in der wirklichen Welt ist die Zukunft ohne Digitalisierung kaum denkbar und so beschreibt auch Star Trek von Beginn an, wie der Einsatz von Computern und komplexen Programmen den Alltag verändert, wie Aufgaben delegiert werden, neue Berufe entstehen und andere verschwinden.
Star Trek verweist neben der Faszination für das Unbekannte und dem Forschungsgeist von Anfang an auf zwei Perspektiven, die immer wieder zusammengeführt werden. Zum einen Vorstellungen davon, wie Technologien den Alltag bereichern können – was sich speziell an Computern immer wieder zeigt. Zum anderen greift die Originalserie als Kind ihrer Zeit auch die in den 1960ern verbreiteten Hoffnungen und Ängste auf, was solche technischen Entwicklungen angeht – insbesondere dann, wenn es um Roboter, Androiden und künstliche Intelligenzen geht.3 Unter der Ägide von Captain James T. Kirk gibt es mehrere Episoden, die mögliche Konsequenzen wissenschaftlichen Fortschritts durchaus kritisch betrachten. Technisches Versagen kommt dabei mehrmals vor, aber auch die zufällige Entstehung künstlicher Intelligenzen sowie neue experimentelle Technologien, die erst noch erforscht werden müssen, um sie sinnvoll einsetzen zu können. Darüber spannt sich die Frage, ob diese Technologien Bedrohung oder Heilsbringer sind, die zwischen Fortschrittsglauben und Zukunftsangst changieren: Was passiert mit der Eigenständigkeit des Menschen, wenn die künstlichen Intelligenzen übernehmen?
Für Gene Roddenberry, den Erfinder von Star Trek, ist das titelgebende Raumschiff Enterprise ein Symbol für die unzähligen Versprechungen, die Technologien uns eröffnen – und beschreibt seine Vision von Star Trek als eine Serie, in der die Technik nicht zum Selbstzweck wird, sondern Menschen dabei helfen soll, ihre Träume zu verwirklichen.4 Und genau dieses Nachdenken über mögliche gesellschaftlich-technologische Entwicklungen macht Star Trek als Serie und Filmreihe bis heute so kreativ und einflussreich: Es wird immer wieder mit dem Was-wäre-wenn?-Element gespielt und dennoch eine in sich geschlossene Welt präsentiert, die als eigenständiges Universum fungiert. So vielseitig diese darin begründeten Erzählungen sind, so verschieden ist auch der Umgang mit Computertechnologien und künstlichen Intelligenzen aller Art, der sich natürlich immer wieder verändert, Rückbezüge auf Forschung und Popkultur zulässt und so letztlich selbst zur Popkultur wird.
WAS IST STAR TREK?
Star Trek setzt sich seit Serienbeginn sowohl mit gesellschaftlichen als auch technischen Entwicklungen auseinander. Die viel zitierte Idee dahinter, auf die sich auch Gene Roddenberry immer wieder berufen hat, ist ein Westerntreck im Weltraum, der statt mit dem Planwagen mit einem Raumschiff neue Welten erkundet.5 Doch dieser Pioniergeist enthält viel mehr. Er bildet den Rahmen für die Geschichte der Entdeckung des Weltraums und verbindet Motive von Westernserien und -filmen mit Strukturen der (historischen) Seefahrt und den Hornblower-Romanen von C. S. Forester.6 Denn die großen Entdeckungsfahrten zwischen 1450 und 1650 und die Seefahrt bis Mitte der 19. Jahrhunderts sind sicherlich ebenso Vorbild für Star Trek – mit dem Unterschied, dass nun nicht mehr die Weltmeere umsegelt werden, sondern der Weltraum erkundet wird. Dies wird auf den verschiedensten Ebenen aufgegriffen: vom Raumschiff über Außenstationen, die das Unbekannte erforschen, bis zur Entstehung verschiedenster Regelwerke wie der Obersten Direktive, die den Umgang mit fremden Zivilisationen beschreibt und deren Regeln trotzdem oft missachtet werden. Der Weltraum wird als ebenso faszinierender wie spannender Horizont inszeniert, der voller Gefahren, aber auch voller neuer Erkenntnisse ist.
Unter Captain Kirk sind dies in der Originalserie Star Trek: Raumschiff Enterprise (1966–1969) oftmals Expeditionen ins Unbekannte und das Entdecken fremder Zivilisationen, nicht selten in Verbindung mit dem Zusammenbruch einer bereits vorgefundenen oder selbst entwickelten Infrastruktur. Schon früh gibt es hier raumfüllende Supercomputer und außerirdische Sonden. Ebenso werden Androiden beschrieben, die als künstliche Doppelgänger menschliches Leben unendlich verlängern können sollen und als Kollektiv, das eine neue Aufgabe sucht, auftreten oder schlicht ewige Gefährtin eines unsterblichen Wesens sein sollen. Im Gegensatz hierzu tauchen bei Star Trek: Das nächste Jahrhundert (1987–1994) verstärkt künstliche Intelligenzen und virtuelle Räume wie das Holodeck auf.7 1987, als die erste Episode von Star Trek: Das nächste Jahrhundert im Fernsehen läuft, liegt die reale Mondlandung fast zwanzig Jahre zurück. Jean-Luc Picard betritt nun als Captain die Brücke der neuen Enterprise. Mit Data gehört außerdem ein Android zur Crew. Auch der Erzählton verändert sich: Der alltägliche Umgang mit neuen Technologien steht im Vordergrund und wird deutlich positiver beschrieben als unter Kirk.
Ganz anders wirkt Star Trek: Deep Space Nine (1993–1999). Hier ist Technologie oftmals nur Beiwerk. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der gleichnamigen Raumstation an der Grenze zum Beta-Quadranten, die Captain Benjamin Sisko befehligt, Konflikten um das Wurmloch in den Gamma-Quadranten und gelegentlichen Besuchen in den Holosuiten. Star Trek: Raumschiff Voyager (1995–2001) hingegen greift wieder auf den Entdeckergeist der frühen Tage zurück. Das titelgebende Raumschiff strandet über 70.000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Delta-Quadranten. Unter dem Kommando von Captain Kathryn Janeway hat die Crew eine lange Heimreise vor sich. Da der Schiffsarzt diese Reise nicht überlebt hat, übernimmt seine Rolle fortan der namenlose Doktor, ein Medizinisch-Holografisches Notfallprogramm, das nach und nach immer mehr Eigenleben entwickelt. Natürlich kommt es fernab der Heimat an Bord der Voyager immer wieder zu technischen Problemen, was die Beschaffung von Ersatzteilen zu einem kreativen Prozess macht. Begegnungen mit fremden Technologien und den Borg bieten viel Stoff für Geschichten.
Mit Star Trek: Enterprise (2001–2005) springt die Handlung zum ersten Mal zurück in die Vergangenheit und damit vom 24. direkt ins 22. Jahrhundert. In der Zeit vor Kirk erforscht Captain Jonathan Archer mit seiner Crew den Weltraum. Die Oberste Direktive wird entwickelt, die Erstkontaktsituationen mit fremden Spezies bestimmt. Im Vordergrund stehen weniger technische Errungenschaften als die Frage danach, wie weit sich die Ideale der sich zu diesem Zeitpunkt in der Entstehung befindlichen Vereinigten Föderation der Planeten, zu der die Sternenflotte gehört, durchsetzen lassen.8 Auch hier taucht viel vom ursprünglichen sense of wonder auf, wenn auch deutlich weniger romantisiert als in der Ursprungsserie. Nach der Einstellung von Star Trek: Enterprise war lange Zeit unklar, wie es mit dem Serienuniversum weitergehen würde. Über 15 Jahre hat es gedauert, bis die nächste Serie am Horizont aufgetaucht ist: Star Trek: Discovery (2017–2024). Die ersten beiden Staffeln spielen etwa zu Zeiten Captain Kirks, ehe die Serie mit Beginn der dritten Staffel über 900 Jahre in die Zukunft springt und damit eine Phase einläutet, die für das Fortbestehen der Föderation vermutlich die schwierigste sein dürfte. Technikdarstellungen sind hier einerseits Beiwerk, andererseits zentrale Aspekte, was sich an der Darstellung starker künstlicher Intelligenzen wie Control und Zora zeigt. In derselben Zeit wie der Anfang von Star Trek: Discovery ist auch Star Trek: Strange New Worlds (seit 2022) anzusiedeln. Zu diesem Zeitpunkt ist noch Christopher Pike, der als Figur bereits in der Originalserie und in Star Trek: Discovery aufgetaucht ist, Captain der Enterprise. Der Entdeckergeist steht wieder im Vordergrund, Technologien werden fasziniert beobachtet, künstliche Intelligenzen tauchen bislang jedoch nicht auf.
Ein völlig neues Technikverständnis offenbart schließlich Star Trek: Picard (2020–2023). Die Serie greift auf Ideen aus Star Trek: Das nächste Jahrhundert zurück und erweitert sie. Mit einem gealterten Jean-Luc Picard wird hier die Frage nach dem Wert künstlicher Existenzformen gestellt, indem hier nicht mehr zwischen Mensch und Maschine unterschieden wird, sondern zwischen organischem und künstlichem Leben. Sämtliche dieser Serien ab Star Trek: Discovery werden durch sogenannte Short Treks (2018–2020) erweitert. Die einzelnen Episoden sind Verbindungselemente zwischen den neueren Serien und zwischen verschiedenen Staffeln und Episoden, die manchen Erzählungen eine tiefere Bedeutung geben, funktionieren teilweise aber auch als kurze Episoden für sich allein.
Neben den Realserien existieren inzwischen auch vier Animationsserien. Die erste davon, Star Trek: Die Enterprise (1973–1974), entstand bereits in den 1970er-Jahren und setzt die Originalserie fort. Dort findet sich beispielsweise die erste Erwähnung eines Holodecks. Star Trek: Lower Decks (seit 2021) ist als Serie innerhalb des Star Trek-Kosmos sicherlich ein Sonderfall. Satire und Humor sind hier zentrale Elemente der Handlung, was einen kreativen Umgang mit der Serienhistorie erlaubt. Star Trek: Prodigy (ebenfalls seit 2021) wiederum richtet sich an ein jüngeres Publikum und blickt in das späte 24. Jahrhundert, in dem die verschollene Protostar auf einem fernen Planeten von Dal R’El entdeckt wird, der dort neben der künstlichen Lebensform Drednok unter anderem auch auf ein Trainingshologramm stößt, das Captain Janeway von der Voyager nachempfunden ist. Die Very Short Treks (2023) sind nur lose im Star Trek-Universum angesiedelt und richten ihren Fokus nicht auf die kanonische Fortführung der Serien, sondern auf episodischen, eher abseitigen Humor.
Erweitert wird das Serienuniversum durch inzwischen dreizehn Kinofilme: Star Trek: Der Film findet 1979 seinen Weg auf die große Leinwand.9 Auf diesen folgen fünf weitere, ehe in Star Trek: Treffen der Generation (1994) Kirk den Staffelstab an Picard übergibt. Dieser erlebt drei Kinoabenteuer mit seiner Crew, in der auch Data wieder eine tragende Rolle spielt. 2009 startet mit Star Trek, Star Trek Into Darkness (2013) und Star Trek Beyond (2016) eine weitere, bislang dreiteilige Filmreihe, die sich mit einer alternativen Zeitlinie auseinandersetzt. Trotz des bekannten Figureninventars um Kirk, Spock und Co. erzählt sie Bekanntes in veränderter Form, um es letztlich als Kelvin-Zeitlinie wieder mit dem bekannten Universum zu verbinden.
All diese Serien und Filme zeigen unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft – je nachdem, in welchem Produktionszeitraum sie liegen und welche Themen in Forschung und Popkultur den Zeitgeist bestimmten. Auch die Erzählstrukturen verändern sich im Lauf der Zeit von in sich abgeschlossenen Einzelepisoden hin zu staffelübergreifenden Handlungsbögen und offeneren Konzepten und Ideen. Mal werden Maschinen und künstliche Intelligenzen bedrohlich dargestellt, ein anderes Mal eher neutral, dann gar als Freund oder ambivalente Figur, die es erst kennenzulernen gilt. Technik und Technologie sind zum ständigen Begleiter geworden. Star Trek verweist beständig auf diesen sich verändernden Umgang und dient als kreative Erweiterung der Realität. Auch und gerade weil inzwischen über 55 Jahre zwischen der ersten Episode und den aktuellen Serien liegen, gilt weiterhin: Dies sind die Abenteuer …
COMPUTER UND MASCHINENWESEN
»Hallo, Computer?«
Montgomery Scott10
Zeitreisen in die Vergangenheit haben ihre Tücken, wie Scotty in Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart feststellt. Um die Zukunft zu retten, will er Dr. Nichols von Plexicorp die Formel für transparentes Aluminium geben, scheitert aber daran, sie in dessen Computer einzugeben. Auf Spracherkennung reagiert das Gerät nicht, Leonard McCoy, der Scotty begleitet, reicht ihm die Maus. Auch sie reagiert nicht auf Spracherkennung. Erst als Nichols auf die Tastatur verweist, wird Scotty klar, wie er den Computer bedienen muss – und dass in den 1980er-Jahren die Computertechnologie noch längst nicht so weit fortgeschritten ist wie im 23. Jahrhundert. Tastaturen sieht man in Star Trek höchstens als fast schon nostalgisch verklärte Reminiszenz, wie in »Vom Ende der Zukunft« in Star Trek: Raumschiff Voyager, als Captain Janeway ebenfalls mit dieser Eingabemethode kämpft. Inzwischen hat die Wirklichkeit die Serienrealität längst überholt und Computer sind in ihren verschiedenen Formen – Smartphone, Tablet oder PC – fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Sie reagieren auf Spracheingaben, haben Touchscreens und benötigen nicht mehr unbedingt weitere Eingabehilfen. Doch als Computer in der Wirklichkeit noch textbasiert gesteuert wurden, wurde bei Star Trek bereits ein Sprachsystem entwickelt, das in etwa dem entspricht, was heutzutage mit Sprachassistenzsystemen wie Siri, Alexa oder Cortana im Alltag fest verankert ist. Auf diese Weise hat künstliche Intelligenz schleichend längst Einzug in unser Leben gehalten.
In Star Trek sind Computer früh allgegenwärtig. Sogar schon zu einem Zeitpunkt, als die wirkliche Welt noch größtenteils analog abläuft: In den realen 1960er-Jahren sind Computer noch neuartig, fremd und oftmals raumfüllend. Sie werden kritisch betrachtet und hinterfragt, denn trotz der großen Bedeutung von Computern für die Raumfahrt und als vielseitig einsetzbare Maschinen für die jeweiligen Raumschiffe spielen sie im Leben der Menschen damals noch keine Rolle und wirken oftmals selbst wie Science-Fiction. Die Befürchtung, Computer könnten die Kontrolle übernehmen und die eigene Arbeit würde nicht mehr benötigt, beschäftigt die Menschen in vielen Bereichen.11 Dieses Misstrauen gegenüber neuen Technologien abseits des Bekannten wird so natürlich auch in Star Trek: Raumschiff Enterprise ab 1966 immer wieder in einzelnen Episoden thematisiert. So werden virtuelle Kriege, voll automatisierte Schiffssysteme, fehlgeleitete Sonden, aber auch zunehmend kybernetische Lebensformen beschrieben, die eine enge Symbiose mit ihren technologischen Erweiterungen eingegangen sind.
Ohne Computertechnologie würde Star Trek ein essenzieller Teil seiner Geschichte fehlen: Schon die Originalserie erzählt von einer digitalisierten Zukunft, in der Computer nahezu alles steuern können, überall präsent sind, Informationen liefern und komplizierteste Berechnungen in Sekundenschnelle lösen. Sie erleichtern den Alltag und sind in manchen Bereichen beinahe schon unsichtbar geworden, so selbstverständlich sind sie in dieser Vorstellung der Zukunft. Der Schiffs- oder Bordcomputer ist dabei elementarer Bestandteil, ermöglicht er es doch, die Raumschiffe – sei es die Enterprise, die Excelsior, die Voyager, die Titan oder die Discovery – zu steuern und die jeweiligen Crews dorthin zu bringen, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Computer- und Maschinendarstellungen sind das narrative Mittel, um eine mögliche Zukunft als Transgressionserfahrung zu erzählen – sie sind Medium, Wissenshort und Steuerungselement zugleich. Und so ist auch bei Star Trek über die Jahrzehnte ein deutlicher Wandel im Umgang mit Computern und Technik spürbar. Immer wieder wird hier in den Filmen und Serien aufgegriffen, wie sich futuristisch anmutende Technologie in den Alltag integrieren kann, wie Computer immer kleiner und deren Programme immer klüger werden, zu künstlichen Intelligenzen und teilweise gar zu technologischen Singularitäten werden, die weit über eine gewöhnliche künstliche Intelligenz hinausreichen. Dabei werden verschiedene Arten künstlicher Intelligenz unterschieden. Eine schwache künstliche Intelligenz ist in der Lage, die Lösung für ein bestimmtes Problem innerhalb eines vorgegebenen Rahmens zu finden, kann die dadurch erlernten Fähigkeiten aber nicht auf andere Aufgaben anwenden. Sie ist nicht kreativ in ihrem Vorgehen, sondern folgt einer festgelegten Methodik und lernt nicht dazu. Starke künstliche Intelligenzen, die bislang nur in der Science-Fiction existieren, nehmen ihre Umgebung wahr und können selbstständig Aufgabenstellungen erkennen sowie einfallsreiche Lösungswege finden, die sie ebenso auf andere Anwendungsbereiche übertragen. Eine technologische Singularität ist die Sonderform einer starken künstlichen Intelligenz und beschreibt einen Punkt in der Entwicklung von KI, an dem keine weiteren Vorhersagen mehr möglich sind und die Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln kann.12
Grundsätzlich gilt: Computersysteme sind in Star Trek mächtige Werkzeuge im interplanetaren und interstellaren Alltag, wenn sie denn kontrolliert und mit Bedacht eingesetzt werden. Computer erscheinen als abstrakte Maschinen, die in der Lage sind, Daten einzulesen, zu speichern, sie zu verwalten, aus den vorliegenden Daten Berechnungen anzustellen und die entsprechenden Ergebnisse anzuzeigen. Star Trek demonstriert aber auch immer wieder, was passieren könnte, wenn eines dieser Systeme seine Aufgaben nicht (mehr) korrekt erfüllt und damit zum unkalkulierbaren Risiko wird. Gerade starke künstliche Intelligenzen als Teil der Computersysteme machen hier Probleme, weil sie als weit entfernt von unseren Interessen und Weltwahrnehmung inszeniert werden. Der Grund ist oft, dass diese Intelligenzen kein menschliches Moralempfinden kennen und hier verschiedenste Denkstrukturen und Wahrnehmungen aufeinandertreffen. Computer in Star Trek können als schwache künstliche Intelligenzen in der Regel bestimmte Anfragen und Eingaben verstehen und entsprechend reagieren. Sie haben jedoch kein eigenständiges Empfinden, keine Erkenntnisfähigkeit, kein Bewusstsein für sich selbst und sind leicht als Maschine identifizierbar. Manchmal sind sie sogar begrenzt lernfähig und können aus erhaltenen Informationen neue Erkenntnisse ziehen. Andere wiederum sind insofern empfindungsfähig, als sie ihre Umgebung wahrnehmen und scheinen intelligent genug zu sein, um autonom agieren und funktionieren zu können. Vielleicht haben sie auch einen geringen Selbsterhaltungstrieb, eine gewisse Neugier und sind in der Lage, bestimmte abstrakte Konzepte zu verstehen – sich ihrer selbst als künstliches Wesen bewusst sind sie aber dennoch nicht, auch wenn sie den Schein kurzzeitig aufrechterhalten können. Gleichzeitig sind sie auch lokal begrenzt, die Idee eines verbindenden Netzwerkes taucht in diesem Kontext kaum auf, auch wenn es teilweise verschiedene Stationen gibt, über die man mit dem Computer kommunizieren kann. Doch vom reinen Bordcomputer bis zur künstlichen Intelligenz als technologischen Singularität ist es ein weiter Weg.
SCHIFFS- UND HILFSSYSTEME:Kann ein Bordcomputer denken?
Im Grunde genommen entspinnt sich jede Episode, jeder Film in Star Trek um einen Computer. Ohne ihn wäre keine Navigation möglich, würde kein lebenserhaltendes System an Bord funktionieren, wäre Wissen über den Bibliothekscomputer und andere Datenbanken nicht abfragbar, wissenschaftliche Experimente nicht durchführ- und auswertbar. Anfragen an den Bordcomputer passieren stets beiläufig, das System ist immer präsent und reagiert, sobald es mit dem Befehl Computer angesprochen wird. In der Originalserie ist dies noch kleinteiliger, denn hier werden sämtlichen Aufgaben spezielle Computerbereiche zugeteilt. Es sind kaum Monitore oder Bildschirme zur Datenausgabe zu sehen, alles ist unmittelbar zweckgebunden, digitale Datenübertragung offenbar (noch) unbekannt.13 Und immer wieder taucht die Frage auf: Kann ein Computer eigentlich denken? Und was bedeutet dieses Denken überhaupt auf maschineller oder gar auf menschlicher Ebene?
Schon unter Captain Kirk sind Computer in Star Trek sowohl Hilfsmittel als auch Gefahrenquelle – abhängig davon, in welchem Kontext und innerhalb welches Zeitgeists sie auftreten. Meistens gibt es einen Unterschied zwischen dem Bordcomputer, der das zentrale Organ eines jeden Raumschiffs ist, und anderen Gerätschaften, die verschiedene Grade einer schwachen künstlicher Intelligenz ausgeprägt haben und genaue Anweisungen und Befehle brauchen. Diverse Speichermedien und Handcomputer dienen als Informationsträger. Das mag in den späten 1960er-Jahren noch futuristisch gewirkt haben, mutet heute aber auf charmante Art beinahe schon naiv an. Die Wirklichkeit hat die Fiktion inzwischen auf vielen Ebenen eingeholt, wenn auch oftmals anders als damals vermutet: Computer sind noch kleiner geworden, können unzählige Aufgaben ausführen, dienen der Kommunikation und passen bisweilen sogar in eine Hosentasche.
Erst Star Trek: Discovery bringt hier mit Zora eine neue Form von Steuerungssystem ein. Zora ist eine eigene Existenzform, die aus zufälligen Begegnungen heraus zur technologischen Singularität geworden ist.14 Abgesehen von dieser Ausnahme sind Bordcomputer in Star Trek bewusst keine starken künstlichen Intelligenzen, sondern schlichte Ein- und Ausgabesysteme.15 Wie manipulierbar ein solches System sein kann, demonstriert schon in der Originalserie der Bordcomputer in der Episode »Kirk unter Anklage«. Kirk steht auf Sternenbasis 11 vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, fahrlässig den Tod eines Besatzungsmitglieds verursacht zu haben. Doch seine Aussagen widersprechen den angeblichen Beweisen des Computers, auf dessen Aufzeichnungen des Vorfalls der gesamte Prozess aufbaut. Das Logbuch, das Kirk als Captain der Enterprise regelmäßig führt und das automatisch alles aufnimmt, scheint diese Daten zu widerlegen.16 Normalerweise enthält das Logbuch nur die Zusammenfassungen und Einordnungen des Captains. In diesem Fall wurde jedoch auch während der gesamten Zeit des Vorfalls ein Bild aus verschiedenen Perspektiven der Brücke aufgezeichnet. Dadurch ist klar nachverfolgbar, welche Art von Befehl Kirk zu welchem Zeitpunkt gegeben hat. Diese Aufzeichnung steht im Zentrum der Betrachtung, denn sie wirft die Frage auf, wie zuverlässig solche Mitschnitte sind.
In dieser Episode treffen zwei Positionen aufeinander, die gegensätzlicher kaum sein können. Sie vertreten verschiedene Standpunkte darüber, was in den 1960er-Jahren von Computern als Möglichkeitsraum erwartet wurde, zeigen aber auch, dass trotz angeblich offensichtlicher Datenlage nicht immer alles so ist, wie es scheint. Während die Gerichtsbarkeit der Sternenflotte auf die Daten und Fakten der Aufzeichnung verweist, nimmt Kirks Anwalt Samuel T. Cogley die Rolle des Technikkritikers ein. Er misstraut den vorliegenden Daten, die zunächst sehr eindeutig scheinen, aber Kirks Aussage widersprechen. Es dürfte an Kirks Leumund als Captain, der stets das Beste für seine Crew will, liegen, dass die Daten überhaupt infrage gestellt werden. Doch schon vor der Gerichtsverhandlung wird Kirk verhört, während ein Aufzeichnungscomputer diese Aussagen protokolliert und bestimmte Details sogar explizit erfragt, obwohl das eigentliche Gespräch nur zwischen Kirk und Commodore Stone stattfindet. Für Stone sind die Daten eindeutig, ein Computer könne schließlich nicht lügen. Diese Auffassung vertritt ebenfalls die Anwältin Areel Shaw, die später Kirk gegenübersteht. Auch Spock widerspricht hier nicht – den Computer als solches hinterfragt er nicht, ist aber dennoch der Ansicht, dass die Aufzeichnung falsch sein müsse.
Cogley ist das Gegenstück von Stone. Anders als Stone, der sein Verhör mit einem Aufzeichnungscomputer macht und sich auf dessen gesammelte Daten verlässt, wird Cogley zunächst in seiner Bibliothek arbeitend gezeigt. Umgeben von Bücherstapeln recherchiert er Kirks Fall. Für ihn sind Bücher Wissen und Historie, denn ein Computer könne nicht verstehen, vor welchem Hintergrund beispielsweise Gesetze entstanden und wie diese der jeweiligen Situation entsprechend korrekt anzuwenden seien. Nur wem die Grenzen dieser Maschinen bewusst seien, könne auch einen Computer sinnvoll einsetzen. Cogley ist es auch, der darauf besteht, dass Kirk in der Verhandlung dem Belastungszeugen, also dem Computer selbst, gegenübergestellt wird. Er argumentiert, wenn man Kirk dieses Recht verweigere, würden die Maschinen über die Menschheit gestellt. Das sei problematisch, da Maschinen Recht nur als abstrakte Daten kennen würden, die ihnen eingegeben würden, nicht aber Gerechtigkeit ausüben könnten, denn diese sei nicht berechenbar.
Durch den Computer als Zeugen lässt sich das Problem tatsächlich lösen – es stellt sich heraus, dass die Aufzeichnungen eben doch verfälscht wurden und das vermeintliche Opfer seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Dem Computer wird hierbei keinerlei eigene Intelligenz und damit auch keine Schuld zugeschrieben. Vielmehr dokumentiert er lediglich den Alltag und nimmt weder eine Wertung noch eine Einordnung vor und kann daher leicht manipuliert werden. Ähnlich wird zwei Serienstaffeln später auch die zentrale Bibliothek der Föderation, Memory Alpha, in »Strahlen greifen an« beschrieben. Auf dem Planetoiden sind sämtliche Ergebnisse der Forschungszentren archiviert und dennoch wird auch dort zur digitalen Datenerfassung explizit menschliches Engagement benötigt: Die vorliegenden Datensätze brauchen eine Bewertung, Struktur und eine inhaltliche Einordnung, damit man sie anschließend sinnvoll abrufen kann. Denn alle Information wird bedeutungslos, wenn sie nicht zu inhaltlich verknüpftem Wissen werden kann. Im Umkehrschluss bedeutet dies ebenso, dass eine Veränderung, Anpassung, Einordnung der Daten menschliches Zutun benötigt, da in Star Trek zu diesem Zeitpunkt keine künstliche Intelligenz existiert, die in der Lage wäre, diese Aufgabe sinnvoll zu übernehmen.
Dass ein zusätzliches System an Bord eines Raumschiffs ebenfalls nicht unkritisch eingesetzt werden sollte, zeigt die Episode »Computer M5«. Die Befürchtung, dass Maschinen den Menschen ersetzen oder die Menschheit beherrschen könnten, wird hier anhand eines Prototyps dargestellt. M5 soll Computeraufgaben automatisieren und ohne menschliches Eingreifen steuern. Auf der Enterprise betrachtet man das mit Argwohn, nimmt die neuen Verhältnisse aber hin – schließlich soll es nur ein Testlauf sein. Die Crew wird während dieser Testphase von knapp 400 vorübergehend auf 20 Personen reduziert. Nur die Brückencrew um Kirk und ein paar wenige andere sowie der Entwickler von M5, Richard Daystrom, bleiben an Bord. Selbst Spock hält es für unabdingbar, den Computer bei seiner Arbeit zu überwachen, weil M5 in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, und anders als in »Kirk unter Anklage« nicht nur Daten gesammelt werden. So spricht sich Spock klar dafür aus, dass der Captain eines Schiffs nicht ersetzbar sei, denn eine Crew brauche ihren Captain, dem sie abseits der Technologie vertrauen könne. Daystrom findet hingegen, dass gerade der Captain durch M5 nicht mehr notwendig sei. Die Diskussion darüber wird auf verschiedenen Ebenen geführt. Daystrom nimmt an, dass Kirk dem M5-System kritisch gegenübersteht, weil er in seiner Position als Kommandant eines Raumschiffs nicht mehr das entsprechende Prestige hätte. Kirk dagegen geht es vielmehr darum, nicht die Kontrolle über ein dann automatisiertes System zu verlieren, das durchaus fehleranfällig sei. Diese Skepsis erweist sich als begründet, denn M5 versagt im Probebetrieb, kann bald Simulation und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden und zerstört kurz darauf einen Frachter, der zufällig seinen Weg kreuzt.
M5 symbolisiert in Verbindung mit Daystrom die menschliche Hybris, neue Technologien sofort im Griff zu haben. Der Computer scheint zu Beginn (und bei einfacheren Aufgaben) nahezu unfehlbar. Die Programmstruktur selbst und die zugrunde liegenden Algorithmen sollen auf den Denkstrukturen ihres Entwicklers basieren und sind damit längst nicht so unabhängig, wie es Algorithmen im Produktionszeitraum von Star Trek: Raumschiff Enterprise nachgesagt wurde. Damit nimmt die Serie auch hier vorweg, wie Algorithmen inzwischen tatsächlich wahrgenommen werden, nämlich als niemals vollständig neutral, weil die Person, die sie programmiert, immer bewusst oder unbewusst Einfluss darauf nimmt, wie Rechenergebnisse dargestellt werden.17 M5 kann sich wenig überraschend von den Denkstrukturen seines Schöpfers nicht lösen, schließlich basiert sein gesamtes Programm darauf. Was Leonard McCoy im Gespräch mit Kirk und Spock als hirnlose Maschine bezeichnet, ist weitaus mehr als das und erinnert damit auch an Cogleys Argumentation aus »Kirk unter Anklage«: M5 ist nicht hirnlos, aber durch die zugrunde liegende Programmierung in der Entscheidungs- und vor allem Erkenntnisfähigkeit dennoch stark eingeschränkt. Als schwache künstliche Intelligenz kann er nicht dazulernen, sondern nur Informationen auf vorgegebene Weise verarbeiten. Kommt es in seiner Datenverarbeitung zu Fehlern, ist er nicht in der Lage, diese zu erkennen oder gar zu korrigieren. Dies wirft nicht nur die Frage auf, wie ersetzbar ein Mensch ist, sondern auch, wie ersetzbar er in diesem Zusammenhang überhaupt sein sollte. Als M5 sich bedroht fühlt, beginnt er, sich selbst zu schützen, und lässt sich nicht mehr deaktivieren. Gleichzeitig übernimmt er auch immer mehr die Kontrolle über die Enterprise und zerstört ein weiteres Schiff.18
Für Kirk ist die Situation untragbar geworden. Die einzige Möglichkeit, die er noch sieht, ist der direkte Dialog mit M5. Da sich der Computer an den Denkstrukturen Daystroms orientiert, soll erst Daystrom mit ihm sprechen, scheitert aber. Die Anlage müsse überleben, sagt M5, dafür sei er berechtigt, jede Möglichkeit zur Verteidigung zu wählen. Erst Kirk schafft es, dem System klarzumachen, dass sein Vorgehen Unrecht ist und er als Maschine keinem Lebewesen schaden dürfe – M5 deaktiviert sich am Ende selbst. Die Episode ist ein kritisches Hinterfragen der Automatisierung des Alltags, die allerdings nicht mit einer generellen Technikskepsis zu verwechseln ist. Vielmehr steht hier im Fokus, wann diese Art von Technologie im Alltag hilfreich ist und wo die Grenzen der Nutzbarkeit liegen. Sicherlich ist es sinnvoll, auf technische Innovation zu setzen, aber es muss immer auch kontextualisiert werden, wozu und in welchem Rahmen sie eingesetzt werden soll. Daystroms Perspektive vergisst außerdem, wie spannend das eigene Erkunden der Umgebung sein kann und weshalb der Mensch ursprünglich in den Weltraum aufgebrochen ist – nämlich um ihn selbst zu erforschen und nicht am Ende von Computersystemen vollständig ersetzt zu werden.
Abseits von Fragen, wie auf moralischer Ebene mit den verschiedenen Formen von künstlicher Intelligenz und Computersystemen umgegangen werden kann, werden die Figuren in Star Trek immer wieder mit technischen Neuerungen konfrontiert. Innerhalb einer Seriengeneration, zwischen Kirk und Jean-Luc Picard, wechselt die Bedienung technischer Geräte vom Schalter zum Knopf zum Touchscreen. Die Computer werden schneller, wirken weniger fremdartig und sind deutlich leistungsstärker als zu Kirks Zeiten. Insbesondere das LCARS, das Library Computer Access/Retrieval System ist in Star Trek: Das nächste Jahrhundert neu. Mit diesem Schnittstellenkonzept ist beinahe das gesamte Raumschiff mit einer grafischen Nutzungsoberfläche und per Berührung steuerbar, von der schlichten Datenabfrage bis hin zur Programmierung aufwendiger Holoprogramme. Der Bordcomputer ist eine schwache künstliche Intelligenz, die nur auf sprachlich korrekt formulierte Eingaben reagiert. Unklare Befehle führen zu Missverständnissen.19 Geht Sprache oder Sprachlichkeit verloren, kann der Computer die ihm gegeben Befehle nicht mehr ausführen, weil er die Anweisungen nicht mehr versteht. Dies geschieht beispielsweise in der Episode »Babel« in Star Trek: Deep Space Nine. Durch ein repliziertes Virus verliert die Besatzung ihr Sprachvermögen, was den Bordcomputer sowohl per Sprachbefehl als auch per Worteingabe unbrauchbar macht.20 Manchmal wird der Bordcomputer auch unbenutzbar, weil sich dort etwas anderes einnistet, beispielsweise mikroskopisch kleine Roboter wie in »Die Macht der Naniten«in Star Trek: Das nächste Jahrhundert. Nachdem die Naniten bei einem Experiment abhandengekommen sind, gelangen sie in den Bordcomputer der Enterprise und vermehren sich dort exponentiell. Das führt zu schiffsweiten Systemausfällen, während sich die Naniten mit jeder Generation weiterentwickeln und so von der schwachen künstlichen Intelligenz zu einer starken werden, die zuletzt sogar in der Lage ist zu kommunizieren. Erst als Picard anbietet, ihnen eine neue Heimat auf einem unbewohnten Planeten zu suchen, geben sie die Schiffskontrolle zurück. Die Abhängigkeit der Crew vom Bordcomputer wird in dieser Episode besonders deutlich. Versagt er, ist die Steuerung der Enterprise schwierig. Und nicht nur das: Selbst die Lebenserhaltungssysteme können betroffen sein. Auch das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb in Star Trek starke künstliche Intelligenzen und diese grundständigen Steuerungsfunktionen eines Raumschiffs in der Regel strikt getrennt werden.
Ähnliches wie bei den Naniten geschieht auch bei den Exocomps in »Datas Hypothese«, aber auf einem anderen, weitaus zurückhaltenderem Niveau. Diese kleinen Maschinen sind so programmiert, dass sie selbstständig einfache Probleme innerhalb ihres Aufgabengebiets lösen und lernen können, wodurch sie zusätzliche Schaltkreisbahnen entwickeln können. Dass sie eine eigene Intelligenz und damit ein rudimentäres Bewusstsein herausbilden, ist innerhalb ihrer Programmierung eigentlich nicht vorgesehen. Es stellt sich heraus, dass die Exocomps tatsächlich lernfähig sind, eine künstliche Intelligenz weisen sie letztlich aber scheinbar nicht auf, zumindest keine starke künstliche Intelligenz. Dennoch opfert sich bei einem Unfall ein Exocomp dem Anschein nach, um zwei weitere zu retten. Die Exocomps bilden somit eine Maschinenart, die möglicherweise kurz vor der eigenen Bewusstwerdung steht, eine Gefahr scheinen sie jedoch nicht darzustellen. Vielmehr bleiben sie auch nach »Datas Hypothese« zumindest in Star Trek: Das nächste Jahrhundert weiterhin Werkzeug. In Star Trek: Lower Decks taucht später ein weiterer Exocomp auf, der sogar sprechen kann, sich Erdnuss-Snackbox nennt und eigene Ziele verfolgt, sich organischem Leben erst zu-, dann wieder abwendet und schließlich sogar Gewissensbisse entwickelt. Erdnuss-Snackbox scheint damit allerdings eine Ausnahme zu sein, denn in »Ein paar Abzeichen mehr« tauchen neben dem Exocomp Kevin, den sie als ihren Vater vorstellt, noch weitere auf, die in ihrer Entwicklung einer künstlichen Intelligenz und Kommunikation weniger weit fortgeschritten zu sein scheinen als Erdnuss-Snackbox.
Generell ist Computertechnik in Star Trek: Das nächste Jahrhundert selbstverständlicher geworden als in der klassischen Serie. Die Skepsis verschwindet – auch weil im realen Alltag der späten 1980er-Jahre Computer selbst in Privathaushalten viel verbreiteter und damit zugänglicher geworden sind. Dies bleibt auch so in Star Trek: Deep Space Nine und Star Trek: Raumschiff Voyager. Sogar Star Trek: Enterprise, das zeitlich vor der Originalserie angesiedelt ist, zeigt einen intuitiveren Umgang mit Computern. Trotzdem bleibt die Technologie in bestimmten Situationen fehleranfällig, was sich auf Deep Space Nine immer wieder zeigt. Als ehemals cardassianische Raumstation treffen hier deren Technologien auf die der Sternenflotte und beide sind nicht immer miteinander kompatibel. Wenn so wie in »In der Falle« versehentlich ein ehemals cardassianisches Antirebellionsprogramm gestartet und die Sicherheitsprotokolle der Sternenflotte überschrieben werden, ist guter Rat teuer. Selbst Gul Dukat, der anfangs wenig Engagement zeigt, auf die Station zu kommen, um das Programm zu deaktivieren, merkt schnell, dass damit nicht zu scherzen ist. Als er Deep Space Nine nämlich wieder verlassen will, nimmt das Programm an, es sei ein Fluchtversuch, und so zählt er nun selbst zu den Gefangenen. Erst Sisko und Chief O’Brien gelingt es schließlich, das System zu stoppen.
Den Schritt vom Touchscreen zur Mixed Reality schafft schließlich Star Trek: Picard. Im Raumfrachter La Sirena zeigt sich, wie sehr sich die Steuerungselemente und Programmierungen verändert haben. Bedienelemente erscheinen nun freischwebend als Hologramm auf der Brücke und reagieren auf Gestensteuerung. Und während Jahre zuvor unter anderem auf der Voyager nur ein einziges medizinisches Notfallprogramm als holografisches Hilfsprogramm im Einsatz war, befinden sich auf der La Sirena gleich mehrere mit verschiedenen Aufgaben von Gastfreundschaft über Psychologie bis hin zu Ingenieurswissen – und außer Captain Cristobàl Rios keine organische Crew. Auch wenn es im ersten Moment so wirkt, als würde hier ein Schiff durch künstliche Intelligenz selbstständig gesteuert werden können, täuscht dieser Eindruck. Die verschiedenen Hologramme üben zwar unterschiedliche Aufgaben aus, der Captain bleibt aber Rios und er ist es, der die entsprechenden Anweisungen zur Steuerung des Schiffs geben muss.
Die Schiffssysteme und deren Programme von der Originalserie bis hin zu Star Trek: Strange New Worlds machen deutlich, wie sich Star Trek als Science-Fiction-Erzählung immer wieder mit realweltlichen Entwicklungen auseinandersetzt. Immer wieder werden auch (pop)kulturelle Strömungen in den Filmen und Serien aufgegriffen und real existierende technologische Entwicklungen als fiktional erweitertes Setting ausgelegt: Während in der Originalserie, Star Trek: Das nächste Jahrhundert, Star Trek: Deep Space Nine und Star Trek: Raumschiff Voyager in Einzelepisoden immer wieder auf Schwierigkeiten mit technischen Systemen eingegangen wird, hat sich der Umgang mit diesen Themen inzwischen stark verändert. Die Darstellung von Bordsystemen und verschiedenen Formen starker und schwacher künstlicher Intelligenzen ist zum Ende der 1990er-Jahre an den Rand gedrängt worden. Das hängt sicherlich auch mit dem in den 1980er-Jahren beginnenden KI-Winter zusammen. Erst ab etwa den 2010er-Jahren werden künstliche Intelligenzen mit dem Auftauchen von Assistenzsystemen wieder präsenter und spielen in der Science-Fiction und damit auch in Star Trek eine größere Rolle. Es verwundert nicht, dass insbesondere Star Trek: Enterprise als Serie, die um die Jahrtausendwende herum entstanden ist, die Schiffssysteme als Handlungselement nahezu vollständig ausklammert. Zudem werden hier nach und nach immer weniger Einzelepisoden erzählt, sondern staffelübergreifende Handlungsbögen aufgebaut. Star Trek: Discovery verfährt ähnlich, entwickelt mit Zora jedoch eine zufällig entstandene starke künstliche Intelligenz, die Teil des Bordsystems wird und ähnlich wie die Entität in »Persönlichkeiten« in Star Trek: Deep Space Nine nicht als Fehlfunktion, sondern als eigenständig wahrgenommen wird. In »Persönlichkeiten« sind die Veränderungen im System zunächst subtil, als eine Sonde ein Programm in den Bordcomputer überträgt. Bemerkt wird das beispielsweise an der Art, wie der Computer im Anschluss auf Sprachbefehle reagiert. Es stellt sich heraus, dass das Programm Teil einer bislang unbekannten Spezies künstlicher Intelligenzen ist. Letztlich darf die Entität im System verbleiben, wird aber in eines der Unterprogramme verschoben, damit der Bordcomputer wieder auf seine ursprünglichen Strukturen zurückgreifen kann – und als eine eigenständige Existenzform anerkannt, die gleichzeitig keinen Zugriff auf lebenswichtige Systeme hat. Zoras Auftauchen wird später ähnlich inszeniert, aber im Gegensatz zur Intelligenz auf Deep Space Nine bleibt sie präsent und stellt als technologische Singularität generell einen Sonderfall dar, der individuell verhandelt wird.21
Die Frage, ob Maschinen tatsächlich denken können, lässt sich in diesem Zusammenhang also gar nicht so einfach beantworten. Speziell die Bordsysteme der Raumschiffe der Sternenflotte sollen das im Normalfall aber auch gar nicht. Trotzdem fällt auf, wie sich der Umgang mit responsiven Programmen verändert hat – sowohl in Star Trek als auch im wirklichen Leben. Während sie in den 1960er-Jahren noch verstärkt als Befehlsempfänger ohne Eigenleistung dargestellt wurden, dienen sie nun auch als Gesprächspartner. Sie sind wortgewandter, bleiben in der Regel jedoch schwache künstliche Intelligenzen, die manchmal dennoch den Eindruck erwecken, sie wären mehr als die Summe ihrer Teile.
VORLÄUFER DER DIGITALISIERUNG:Über Supercomputer und gesellschaftliche Entwicklungen
Besonders in den 1960er-Jahren sind künstliche Intelligenzen in der Science-Fiction und auch in Star Trek oftmals an Supercomputer gebunden, die für bestimmte Zwecke entwickelt wurden. Daher ist die eigentliche Intelligenz dieser Systeme meist eher eingeschränkt, wenn auch deutlich weiter gefasst als bei den üblichen Bordsystemen eines Raumschiffs. Eine Weiterentwicklung ist ihnen nicht möglich, sie können keine neuen Erkenntnisse gewinnen, sondern nur strikt nach den ihnen bekannten Vorgaben handeln. Werden diese Computer als umfassende Anlagen geplant, beispielsweise, um innerhalb einer Gesellschaft für bestimmte Aufgaben eingesetzt zu werden, entwickelt sich daraus häufig eines dieser beiden Narrative als Erzählmuster:
1.Eine Gesellschaft, die hochtechnologisiert ist oder war, delegiert(e) freiwillig Aufgaben an einen Computer beziehungsweise eine künstliche Intelligenz. Sie ist sich der möglichen Konsequenzen zwar scheinbar bewusst, wird von diesen aber, sobald sie eintreten, dennoch überrascht.
2.Eine Gesellschaft, in der die Computer den Alltag gestalten und diesen übernommen haben. Teilweise liegt dieser Vorgang so weit in der Vergangenheit, dass es innerhalb der Gesellschaft kein oder kaum Wissen darüber gibt.
In beiden Fällen wird ein Kontrollverlust und eine ursprünglich teilweise freiwillige Abgabe der Kontrolle an Computer thematisiert. Was sich daraus entwickelt, ermöglicht Szenarien von der Weltherrschaft der Maschinen bis hin zu künstlichen Intelligenzen, die stark in den Alltag eingreifen und Weiterentwicklung sowohl auf technischer als auch kultureller Ebene verhindern. Das muss nicht einmal beabsichtigt sein, ergibt sich jedoch nicht selten aus der Begrenztheit der Programme.
Ein System, das nur eine sehr schwache künstliche Intelligenz zeigt, indem es schlicht eingegebene Werte extrapoliert, ist das von Eminiar VII und Vendikar. Auf beiden Planeten befinden sich Großrechner als raumfüllende Installation, der eigentliche Rechenprozess läuft im Verborgenen ab. Das System ist zwar alles bestimmend, trifft aber keinerlei eigene Entscheidungen, sondern ist ein Simulationsprogramm, das in »Krieg der Computer« in Star Trek: Raumschiff Enterprise von den Kontrahenten als eine Art auf Wahrscheinlichkeitsberechnung basierender Zufallsgenerator gesteuert wird und virtuelle Kriege austrägt. Auch wenn die Angriffe nur virtuell sind und es zu keiner sichtbaren Zerstörung der Kriegsschauplätze kommt, sind jedes Mal viele Tote zu beklagen. Wer sich während der Simulation real in einem der betroffenen Gebiete aufhält, wird als Kriegsopfer eingestuft, registriert und muss sich innerhalb eines Tages bei den sogenannten Desintegrationskammern einfinden, um dort seinem Schicksal entgegentreten zu können.





























