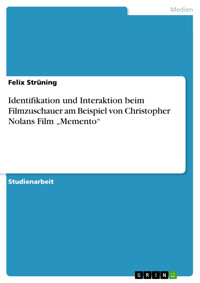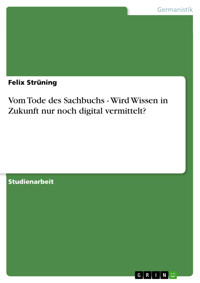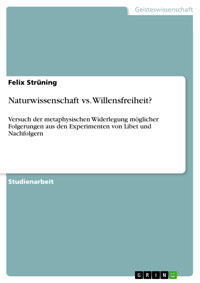18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,7, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für deutsche Literatur), Veranstaltung: Schulkanonische Literatur im Überblick und in Vertiefung, Sprache: Deutsch, Abstract: Ist ein Kanon heutzutage noch das richtige Modell, um Schülern, Studenten, Lehrern und allgemein Lesern zu sagen, was man lesen sollte? Oder gar gelesen haben muss, um von sich behaupten zu können, Allgemeinbildung zu haben? Literaturkenntnis ist schließlich kein entscheidender Faktor für das alltägliche Leben. Einerseits werden Leselisten vor allem von Studenten sehr gerne angenommen, da bei vollen Lehrplänen und umfangreichen Lektüreanforderungen die Zeit sehr kostbar wird. Sie mit ‚dem falschen’ Buch zu verbringen, wäre töricht. Auch scheint es in Zeiten von Multiple Choice Tests und „Wer wird Millionär?“-Sendungen immer mehr darauf hinauszulaufen, ein genau definiertes Kulturwissen anzustreben, eben einen Kanon, bei dem man weiß, wenn man ihn liest, hat man das Wichtigste ausgewählt. Bildung wird oft nicht mehr als offen und ständig zu erweiternd verstanden, sondern auf ‚key values’ reduziert. Am besten ist es, Wissen auf eine Auswahl aus einer beschränkten Anzahl von Möglichkeiten zu komprimieren. Wie Volker Hage und Johannes Saltzwedel im Spiegel schon 2001 konstatierten: „Kultur hat es leichter, wenn sie vermessen wurde; als durchgerechnete Gegenwelt zur chaotischen Gegenwart und Zukunft.“ Besten- und Empfehlungslisten haben bekanntlich eine lange Tradition, die ersten wurden schon in der Antike angefertigt. So z.B. durch die große Bibliothek von Alexandria und ihre Gelehrten, die nur drei Autoren in ihrem Mindestkanon auflisteten: Aischylos, Sophokles und Euripides. Aufgrund der massiven Ausschlussfunktion dieser antiken Bestimmungen, wurden nur sehr wenige Autoren und Texte tradiert und überliefert. Grund genug, dass heutige Kanonmacher ihre Listen meist nur als Vorschläge verstanden wissen wollen. Kanones vermitteln „Orientierung und ‚subjektive Sicherheit’“ , außerdem das Gefühl, Kultur zu besitzen und sie zu kennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Felix Strüning 15. April 2007
HS: Schulkanonische Literatur im Überblick und in VertiefungM. Kämper-van den BoogaartWiSe 2006/2007
Page 4
Einleitung
Ist ein Kanon heutzutage noch das richtige Modell, um Schülern, Studenten, Lehrern und allgemein Lesern zu sagen, was man lesen sollte? Oder gar gelesen haben muss, um von sich behaupten zu können, Allgemeinbildung zu haben? Literaturkenntnis ist schließlich kein entscheidender Faktor für das alltägliche Leben.1Einerseits werden Leselisten vor allem von Studenten sehr gerne angenommen, da bei vollen Lehrplänen und umfangreichen Lektüreanforderungen die Zeit sehr kostbar wird. Sie mit ‚dem falschen’ Buch zu verbringen, wäre töricht.2Auch scheint es in Zeiten von Multiple Choice Tests und „Wer wird Millionär?“-Sendungen immer mehr darauf hinauszulaufen, ein genau definiertes Kulturwissen anzustreben, eben einen Kanon, bei dem man weiß, wenn man ihn liest, hat man das Wichtigste ausgewählt. Bildung wird oft nicht mehr als offen und ständig zu erweiternd verstanden, sondern auf ‚key values’ reduziert. Am besten ist es, Wissen auf eine Auswahl aus einer beschränkten Anzahl von Möglichkeiten zu komprimieren. Wie Volker Hage und Johannes Saltzwedel im Spiegel schon 2001 konstatierten: „Kultur hat es leichter, wenn sie vermessen wurde; als durchgerechnete Gegenwelt zur chaotischen Gegenwart und Zukunft.“3Besten- und Empfehlungslisten haben bekanntlich eine lange Tradition, die ersten wurden schon in der Antike angefertigt. So z.B. durch die große Bibliothek von Alexandria und ihre Gelehrten, die nur drei Autoren in ihrem Mindestkanon auflisteten: Aischylos, Sophokles und Euripides. Aufgrund der massiven Ausschlussfunktion dieser antiken Bestimmungen, wurden nur sehr wenige Autoren und Texte tradiert und überliefert.4Grund genug, dass heutige Kanonmacher ihre Listen meist nur als Vorschläge verstanden wissen wollen. Kanones vermitteln „Orientierung und ‚subjektive Sicherheit’“5, außerdem das Gefühl, Kultur zu besitzen und sie zu kennen.
Anderseits wird immer mehr eine Ablehnung von Kanones und verbindlichen Lektürelisten beklagt. Schulen und andere Bildungseinrichtungen, beziehungsweise die zuständigen Ministerien, stehen immer wieder vor der Frage, wie die Lektüreauswahl bei der Literaturvermittlung geschehen soll. Nennen die Listen Autoren und Titel oder nur Themengebiete? Sind bestimmte Autoren/Titel verbindlich, andere frei wählbar?
Nach einer Diskussion der aktuellen Kanondebatte und -auslegung soll sich diese Arbeit Buch- und Zeitungsprojekten der letzten Jahre zuwenden, um sie auf Kanonanspruch und
1Volker Hage, Johannes Saltzwedel, Arche Noah der Bücher, in: Der Spiegel, 25/2001, 18.06.2001, S. 208
2Ebd., S. 210
3Ebd., S. 208
4Ebd., S. 209
5Angelika Buß, Kanonprobleme, in: Michael Kämper-van den Boogaart, Deutschdidaktik, Berlin 2006, S. 3
Page 5
Kanontauglichkeit zu untersuchen. Als erstes werden zwei kanonische Bibliotheken der Wochenzeitung „Die Zeit“ betrachtet. Anschließend widmet sich die Arbeit der vom Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki 2001 im „Spiegel“ veröffentlichten Lektüreliste und seinem in Folge dessen herausgegebenen Kanon als Buchkassetten. Schließlich wendet sich die Untersuchung vier Zeitungseditionen zu, die in den letzten Jahren kanonähnlich auf den deutschen Buchmarkt gebracht wurden. Dabei macht die „SZ Bibliothek“ der „Süddeutschen Zeitung“ den Anfang, die als Reaktion darauf erschienene „Bild Bestseller Bibliothek“ folgt. Anschließend kommt die von Elke Heidenreich verantwortete „Brigitte-Edition“ zur Diskussion und letzten Endes die „Spiegel Edition. Die Bestseller“.
Es geht bei dieser Arbeit nicht primär darum, wie ein Werk beschaffen sein muss, um kanonisierbar zu sein. Stattdessen wird diese übliche Perspektive fallengelassen und darauf geschaut, wie ein Kanon aufgebaut werden muss, um als solcher zu gelten. Kann man also Kriterien finden, mittels derer man sozusagen die leere Hülle eines Kanons - oder einer Edition, die selbigen Anspruch hat - mit Einzelwerken auffüllen kann? Auch wenn ‚Kanon’ eher als Problem denn Begriff der Literaturtheorie6gesehen werden muss, können die im ersten Teil erarbeiteten Kriterien dazu dienen, die ausgewählten Druckerzeugnisse auf ihre Kanontauglichkeit zu untersuchen. Handelt es sich z.B. bei den Zeitungseditionen um Kanones oder nur um beliebte bzw. geschätzte Literatur? Gibt es Spezialformen von Kanones, denen die Zeitungseditionen formal entsprechen? Schließlich stellt sich die Frage, warum Projekte wie die „SZ Bibliothek“ in Zeiten abnehmender Kanonakzeptanz solchen wirtschaftlichen Erfolg haben.
6Ebd., S. 2