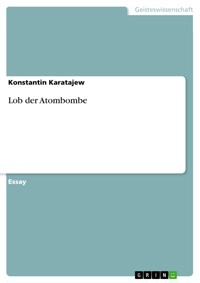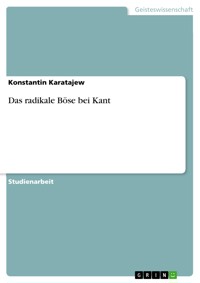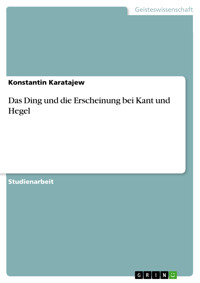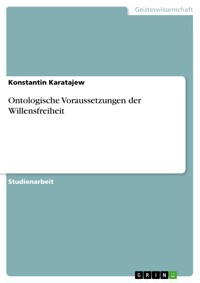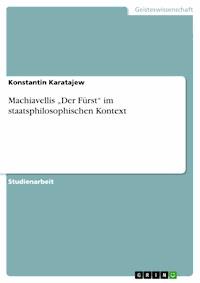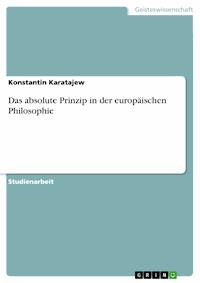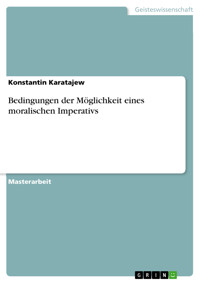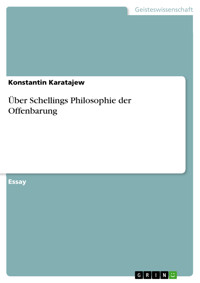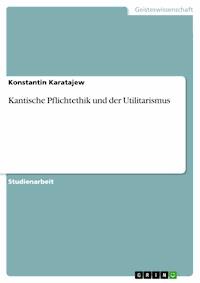
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...), Note: 1,0, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Sprache: Deutsch, Abstract: Immanuel Kants und John Stuart Mills moralphilosophische Konzepte liegen zeitlich ungefähr 80 Jahre auseinander, doch in den 80 Jahren zwischen Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ und Mills „Utilitarianism“ erlebte das Menschenbild der abendländischen Philosophie eine folgenreiche Transformation. Die entscheidende Wirkung ging von Charles Darwins Buch „On the Origin of Species by Means of Natural Selection“ (1859) aus. Kant und Mill gehen also von unterschiedlichen Voraussetzungen aus und beantworten die Frage, was der Zweck moralischen Handelns ist, jeweils anders. Bei Kant ist der Zweck moralischen Handeln die Pflichterfüllung, bei Mill das größte Glück der größten Zahl. Man sieht deutlich die unterschiedlichen Ausrichtungen der Moral: die Anhänger der Kantischen Moralphilosophie müssen sich der Prüfung durch die eigenen Vernunft unterziehen und fragen, ob sie gemäß der Einsicht in die unbedingte Pflicht handelten. Die Utilitaristen interessiert die innere Welt des handelnden Subjekts nicht. Gemäß dem Utilitarismus ist eine Handlung gut, wenn es durch sie niemandem schlechter geht, und mindestens einem besser geht, als vorher. Kant und Mill ziehen also keineswegs verschiedene Schlussfolgerungen aus derselben Weltanschauung, sondern stehen auf unterschiedlichen weltanschaulichen Fundamenten. Während für Kant die Vernunftwelt mit ihren Vernunftwahrheiten wie die Würde des Menschen genauso real ist wie die empirische Welt, bewegt sich Mills Argumentation ausschließlich in der empirischen Welt, in der es allein um konkurrierende Interessen geht. In der praktischen Philosophie geht es nicht darum, erkenntnistheoretisch festzustellen, welches weltanschauliche Fundament mehr der Wahrheit entspricht. Es geht darum, welches moralphilosophische Konzept für das vernunftbegabte Sinnenwesen Mensch besser geeignet ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Inhaltsangabe
1. Einleitung
2. Moralphilosophische Grundpositionen Kants und Mills
2.1. Kants Pflichtethik
2.2. Mills Utilitarismus
3. Gegenüberstellung
3.1. Versuch einer Synthese
3.2. Pflichtethik und Utilitarismus im Lichte menschlicher Lebenswirklichkeit
4. Schlusswort
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Immanuel Kants und John Stuart Mills moralphilosophische Konzepte liegen zeitlich ungefähr 80 Jahre auseinander, doch in den 80 Jahren zwischen Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ und Mills „Utilitarianism“ erlebte das Menschenbild der abendländischen Philosophie eine folgenreiche Transformation. Die entscheidende Wirkung ging von Charles Darwins Buch „On the Origin of Species by Means of Natural Selection“ (1859) aus. „Darwins Theorie veränderte nun die Situation zwar nicht dergestalt, dass jetzt eine definitive, empririsch-wissenschaftliche Antwort auf die Frage nach dem Ursprung des Lebens oder der Entstehung der Natur vorgelegen hätte. Sie veränderte sie aber doch insofern, als es jetzt eine weltimmanente Alternative zu der Annahme des Schöpfergottes gab“[1]. Der Mensch war nicht mehr ein Geschöpf eines allmächtigen, allgütigen und allwissenden Gottes, sondern ein Produkt einer jahrmillionenlangen Entwicklung des Lebens, auch bekannt als Evolution. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzog sich dieser weltanschauliche Wandel unter den europäischen Gelehrten, der Wandel vom Agnostizismus mit metaphysischer Vermutung zum Agnostizismus mit materialistischer Vermutung: „Ganz allmählich vollzog sich in Westeuropa die Abkehr von der metaphysischen Weltdeutung hin zum Materialismus. Die Materialismus-Kontroversen in den fünfziger Jahren hatten diesen Prozess in Deutschland bereits eingeleitet. Wirkliche Breitenwirkung erlangte der Materialismus aber nicht in seiner dogmatisch-aggressiven Variante, wie etwa bei Vogt, sondern in der skeptischen Variante Darwins: als Agnostizismus mit materialistischer Vermutung“ [2].
Kant und Mill gehen also von unterschiedlichen Voraussetzungen aus und beantworten die Frage, was der Zweck moralischen Handelns ist, jeweils anders. Bei Kant ist der Zweck moralischen Handeln die Pflichterfüllung, bei Mill das größte Glück der größten Zahl. Man sieht deutlich die unterschiedlichen Ausrichtungen der Moral: die Anhänger der Kantischen Moralphilosophie müssen sich der Prüfung durch die eigenen Vernunft unterziehen und fragen, ob sie gemäß der Einsicht in die unbedingte Pflicht handelten. Die Utilitaristen interessiert die innere Welt des handelnden Subjekts nicht. Gemäß dem Utilitarismus ist eine Handlung gut, wenn es durch sie niemandem schlechter geht, und mindestens einem besser geht, als vorher.
Kant und Mill ziehen also keineswegs verschiedene Schlussfolgerungen aus derselben Weltanschauung, sondern stehen auf unterschiedlichen weltanschaulichen Fundamenten. Während für Kant die Vernunftwelt mit ihren Vernunftwahrheiten wie die Würde des Menschen genauso real ist wie die empirische Welt, bewegt sich Mills Argumentation ausschließlich in der empirischen Welt, in der es allein um konkurrierende Interessen geht.
In der praktischen Philosophie geht es nicht darum, erkenntnistheoretisch festzustellen, welches weltanschauliche Fundament mehr der Wahrheit entspricht. Es geht darum, welches moralphilosophische Konzept für das vernunftbegabte Sinnenwesen Mensch besser geeignet ist.