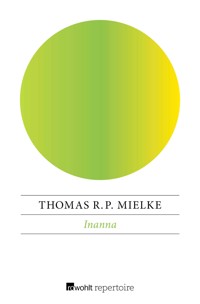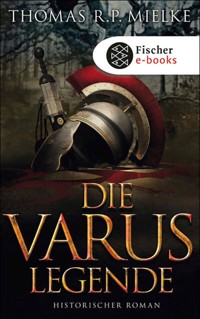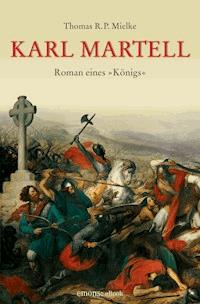
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte Plektrud, die Gründerin von St. Maria im Kapitol, die Familienmacht zwischen Mosel und Niederrhein festigen. Als ihr Ehemann Pippin II., der Hausmeier der Merowingerkönige, im Jahr 714 stirbt, lässt sie dessen unehelichen Sohn Karl in Köln einkerkern. Doch der bricht aus und sammelt in den Ardennen einen Haufen junger Rebellen um sich. Er holt den geraubten Königsschatz nach Köln zurück, schlägt Adelsheere vor Paris, vertreibt die räuberischen Friesen aus Köln und steigt zum Herrscher des Frankenreichs auf. Und errettet 732 bei Tours und Poitiers das christliche Abendland vor den heranstürmenden Eroberern unter den Fahnen Allahs
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas R. P. Mielke, 1940 als Sohn eines Brasilienpastors in Detmold geboren, lebt in Berlin. Nach einer Ausbildung zum Fluglotsen und dem Besuch der Werbeakademie Hamburg arbeitete er drei Jahrzehnte als Kreativdirektor in internationalen Werbeagenturen. Neben historischen Bestsellern wie »Gilgamesch«, »Inanna«, »Attila« und »Karl der Große« schrieb er weitere historische Romane und Romanbiographien. Hierzu gehören »Attila«, »Die Avignon-Trilogie« oder »Die Varus-Legende«. Seine Bücher erreichen sechsstellige Auflagen und wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Im Emons Verlag erschien »COLONIA – Roman einer Stadt«.
Dieses Buch ist ein Roman. Szenen und Dialoge sind frei erfunden, wenngleich in das historische Umfeld und die heute verfügbaren Daten über die damaligen Ereignisse und Personen eingebettet.
© Hermann-Josef Emons Verlag 2014 Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: akg-images / Erich Lessing Umschlaggestaltung: Tobias DoetschISBN 978-3-86358-566-2
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
1
Von Kerker zu Kerker
»Karl? Hörst du mich? Ich bin’s, Graf Rotbert …«
Seit Monaten blickte der Gefangene nur finster und grimmig. Nun zog er die Brauen zusammen, schob seine vollen Lippen vor und spuckte auf den feucht glänzenden Steinboden unter der winzigen Flamme des Kienspans an der Mauer.
»Nein!«, knurrte er und schüttelte so wild den Kopf, dass seine blonde, strähnig gewordene Mähne nach allen Seiten flog. Wie die meisten Franken trug er Bart und Haare ebenso lang wie ihre Könige aus dem Geschlecht der Merowinger.
So leicht ließ er sich nicht mehr in eine Falle locken! Nicht von Plektrud, diesem verhassten Weib, das nicht nur seine Stiefmutter, sondern jetzt auch noch die alleinige Regentin über das östliche Frankenreich zwischen Main und Maas war. Nicht von ihren schleimenden Vasallen, die ihn gleich nach dem Tod seines Vaters vor nun schon fast neun Monaten brutal ergriffen, verschleppt und in die Kerker von Aquis grana gesperrt hatten. Und erst recht nicht von jenen, mit denen er Seite an Seite und Schulter an Schulter gekämpft hatte: gegen Friesen und Sachsen, Baiern und Alamannen und gegen ihre verfeindeten Stammesbrüder im westlichen Teil der Francia.
»Verschwinde!«, stieß er wütend hervor. Er ballte die Hände zu Fäusten, als wollte er gegen die Bohlentür schlagen. Auch das hatte er in den ersten Wochen und Monaten getan. Er hatte getobt und geschrien, seinen gesamten Besitz und sein Erbteil für seine Freiheit geboten. Er hatte alles zertrümmert, was er erreichen konnte, und auch jene verflucht, die sich mit Kreuz und Bibel bis zu ihm vorgewagt hatten. Inzwischen öffnete niemand mehr die kleine Türluke. Brot und Wasser erhielt er nur noch durch einen schmalen Schacht in der Decke, der kaum groß genug war, um den Gestank abziehen zu lassen – auch dann nicht, wenn sie ihm in unregelmäßigen Abständen einen Schwall Schwefelwasser aus den zerfallenen römischen Thermen schickten, um das Verlies durchzuspülen.
Wieder schlug es von außen gegen die schwere, mit rostigen Eisen beschlagene Bohlentür. Karl glaubte nicht, dass es tatsächlich Rotbert war. Und selbst wenn … was konnte er wollen?
In all den Monaten hatte Karl keine Anklage gehört und keinen Richter gesehen!
Beides war überflüssig, denn alle wussten, warum er nach dem Tod seines Vaters und der Mönchs-Grablege auf dem Chevremons so schnell verschwunden war. Offiziell war seine Mutter Alphaid der Grund – die Zweitfrau, die der fränkische Majordomus Pippin von Heristal mehr geliebt hatte als seine Hauptfrau Plektrud. In Wahrheit aber fürchtete die Witwe des mächtigsten Mannes der Franken ihren Stiefsohn, der vor fünfundzwanzig Jahren vom Bischof von Reims voller Bewunderung »Kerrl« genannt worden war. Aus dem Erstaunen war sein Taufname geworden. Inzwischen hatte er ebenfalls geheiratet und drei eigene Kinder: den neunjährigen Karlmann, die sechsjährige Hiltrud und einen elf Monate alten Knaben, von dem er nicht einmal wusste, ob er schon getauft war und einen Namen erhalten hatte. Vielleicht hatte er deshalb an seine eigene Taufe denken müssen …
Rotbert, der in den letzten Jahren so oft neben ihm geritten war, schlug erneut gegen die Kerkertür. Ganz langsam, mit einem krächzenden Geräusch öffnete sich die winzige Klappe in der Bohlentür. Karl konnte das Licht einer Fackel auf der anderen Seite erkennen, aber nicht einmal den Schatten des früheren Freundes.
»Was willst du, Rotbert?«, fragte Karl. »Hol mich hier raus oder lass mich in Ruhe!«
»Sei still und komm näher! Ich habe eine Nachricht für dich.«
Rotbert war immer ein guter und zuverlässiger Freund gewesen – so lange jedenfalls, bis sich fast alle, die im Gefolge des verstorbenen Majordomus geritten waren, auf Plektruds Seite geschlagen hatten.
Die mächtige Matrone in Colonia mit ihrer reichen, bis hin zur Mosel begüterten Verwandtschaft hatte sämtliche Trümpfe in ihrer Hand. Und einer davon war ihr unmündiger Enkel Theudoald, den sie gegen Recht und Gesetz zum Majordomus über das östliche Franken, von Friesland bis Metz und von Reims bis zum Main, erhoben hatte.
Karl näherte sich der Bohlentür. »Was willst du?«, fragte er noch einmal. »Und warum meldet sich einer von euch erst nach so vielen Monaten?«
»Es ging nicht anders«, antwortete der langjährige Getreue. Rotbert sah kränklich und so blass aus, als hätte er die Monate in feuchter Dunkelheit verbracht. Dabei besaß er einträgliche Ländereien und die Gerichtsbarkeit im Gebiet um Maastricht und im Haspengau. Dagegen konnte Karl von seinem geerbten Pflichtteil in der Nähe von Echternach und ein paar Rechten in verstreuten Walddörfern kein Gefolge, geschweige denn bewaffnete Reiter unterhalten.
»Hör mir jetzt zu, Karl!«, stieß Rotbert ungeduldig hervor. »Nur wenn du mitspielst, siehst du die Freiheit wieder.«
»Was soll das? Was habt ihr vor?«
»Du hast einen Gönner gewonnen, mindestens ebenso mächtig wie deine Stiefmutter …«
»Wer soll das sein?«, fragte Karl. »Etwa mein Taufpate, Bischof Rigobert von Reims?«
»Ach, der hält eigennützig zu Paris und den Neustriern.«
Karl schnaubte nur. Monatelang hatte sich niemand um ihn gekümmert, und nun kam Rotbert mit seltsamen Andeutungen.
»Was verlangst du von mir?«
»Du wirst morgen früh von Aquis grana nach Colonia gebracht. Plektrud befürchtet, dass entweder die Neustrier oder die Männer, die immer noch auf deinen Vater schwören, dich zu einem der Ihren machen.«
»Auf den Gedanken hätten sie bereits vor neun Monaten kommen können«, stellte Karl zornig fest.
»Weißt du denn nicht, was inzwischen passiert ist?«
»Ich weiß nur, dass ich ausgestoßen und enterbt bin.«
»Vergiss das jetzt, Karl! Nur dann kann ich dich morgen nach Colonia bringen lassen.«
»Und wozu?«, fragte Karl. »Kerker sind überall gleich.«
»Der Trupp, der dich zum Rhein bringt, wird von Alberich angeführt. Du kennst ihn ja.«
»Und ob ich diesen Erstgeborenen von Adela kenne!«, knurrte Karl abfällig. »Der ach so frommen Schwester meiner Stiefmutter! Ich dachte viel zu lange, dass Alberich und ich Gefährten sind.«
»Wir können Alberich wieder für uns gewinnen. Aber nur dann, wenn du ihm keine Schwierigkeiten machst. Wir wollen daher, dass du für eine Weile deinen Zorn und deine Wut bezwingst.«
»Was steckt dahinter? Was habt ihr mit mir vor?«
»Zunächst ein Schauspiel«, antwortete der Graf. »Das ist schon mehr, als ich dir sagen dürfte. Ich muss los. Die Wärter kommen … aber kein Wort zu ihnen!«
Der klare Augusttag hatte schon heiß begonnen. Er wurde unerträglich. Karl stöhnte leise, während sein Pferd wie zur Antwort schnaubte. Er spürte seine Hände kaum noch. Sie waren nur lose an den Sattel gefesselt, aber die Hitze, der Schweiß und die Bewegungen des Ritts kamen ihm längst wie eine Sklavenfolterung vor. Er ritt inmitten von einem Dutzend junger Männer. Sie gaben sich laut und mutig, obwohl sie die ganze Zeit einen gebührenden Abstand hielten.
Ohne große Erklärung hatten sie ihn abgeholt und waren zwischen den dicht bewaldeten Hügeln nach Osten geritten. Sie waren jung, gut bewaffnet und ritten auf Kaltblütern, die leichter aussahen als die Tiere jenseits des Rheins bei den Sachsen.
Nur langsam kamen sie voran, mieden die Reste der weiter nördlich gelegenen Römerstraßen und blieben im Halbdunkel unter dem Dach der hohen Wipfel von Buchen und Eichen. Gegen Mittag erreichten sie Wasserläufe, aus denen bereits die Römer frisches Wasser für ihre Grenzsiedlungen am Rhein gewonnen hatten – auch dann noch, als sie bereits die große Frischwasserleitung vom Nordrand der Ardennen bis nach Colonia gebaut hatten.
Karl sah, wie ein tief hängender Eichenzweig auf ihn zukam. Er wollte sich ducken, kam aber nicht tief genug. Das harte Laub peitschte über sein Gesicht, färbte es rot.
Sie hatten ihn am Morgen kurz in ein Thermebecken mit heißem, schweflig stinkendem Wasser eintauchen lassen und ihm dann neue Kleidung gegeben: ein ärmelloses, mit Kastaniensaft gefärbtes Hemd, lange Leinenhosen, einen Ledergürtel mit leeren Schlaufen an den Knoten, grünliche Wadenbinden und flache Lederschuhe. Seine eigenen Kleidungsstücke und das Schwert, das er bei seiner Festnahme getragen hatte, blieben verschwunden.
Plektruds Vasallen waren am Abend vor Weihnachten im Landgut Heristal an der Maas aufgetaucht – drei Wochen nach dem Tod seines Vaters. Seine Kinder schliefen bereits, als er friedlich mit seiner starken, bescheidenen Gemahlin Chrotrud zusammensaß. Kurz zuvor hatte sie einen Strauß aus Mistelzweigen für den heiligsten Tag des Jahres an das Holzkreuz der Wohnhalle gehängt. Jetzt war sie dabei, mit einem schmalen, armlangen Holzbrettchen die sieben Wollfäden für einen bunten Weihnachtsgürtel zu weben. Sie lächelte ihm zu und sang dabei leise das Lied von den mordwilligen Königinnen der Merowinger.
Karl fühlte sich warm und wohlig in ihrer Nähe. Er hatte sich gerade eine Damaszenerklinge mit ihrem eigenartigen Muster im Eisen aus einer gepolsterten Holztruhe am Rand der Wohnhalle genommen, als es geschah …
Sie hatten das schwere Haupttor aufgestoßen, waren an ihm vorbei bis zu Chrotrud gepoltert, hatten nach allen Seiten mit Äxten und Spathae gewütet und waren über ihn hergefallen, noch ehe er auch nur einmal die Damaszenerklinge im Feuerschein heben konnte. Bevor es dunkel um ihn geworden war, hatte er gewusst, wer hinter dem Überfall steckte …
Plektrud war gleich nach der Beerdigung ihres Gemahls Pippin II. auf dem Chèvremont östlich von Jupille nach Colonia weitergezogen. Dort, in der Hauptstadt des östlichen Frankenreiches, wollte sie weiterregieren, obwohl kein Gesetz – weder ein merowingisches noch eines der salischen oder ripuarischen Franken – der Witwe eines verstorbenen Majordomus das Recht dazu gab. Nach wie vor gehörte die Krone den Königen aus der Familie der Merowinger.
Bereits damals hatten sich die Stämme der Franken in zwei große Gruppen gespalten, die sich auf den Katalaunischen Feldern an der Marne im Kampf Römer gegen Hunnen feindlich gegenübergestanden hatten. Die vom Rhein stammenden Franken hatten zusammen mit Attila gekämpft und dabei ihr Anrecht auf den fränkischen Thron verloren. Ein anderer Stamm aber, der auf der Seite des untergehenden Römischen Reiches gestritten hatte, war zum Stammvater und Ahnherrn der Merowinger geworden.
Und doch hatte sich das Blatt schon bald erneut gewendet. Als die Merowinger sich selbst zerfleischten und Hilfe bei neuen Anführern suchten, waren es die Hausmeier aus der Familie der Pippine gewesen, die zunächst als Erzieher der Königskinder und Hausverwalter der Königinnen und dann als die eigentlichen Herrscher die Macht übernommen hatten.
Pippin der Ältere hatte zusammen mit Bischof Arnulf von Metz und zehn anderen Schiedsmännern des Adels Chlothar II. in das Königreich Austrasien geholt. Bereits sein Sohn Grimoald machte den großen Fehler, zu früh nach der ganzen Macht in der Francia zu greifen. Er ließ seinen Sohn von einem Merowinger adoptieren und unter dem Namen Childebert ein Jahr lang König sein. Der Versuch, der einem Staatsstreich gegen die herrschende Dynastie gleichkam, war furchtbar ausgegangen. Doch auch der zweite Anlauf endete anders als vorgesehen.
Karl dachte daran, warum sein Vater die mächtigste und reichste aller Frauen geheiratet hatte. Alles schien bestens geregelt. Doch dann starb sein erster Sohn Drogo als Herzog der Champagne. Sein zweiter Sohn Grimoald war noch Majordomus geworden, aber er starb wenige Monate vor seinem Vater. Übrig blieben nur zwei Männer, die den Makel trugen, keine Nachkommen der reichen und stolzen Plektrud zu sein: Der eine war der oft wankelmütige Hitzkopf Hildebrand, von Pippin mit einer burgundischen Konkubine gezeugt. Der andere war er selbst – aus Pippins Zweitehe, die nach fränkischem Recht anerkannt war, doch in den Augen von Plektrud nichts galt.
Der Trupp verließ den Wald und ritt in das weite, flache Land. Sie blieben weit von der Römerstraße entfernt und überquerten eine Weile später den kleinen Fluss Erft.
Karl sah auf den schon abgeernteten Feldern zwischen Waldstücken nur hin und wieder ein paar Hörige mit ihren Familien. Sie klaubten die Reste der Ähren auf, die bei der ersten Mahd zu Boden gefallen waren. Die Reiter wagten sich jetzt dichter an ihn heran – ganz so, als fürchteten sie, dass Karl kurz vor der Stadt noch einen Fluchtversuch wagen könnte.
Die Mittagsstunde war bereits vergangen, als Alberich dicht neben Karl ritt und ihm einen Wasserbeutel reichte. Karl trank und bedankte sich.
»Ich weiß nicht, ob du dich wohl bei dem fühlst, was du hier mit mir machst«, sagte er eher sachlich als vorwurfsvoll. »Ich weiß, dass es nicht genug Gold oder Silber gibt, um damit den Stolz und die Ehre eines Mannes wie dir zu kaufen. Doch gerade deshalb möchte ich wissen, warum du zum Erfüllungsgehilfen deiner Tante geworden bist.«
»Ich wusste, dass du das fragen würdest«, antwortete Alberich und legte seine Hand auf den Griff seines Kurzschwertes. »Aber ich kann und will dir nicht darauf antworten!«
Karl wunderte sich, wie leer und verlassen die ganze Gegend auch noch kurz vor den Stadtmauern Colonias wirkte. Die einstmals mächtige, von vielen Tausend Einwohnern besiedelte Stadt hatte fast alle Hinweise auf ihre frühere Größe verloren. Die Franken waren eigentlich nur späte Gäste in der ehemaligen Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Ebenso wie in der früheren Kaiserstadt Trier lebten in Colonia nur noch ein paar Tausend Menschen. Doch nutzten auch sie die alten Regierungs- und Verwaltungsgebäude.
Die Pferde der kleinen Gruppe mit dem Gefangenen in ihrer Mitte folgten für eine Weile der alten Römerstraße, die in einem großen Stadttor in den Decumanus Maximus überging. Colonia war nicht anders gebaut als Dutzende von ähnlichen Städten überall im früheren Imperium Romanum. Wie alle Franken empfand Karl auch jetzt noch eine heimliche Scheu vor dem künstlichen Gebirge aus behauenen Steinen. Mit klappernden Hufen ritten sie durch die breite Ostweststraße, die von Hausfront zu Hausfront gut zweiunddreißig Schritt maß. Überall waren Mauern eingestürzt und Steinquader herausgebrochen worden. Dort, wo einst Klammern aus Eisen und Kupfer Stein und Gebälk zusammengehalten hatten, waren jetzt nur noch dunkle Löcher zu sehen, aus denen Rostnasen sickerten. Die meisten Flächen waren von Buschwerk und Birken, dem Unkraut des Waldes, überwuchert. Es gab schon lange niemanden mehr, der sich um die Pflege der Straßenplatten, der Dächer und der Kanalisation kümmerte.
Sie ritten über den ehemaligen Forumsplatz, ließen die Ruinen der früheren Thermen an der Südseite des Platzes hinter sich und ritten auf das praetorium zu.
Irgendwie erinnerte Karl das zweistöckige Gebäude mit dem immer wieder nur notdürftig geflickten Ziegeldach an ein flaches Kirchenschiff ohne Turm. Bereits als Halbwüchsiger hatte er zusammen mit seinen Spielkameraden in großen Schritten die langen Fronten der Gebäude ausgemessen. Die regia oder »der Palast«, wie sie damals gesagt hatten, maß an der Rheinseite über neunzig Schritte – und das bereits ohne die Hofräume und Gemächer an den Seiten. Das große Oktogon in der Mitte des Gebäudes war sein Empfangssaal und gleichzeitig Ausstellungsraum für den Königsschatz gewesen. Obwohl Karl fast alle Räume des praetoriums kannte, empfand er es plötzlich als hart und abweisend in seiner römischen Symmetrie und Ebenmäßigkeit.
Zum ersten Mal nach langem Schweigen führte Alberich sein Pferd neben Karl: »Wir melden uns hier nur zurück, ehe wir dich zu deinem neuen Kerker unter der Kirche St. Maria im Kapitol bringen.«
»Warum das?«, fragte Karl spöttisch. »Hat dieses hasserfüllte Weib Plektrud hier keine Räume mit festen Türen und ausreichend Bewaffneten?«
»Plektrud zieht ein Dutzend guter Männer den vielen vor, die hier nur saufen und herumlungern.«
Im selben Augenblick erkannte Karl, was Alberich meinte. Wie auf ein geheimes Kommando hin tauchten von allen Seiten Männer in Waffen auf. Es war, als hätten sie sich nur deshalb hinter Mauern und Fensteröffnungen, Torbögen und Arkadenpfeilern zurückgezogen, um die kleine Gruppe mit dem ältesten noch lebenden Sohn Pippins passieren zu lassen.
Handwerker, Flussleute und Händler drängten sich vor, um den Einzug des lange verschollenen Gefangenen zu sehen. Einige winkten ihm verstohlen zu, ehe sie wieder im Schatten der Häuser verschwanden. Die meisten aber starrten ihn nur an und verfolgten mit ihren Blicken die bewaffnete Eskorte, die Karl bis vor den Haupteingang des praetoriums geleitete.
Zehn, zwanzig Adlige aus Plektruds Hofstaat kamen zwischen den Säulen des dreifachen Haupteingangs hervor und bildeten ein Spalier. Karl richtete sich so hoch auf, wie es seine an den Sattel gefesselten Hände zuließen. Er nahm die Schultern zurück, schüttelte den Kopf, um seine blonden Haare fliegen zu lassen, und zeigte seine Zähne. Nach all der Kälte und Dunkelheit im Verlies von Aquis grana brannte seine Haut, und er war sicher, dass er nicht krank und blass, sondern so stark und hitzig aussah, wie es sein Stolz und sein Ruf erforderten.
»He, Plektrud!«, rief er, so laut er konnte. »Hier kommt der Kerrl … Karl, Pippins Sohn, vor dem du dich mehr fürchtest als vor dem Leibhaftigen!«
Nur zwei Stunden später, als die letzten Strahlen der untergehenden Sonne die östliche Rheinseite in warmes Rot tauchten, begriff Karl, dass er umdenken musste.
Noch als seine Hände vom Sattel gelöst wurden, hätte er schwören können, dass nichts auf der Welt seinen Zorn auf Plektrud bändigen konnte.
Doch dann war seine Frau Chrotrud vor den Säulen des praetoriums erschienen, den neunjährigen Karlmann und die sechsjährige Hiltrud an ihrer Seite. In ihren Armen hatte sie den jüngsten Sohn getragen. Sie waren bis an sein Pferd herangekommen, dann hatte Chrotrud den Kleinen zu ihm hochgehalten. »Er heißt Pippin III. – nach deinem Vater und Großvater. Erzbischof Willibrord von Utrecht hat ihn zu Ostern auf diesen Namen getauft.«
Nun saßen sie auf dem ehemaligen römischen Kapitolshügel. Er fiel zum Rhein hin ab und war noch immer mit einer breiten Freitreppe verziert. Hier, im Südosten der Stadt, wo die südliche Stadtmauer in die Flussbollwerke überging, hatten bereits die früheren Herrscher der ripuarischen Franken ihren Wohnsitz gehabt und dafür den Tempel der Trias aus den Göttern Jupiter, Juno und Minerva zu ihrer eigenen Pfalz umgebaut.
Mit allem anderen hatte er gerechnet – aber nicht damit, dass die verhasste Stiefmutter ihn zusammen mit ihren engsten Beratern zu einem Abendessen auf die Terrasse des Kapitols laden würde …
Im Lärm des Festmahls unter freiem Himmel kamen die Bilder der Erinnerung vollkommen ungeordnet über Karl. Ihm war, als würde alles, was er je gesehen oder auch gehört hatte, wie Reihen von Bewaffneten an ihm vorüber zu einer Märzversammlung ziehen.
Er blickte über den Rhein hinweg und erkannte die Reste der Brücke, die Kaiser Konstantin, der Schöpfer Konstantinopels, vor vierhundert Jahren selbst eingeweiht hatte. Der Mundschenk Plektruds ließ neuen Wein in seinen kostbaren Römerkelch eingießen. Karl dankte mit einer schweren Handbewegung. Dabei blickte er auf das breite Band des Flusses und auf die fest im Hafen vertäuten Schiffe friesischer Händler.
Karl schloss für einen Moment die Augen. Er spürte das Glühen des ungewohnten Weines und die Hitze des langsam vergehenden Augusttages in allen Fasern seines Leibes. Seine Haut brannte, und sein Bauch war voll vom ungewohnt schweren Braten. Auf seinen Lippen schmeckte er noch immer die in Wacholderbutter gebackenen Krammetsvögel mit ihren von Federn und Krallen befreiten und über Kreuz durch die Augenhöhlen gesteckten Füßen. Er hörte die Stimmen um sich herum, erkannte die helleren seiner eigenen Kinder, die seiner Stiefmutter, seiner vier Stiefneffen und den weithin dröhnenden Bass von Rigobert, dem Bischof von Reims.
»Ich sage euch noch einmal: Ihr müsst den Neustriern ein Angebot machen«, forderte Rigobert wie von der Kanzel herab. »Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass hier im Ostteil des Reiches erstmals eine hochedle Frouwe regiert, wenn auch im Namen eines erst siebenjährigen Majordomus.«
Karl fuhr zusammen. Im ersten Augenblick glaubte er, nicht recht gehört zu haben. Dann lachte er kurz. Es klang wie der Beuteaufschrei eines Falken. Sie hatte es getan! Sie hatte es tatsächlich getan!
Schon als die schwere Krankheit seinen Vater anfiel, hatte Karl von Plektruds weitreichenden Plänen gehört. Man munkelte, dass nicht die Söhne seines kurz zuvor verstorbenen Stiefbruders Drogo die Nachfolge antreten sollten, sondern ihr Enkel – der uneheliche Grimoaldsohn Theudoald.
Wie konnte sie einen siebenjährigen Bastard zum Majordomus ernennen? Karl stöhnte unwillkürlich. War er selbst nicht weitaus näher an der Erbfolge?
Karl öffnete die Augen und blinzelte zu Chrotrud hinüber. Auch ohne Worte wussten sie, dass sie sich aufeinander verlassen konnten. Und plötzlich freute Karl sich darüber, dass es sie gab. Chrotrud war eine einfache, aber sehr schöne junge Frau aus einer kleinen Siedlung zwischen Lüttich und Maastricht. Er liebte ihr schweres weizenblondes Haar und auch den kräftigen Körperbau, den es im Grenzland von Toxandrien, zwischen den Friesen und Franken, häufiger gab.
Ihre Familie war mit der seiner eigenen Mutter Alphaid seit Generationen befreundet. Sie waren erdverbundene, zuverlässige Nachbarn und eher bäuerlich als kriegerisch.
Ihr Jüngster und die sechsjährige Hiltrud nahmen nicht am Abendessen teil. Nur Karlmann mit seinen neun Jahren hatte dabei sein dürfen – ebenso wie Theudoald.
Mit seinen halblangen rotblonden Wuschelhaaren sah Karlmann bereits aufmerksam und verständig aus. Er verfolgte die Gespräche der Erwachsenen mit hellen blauen Augen, die er von seinem Vater geerbt hatte. Theudoald hingegen, dessen ebenfalls blonde Haare so lang und glatt wie möglich bis zu den Schultern gekämmt waren, rekelte sich gelangweilt in seinem Prunksessel. Er schien nicht einmal zu ahnen, welche Bedeutung die ihm übertragenen Ämter und Titel besaßen. Trotzdem bewachte ihn die Witwe seines Großvaters wie einen lebenden Kronschatz. Sie stand bereits in der Mitte der Sechziger, doch ihrer herben Strenge entgingen kein Wort und keine Bewegung des Jungen.
Karl überlegte, ob er Plektrud eher mit Juno oder Minerva vergleichen sollte. Ihr Gesicht wirkte so unnahbar, als sei es ebenfalls aus Stein gehauen. Karlmann stand auf und kam auf Karl zu. Chrotrud wollte ihn zurückhalten, doch Karlmann duckte sich und entschlüpfte ihrem Griff. Karl sah, wie Plektrud sich unwillkürlich aufrichtete. Wachsam wie das Weibchen des Adlers ließ sie ihren Blick von einem zum anderen zucken, während ihre Lippen schmaler und die schrägen Kerben an den Mundwinkeln tiefer wurden. Karl sah, wie ihre Nasenflügel bebten.
Er wehrte sich dagegen, dass sich die Müdigkeit wie eine durchnässte, immer schwerere Pferdedecke über ihn legte. Alles blieb dunkel und undurchsichtig. Ihm fehlten die Monate, die er, von jeder Nachricht abgeschnitten, im stinkenden Kerker von Aquis grana verbracht hatte. Nur eins war ihm klar: Er durfte auf keinen Fall gegen den Rat von Graf Rotbert verstoßen, aufspringen und alles zerschlagen.
Schon dadurch, dass Plektrud seine Frau und seine Kinder nach Colonia geholt hatte, war er viel besser und geschickt er gefesselt als durch Eisen und Ketten. Er musste sich einfach beherrschen. Auch wenn das Blut ihm wieder und wieder bis in den Kopf schoss und in den Schläfen hämmerte.
Er atmete tief durch und hörte, wie auf der anderen Seite des Tempels Musikinstrumente angespielt und noch mehr Spießbraten mit klirrenden Messern verteilt wurde. Plektrud schien sehr gut zu wissen, wie sie Anhänger und Vasallen, Krieger und Knechte bei Laune halten konnte.
Vielleicht war es diese Bequemlichkeit, dachte Karl, dass keiner der Anhänger Pippins den Aufstand geprobt hatte, als seine Witwe das Regiment übernahm.
Er wusste nicht genau, was in den vergangenen Monaten tatsächlich geschehen war. Er hatte nur gehört, dass es vor knapp einem Monat in den bewaldeten Hügeln bei Compiègne nördlich von Paris zu erbitterten Kämpfen gekommen war. Nur unter großen Verlusten und mit sehr viel Mühe war es den Männern von Colonia gelungen, ihren kindlichen Anführer Theudoald in Sicherheit zu bringen.
Im Siegesrausch hatten sie sofort einen neuen Majordomus für Neustrien gewählt. Sie hatten sich für den starken und mächtigen Raganfrid mit der zerbissenen Lippe entschieden. Es gab viele Gerüchte darüber, wer ihm die Oberlippe mit einer schrägen Narbe verziert hatte. Manche behaupteten, es sei ein vergifteter Wolfszahn in einer Vollmondnacht gewesen, andere schworen, er hätte sich seine Scharte von einer Bauerntochter geholt, die sich vor seinem behaarten Bauch ekelte. Des ungeachtet besaß Raganfrid nicht nur weite Ländereien nördlich von Paris, sondern auch Fischereirechte, große Wälder, Dörfer mit Hörigen und Sklaven und Äcker mit Weinstöcken in Richtung Marne.
Plektrud hatte sich eine ganze Weile die streitenden Männer angehört. Einige wollten die Friesen zu Hilfe holen, andere die Sachsen. Sie hob die linke Hand. Sofort verstummten alle Gespräche. Die Männer blickten sie an.
»Ich bin nicht bereit, auf kindische oder lächerliche Vorschläge zu antworten«, sagte sie mit harter Stimme. Sie sprach nicht besonders laut, doch ihre Augen wurden klein, und die Falten ihres Gesichtes strafften sich, während sie redete: »Es ist viel zu gefährlich, Alamannen oder Baiuwaren, Sachsen oder Friesen zur Verstärkung heranzuholen. Ebenso könnten wir die Herrscher der sieben britischen Königreiche, die Dänen oder die Langobarden um Hilfe bitten.«
Sie zog die Mundwinkel herab und blickte unverwandt auf Karl. Er wusste nicht, was sie beabsichtigte.
»Warum siehst du mich so an?«, schnaubte er. »Ich bin der Einzige, der sich an eurer Niederlage nicht beteiligt hat.«
Sie lachte kurz. »Du bist der Mann, der zwischen mir und diesem bauchhaarigen Wolfsopfer Raganfrid das Zünglein an der Waage spielen kann.«
»Ich war noch nie ein Freund der Neustrier.«
»Du warst auch mir kein Freund …«
»Ich bitte dich, Plektrud«, unterbrach Bischof Rigobert von Reims. »So kommen wir nicht weiter. Die Sachsen sind in Hatuarien bei Xanten über den Rhein gekommen. Von Westen her wurden die ersten Neustrier bereits an der Römerstraße zwischen Maastricht und Jülich gesichtet. Und am Niederrhein ruft Fürst Radbod seine Friesen zu den Waffen.«
»Ja, auch Fürst Radbod ist dabei«, zürnte die Witwe Pippins. »Er hatte ja nur eine unfruchtbare Tochter für Grimoald, meinen Sohn. Wenn auch von ihm hier Enkel sitzen würden, wäre er ein Verbündeter und kein Kumpan der Neustrier …«
Karl hatte Mühe, sich nach dem langen Tag noch länger wach zu halten. In seinen Armen, seinen Beinen, seinem Kopf kämpfte Schwäche gegen das erste Fieber. Der Ritt durch die Augustsonne war ihm viel schlechter bekommen, als er sich eingestehen wollte. Wie gern wäre er jetzt mit einem satten Seufzen an Chrotruds Brust gesunken, hätte sie in den Arm genommen und wäre wie ein Kind neben ihr eingeschlafen. Er ahnte nicht, dass er in diesem Augenblick genau den Eindruck machte, den seine Stiefmutter sorgfältig vorgeplant und eingefädelt hatte.
Er griff mit beiden Händen nach dem Rand des Bohlentischs, spürte erneut den Blick von Plektrud, sah ihre leicht herabgezogenen Mundwinkel – sah den Triumph in ihren Augen. Karl hatte einfach keine Kraft mehr. Und wie so viele andere beim Gelage rutschte er zum ersten Mal in seinem Leben besinnungslos unter den Tisch.
2
Flucht aus dem Kapitol
Tote und Lebende kämpften miteinander, Männer und Frauen, Kinder und Greise. Dazwischen Bischöfe und Skelette rasender Wolkenschiffe und die Erdwichtel, die sich nach dem Abzug der Römer in jeder der unterirdischen Heizungsanlagen versteckt hielten, um von dort aus ihren Schabernack bis in die Hütten und Häuser der Menschen zu treiben.
Karl hatte das Gefühl, als zerspränge sein Schädel im Lärm und Getöse, im Schlachtengetümmel der Geister und Dämonen wieder und wieder in tausend Stücke.
Mühsam versuchte er, sich aufzurichten, rutschte an einer glatten Steinwand hoch und befühlte mit seinen Händen den schmerzenden Schädel. Gleichzeitig erkannte er, dass die große Schlacht nicht um ihn herum, sondern in seinem Kopf stattfand.
Er wollte aufwachen, herausfinden, wo er war. Seine Gedanken rasten durcheinander, doch irgendetwas fehlte ihm. Er blieb mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt stehen, schnaufte und kämpfte gegen das Feuer, das wieder und wieder durch seinen Körper brandete.
Sie hatten ihn eingesperrt – erneut in die Nacht geworfen! Er spürte die Nähe von Wasser. Es stank nach Fisch, saurem Wein und nach Weihrauch. Was war geschehen?
Welches Unterpfand und welche Geisel konnte er für sie sein? Hatte sie wirklich befürchtet, er könnte in Aquis grana von den Neustriern befreit werden, um gemeinsame Sache mit den verfeindeten westlichen Franken zu machen? Karl spürte, dass ihm das Denken immer noch schwerfiel. Er kam einfach nicht dahinter, warum er innerhalb weniger Stunden aus seinem Gefängnis geholt, am Tisch der Noblen betrunken gemacht und anschließend wieder in ein Verlies geworfen worden war.
Sie hatte das Naheliegende nicht getan. Je klarer ihm wurde, dass er die Stiefmutter noch immer nicht durchschaute, umso besorgter wurde er.
Er richtete sich ächzend auf und wankte ein paar Schritte hin und her. Erst jetzt bemerkte er, dass sein neues Verlies nicht vollkommen dunkel war. Er sah Schatten von Säulen inmitten eines tonnenförmigen Gewölbes. An der Schmalseite drang etwas Licht durch einen Schacht. Und plötzlich wusste er wieder, wo er war.
Er erinnerte sich an die aufregende Zeit, kurz bevor er mit fünfzehn Jahren nach fränkischem Recht volljährig geworden war. Damals waren er, der dürre Rotbert und ein paar andere Freunde tagelang durch die verlassenen, von Gebüsch überwucherten Ruinen Colonias gestreift, während ihre Väter im praetorium um Recht und Verträge, Krieg und Frieden rangen.
Karl hatte miterlebt, wie seine Stiefmutter innerhalb der Mauern des früheren römischen Kapitols ein Stift errichtet hatte, das ausschließlich Mädchen von nobler Herkunft und Gesittung aufnehmen sollte. Er grinste, als im wieder einfiel, wie sie sich vor gut zehn Jahren abends versteckt hatten, um zu beobachten, wie die Mädchen nach ihren Nachtgebeten zu Bett gebracht wurden.
Er lehnte sich mit dem Rücken an die Wand unter dem Lichtschacht. Der tonnenförmige Raum war damals eines der vielen Verstecke und Höhlenlager der Jungen gewesen. Irgendwo in der Mitte hatte ein halb verbogener römischer Reiseofen gestanden. Karl erinnerte sich noch gut an den geflochtenen Korb aus Eisenbändern, der so über einem Dreibein angebracht war, dass er mit einem einzigen Handgriff flach zusammengelegt werden konnte. Der Ofen war ihr Lagerfeuer in all den Stunden gewesen, in denen sie hier unten zusammengehockt und von den großen Taten geschwärmt hatten, die jeder von ihnen einmal vollbringen wollte.
An diesem Punkt seiner Erinnerungen hielt Karl unwillkürlich die Luft an. War es wirklich ein Zufall, dass er jetzt ausgerechnet in diesem Raum gefangen gehalten wurde? Jetzt fiel ihm wieder ein, woran er viele Jahre lang nicht gedacht hatte. Es gab ein Geheimnis, das nur er, Rotbert und drei, vier andere kannten. Sie hatten sich damals geschworen, dass keiner darüber sprechen würde – es sei denn, wenn einer von ihnen in Lebensgefahr schwebte.
Karl atmete ganz langsam ein und aus. Er spürte, wie er zunehmend ruhiger und kühler wurde, wie sein Kopf und sein Verstand sich langsam klärten. Ja, das konnte es sein! Warum hatte der schmalbrüstige Rotbert gesagt, er solle sich nicht dagegen wehren, nach Colonia überführt zu werden? Warum war er von all den Möglichkeiten, die es in Colonia gab, ausgerechnet in diesen Kellerraum gebracht worden?
Karl stieß sich von der Mauer ab. Er stürzte an den ersten zwei Säulen vorbei bis in eine Ecke, in der auch nach so langer Zeit noch staubige Steintrümmer lagen. Im Halbdunkel des Kellergewölbes sahen sie ganz so aus, als wären sie seit Jahrhunderten nicht mehr bewegt worden. Karl wusste es besser! Hier, genau hier lag der Schlüssel für das Geheimnis, das sie vor gut zehn Jahren gemeinsam entdeckt hatten …
Er war ungeduldig, als er versuchte, einen der schweren Steinquader zu heben. Er keuchte und mühte sich mehrmals vergeblich. Bis ihm wieder einfiel, wie sie es damals gemacht hatten. Sie waren mehrere gewesen, doch diesmal musste er es allein schaffen!
Er überlegte einen Moment. Dann stellte er sich breitbeinig über den Steinblock, nahm einen faustgroßen Steinbrocken und klemmte ihn unter sein Kinn. Er neigte sich vor, bückte sich und griff mit beiden Händen unter das große Trümmerstück. Mit einem Ruck hob er es an. Gleichzeitig hob er etwas den Kopf und ließ den Steinbrocken unter seinem Kinn nach unten fallen. Er traf den Spalt und verschwand. Karl klaubte weitere Steine zusammen und schob sie in die entstandene Höhlung – so lange, bis der leicht schräg liegende Stein fest verkeilt war. Er wollte gerade darangehen, den stützenden Trümmerberg aus kleineren Steinen wegzuräumen, als er ein Geräusch an der Tür hörte. So schnell wie möglich wankte er zum steinernen Bogen, der den Ausgang des Kellergewölbes bildete.
»Mach keinen Unsinn, Karl!«, rief eine Stimme von draußen. »Vier Männer stehen hier mit erhobenem Schwert, und weitere vier werden dich mit ihren Lanzen aufspießen, falls du versuchen solltest, die Tür aufzustoßen und mich zu überrennen.«
»Ihr wisst, dass ich das nicht tun würde«, antwortete Karl erschöpft.
»Wir bringen dir etwas zu essen und zu trinken«, antwortete Alberich. »Außerdem soll ich dir im Auftrag von Plektrud sagen, dass eine Flucht sinnlos wäre. Dein Freund Rotbert ist schon im frühen Morgenrot mit seinen Spießgesellen an der Südmauer gefangen worden.«
»Graf Rotbert gefangen?«
Karl spürte, wie ihm übel wurde. Ein großer Schlüssel schob den sehr alten Türriegel zur Seite. Er kniff die Augen zusammen und blinzelte in den Schein der Fackeln. Er brauchte lange, bis er Alberich und die Männer dahinter deutlicher sah.
»Der spacke, stinkende Graf Rotbert lebt«, sagte Alberich und schnippte mit den Fingern. Einer der Männer hielt Karl einen Wasserkrug hin. Ein anderer reichte ihm einen Lederbeutel mit harten Brotstücken, Nüssen und Scheiben von Trockenfrüchten, wie er üblicherweise an Pferdesätteln hing.
»Was ist geschehen?«, fragte er, hob den Wasserkrug und nahm einen tiefen Schluck. Das Wasser schmeckte nicht nach Schwefel.
»Wir nehmen an, dass der schmale Rotbert versuchen wollte, dich hier herauszuholen«, antwortete Alberich sachlich.
»Das wäre dumm von ihm gewesen.«
»Ja«, sagte Albereich abfällig. »Jedermann wusste, dass er es versuchen würde. So aber hat er einige gute Männer verloren und Plektrud nur dazu gebracht, deine Frau und deine Kinder noch besser zu verstecken.«
Karl presste die Lippen zusammen, dann nickte er. »Dieses verdammte Weib!«
»Ich fürchte, du begreifst noch immer nicht, was wirklich los ist«, antwortete Alberich nachsichtig. »Plektrud hat nur noch Colonia und ein paar Güter hier zwischen Rhein und Maas. Sie weiß genau, dass sie im Augenblick schwächer ist als die Neustrier im Westen. Sie kann sich nicht mehr auf die Edlen Austriens verlassen. Und sie muss fürchten, dass du es bist, der ihr am gefährlichsten werden kann.«
»Na und?«, fragte Karl. »Was will sie tun? Mich langsam aushungern und verderben lassen? Meine Familie zur Fronarbeit auf ihre Felder schicken? Sollen wir alle in den Wäldern Bucheckern sammeln? Was kann sie denn gewinnen, wenn sie uns alle umbringt?«
»Denk doch mal andersrum«, sagte Alberich. »Was hätte sie davon, wenn sie es nicht tut?«
Noch in derselben Nacht, als Fledermäuse durch die Ruinen der alten Stadt strichen und in den Wäldern südlich der Stadtmauern Käuzchen und Nachtgetier Laut gaben, löste sich ganz langsam ein kleiner Nachen vom Ufer jenes Rheinarms, der seit Jahrhunderten den schützenden Hafen von Colonia bildete. Das Boot fuhr einige Hundert Schritt flussaufwärts, ehe es den schneller fließenden Hauptstrom erreichte. Aber es bog nicht nach Osten ab, nicht hinüber zur sächsischen Seite mit seinem längst verfallenen Kastell Divitia. Es blieb vielmehr dicht am Uferschilf. Mit starken, dennoch lautlosen Bewegungen der mit Werg umwickelten Ruder glitt es stromaufwärts.
Der Schein des zunehmenden Halbmondes wanderte an weiß gezackten Rändern der schwarzen Nachtwolken entlang. Sie bedeckten ihn fast vollständig, und nur gelegentlich ließ ein Loch in den Wolken den Fluss und die Ufer ein wenig heller werden. In diesen Momenten bewegte sich nichts mehr in dem kleinen Nachen, der ein Stück der gerade geruderten Strecke flussabwärts trieb.
An einer dunklen Stelle bog der Kahn in einen Bach ein, der von Westen her in den Rhein mündete. Hier war das Ufergebüsch so dicht, dass die Schatten im Boot keine Entdeckung mehr fürchten mussten. Die Ruderschläge wurden schneller, und das Wassergefährt legte am südlichen Ufer des Baches an.
Für eine Weile blieb alles still. Dann teilten sich die Zweige. Kräftige Hände halfen erst einer dunklen Gestalt ans Ufer, dann zwei kleineren. Andere Schatten kletterten vorsichtig in das kleine Boot. Der Ruderer stieß es vom Ufer ab und ließ es mit der leise glucksenden Strömung des Baches in das große Wasser zurückschwimmen.
Nur wenig später war alles am Hafen von Colonia wieder so still wie zuvor. Niemand hatte bemerkt, dass sich mit dem kurzen Austausch von verhüllten Menschen alles erneut verändert hatte.
Karl stand auf, reckte sich und ging mit schmerzenden Gliedern näher zum Licht. Er wusste sehr gut, wie sein Vater damals in der Nähe von Sankt Quentin über die Neustrier gesiegt hatte. Wieder und wieder war an den abendlichen Feuern erzählt worden, wie Theuderich II. samt seinem Königsschatz in die Gewalt des Hausmeiers geraten war.
Die Tochter des Besiegten war Pippins Schwiegertochter geworden. Aber auch er selbst gönnte sich eine besondere Belohnung, indem er Alphaid heiratete und zu seiner zweiten Frau machte. Und um auch an anderer Stelle klarzustellen, wer jetzt das Schwert der Franken führte, griff Pippin auch noch Fürst Theodo in Baiern an.
Ein Jahr später war Karl geboren worden. In diesen Jahren vergab Pippin Bistümer und Abteien an seine Gefolgsleute. Er konnte ihnen mehr bieten als die Merowingerkönige, die kaum noch Ländereien und nur noch wenige Fiskalgüter in ihrem Kronschatz hatten.
Als Dreizehnjähriger hatte Karl miterlebt, wie sein Vater in der Blüte seiner Macht seine Ländereien unter seinen drei legitimen Söhnen aufteilen wollte. Zu diesem Zeitpunkt war der schon lange schwelende Hass Plektruds offen ausgebrochen. Sie ließ verbreiten, dass Karls Mutter sich bei Pippin eingeschlichen hatte, als sie selbst mit ihren Schwestern Gertrud, Bertrada und Adela zu einem Familientreffen auf ihrer Stammburg in der Nähe von Prüm gereist war. Ihre Beschuldigungen wurden so heftig, dass sogar Bischof Lambert von Maastricht ihre Partei ergriff und sich gegen Alphaid und Karl wandte.
Karl war zu jung gewesen, um sich mit einem Bischof anzulegen. Ohnmächtig musste er zusehen, wie seine Mutter immer mehr verkümmerte, abmagerte, in sich ging und schließlich niemanden mehr sehen wollte. Schließlich kamen der Bischof ebenso wie sein Onkel Dodo, der Verwalter der Königsgüter in der Nähe von Lüttich, und verschiedene andere von den Waldsiedlungen rechts und links der Maas mit bewaffnetem Gefolge zum Gottesdienst. Doch irgendwann lief der Leidenskelch über.
Dann, als Lambert erneut die Ehre von Karls Mutter angriff, kam es zum Eklat. Zwei Neffen des Bischofs erschlugen noch in der Kirche zwei Männer seines Onkels, der nur knapp entkommen konnte. Bereits am folgenden Sonntag kehrte Dodo zurück. Diesmal war er der Stärkere. Er selbst hob den Speer, als Lambert in vollem Ornat vom Altar zur Kanzel ging. Der Bischof kam nicht mehr dazu, Karls Mutter erneut eine Hure zu nennen, die nach altem Recht eine Nebenfrau Pippins war. Er brach direkt neben dem steinernen Taufbecken in seinem Blut zusammen.
Im selben Jahr war Karl volljährig geworden. Er konnte seine Gespielin Chrotrud in der Familienpfalz Jupille zwischen der Maas und den nach Osten hin steil und waldig aufsteigenden Hügeln der Ardennen heiraten. Kurz darauf, im Mai des Jahres 706, wurde sein erster Sohn Karlmann geboren.
Zu dieser Zeit lebte Karls Mutter Alphaid nicht mehr, und ihre Familie war längst geächtet. Die meisten wussten, dass hinter all dem eine ganz andere Frau stand: Plektrud, die mächtige Schwester der frommen Adela von Pfalzel. Um Frieden über die vielen Gerüchte und Geschichten zu legen, verschenkten Pippin und Plektrud am 20. Mai desselben Jahres ihre sämtlichen Anteile am Kloster Echternach an Willibrord. Jedermann wusste, dass diese Schenkung eine Art Buße für Pippins zweite, nach christlichem Brauch nicht zulässige Ehe war.
In den folgenden Jahren war Karl viermal mit seinem Vater, den Großen Austriens und einigen Tausend fränkischen Kriegern zu Fuß gegen die Alamannen gezogen. Bereits beim ersten Zug war der Alamannenherzog Gotefrid durch das Schwert umgekommen. Pippin wollte nicht, dass der starke, tödliche Schlag seinem Sohn Karl zugerechnet wurde. Er verbot allen, die es gesehen hatten, darüber zu reden.
Aber auch wenn ihm dieser Befehl noch gelang, war er nicht mehr stark genug gewesen, um sich gegen den Verfall seines Einigungswerkes zu wehren. Noch einmal setzte er überall neue Bischöfe ein, gründete Klöster und verschenkte Land an die Kirche.
Zu Beginn des vorangegangenen Jahres war der fromme Grimoald gekommen, um seinen schwer kranken Vater zu besuchen. An seinem Bett gaben sich die Stiefbrüder die Hand. Anschließend waren sie zusammen zur neuen Lambert-Basilika nach Lüttich geritten, um dort für Pippin zu beten. Darüber hinaus wollten sie sehen, wie die Kirche ausgestattet war, in die der Körper des Märtyrers Lambert einmal überführt werden sollte. Doch dann war etwas geschehen, womit niemand rechnen konnte.
Noch während der Besichtigung, an einem ganz normalen Wochentag, kam ein Mann auf die versöhnten Brüder zu. Weder Karl noch Grimoald kannten den Fremden. Noch ehe sie ihn begrüßen und befragen konnten, riss der andere sein kurzes zweischneidiges Schwert hervor und stach Grimoald so hart durch die Brust, dass die Schwertspitze fast ohne Widerstand gleich aus dem Rücken fuhr. Er ließ sein Schwert stecken und verschwand so schnell, dass weder Karl noch irgendein anderer ihn einfangen konnten.
Viel später erst und durch die Prüfung der Mordwaffe kam heraus, dass dieser Mann namens Randgar zu den Friesen von Herzog Radbod gehörte, die mit den Neustriern im Westen verbündet waren.
Nur wenige Tage später schenkten Pippin und Plektrud in ihrer Trauer dem Kloster Echternach weitere Ländereien. Da Pippin zu krank war, beauftragte er Plektrud, die Schenkungsurkunde ohne ihn zu unterzeichnen.
Pippins Krankheit, der Übergang seiner Macht auf Plektrud und der Verlust ihrer beiden einzigen Söhne, all dies verstärkte Plektruds Hass gegen Karl. Sie ließ behaupten, dass er den Mörder mit voller Absicht hatte entkommen lassen. In ihrer zornigen Trauer streute sie sogar das Gerücht, dass es nur Angehörige von Karls Familie mütterlicherseits gewesen sein könnten, die im Zusammenspiel mit Neustriern und Friesen ihren zweiten und letzten Sohn beseitigt hätten. Ihr hasserfülltes Herz ließ sich auch dadurch nicht beruhigen, dass Grimoald mit einer Tochter des Friesenfürsten Radbod verheiratet gewesen war. Zu allem Unglück gab es aus dieser Ehe keine Kinder. Damit zerbrach sowohl für Radbod als auch für Plektrud das einst mit großen Hoffnungen geschlossene Bündnis.
Karl schüttelte unwillkürlich den Kopf, als er daran dachte, welche weiteren, noch wilderen Gerüchte vor einem Jahr aufgetaucht waren. Möglicherweise war Plektrud damals davon überzeugt gewesen, dass die vier legitimen Söhne ihres Erstgeborenen nicht die Fähigkeiten besaßen, die sie von einem Führer der Franken erwartete. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich auffällig für den fünften Enkel eingesetzt, den Grimoald mit irgendeiner Magd gezeugt hatte.
Karl hatte niemals an die Gerüchte glauben wollen. Sie erinnerten zu sehr an die mörderischen Intrigen der Merowinger. Er spürte, dass etwas ganz anderes in der Luft lag. Kamen nicht Friesen, Sachsen und Neustrier von drei Seiten zugleich auf Colonia zu?
Er seufzte tief. Dann ging ein Ruck durch seinen Körper. Es war, als würde er aus seiner langen, unheimlichen Benommenheit erwachen. War es das Schwefelwasser von Aquis grana, das ihn über Monate gelähmt hatte? Konnte der Hass der Stiefmutter ihm die Kraft und seinen Mut geraubt haben? Er schüttelte, dehnte und reckte sich, bis die Gelenke knackten.
»Schluss damit!«, stieß er hervor, und seine Stimme war so klar wie schon seit Monaten nicht mehr. »Wach auf, Kerl! Wach endlich auf!«
Er schwankte kaum noch, als er mit langen Schritten durch den Kerker stampfte. Dann bückte er sich vor dem Stein, den er so mühsam aufgerichtet hatte. Er räumte alles fort, was das Versteck verdeckte, das er vor rund zehn Jahren mit Rotbert, einem stiernackigen Friesen namens Wusing und ein paar anderen Jungen angelegt hatte. Und wie damals hielt er die Luft an, als seine Finger erneut in die Römermünzen griffen, die schon seit Jahrhunderten im Fundament des Kapitolstempels versteckt waren.
Die wild aussehenden Flussleute lehnten sich gelangweilt an die fast mannshohen hölzernen Fässer auf ihrem Frachtkahn. Sie sahen den Sklaven zu, von denen sie nicht einmal wussten, woher sie alle stammten. Es waren zwielichtige Sachsen unter ihnen, magere Männer aus dem Osten, mehrere aufsässige Dänen und ein paar Franken, die aus der Hörigkeit entflohen waren, weil sie durch ständige Verheerung den Zins für ihre winzigen Ackerstücke nicht mehr bezahlen konnten.
Der Frachtkahn kam aus Dorestad. Er hatte an der Südspitze der Hafeninsel von Colonia angelegt, um frisches Wasser aufzunehmen. Obwohl fast überall mit neuem Kriegsgeschrei gerechnet wurde, hatten die Händler keine Furcht vor Angreifern an den Ufern des Flusses, ebenso wenig wie vor Piraten, die auch nicht wilder waren als die mutigen Männer, die nur geleerte Fässer an die Mosel zurückbrachten.
Nur wer genau hinsah, hätte noch eine dritte Gruppe auf dem Frachtkahn ausmachen können. Sie waren keine Friesen und sahen auch nicht aus wie Hörige. Einige blickten sich die ganze Zeit misstrauisch um, andere sahen wie Edle aus, die auch zu Pferd zu kämpfen wussten. Sie alle hatten sich das Gesicht mit Pflanzensaft und Holzkohle unkenntlich gemacht.
Der Anführer der Flussleute blieb ebenfalls vorsichtig. Erst als Wusing ihm das Fünffache der üblichen Leerfracht anbot, willigte er in die Fahrt rheinaufwärts mit einer Handvoll Namenloser ein.
Die Männer der Hafeninsel von Colonia wurden im Voraus mit Gold- und Silbermünzen bezahlt. Voller Bewunderung tuschelten die Friesenhändler noch immer darüber, dass die schweigsamen Männer goldene Solidi mit den Bildnissen römischer Kaiser in ihren Lederbeuteln hatten.
Jeder der weit gereisten Händler aus Friesland dachte dasselbe. Ihre Gedanken kreisten einzig und allein um die Frage, wie hoch der Preis dafür sein würde, sämtliche zehn Passagiere umzubringen oder über Bord zu werfen, um dadurch so viel zu gewinnen, dass keiner mehr mit Wein handeln oder sich an den Rudern quälen musste.
Der Frachtkahn fuhr den ganzen Tag flussaufwärts. Er passierte das Römerkastell Bonn und das im östlichen Sachsenland liegende Siebengebirge. Gegen Abend näherten sie sich den römischen Ruinen von Remagen. Kurz darauf erreichten sie die Mündung der Ahr in den Rhein. Der Wasserstand war nicht besonders hoch, dennoch gelang es den friesischen Flussleuten, den Frachtkahn bis in die unzugängliche Felswildnis rudern zu lassen.
Dort, wo die Berge wie himmelhoch aufragende Mauern begannen, steuerten sie ihr Schiff an den Rand des Flusses. Sie ankerten und ließen Holzbohlen bis auf die Steine am Ufer fallen. Die Franken hatten keinen Augenblick lang die Griffe ihrer Schwerter und Messer losgelassen. Der Einzige von ihnen, der nicht einmal ein Schwert trug, öffnete den großen und schweren Lederbeutel an seinem Gürtel und zahlte die Friesen aus. Das Gold blitzte in der untergehenden Sonne, und nur die Silbermünzen sahen grau und schmutzig aus. Dennoch wussten die friesischen Händler, dass sie noch immer mehr wert waren als alle anderen Prägungen, die es in den zweihundert Jahren der Merowingerkönige gegeben hatte.
Der große, wild aussehende Franke sprang als Erster an Land. Für alle sichtbar taumelte er ein wenig, ehe er sich wieder fing. Erst danach verließen auch die bewaffneten Männer das Schiff der Friesen. Sie achteten darauf, dass nirgendwo Pfeil und Bogen auftauchten oder Wurfspeere auf sie gerichtet wurden. Misstrauisch und vorsichtig verteilten sie sich am Uferbuschwerk.
Der Flusskahn legte vom Ufer ab, drehte sich in der Strömung und wurde von den Sklaven in Richtung Rhein gerudert. Und dann rief der Anführer der friesischen Händler doch noch etwas zum Ufer hinüber:
»Du bist Karl, nicht wahr! Ja, du bist Karl, der Sohn von Pippin. Wir haben dir zur Flucht verholfen, und wir werden dich und dein Gold in guter Erinnerung behalten. Wenn du uns brauchst …«
Er brach ab, hob beide Arme und lachte. Die zehn Männer am Ufer sahen dem schnell davonschwimmenden Frachtkahn nach.
»Ich würde schwören«, knurrte einer der Männer am Ufer, »ich würde schwören, dass irgendeiner von denen noch einmal die Hand aufhalten und Plektrud verraten wird, wo sie uns abgesetzt haben.« Es war Graf Rotbert.
Karl schob die Unterlippe vor. »Wir sind zwar nah an Prüm und Plektruds Familienburg«, sagte er dann, »dennoch vertraue ich auf Gott und die Mönche von Echternach.«
Er streckte den Arm aus und deutete auf eine Gruppe von Männern in grauen Kapuzenkutten. Sie stolperten den Bergpfad herab und zogen widerspenstige Esel hinter sich her.
3
Die Mönche von Echternach
»Die rohe Natur und die oft finsteren Nebel um die Bergkuppen in dieser Gegend halten die Menschen fern«, sagte Willibrord ein paar Stunden später. Sie lagerten am Ufer eines der vielen kleinen Bäche, die zur Sommerzeit nur noch wie Rinnsale aus den Bergen zur Ahr flossen.
»Im Winter und Frühling ist hier kein Durchkommen«, erzählte der Erzbischof von Utrecht, der kurz vor Pippins Tod endgültig nach Echternach umgezogen war.
Die frommen Männer hatten Zelte, Proviant und Töpfe mitgebracht. Noch immer erstaunt, beobachteten die Franken aus Colonia, dass die irischen Mönche nicht nur beten und predigen konnten. Sie bewegten sich so geschickt, als wären sie nicht in Abteien und Klosterzellen, sondern in den Wäldern aufgewachsen.
Willibrords Männer verteilten kalten Braten und kleine Näpfe mit Grütze. Dann stellten sie Schutzplanen auf und entfachten ein kleines Feuer. Anschließend brachen sie das mitgebrachte Brot und schenkten mit Wasser verdünnten Moselwein aus.
Der Erzbischof von Utrecht stand auf und wartete, bis die anderen verstummt waren. Dann neigte er den Kopf und sprach ein Gebet. Er dankte Gott dafür, dass seine Pläne bisher so gut gelungen waren. Anschließend aßen sie und berichteten sich gegenseitig, was bisher geschehen war.
Die Männer aus der Wachmannschaft des Kapitols, die Karl und Rotbert mit ihren römischen Münzen bestochen hatten, zogen sich an den Rand des Lagers zurück. Sie fühlten sich nicht wohl im Kreis der irischen Mönche. Dennoch hatte jeder von ihnen bereits geschworen, in Zukunft treu zu Karl zu stehen.
Es störte den Sohn des großen Pippin nicht, dass er die ersten Männer, die an seiner Seite auf Leben und Tod kämpfen würden, mit römischem Gold und Silber bezahlte. Jeder Franke, der in ein Aufgebot fiel oder am Heribann teilnehmen musste, wurde auf diese oder jene Weise entlohnt. Es war ein Geflecht aus Geben und Nehmen, ohne das alles wie ein römisches Fußbodenmosaik in irgendeiner der Ruinenstädte zerbrochen und auseinandergefallen wäre.
Karl wusste inzwischen, dass Willibrord der große Unbekannte war, der aus dem fernen Echternach die Fäden gezogen hatte. »Natürlich hättest du auch allein fliehen können«, sagte der Erzbischof von Utrecht. »Aber wo hättest du Mitstreiter gefunden? Was hättest du ihnen bieten können?«
»Ich weiß«, antwortete Karl. »Aber ich weiß auch, dass es viele Männer in Austrien gibt, die mit meinem Vater zusammen gekämpft haben und die nichts von Plektrud halten.«
Willibrord sah Karl lange an. »Du bist noch nicht so weit«, sagte er schließlich. »Wenn du deine Stiefmutter und all ihre Verbündeten bezwingen willst, darfst du nicht wild um dich schlagen, sondern musst Schritt für Schritt und sorgfältig geplant vorgehen. Du musst die Stärken und Schwächen deiner Gegner erkunden, wieder zu Kräften kommen und alte Anhänger deines Vaters für dich gewinnen. Du brauchst dafür den gesamten Herbst und auch den Winter, bis du gegen die Friesen, die Neustrier oder gar Colonia ziehen kannst. Gewiss, du hast Gold, um einige Männer zu bezahlen, aber vergiss nicht, was Pferde und Schwerter, Helme und Rüstungen kosten. So viel hast du einfach nicht in deinem Beutel und auch nicht in deinem Erbteil.«
Sie sprachen noch eine Weile über verschiedene Möglichkeiten. Dann teilten sie die Wachzeiten gerecht zwischen den irischen Mönchen und den Franken auf. Zum ersten Mal sah Karl, was er bisher nur gehört hatte: Die Männer in ihren Kutten nahmen aus ihrem Gepäck sorgfältig eingewickelte Schwerter. Einige hatten sogar Pfeile und Bogen aus Eibenholz mitgebracht.
»Seltsam«, wunderte sich Karl, »ich dachte immer, das Evangelium ist eure Waffe.«
Willibrord lachte. »Wie wahr! Aber es ziemt sich nun mal nicht, mit dem Evangelium oder gar mit dem Kreuz zuzuschlagen, wenn wir angegriffen werden. Wer missionieren will, weiß, dass er sich in Gefahr begibt. Und wer sich davor fürchtet, der muss in Klosterzellen bleiben, hinter der Abtei die Gräber der Verstorbenen pflegen oder das Unkraut aus Gemüsebeeten zupfen.«
»Es sind schon viele fromme Männer umgekommen«, erwiderte Karl. Er überlegte einen Augenblick, bevor er Willibrord sagte, was ihm in diesem Augenblick wieder durch den Kopf ging. »Woher nehmt ihr eigentlich das Recht, übers Meer zu kommen und die Standbilder zu zerschlagen, die unser aller Götter waren? Ich bin auch getauft, aber ich denke manchmal, dass ihr den Menschen ihre alten Götter stehlt.«
Willibrord hob die Hände. Dann nickte er zustimmend. »Wir geben ihnen dafür den Trost und die Erlösung von Jesus Christus, unserem Herrn«, antwortete er. Er wirkte eher sanft als eifernd und zeigte, dass auch er gelernt hatte, den milden Weg der Überzeugung und Bekehrung einzuschlagen.
»Ja«, sagte er dann, lehnte sich mit dem Rücken gegen einen umgestürzten Baumstamm und streckte die Beine aus. »Jetzt, wo du mich daran erinnerst, fällt mir wieder ein, wie peinlich ich damit gescheitert bin, den Friesenfürsten Radbod zu bekehren.«
Er lachte leise vor sich hin und schüttelte den Kopf. Karl hob die Brauen. Einer der Mönche reichte ihm eine Schale heiße Brühe. Der Tag war sehr warm gewesen, und auch die Nacht wurde nicht kühler, doch Karl dankte ihm mit einem Kopfnicken. Er schlürfte ein paar Schlucke, dann wandte er sich wieder dem Bischof in der schlichten Mönchsgewandung zu.
»Ich habe schon davon gehört«, sagte er dann. »Stimmt es denn, dass du Radbod bereits splitternackt in einem Fluss zur Taufe stehen hattest?«
»Ja, das ist richtig«, antwortete Willibrord. »Es war der Flie, in dem ich es versuchte.« Sie sahen, dass auch andere näher kamen. Die Mönche schienen die Geschichte schon zu kennen, aber Graf Rotbert und die anderen wollten mehr hören. »Ich gebe zu, dass mir die ganze Sache noch immer unbehaglich ist«, sagte Willibrord nach kurzem Zögern. »Ich hatte damals versagt, weil ich zu jung war. Ich war so überzeugt von meiner Mission, dass ich nicht mitempfand, was andere in ihrem Kopf und Herzen bewegt.«
Karl wunderte sich über die Offenheit, mit der der große Bischof seinen Fehler eingestand. Er kannte ihn seit vielen Jahren und hatte ihn mehrmals mit seinem Vater im Gespräch gesehen. Aber erst jetzt, in dieser Sommernacht irgendwo in der Felsenwildnis, lernte er den Iren wirklich kennen.
»Ich wusste selbstverständlich, warum dein Vater, Karl, mir seinen Schutz versprochen hatte, als ich ihn darum bat, mich bei den Friesen zu empfehlen. Ich wusste auch, dass mein Vorgänger Kilian an euren eigenen Bischöfen gescheitert ist. Sie schätzen nicht, dass wir für den Primat des Papstes eintreten und wollen lieber ihre eigenen Fürsten in den Diözesen bleiben. Deshalb habe ich von Anfang an versprochen, dass ich mich nicht für Austrien oder Neustrien interessiere. Ich habe stattdessen angeboten, die Friesen zu bekehren. Die Zeit dafür war günstig. Radbods Tochter war bereits getauft und mit deinem Stiefbruder Grimoald verheiratet. Was also lag da näher, als auch seinen störrischen Schwiegervater öffentlich zu taufen?«
»Dann ging es dir und meinem Vater nicht um die Bekehrung Frieslands?«
Willibrord kicherte ein wenig in sich hinein, dann seufzte er und sagte: »Du musst noch sehr viel lernen, Karl. Du weißt vielleicht das Schwert zu führen und Alamannenherzöge vom Pferd zu holen, aber ganz oben werden Pläne viel feiner noch gesponnen als feinste Seide in Mädchenhänden.«
Karl akzeptierte ohne Zorn die Rüge. Er wusste nicht, warum der immer wieder reich beschenkte Bischof Plektrud urplötzlich aufgegeben und stattdessen auf ihn gesetzt hatte.
»Also gut«, sagte Willibrord dann. »Ich habe Jahre gebraucht, um diesen Friesenfürsten weichzureden. Als es dann endlich so weit war, kamen wir überein, die Taufe groß und würdig zu begehen, mit allen Edlen seines Hofes und so viel Volk, wie überall am flachen Ufer stehen konnte. Natürlich hoffte Radbod, dass ihm Pippin einen Teil seines verlorenen Reiches zurückgab, wenn er sich taufen ließ. Und ich selbst hoffte, dass überall davon geredet werden würde – so, wie über jene legendäre Taufe von Zülpich, mit der das Frankenreich der Merowingerkönige christlich wurde.«
»Aber du hast ihn nicht getauft«, stellte Karl fest.
»Nein, Karl. Das ist mir nicht gelungen«, gab der Bischof zu. »Er hatte seinen Fuß bereits im Taufwasser, aber wir sahen alle, dass er im Grunde seines Herzens noch nicht überzeugt war. Auch ich spürte natürlich seine Anspannung und Unruhe. Ich biss die Zähne zusammen und wusste plötzlich, dass ich keine Zeit mehr verlieren durfte. Doch dann passierte mir der größte Fehler meines Lebens.«
Willibrord schien nicht zu merken, dass inzwischen alle Mönche und auch die Frankenkrieger von der Kerkerwache von Plektrud nah herangekommen waren. Er hob seine linke Hand.
»Hiermit habe ich den Arm des Friesen gepackt und versucht, ihn festzuhalten. Er wandte sich zu mir, und seine hellen Augen blitzten. Ich, der ich taufen wollte, musste mit dem Heiden kämpfen. Doch plötzlich erkannte ich, was ich tat, und ließ ihn los.
›Sag, was geschieht!‹, schrie er so laut, dass alle am Ufer ihn hören mussten. ›Was geschieht mit meinen Ahnen, wenn ich mich von dir taufen lasse? Gehe ich zu ihnen, wenn ich den Tod besiegt habe?‹
›Nur Jesus Christus, Gottes Sohn, hat je den Tod besiegt‹, antwortete ich ebenso laut und viel zu unbedacht. Ich wollte nicht mit ihm streiten, wollte ihn taufen … mehr nicht. Und dann sagte ich, was ich nie hätte sagen dürfen: ›Und deine Ahnen, Friesenfürst – all diese ungetauften Heiden schmoren selbstverständlich in der Hölle.‹
Er riss sich mit voller Kraft aus meinem Griff. Er stieß mich von sich und brüllte: ›Ha! Du verdammter Priester! Soll ich für dich und deinen Christengott all meine Vorfahren verraten? Willst du mich deshalb taufen und dadurch das Band zu meinen Ahnen zerreißen? Verschwinde mir aus den Augen, ehe ich dich und deinesgleichen mit bloßer Faust erschlage! Und kehrt niemals zurück – denn Friesland bleibt treu unseren alten Göttern!‹«
Für eine Weile war nur das leise Knacken im letzten Feuerschein zu hören. Keiner der Männer sprach. Doch mindestens die Hälfte von ihnen konnte verstehen, warum der Friese sich entschieden hatte, lieber nicht in das Paradies der Christen zu kommen.
Am nächsten Morgen badeten die Männer kurz im kalten Fluss. Einige schnauften, balgten im Wasser und planschten wie Kinder. Sie wuschen sich, während die Mönche beteten. Dann kamen alle wieder ins Trockene. Sie aßen gemeinsam, beteten nochmals und zogen weiter flussaufwärts.
Sie passierten einen Vulkankegel, der mit scharfer Stirn zum Fluss hin so hoch aufstieg, wie die Lerchen über den Feldern fliegen konnten. Gegen Mittag machten sie Rast und aßen etwas, dann trug einer der Mönche aus dem Lukasevangelium vor.
Karl wunderte sich darüber, wie gut der Ire Fränkisch sprach. Willibrord sah sein Erstaunen und lächelte ihm zu. Erst jetzt erkannte Karl, dass sich die Augen des irischen Mönchs kaum bewegten. Er las nicht vor, sondern hatte alles in der für ihn ungewohnten Sprache auswendig gelernt.
Auch der neue Tag wurde sommerlich und heiß. Obwohl die anderen Männer weder müde noch erschöpft aussahen, nutzten einige von ihnen die Pause für ein Viertelstündchen Schlaf.
Karl hatte plötzlich das Gefühl, dass die Rast eher ihm zuliebe über das gewohnte Maß ausgedehnt wurde. Gleichzeitig fiel ihm auf, dass er den ganzen Vormittag nicht an seine Familie gedacht hatte. In all den langen Kerkermonaten hatte er unablässig daran gedacht, wie es wohl wäre, wenn er mit seinem Ältesten den Wald erforschte und ihm aus einem Haselzweig eine Flöte schnitzte, für Hiltrud Puppenwagen bauen und seinen Jüngsten in den Armen wiegen würde. Doch bereits jetzt – eineinhalb Tage nachdem er wieder in der Sonne war – dachte er kaum noch an seine Familie. Er wusste nur, dass sie schon in der vorletzten Nacht über den Rhein und den südlich von Colonia liegenden Duffesbach in Sicherheit gebracht worden war. Graf Rotbert hatte sie in einem winzigen Gehöft versteckt, das zu seinen Ländereien gehörte.
Willibrord gab das Zeichen zum Aufbruch. Am späten Nachmittag wichen die Berghänge so weit zurück, dass ein paar größere Bäche in die Ahr einmünden konnten. Als sie an diesem Abend Rast machten, befanden sie sich genau zwischen dem Rhein und der alten Römerstraße, die von Colonia quer durch die östlichen Ardennen nach Trier und weiter bis nach Metz führte.
»Bisher war alles einfach«, sagte Willibrord, nachdem sie gebetet, gegessen und getrunken hatten. Sie saßen unter dichten Buchen auf umgekippten Baumstämmen. Ein paar der Mönche waren losgezogen, um noch im letzten Abendlicht nach Pilzen zu suchen. Sie kamen bereits kurz darauf mit prall gefüllten Leinenbeuteln zurück.
»Es wäre Sünde, nichts von dem Reichtum mitzunehmen, den Gott, der Herr hier überall verstreut hat«, sagte der Mönch Martin mit sanfter Stimme. Willibrord nickte ihm zu und schickte ihn damit wieder fort.
»Warum trägst du eigentlich nicht den Namen, den dir der Papst verliehen hat?«, fragte Karl.
»Ganz einfach«, antwortete der Erzbischof von Utrecht lachend. »Mir gefällt mein Name Willibrord nun mal besser als Clemens. Was soll ich in dieser wilden Gegend mit einem Namen, der nur ›der Milde‹ bedeutet?«
»Bist du es etwa nicht?«, fragte Karl zurück und lachte ebenfalls.
»Lass mich so antworten: Wenn ich mein Leben lang so nachsichtig und freundlich gewesen wäre, wie du mich jetzt siehst, hätte ich gleich in Irland bleiben können.«
»Aber ihr verkündet doch Güte und Mildtätigkeit.«