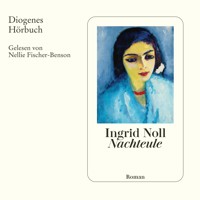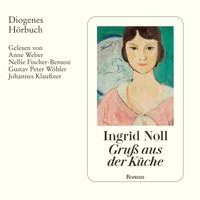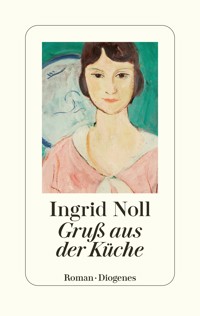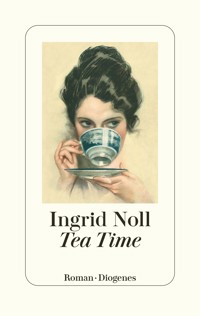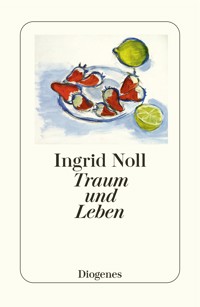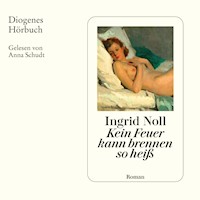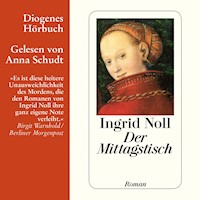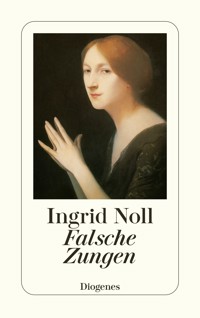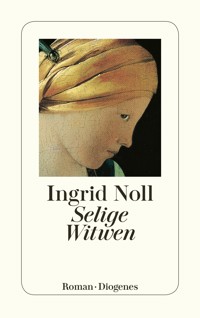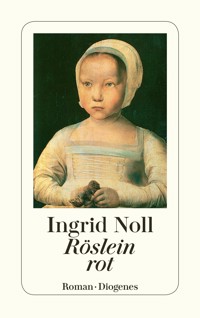11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Schön ist sie nicht, aber sie kann kochen und anpacken. Deshalb ist Lorina Altenpflegerin geworden und hat mit der Anstellung in der Villa von Frau Alsfelder das große Los gezogen. Hier geben sich attraktive Masseure die Klinke in die Hand, und Techtelmechtel entstehen, die besser geheim bleiben sollen. Für Aufregung sorgen ein aufgeschwatzter Pudel und ein zurückgelassenes Baby, die die alte Dame sichtlich neu beleben. Sehr zum Missfallen ihres Großneffen, der aufs Erbe lauert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ingrid Noll
Kein Feuer kann brennen so heiß
Roman
Diogenes
1Plumplori
Eigentlich hatten meine enttäuschten Eltern fest mit einem Lorenz gerechnet, aus Mangel an Phantasie nannten sie mich einfach Lorina, kurz Lori.
Schon bald nachdem ich geboren wurde und mein Vater zum ersten Mal in meine kreisrunden Augen schaute, machte er aus Lori einen Plumplori. Es soll Menschen geben, die unentwegt über die eigenen Füße stolpern; diese Eigenschaft wird im Allgemeinen Männern zugeschrieben, bei mir fand man es nicht besonders lustig. Und als ich viel zu spät laufen lernte, sagte meine Schwester Carola nur noch Trampeltier zu mir. Angeblich walzte ich mit großem Getöse alles nieder, was mir in die Quere kam. Meine hessische Großmutter, die mit dem Vornamen Lorina wenig anfangen konnte, nannte mich Dabbes, was Tollpatsch bedeutet. Es war nicht direkt abwertend gemeint, eher scherzhaft, doch ich litt darunter. Ein Trampeltier ist sächlich, Plumplori und Dabbes sind männlich – für ein kleines Mädchen kein gutes Omen. Schon früh musste ich mir die Rolle einer Prinzessin abschminken. Man wäre sowieso nie auf die Idee gekommen, mich in rosa Tüllröckchen zu stecken, denn man hätte mich am Ende für einen kleinen Transvestiten halten können.
Kürzlich las ich von den geschmeidigen Bewegungen einer Katze – ja, das war es, was mir fehlte. Biegsam, gelenkig, weich, anmutig, trotzdem aber kraftvoll, das war mein Ideal. Lange überlegte ich, ob mir Ballettunterricht vielleicht auf die Sprünge helfen würde, aber die Scham, zum Gespött einer Elfenschar zu werden, überwog. Aus ähnlichen Gründen habe ich mich später auch vor der Tanzstunde gedrückt.
Das Märchen vom hässlichen kleinen Entlein, das sich beim Happyend in einen stolzen Schwan verwandelt, trifft in meinem Fall nicht zu. Ich wäre ja zufrieden, wenn ich nur als Kind ein hässliches Entchen gewesen wäre, um mich als ausgewachsener Teenager in eine Schönheit zu verwandeln. Doch ich bin auch als gestandene Frau ein Trampel geblieben.
Die beste Zeit hatte ich mit drei Jahren, weil mich die gleichaltrigen Jungen noch für ihresgleichen hielten. Aber schon bald wurde ich beim Pipimachen geoutet, woraufhin alle im Kindergarten wussten, dass ich eigentlich nur ein linkisches Mädchen war. Im Gymnasium riet mir eine Mitschülerin, lesbisch zu werden, weil ich bei Männern sowieso keine Chance hätte. Ich habe zwar versucht, in diese Kreise vorzudringen, aber auch dort bevorzugte man Attraktivität und Charisma. Selbst mein eigener Vater lehnte mich mehr oder weniger ab, bloß meine Mutter versuchte, mich zu trösten. »Schönheit liegt doch nur im Auge des Betrachters«, meinte sie, ein absolut dummer Spruch, denn beim Anblick eines Plumploris gerät wahrscheinlich nur ein Zoologe in Entzücken.
Schon früh waren sich alle einig: Bei diesem Kind muss man andere Prioritäten setzen, vielleicht ist es ja besonders musikalisch, denn ich brummte schon als Baby mit seltsam schnarrenden Tönen vor mich hin. Und meine großen Hände schienen bestens dafür geeignet, mehr als nur eine Oktave greifen zu können. Leider erwies sich diese Hoffnung als Irrtum. Auch in anderen kreativen Bereichen war ich eine Niete, einem Dabbes zerbrechen die Malstifte in der zornig geballten Faust, vom Pinsel wird eher das T-Shirt als das Papier eingefärbt. Sport kam nicht in Frage, denn Boxen oder Gewichte-Heben fand meine Mutter selbst bei Männern ziemlich abartig. Doch es gab immerhin eine Überraschung: Ich lernte zwar erst spät, irgendetwas Verständliches zu artikulieren, dann aber gleich in kurzen Sätzen. »Papa raus! Mama raus!«, waren meine ersten Worte, als meine Eltern ins Wohnzimmer kamen und den Fernseher ausschalten wollten. Sie erschraken so sehr, dass sie mir widerspruchslos gehorchten. Am meisten staunten sie allerdings über mein rollendes R, das jedem Spanier zur Ehre gereicht hätte.
Diesen kleinen Sprachfehler konnte oder wollte ich auch später nicht ablegen, zumal man mich auch aufgrund meines Namens für eine halbe Südländerin hielt. Als in meiner Schule Spanisch als zweite Fremdsprache angeboten wurde, war das für mich ein gefundenes Fressen. Ich erlernte mühelos einen spanischen Zungenbrecher: El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Wenigstens damit konnte ich Eindruck schinden.
Meine Schwester hasste es, wenn ich ihren Namen Carola, kurz Caro, wie einen spanischen perro zu rollen pflegte. Übrigens erfuhren wir beide erst als Erwachsene, dass auch sie eigentlich ein Junge, ein Carl Theodor, werden sollte. Die Ehe meiner Eltern war desaströs, und daran war ich schuld. Als man endlich per Ultraschall das Geschlecht der Ungeborenen feststellen konnte, wurde meine Mutter noch mehrmals schwanger. Da es wieder keine Jungen waren, fuhr sie ins Ausland und entledigte sich der unerwünschten Embryonen. Mein Vater bestand auf weiteren Versuchen, die sie jedoch ablehnte. Anscheinend haben sich meine Eltern nur deswegen nicht wieder versöhnen können. Wäre ich ein Lorenz geworden, dann wären wir vielleicht eine glückliche Familie gewesen.
Ebenso wie ich hatte Boris seinen Namen nie gemocht. Aber als er mich kennenlernte und ich das R in seinem Namen so fremdartig rollte, war er anscheinend beeindruckt. Mein Rufname Lori reimte sich auf den seinen, wenn man das S wegließ. Bori und Lori passten zusammen wie Hanni & Nanni, Pech & Schwefel, wie Bonnie & Clyde, fand er. Wie Pat und Patachon, dachte ich insgeheim. Vielleicht war mein Zungenspitzen-R auch das Einzige an mir, das Boris faszinierte.
Nach dem Abitur hatte ich keine Ahnung, was ich werden sollte – ohne spezielle Begabung, nur in Deutsch und Spanisch eine sehr gute Note und ohne Lust auf ein Studium. Am liebsten wollte ich etwas mit Menschen zu tun haben, denen mein Aussehen egal war, zum Beispiel Blinde, Kleinkinder oder demente Greise. Mich faszinierten auch soziale Ehrenämter wie etwa Flüchtlingsbetreuer oder Hospizdienstbegleiter, aber schließlich wollte ich meinen ewig unzufriedenen Eltern nicht auf der Tasche liegen und meinen Unterhalt bald selbst verdienen. Ich besuchte also drei Jahre lang eine staatlich anerkannte Altenpflegeschule, um dann später eine Anstellung im Pflegemanagement zu finden. Aus Mangel an Initiative war ich aber lange Zeit nur als Fachkraft bei einem ambulanten Pflegedienst tätig, wo ich gelegentlich auch mit Boris zusammentraf. Doch erst als ich bei Viktoria Alsfelder angestellt wurde, lernten wir uns näher kennen. Boris war selbständiger Physiotherapeut und Masseur. Dreimal in der Woche knetete er unsere gemeinsame Patientin von Kopf bis Fuß kräftig durch und zwang sie sogar, ein paar Schritte mit dem Rollator zu gehen.
Bei der Sozialstation hatte ich gekündigt, weil ich den ständigen Zeitdruck nicht mehr aushielt. In der Alten- und Krankenpflege sind bundesweit etwa 35000 Stellen unbesetzt. Allein für eine Waschung braucht man eigentlich eine halbe Stunde, die man sich aber nicht nehmen kann. Ich musste von einem Patienten zum anderen hetzen und konnte mich weder auf ein kleines Gespräch noch auf andere liebevolle Zuwendungen einlassen, denn ich tat mich schwer mit der langwierigen bürokratischen Dokumentation. Es war wie ein Fingerzeig des Himmels, als mich nach Tagen der Verzweiflung und Depression der Anruf einer ehemaligen Kollegin erreichte. Ob ich schon eine neue Stelle hätte? Eine schwerbehinderte ältere Dame suche eine Pflegerin mit deutscher Muttersprache, die allerdings dort wohnen müsse, dafür aber auch ein gutes Gehalt bekomme. Der Hinweis erwies sich als Glücksfall. Ich sprach bei Frau Alsfelder vor, wir unterhielten uns ausführlich, und ich zog schon eine Woche später bei ihr ein. Die alte Dame trug die schlohweißen Haare wie ein junges Mädchen als Pferdeschwanz. Wenn sie mich mit ihren wachen Augen ansah, fand ich sie sehr schön. Ob ich spanische Wurzeln hätte, fragte sie, denn meine sprachliche Besonderheit schien sie zu interessieren. Das Einstellungsgespräch dauerte wie gesagt ziemlich lange, denn meine neue Arbeitgeberin redete betulich und ein wenig abgehackt. Zum Glück schien sich aber ihre Lähmung kaum auf das Sprachzentrum ausgewirkt zu haben. Wichtiger als meine Zeugnisse war ihr wohl die Einschätzung meiner körperlichen Kräfte. Als Test ließ sie mich verschiedene schwere Gegenstände hochheben, und am Ende musste ich sie selbst von einem Raum zum anderen schleppen, obwohl ein Rollstuhl zur Verfügung stand. Mein Äußeres schien sie keineswegs zu stören, wahrscheinlich dachte sie sogar, dass eine Walküre bestimmt keine Liebschaften hätte und einzig und allein im Beruf Erfüllung fände.
In meinem neuen Zuhause hatte ich es besser getroffen als je zuvor, denn mein großes Zimmer hatte einen Balkon mit Blick über einen kleinen Vorgarten bis hin zu den fernen Bergen des Pfälzer Waldes. Außer mir gab es noch die Haushaltshilfe Nadine, die allerdings nur am Vormittag kam, putzte, Spül-, Waschmaschine und Trockner bediente und bügelte. Einmal im Monat erschien auch ein Gärtner, mähte den Rasen, schnitt die Hecke und pflanzte auf Geheiß ein paar gelbe Blumen. Alle zwei Wochen fuhr eine drahtige medizinische Fußpflegerin schwungvoll vor und kümmerte sich mit Hingabe um die Krallenzehen meiner Arbeitgeberin. Von Nadine erfuhr ich nach und nach so manches, was ich über Frau Alsfelder wissen wollte. Sie stamme eigentlich aus einer verarmten Adelsfamilie und war erst durch die Hochzeit zu Wohlstand gekommen. Ihr Exmann saß im Aufsichtsrat eines Chemiekonzerns und war anscheinend richtig reich. Als seine Frau nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt war, ließ er sich scheiden. Sein schlechtes Gewissen führte angeblich dazu, dass er ihr die schöne Villa überließ und einen Treppenlift sowie andere behindertengerechte Umbauten finanzierte. Es gab insgesamt sogar drei Rollstühle im Haus, je einen im ersten Stock, im Parterre und in der Garage. Selbstverständlich zahlte er auch großzügigen Unterhalt, doch ein Jahr später heiratete er seine Geliebte. Ob Frau Alsfelder insgeheim verbittert oder gar hasserfüllt war, konnte Nadine nicht beurteilen, denn über Gefühle wurde grundsätzlich nie gesprochen, persönliche Informationen hatte sie zum großen Teil bloß von einem Besucher erhalten, einem mitteilsamen Großneffen. Nadine nannte ihn den Erbschleicher.
Meine Aufgaben waren zwar vielfältig, füllten den Tag aber nicht aus. Morgens servierte ich der Kranken das Frühstück, ihre Medikamente und die Zeitung, hinterher brachte ich sie im Rollstuhl ins Bad, schob sie auf den Wannenlift und ließ sie ins heiße Wasser gleiten. Dort wollte sie zwanzig Minuten lang allein bleiben und planschen. Wenn sie schließlich frisch angezogen, gekämmt und geschminkt im Wohnzimmer saß, äußerte sie ihre Wünsche für das Abendessen. Mittags verlangte sie nur etwas Obst. Ich fuhr jeden zweiten Tag zum Supermarkt und kaufte ein. Für die Besorgungen durfte ich den Firmenwagen nehmen, wie Nadine das behindertengerecht umgebaute Auto mit Rollstuhl-Verladesystem nannte. Nach ihrem Imbiss brachte ich meine Patientin gegen 13 Uhr wieder ins Bett. Dann hatte ich bis zur Teestunde frei. Im Grunde gehörte es auch zu meinen Pflichten, die Kranke im Rollstuhl spazieren zu fahren, aber sie mochte ungern das Haus verlassen. Wahrscheinlich war es ihr peinlich, wenn die Nachbarschaft sie beobachten konnte und bemitleidete. Um wenigstens manchmal frische Luft zu schnappen, saß sie bei schönem Wetter ganz gern im Garten und schaute den Vögeln nach. Wenn es kalt oder regnerisch war, las sie mit großer Leidenschaft in einer dicken Gedichtsammlung, oft murmelte sie unaufhörlich vor sich hin, so dass ich annahm, sie lernte vielleicht eine Ballade auswendig. Abends kochte ich ein leichtes Gericht, servierte um 19 Uhr und brachte Frau Alsfelder um 20 Uhr wieder ins Bett, wo sie sich mittels Fernbedienung durch sämtliche Fernsehsendungen kämpfte. Wenn ich an ihrer Tür lauschte, vernahm ich in regelmäßigen Abständen ein gar nicht ladylikes Scheißprogramm! Anschließend durfte ich nach Belieben das Haus verlassen, sollte aber übers Handy erreichbar sein. Meistens tat ich aber fast das Gleiche wie meine Patientin: Ich lag im Bett und schaute mir auf Netflix eine schwachsinnige Serie nach der anderen an.
2Der Sonne Morgenstrahl
Wie alle meine Altersgenossen war ich als Teenager ständig verliebt, allerdings immer nur in unerreichbare Personen. Natürlich ist es normal, wenn man anfangs bloß für Schauspieler und Popstars, vielleicht auch für Musik- und Sportlehrer schwärmt. Doch irgendwann reicht das nicht mehr, und das Objekt der Begierde rückt in greifbare Nähe. Als meine Schulkameradinnen schon fast alle einen Freund hatten, ging ich leer aus und konnte bei diesbezüglichen Gesprächen nur mit heißen Ohren zuhören.
Und das änderte sich auch nicht nach der Schul- und Ausbildungszeit. Ich hatte mich schon längst damit abgefunden, dass ich bis ans Lebensende wie eine Nonne leben müsste, als ein Wunder geschah.
Nadine hatte mir bereits gesteckt, dass Boris ihr nachstellte. Er würde damit angeben, dass er heilende Hände habe, spottete sie. Ein geiler Bock, der hinter jeder Schürze her sei, das sei nicht ihre Baustelle. Schließlich suche sie keine Abenteuer, sondern einen Mann fürs Leben, einen, mit dem man eine Familie gründen könne. Abgesehen davon wisse sie nicht genau, ob Boris von seiner Ex überhaupt geschieden sei.
Boris war kein schöner Mann, relativ klein, kurzbeinig und zappelig, aber mit einem kräftigen Brustkorb und muskulösen Armen. Er legte großen Wert auf blitzsaubere, gepflegte Kleidung. An den Ohren trug er Kreolen aus Edelstahl mit einem eingehängten winzigen Kreuz. Seine Nase war groß und schief, der Haaransatz bereits etwas zurückgewichen. Andererseits besaß er Witz und auch ein wenig Charme sowie eine sehr direkte, zupackende Art. Er pfiff und sang gern vor sich hin, was ich als Zeichen guter Laune deutete.
Ebenso wie Nadine ging Boris schon lange bei Frau Alsfelder ein und aus, beide besaßen einen Hausschlüssel. Boris schien aber im Gegensatz zu uns Frauen ein fast vertrauliches Verhältnis zu der zurückhaltenden Patientin aufgebaut zu haben. Damit er nicht jedes Mal umständlich seine transportable Massagebank aus dem Wagen ins Haus schleppen musste, hatte sie eine Luxusausführung gekauft, die nun immer in ihrem Schlafzimmer und mir im Wege stand. Manchmal hörte man sie sogar lachen, wenn Boris sie in die Mangel nahm.
Eines Tages schlürfte Boris in der Küche noch schnell eine Tasse Kaffee, blickte zu mir hoch und sagte völlig unvermutet: »Du hast wunderschöne Kulleraugen!«
Es war das erste Mal in meinem dreißigjährigen Leben, dass mir ein Mann ein Kompliment machte, ich wurde rot wie eine Tomate und verließ den Raum auf der Stelle. Später stand ich vor dem Spiegel und betrachtete mich aufmerksam. Weil meine Augen fast kreisrund sind, kann man das Weiße über und unter der Iris gut sehen. Mein Vater hatte mich deswegen ja auch Plumplori genannt. Andere Frauen sprechen gelegentlich von einem »Bad Hair Day«, bei mir sind es nicht gelegentliche Tage, an denen meine Haare nicht sitzen, sondern ein Dauerzustand. Der Frisör hält extreme Hormonschwankungen für die Ursache. Meine Nase ist knubbelig, die Stirn niedrig. Mein Gesicht erinnert an eine misslungene Kinderzeichnung. Auch Kröten haben angeblich schöne Augen, dachte ich, gab es nicht das Märchen vom Froschkönig, der sich schließlich in einen Prinzen verwandelt? Mir fiel allerdings ein, dass die Prinzessin ihn nicht etwa wachgeküsst, sondern an die Wand geknallt hatte.
Eines Morgens wurde ich sehr früh, aber sanft geweckt, noch halb im Schlaf hörte ich ein altes, fast vergessenes Lied, das wir in der Schule gesungen hatten.
Es tagt, der Sonne Morgenstrahl weckt alle Kreatur …
Das konnte nur Boris sein, der so fröhlich sang, aber als ich das Licht anknipste und auf die Uhr schaute, war es erst kurz vor sieben. Es musste also ein Traum gewesen sein, ich durfte gut und gern noch ein bisschen weiterschlafen. Und Boris war sowieso erst sehr viel später zu erwarten. Doch in diesem Augenblick tat sich die Tür auf, der Masseur mit den heilenden Händen trat ein und stellte singend zwei Tassen Kaffee auf den Nachttisch. Ich fuhr hoch und starrte ihn an wie ein Gespenst.
Grinsend setzte er sich auf die Bettkante. »Wer immer für andere Frühstück macht, der muss auch mal belohnt werden«, sagte er. »Möchtest du lieber Müsli, einen Toast oder ein Brötchen? Wird auf Bestellung sofort serviert!«
Zuerst muss ich ins Bad, dachte ich, rieb mir die verklebten Augen und murmelte mit pelziger Zunge: »Toast!«
Brötchen gab es zu dieser Uhrzeit sowieso noch keine, Nadine brachte welche mit, wenn sie um neun Uhr hier auftauchte.
Kaum hatte er das Zimmer verlassen, als ich ins Bad flitzte und mir vor allem die Zähne putzte. Sollte ich mich noch blitzschnell umziehen? Doch das brandneue Nachthemd fiel wahrscheinlich auf, Boris sollte sich bloß nicht einbilden, ich würde mich für ihn schön machen. Wie kam er überhaupt auf die verrückte Idee, mich noch vor Tau und Tag in meinem Schlafzimmer zu überfallen?
Er erklärte es etwas später, als er mit einem üppig beladenen Tablett wieder hereinkam. Vor seinem ersten Termin gehe er gelegentlich noch joggen, es sei aber heute so kühl gewesen, dass er keinen Bock mehr auf eine große Runde hatte und – weil er gerade an unserem Haus vorbeikam – plötzlich Lust auf ein heißes Getränk verspürte. Da er sich ja in unserer Küche auskannte, war das kein Problem. Als er die Kaffeemaschine einschaltete, sei ihm schließlich eingefallen, dass ich vielleicht auch mal gern verwöhnt werden würde.
Ich hatte noch gar keinen Hunger, aß aber trotzdem einen gebutterten Toast mit Honig, wobei ich ein paar klebrige Tropfen an meiner Bettdecke abschmieren musste. Fasziniert registrierte ich, dass Boris völlig unverfroren Frau Alsfelders edle Meissener Tassen ausgesucht hatte, während er die Milch in Nadines grünlichen Keramikbecher mit Hahn und Henne geschüttet hatte. Ich empfand die ganze Situation als übergriffig, gleichzeitig aber auch wie ein unerhörtes Abenteuer. Wann hatte man mir zuletzt eine Mahlzeit am Bett serviert? Noch nie, denn selbst bei Kinderkrankheiten wurden mir von meiner Mutter höchstens der unbeliebte Kamillentee und ein Zwieback hingestellt. Sobald ich kein Fieber mehr hatte, musste ich mich wieder an den Esstisch setzen. Im Gegensatz zu mir schien dieser ungewöhnliche Imbiss aber für Boris ganz selbstverständlich zu sein.
»Wann steht die Alte auf?«, fragte er, aber das würde noch lange dauern. In der Regel wurde ich durch ein Klingelzeichen gerufen, selten vor halb zehn und fast nie in der Nacht. Auch Nadine war erst viel später zu erwarten.
Boris gähnte. Eigentlich sei er noch müde und vor allem noch nicht richtig wach, meinte er. Leider habe er seinen nächsten Termin bereits um acht, da dürfe er keine eiskalten Flossen haben. Und bei diesen Worten schlüpften seine Hände blitzschnell unter meine Bettdecke, krochen unter die Pyjamajacke und weiter auf meinen schlafwarmen Bauch, um ihn als Heizkissen zu missbrauchen. Obwohl seine heilenden Pfoten überhaupt nicht kalt waren, spürte ich ein elektrisches Kribbeln im ganzen Körper sowie ein heftiges Verlangen, den kompletten Boris zu mir herunterzuziehen, aber andererseits auch die moralische Verpflichtung, die zwei aufdringlichen Tentakel energisch wegzuschieben. So einfach war ich schließlich nicht zu haben. Doch bereits bei meinem noch zaghaften Widerstand gab er auf, erhob sich und griff nach seiner Jacke.
»War nett mit dir«, sagte er. »Ich muss schleunigst heim und duschen, bevor mein erster Patient kommt. Wenn du magst, kann ich uns den grauen Alltag demnächst wieder mal versüßen!«
Er warf mir eine Kusshand zu, dann war er fort, und ich blieb völlig aufgelöst zurück. Wie ein Morgenstrahl hatte Boris mich geweckt, und ich war zu meiner eigenen Überraschung in Hochstimmung. Gleichzeitig aber auch in großer Sorge, ob ich nicht alles falsch gemacht hatte. Sollte ich mich bei einer Wiederholung nicht etwas entgegenkommender zeigen? Petit-déjeuner heißt Frühstück auf Französisch, und dabei fiel mir ein Gemälde von Manet ein, wo zwei Männer mit einer splitternackten Frau im Walde picknicken. Zur damaligen Zeit war dieses Bild bestimmt ein Skandal, heute ist man diesbezüglich abgebrühter. Wahrscheinlich war ich viel zu schamhaft und nicht besonders selbstsicher, aber dafür hatte ich auch gute Gründe. Doch seit Boris meine kugelrunden Augen bewundert hatte, war ich in meiner bisherigen Selbsteinschätzung verunsichert. Schönheit liege im Auge des Betrachters, hatte meine Mutter behauptet, vielleicht war doch etwas Wahres daran. Boris wirkte auf mich plötzlich nicht mehr wie ein merkwürdiger Sitzriese, sondern wie ein attraktiver und einfühlsamer Freund.
Schließlich stand ich auf, duschte und zog meine weiße Kittelschürze an. Bevor Nadine kam, musste ich schleunigst das Tablett aus meinem Zimmer holen, die Lebensmittel wieder ins Regal einräumen und das Geschirr und Besteck unter fließendem Wasser säubern. Auf keinen Fall sollte sich Nadine wundern, warum plötzlich ihr grüner Becher in der Spülmaschine stand. Kurz darauf aßen wir wie immer zwei ihrer mitgebrachten Brötchen und plauderten. Ich war allerdings überhaupt nicht bei der Sache und redete wohl nur dummes Zeug. Nicht ungern hätte ich einer guten Freundin von meinem aufregenden Erlebnis berichtet, aber ich hatte leider keine.
Als ich – immer noch verwirrt – meiner Herrin das Frühstück servierte, meinte sie: »Ach, Lorina, ehe ich’s vergesse, ich muss Ihnen noch was sagen …«
Mir blieb das Herz fast stehen, weil Frau Alsfelder bestimmt den Gesang des frühen Eindringlings gehört hatte. Aber sie fuhr fort: »Heute wird mich mein Großneffe ausnahmsweise zur Mittagszeit besuchen, da muss er eine anständige Mahlzeit bekommen, junge Männer haben bestimmt einen besseren Appetit als alte Frauen.«
Was sie denn vorschlage, wollte ich wissen, und wir einigten uns auf ein riesiges und ein winziges Schnitzel und Kartoffelsalat. Sie meinte, damit könne man nie etwas falsch machen.
Bisher hatte ich dem sogenannten Erbschleicher zwar schon mehrmals die Tür geöffnet, obwohl er angeblich einen Hausschlüssel besaß, aber immer nur wenige Worte mit ihm gewechselt, etwa so: »Wie geht es meiner Tante?« – »So wie immer!«
Christian sah gut aus, war wohl etwas jünger als ich und kam mindestens einmal im Monat vorbei, um sich um finanzielle und organisatorische Angelegenheiten zu kümmern. Er sorgte dafür, dass genug Bargeld im Haus war, dass Rechnungen pünktlich bezahlt und Briefe beantwortet wurden. Da er BWL studierte, schien er wie geschaffen für diese Aufgaben, überdies hatte er gute Manieren und war flink und sportlich. Christian zahlte mir auch das monatliche Haushaltsgeld aus und nahm die Quittungen für meine Einkäufe entgegen. Ob er sie jemals prüfte, konnte ich nicht beurteilen. Selbstverständlich kannte er sich auch mit technischen Dingen aus, gehörte zur Generation Smartphone und konnte seiner Tante immer auf die Sprünge helfen, wenn sie da Probleme hatte. Sie besaß natürlich ein Handy, sogar ein Tablet und beschäftigte sich seit kurzem gern mit virtuellen Spielen.
Nadine war schon heimgegangen, ich verzehrte gerade genüsslich mein eigenes großes Schnitzel, als Christian die benutzten Teller und Bestecke eigenhändig zu mir in die Küche trug und sich artig für das Essen bedankte.
»Meine Tante will jetzt Siesta halten, vielleicht bist du so nett und kümmerst dich um die Toilettendinge, natürlich erst, wenn du aufgegessen hast«, sagte er. »Danach hätte ich gern noch einen Espresso, ich lese die Zeitung, bis du fertig bist.«
Für Christian war es wohl selbstverständlich, dass wir uns duzten, ich selbst hatte es bisher vermieden. Zwanzig Minuten später saß ich wieder in der Küche und trank an diesem Tag zum zweiten Mal Kaffee mit einem Mann.
»Was für ein Glück, dass du es so gut mit meiner Tante kannst«, sagte er. »Bisher war sie noch mit jeder Pflegerin unzufrieden, wie schaffst du das nur?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Sie ist immer höflich, ich bin es auch. Waren es meine Vorgängerinnen etwa nicht?«
»Ach, die hatten meistens nur Flausen, Männer oder die eigene Familie im Kopf«, sagte er. »Die eine hatte einen saufenden Kerl zu Hause, eine andere zwei kleine Kinder, die sie heimlich mitbrachte. Eine stank nach Schweiß, andere sprachen einen unverständlichen Dialekt oder überhaupt kein Deutsch – und so weiter. Außerdem wollten alle am Abend wieder heimgehen. Übrigens hat ihr dein Markenzeichen, das Bühnen-R, von Anfang an imponiert.«
Schon wieder ein Kompliment, dachte ich, anscheinend bin ich gar nicht mal so hässlich und doof, wie ich mir einbilde. Als ob das aber noch nicht genug wäre, fuhr er fort: »Außerdem merkt man sofort, dass du einen großen Wortschatz hast und dich fast gewählter ausdrückst als Tante Vicki. Ich würde mich nicht wundern, wenn du auch ein paar Fremdsprachen draufhättest.«
»Bloß Englisch und Spanisch«, sagte ich bescheiden, dann grinste ich ein wenig und rollte: »El perrito de Rita me irrita …«
»Bist du etwa zweisprachig aufgewachsen? Und was heißt dieser Satz auf Deutsch?«, fragte Christian verblüfft.
»Das Hündchen von Rita ärgert mich«, antwortete ich. »Der Satz ist aber noch längst nicht zu Ende. Für Spanier ist dieser Zungenbrecher etwa so wie unser Blaukraut bleibt Blaukraut, und Brautkleid bleibt Brautkleid.«
Der Erbschleicher war sichtlich beeindruckt, vor allem, dass ich Spanisch bloß in der Schule gelernt und sogar Abitur hatte. Ich fragte mich allerdings, ob sein freundliches Interesse nur Mittel zum Zweck war und er sich aus irgendeinem noch unklaren Grund bei mir einschleimen wollte.
Als Christian längst gegangen war und ich meine Arbeitgeberin wieder aus dem Bett befreite, trat ich zum ersten Mal fast selbstsicher auf. Frau Alsfelder schätzte mich und war offensichtlich zufrieden mit mir. Heute hatte sie sogar bemerkt, nicht jeder könne ein Wiener Schnitzel perfekt zubereiten, oft sei die Panade zu dick oder das Fleisch sei gar nicht vom Kalb und viel zu fett. Plötzlich fiel mir selbst auf, dass ich bisher durch keine bemerkenswerte Ungeschicklichkeit in diesem Haus aufgefallen war. Einmal Dabbes, immer Dabbes – das musste nicht sein. Hier fühlte ich mich einigermaßen wohl, hier machte mir die Arbeit sogar ein bisschen Spaß. Das Einzige, was noch nicht geklärt war, betraf meinen Urlaub. Zwar hatte ich jedes vierte Wochenende frei – dann kam dreimal am Tag eine ambulante Pflegerin –, aber ich wollte natürlich auch mal eine etwas längere Reise machen. Ich wurde übertariflich bezahlt und konnte mich bisher auf keinen Fall beklagen, bestimmt würde demnächst auch dieses Problem zu meiner Zufriedenheit gelöst werden. Geld macht doch viel aus, dachte ich. Frau Alsfelder ist zwar schwerbehindert, aber im Vergleich zu den anderen Patienten, die ich bisher gepflegt habe, kann sie sich ein relativ schönes Leben leisten, im eigenen Haus wohnen, Personal bezahlen und sich auch sonst alles gönnen, was ihren Zustand verbessert. Auch ich war durch ein gutes Gehalt viel motivierter als bisher, hatte mehr Freizeit, konnte meistens ausschlafen und mich um meine einzige Patientin so intensiv kümmern, wie es sich im Grunde für alle Pflegebedürftigen gehörte.
»Unfassbar!«, murmelte Frau Alsfelder, als ich ihr das Abendessen brachte, und legte die Zeitung beiseite. »Haben Sie es auch gelesen? Ein Krankenpfleger in Norddeutschland soll über hundert Patienten umgebracht haben. Hundertdreißig Leichname wurden bereits exhumiert! Der Mörder injizierte seinen Opfern Herzmedikamente – anfangs nur, um sie aus einem lebensbedrohlichen Zustand durch eine gelungene Reanimation zu retten und damit seine Kollegen zu beeindrucken. Aber irgendwann wurde das Morden zum Selbstzweck. Ist das nicht grauenhaft? Was sagen Sie als Profi dazu?«
»Abartig!«, versicherte ich. »Es wäre schlimm, wenn durch einen Irren unsere gesamte Berufsgruppe in Verruf geriete. Hoffentlich trauen Sie mir jetzt noch über den Weg …«
»Nein, nein, auf Sie kann ich mich durchaus verlassen. Aber natürlich ist ein gesundes Misstrauen nicht verkehrt, wenn man zum Beispiel taub, blind, vergesslich oder – wie ich – gelähmt ist. In Altersheimen werden die Pflegerinnen ja häufig des Diebstahls beschuldigt, wenn die Senioren ihr Geld oder sonst einen Wertgegenstand bloß verlegt haben und nicht finden können. Doch gelegentlich wird eben auch geklaut, davon kann ich ein Lied singen. Ausnahmen gibt es immer.«
Frau Alsfelder hatte bisher noch nie so persönlich mit mir gesprochen, ich fühlte mich an diesem Tag von ihr und von zwei jungen Männern derart aufgewertet, dass mir fast die Tränen kamen.
3Kein Feuer, keine Kohle
Es kam, wie es kommen musste: Bei unserem zweiten Frühstück landete Boris in meinem Bett, beim dritten dort, wo er von Anfang an hinwollte. Ich war glücklich, dass ich mich endlich wie eine vollwertige Frau fühlen konnte.
Im Beruf einer Pflegerin hat man es täglich mit nackten Menschen zu tun. Da ich unter meinen Kolleginnen als nicht besonders geschickt galt, wurde ich nach einigen Fehlversuchen davon befreit, alte Männer mit Harnverhaltung zu katheterisieren, aber ich habe es während der Ausbildung immerhin lernen müssen. Aber auch bei weniger intimen Manipulationen wurde ich gelegentlich mit den Anzüglichkeiten dementer Greise konfrontiert, die in einem früheren Leben sogar feine Herren gewesen sein mochten. Nun ließen sie ihren verdrängten Phantasien wenigstens verbal freien Lauf. Wir nannten diese Spezies Die zahnlosen Tiger. Erst durch Boris lernte ich die männliche Anatomie von einer viel interessanteren Seite kennen.
Nach einem dieser frühmorgendlichen Gelage strahlte ich so viel Lebensfreude aus, dass Nadine Verdacht schöpfte. Vielleicht hatte ich auch die Spuren unseres Picknicks nicht sorgfältig genug weggeräumt. Jedenfalls sah sie mich nachdenklich an und meinte: »Der Boris ist hinter dir her, das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Lass dich bloß nicht einwickeln, du bist viel zu schade für diesen Hurenbock! Als ich ihn damals abgeschmettert habe, behauptete er, das würde mir noch leidtun, denn er könne jede Frau rumkriegen und glücklich machen. So ein Angeber! Also sag bitte nie, ich hätte dich nicht gewarnt!«
Auch Frau Alsfelder schien irgendetwas zu wittern. Sie drückte sich allerdings etwas diplomatischer aus.
»Ich bin sehr froh, dass Boris – genau wie Sie – sehr zuverlässig ist und dreimal in der Woche pünktlich hier erscheint. Im Übrigen ist er unschlagbar in seinem Beruf, deswegen würde ich nur ungern auf ihn verzichten. Aber er hat eine gewisse Schwäche, wenn es um jüngere Patientinnen oder Mitarbeiterinnen geht. Bei einer alten Frau wie mir weiß er natürlich, was sich gehört, doch mir ist leider zu Ohren gekommen, dass es einen Grund dafür gibt, warum er keine Kassenpatienten behandeln darf und auch in verschiedenen Vereinen und sogar im Kirchenchor rausgeflogen ist. Eigentlich ist es nicht meine Art, Klatsch und Tratsch weiterzuverbreiten, aber ich möchte auf keinen Fall, dass Sie in irgendeiner Weise belästigt werden. Was rede ich da! Sie sind ja eine kräftige Frau und einen Kopf größer als er!«
Wahrscheinlich wurde ich ein bisschen rot. Ich befand mich nämlich in einer Zwickmühle. Einerseits hätte ich am liebsten in alle Welt hinausposaunt: Ich bin eine begehrenswerte Frau! Ich habe Sex mit einem Mann! Andererseits wollte ich meinen guten Job nicht verlieren und war zum Schweigen verurteilt. Nur allzu gern hätte ich wie andere Paare gemeinsam mit Boris etwas unternommen, etwa in einem romantischen Restaurant bei Kerzenschein diniert, so wie es in meinen Lieblingsfilmen vorkam. Oder eine Ruderpartie bei strahlendem Sommerwetter, ein Besuch im Theater oder in einem angesagten Club. Selbst zu einem Fußballspiel wäre ich fröhlich mitgegangen, wenn das eher in Frage kam. Aber wahrscheinlich konnte ich von Boris keine öffentlichen Auftritte verlangen. Ganz abgesehen davon, dass er bereits einen zweifelhaften Ruf als Ladykiller hatte, hörte ich schon das Gespött unserer hämischen Mitmenschen: der Gartenzwerg und sein Riesenweib. So musste ich es leider hinnehmen, dass wir uns nur heimlich und zu einer Zeit trafen, in der die meisten Menschen noch schliefen. Gab es nicht orientalische Geschichten, in denen der Geliebte nur bei Nacht erschien? Es hatte ja auch etwas Märchenhaftes, Surreales, wenn man die Welt da draußen ausschloss und sich von der Liebe verzaubern ließ. War es überhaupt Liebe? Dieses Wort war bisher noch nie gefallen.
Eines Tages fragte ich ihn: »Findest du mich eigentlich hässlich?«
Er lachte. »Du bist eine aparte Frau, das weißt du doch«, sagte er. »Willst du am Ende Komplimente von mir hören?«
Eigentlich schon, denn ich wollte ja auch bei Tageslicht bestehen. Lange dachte ich über das Adjektiv »apart« nach; »von eigenartigem Reiz« lautete die Definition im Duden, also war es reine Geschmackssache, wie auch die Beurteilung eines Plumploris.
Über sein Privatleben schwieg sich Boris aus, aber ich bohrte immer wieder nach. Einmal verplapperte er sich, dass er Kinder habe, aber die Zwillinge lebten wohl bei ihrer Mutter. Dies war ein Thema, das er anscheinend nicht vertiefen wollte, und ich ließ es ungern dabei bewenden.
Am liebsten hätte ich nämlich alles über ihn gewusst, über seine Hobbys, seine Familie, seine Kindheit. Immerhin erfuhr ich, dass er als Junge ein paar Jahre lang Pfadfinder gewesen war und daher viele Wanderlieder kannte. Seine alten Patienten freuten sich, wenn sie eine vertraute Melodie hörten und dadurch an ihre Jugend erinnert wurden. Boris war zweifellos musikalisch, konnte Mundharmonika spielen und lernte beim Autofahren im Nu die neuesten Hits, so dass er auch bei jüngeren Menschen punkten konnte. Gern sang er auch Lieder, die er von einem befreundeten Soldaten gelernt hatte. Zum Beispiel: Frühmorgens, wenn die Hähne krähn, ziehn wir zum Tor hinaus, und mit verliebten Äuglein spähn die Mädels nach uns aus. Ich erfuhr außerdem, dass er im Laufe seines bewegten Lebens eine Zeitlang Mitglied im Deutschen Alpenverein gewesen war, wo man ebenfalls gern Volkslieder zur Gitarrenbegleitung sang.
Mehrmals musste ich ihn ermahnen, bei seinen Besuchen zu nachtschlafender Zeit nicht lauthals loszulegen.
»Erstens singe ich nur mit halber Stimme«, behauptete er. »Zweitens ist die Alte von ihren Pillen völlig zugedröhnt, drittens benutzt sie Ohrstöpsel, so dass sie noch nicht mal wach würde, wenn eine Eisenbahn durchs Schlafzimmer rattert.«
Es stimmte zwar, dass ich Woche für Woche die kleinen Medikamentenfächer für jeweils drei Tageszeiten gewissenhaft auffüllte und dafür sorgte, dass nichts vergessen wurde. An ihre abendliche Schlaftablette war Frau Alsfelder schon so lange gewöhnt, dass man durchaus von Abhängigkeit sprechen konnte. Andererseits hatte sie nie darum gebeten, diese Dosis zu erhöhen. Ob die Patientin immer das Ohropax verwendete und ob sie vielleicht stundenlang wach lag, wusste ich nicht. Sie klagte sowieso fast nie, was ich als sehr angenehm empfand.
Meine Bedenken hatten jedoch Erfolg, und Boris bemühte sich zum Glück, nur noch in meinem Schlafzimmer zu singen. Belustigt registrierte ich, dass er mich schon zweimal Püppi genannt hatte, was wie die Faust aufs Auge zu mir passt. Etwas anderes störte mich allerdings wirklich. Nie sagte er vorher, wann der nächste Besuch fällig war, so dass ich mich also auch nicht darauf vorbereiten konnte. Die Folge war, dass ich fast immer zu früh wach wurde, mir die Zähne putzte und oft sogar schon duschte, um dann vergeblich auf meinen Lover zu warten. Wahrscheinlich war es Teil seines Vergnügens, seine Überfälle unberechenbar zu machen. Mehrmals sprach ich ihn darauf an, dann erklärte er, seine Arbeitszeiten würden häufig wechseln, und er wisse das nicht schon lange im Voraus. Es bereite ihm außerdem große Freude, ein schlafendes Dornröschen wachzuküssen. Dieser Wermutstropfen wurde insofern ausgeglichen, als er sich nach wie vor um ein anständiges Frühstück kümmerte. Um ihn meinerseits zu erfreuen, legte ich neuerdings anderen Aufschnitt in den Kühlschrank. Müsli, Marmelade, Honig oder Käse waren nicht nach seinem Gusto, er bevorzugte Schinken, Leberwurst und Salami. Frau Alsfelder war großzügig, was mein Haushaltsgeld anbetraf. Ich dürfe getrost alles einkaufen, was mir am besten schmecke, meinte sie und zitierte den Bibelspruch: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Bisher war ich immer bescheiden in meinen Ansprüchen gewesen und hatte weder Hummer noch Champagner vom Supermarkt nach Hause gebracht. Doch vielleicht waren es jetzt die selten eingekauften Lebensmittel, die Nadine misstrauisch gemacht hatten. Eines Nachts briet sich Boris sogar zwei Spiegeleier mit Bacon, wobei die ebenso appetitliche wie verräterische Dunstwolke trotz geöffneter Fenster noch lange in der Küche und in meinem Schlafzimmer schwebte. Dabei wollte ja gerade er, dass unser Verhältnis geheim blieb. Fast bei jedem Besuch sang er ganz am Schluss:
Kein Feuer, keine Kohle,
kann brennen so heiß,
als heimliche Liebe,
von der niemand nichts weiß.
Nadine schnupperte misstrauisch. »Was hast du gestern Abend gekocht?«, fragte sie. »Es riecht nach Speck, hat unsere Gnädige etwa ganz neue Gelüste, oder bist du am Ende schwanger?«
»Ich habe manchmal das Bedürfnis, etwas anderes zu essen als Frau Alsfelder«, sagte ich. »Hin und wieder etwas Herzhaftes, das müsstest du doch allemal verstehen …«
»Ach so, deswegen die Leberwurst«, sagte sie. »Die schmeckt mir übrigens auch besser als euer fader Quark. – Übrigens hat der Christian vorhin angerufen, er käme am Nachmittag vorbei und brächte eine Überraschung mit!«
Ich war natürlich gespannt, denn Christian brachte nie etwas anderes als Geld für die Haushaltskasse mit, weder einen Blumenstrauß für seine Tante noch eine edle Sachertorte für eine gemeinsame Kaffeepause.
Gegen vier öffnete ich ihm erwartungsvoll die Tür; Christian trug ein fiependes Wollknäuel auf dem Arm. »Ist der nicht süß?«, fragte er.
Jungtiere sind fast immer süß, wahrscheinlich sogar Plumploris.
»Was soll das?«, fragte ich mit gerunzelter Stirn. »Ist der überhaupt schon stubenrein?«
Christian trat ein, setzte den schüchternen Welpen ab und strahlte mich an.
»Ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, wie man Tante Vicki etwas häufiger an die frische Luft locken könnte. Haustiere sollen sowieso die besten Therapeuten sein, auch in sozialer Hinsicht.«
»Wie stellst du dir das vor?«, fragte ich. »Gut, sie wird ihn vielleicht mal streicheln, aber ein Hund muss täglich ausgeführt werden. Das bliebe zu hundert Prozent an mir hängen!«
»Dir täte es auch gut!«, sagte er. »Du könntest Tante Vicki im Rollstuhl durch den Park schieben, dann läuft der Pudel nebenher, und ihr lernt auf diese Weise andere Hundebesitzer kennen. Gleich drei Fliegen mit einer Klappe: interessante Kontakte, neue Erfahrungen sowie frische Luft!«
Ich schüttelte missbilligend den Kopf und war gespannt, was Frau Alsfelder zu einem solchen Danaergeschenk sagen würde. In diesem Moment entdeckte das Hündchen meine Schuhe neben der Fußmatte, knurrte bedrohlich und stürzte sich auf den gefährlichen Gegner. Es sah possierlich aus, wie es den Bösewicht mit Feuereifer schüttelte und zur Strecke bringen wollte. Christian zog ein Leckerli aus der Hosentasche, um den Hund abzulenken und meine Treter zu retten. Plötzlich erinnerte ich mich daran, wie gern ich als Kind Tiere gefüttert hatte – Enten im Teich, Nachbars Katze oder Eichhörnchen in unserem Garten –, und wurde milder. Christian packte den Vierbeiner an der Genickfalte und nahm ihn wieder auf den Arm.
»Aua, er hat noch spitze Milchzähne!«, sagte er. »Mein Tantchen wird dahinschmelzen! Und vielleicht kann der Fiffi sogar ihre Ängste etwas abbauen!«
Ich sah ihn fragend an.
»Du weißt bestimmt, dass sie sich regelmäßig die Sendung Aktenzeichen XY ansieht, wo man die Zuschauer um Mithilfe bei unaufgeklärten Kriminalfällen bittet. Dabei hat sie sich schon ein paarmal über schreckliche Szenen aufgeregt, weil man alte Menschen überfallen und beraubt, manchmal sogar gefoltert und getötet hat. Seit du im Haus wohnst, ist sie ein bisschen entspannter, weil sie von deiner Kraft und Wehrhaftigkeit überzeugt ist. Aber es ist ja allgemein bekannt, dass ein Kläffer ein besserer Schutz ist als eine Alarmanlage.«
Er wandte sich dem Treppenlift zu. »Funktioniert der überhaupt noch? Wird er regelmäßig benutzt?«, fragte er, setzte sich probeweise darauf, drückte auf den Bedienhebel und schwebte mitsamt dem Welpen in die obere Etage. Dabei winkte er mir mit der Hundepfote huldvoll zu, denn bei den Besprechungen blieben Großtante und -neffe stets unter sich. Umso mehr wunderte ich mich, dass ich nach wenigen Minuten herbeigeklingelt wurde.
Frau Alsfelder thronte im Rollstuhl und deutete wortlos auf einen kleinen See zu ihren Füßen. Ich eilte hinaus und holte eine Rolle Küchenpapier und den nassen Wischlappen. Das kann ja heiter werden, dachte ich ärgerlich.
»Man muss ihn am Schlafittchen packen und mit der Nase in die Pfütze stupsen«, schimpfte Frau Alsfelder, aber Christian schüttelte den Kopf.
»Das sind Erziehungsmethoden aus dem letzten Jahrhundert, als es noch die Prügelstrafe für unartige Kinder gab«, belehrte er seine Tante. »Im Grunde bin ich schuld, ich hätte mit dem Hundekind erst mal eine Runde im Garten drehen müssen. Übrigens ist es ein Mädchen, wie sollen wir es denn nennen?«
»Perrrrra«, knurrte ich.
»Anscheinend gehst du davon aus, dass ich den Köter behalten will«, sagte Frau Alsfelder. »Das muss ich mir allerdings noch dreimal überlegen.«