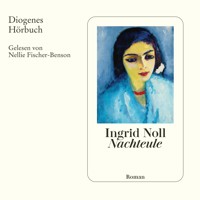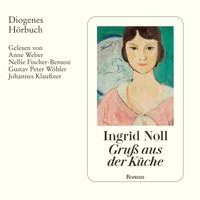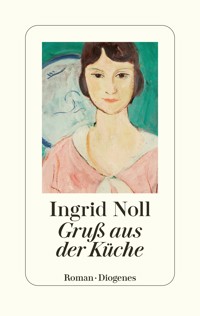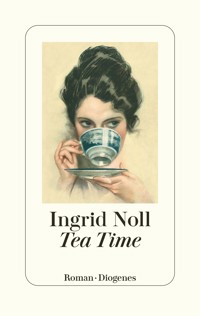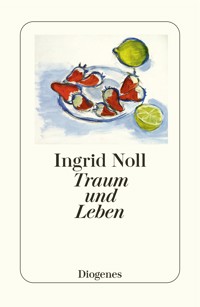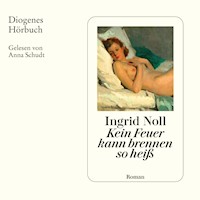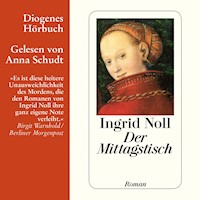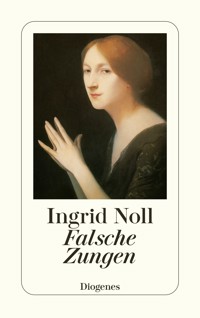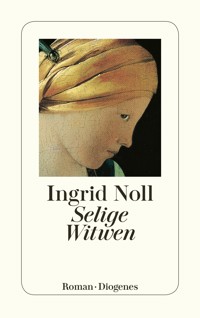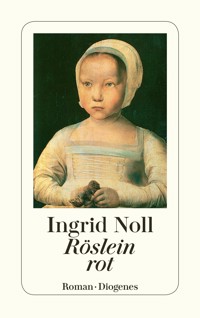22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luisa, 15, als Baby aus Peru adoptiert, wächst behütet in einem wohlhabenden Elternhaus auf. Sie hat eine besondere Fähigkeit: Luisa kann im Dunkeln sehen. Als sie im nahen Wald einen jungen Obdachlosen entdeckt, schließt sie ihn ins Herz. Tim lässt sich von ihr versorgen und sogar verstecken, denn er hat allen Grund, unsichtbar zu bleiben. Durch Luisas Gabe wird sie zur Komplizin und gerät in ein Netz aus Lügen und Verbrechen, das sich immer enger zuzieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ingrid Noll
Nachteule
Roman
Diogenes
Für Ursula,
meine Lektorin
Prolog
In meinen Albträumen bin ich eine Eule, die bei ihren nächtlichen Streifzügen auf Jagd geht und andere Lebewesen ohne Gewissensbisse tötet. Wenn ich aufwache und weinen muss, nimmt mich Noah in den Arm, und alles ist wieder gut.
Das Physikum habe ich letztes Jahr mit Bravour bestanden, aber es wird noch lange dauern, bis ich mein Ziel erreicht habe. Irgendwann möchte ich nämlich als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie eine eigene Praxis eröffnen. Demnächst werde ich mit einer Lehranalyse beginnen, um meine härteste Zeit als Teenager aufzuarbeiten. Mein Freund hat mich bei meinem Vorhaben bestärkt, bereits im Vorfeld alles über meine toxische Beziehung aufzuschreiben.
Unsere früheren Berufswünsche haben Noah und ich längst über Bord geworfen. Ich möchte den Dingen jetzt auf den Grund gehen. Und er studiert Archäologie und schreibt seine Bachelorarbeit über peruanische Grabkammern aus vorkolonialer Zeit. Wenn es sich um finstere Höhlen handelt, kann ich ihm dank meiner besonderen Fähigkeit sicher zur Seite stehen. Scherzhaft meinte er, dass wir eigentlich beide in Untiefen herumstochern. Wenn ich meine teilweise schmerzlichen Erinnerungen fertig dokumentiert habe, wollen wir zur Belohnung nach Südamerika reisen. In unserer Schulzeit fragte ich Noah französische Vokabeln ab, jetzt lernen wir gemeinsam Spanisch.
1Luisa
Schon als Vierjährige erfuhr ich von meinen Eltern, dass sie mich adoptiert hatten. Verschweigen hätte auch keinen Sinn gemacht, weil man gar nicht unterschiedlicher aussehen könnte. Mein Vater Ewald ist ein nordischer Riese, sommersprossig und hellhäutig, meine Mutter Silvia stammt aus dem Rheinland, ist eher ein mediterraner Typ und könnte auch für eine Französin oder Schweizerin gehalten werden. Bei mir dagegen sieht man sofort, dass ich von einem indigenen Volk aus einem anderen Erdteil abstamme. Deswegen kommt es immer wieder zu ärgerlichen Situationen. Auf die Feststellung meiner Mitmenschen: »Ich bewundere Ihr perfektes Deutsch«, reagiere ich stets mit einem Gegenkompliment: »Und ich Ihren breiten Dialekt!« Die ewige Frage nach meinem Migrationshintergrund ist durch mein Aussehen zwar nachvollziehbar, aber sie zeigt mir auch, dass man mich doch ausgrenzt und manchmal wie ein Kleinkind anspricht.
Wie bei den meisten Babys war mein erstes Wort Mama, und danach folgte das übliche Geplapper: Heia, Papa, Wau-Wau. Doch schon mit drei Jahren sprach ich in kurzen, weitgehend korrekten Sätzen. Es mag vor allem daran gelegen haben, dass sich meine Eltern besonders viel Mühe mit meiner Spracherziehung gaben und später auch verhinderten, dass ich mir den Szenejargon Gleichaltriger angewöhnte. Wahrscheinlich wirkte ich oft recht altklug, wenn ich zum Beispiel die ewigen Sprichwörter meiner Mutter nachschwätzte und sagte: »Übermut tut selten gut!«, oder sogar den Mitschülern predigte: »Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!«
Erst mit achtzehn Jahren lernte ich etwas Spanisch, weil ich irgendwann die Heimat meiner unbekannten Vorfahren besuchen wollte. Ein Kurs in Quechua wurde leider nirgends angeboten.
»Ich bin stolz auf meine blonden Haare«, sagte eine Klassenkameradin.
»Dann hast du dir sicher viel Mühe beim Färben gegeben«, meinte ich. Noch nie habe ich verstanden, wieso man auf etwas stolz ist, für das man überhaupt nichts kann. Da war ein Junge stolz auf seine adligen Vorfahren, eine eingebildete Gans war es, weil ihr Urgroßvater Widerstand gegen die Nazis geleistet hatte. Auf mein perfektes Deutsch kann ich ebenso wenig stolz sein wie auf meine kräftigen schwarzen Haare oder meine Luchsaugen, aber auf schlagfertige Antworten schon eher.
Meinen Vornamen Luisa hatten meine Eltern mit Bedacht gewählt, weil er mit seinen drei verschiedenen Vokalen gut klingt. Mein Nachname Müller kann dagegen gar nicht deutscher sein. Angeblich hatte mein Vater erwogen, mich Inka oder Maya zu nennen, was meine Mutter zum Glück aber nicht zuließ.
Natürlich würde ich gern wissen, von wem ich abstamme, aber da man mich kurz nach meiner Geburt vor der Tür eines südperuanischen Missionskrankenhauses abgelegt hat, konnte man auch dort keine Auskunft erteilen. Man nimmt aber an, dass ich die uneheliche Tochter einer Minderjährigen bin. Manchmal frage ich mich, ob ich meine besondere Fähigkeit von meinen unbekannten Verwandten geerbt habe oder ob es sich um eine Mutation handelt.
Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, jedenfalls ging ich noch nicht zur Schule, als ich meine Eltern in ungläubiges Staunen versetzte. Bisher hatten sie sich bloß darüber amüsiert, dass ich gruselige Märchen liebte, eine blühende Fantasie hatte und sogar schaurige Geschichten selbst erfand. Angstlust ist bei Kindern jedoch nichts Ungewöhnliches. Aber nach diesem Erlebnis fanden sie meine Wahrnehmungen fast ein wenig unheimlich.
Es war ein Winterabend und draußen stockdunkel. Ich lümmelte im Bademantel auf dem Sofa, hatte eine Kindersendung gesehen und sollte nun ins Bett gehen. Weil ich noch nicht besonders müde war, wollte ich Zeit schinden.
»Gibt es bald Schnee?«, begann ich die Unterhaltung. Meine Eltern wussten es nicht, deshalb schwang ich mich auf das Fensterbrett und blickte sehnsüchtig in den dunklen Garten hinaus.
»Draußen steht ein Mann«, sagte ich. Meine Mutter schaute auch hinaus und schüttelte den Kopf. »Das bildest du dir bloß ein, in dieser pechschwarzen Winternacht kann man nicht mal die Hand vor den Augen sehen!«, stellte sie fest.
»Doch, neben dem Kirschbaum steht einer«, sagte ich, und nun blickte auch mein Vater von seiner Zeitung hoch.
»Du bist ein kleiner Angsthase!«, sagte er. »Ich glaube, du hast dir zu viele Räubergeschichten ausgedacht und solltest jetzt allmählich die Flatter machen. Mama liest dir noch etwas vor, aber bestimmt keine Gruselmärchen …«
»Ich gehe nicht ins Bett, wenn draußen ein Mörder auf uns lauert«, sagte ich.
Meine Eltern sahen sich an und grinsten.
»Ich kann dir beweisen, dass du ein bisschen spinnst«, sagte jetzt mein Papa und drückte auf einen Schalter, der den Garten plötzlich in Flutlicht tauchte. Und jetzt sahen meine Eltern mit eigenen Augen, dass unter dem Kirschbaum ein schwarz gekleideter Mann stand, der mit einem Fernglas in unser helles Wohnzimmer starrte. Als er so unerwartet angestrahlt wurde, geriet er in Panik und flitzte davon.
»Das kann ja wohl nicht wahr sein!«, rief meine Mutter entsetzt, griff zum Handy und wählte den Notruf.
Auch mein sonst so gelassener Vater geriet in Wallung, riss die Terrassentür auf und stürmte in Pantoffeln in den hell erleuchteten Garten hinaus. Unter dem Kirschbaum fand er tatsächlich einen schwarzen Handschuh, der nicht von uns stammte. Während meine Mutter noch telefonierte, packte mich mein Vater am Schlafittchen.
»Wieso konntest du den Mann im Dunkeln sehen? Steht er vielleicht nicht zum ersten Mal in unserem Garten?«
Ich schüttelte den Kopf, denn ich hatte den Fremden noch nie zuvor bemerkt. Meine Eltern musterten mich sowohl ungläubig als auch ratlos. Als dann ein Polizeibeamter erschien, ließ er sich den Sachverhalt schildern, machte sich Notizen und kassierte den fremden Handschuh als Beweismittel. Es war aber klar, dass er die ganze Geschichte nicht besonders ernst nahm und eher an einen Voyeur als an einen Einbrecher dachte.
Meine Eltern beruhigten sich allmählich, ich durfte bei ihnen im Ehebett schlafen und hatte am nächsten Tag den schwarzen Mann im Garten fast wieder vergessen. Doch mein Vater anscheinend nicht.
Als es draußen dunkel geworden war, sagte er: »Wir machen jetzt mal ein Experiment. Ich verstecke mich im Garten, und du sagst der Mama, ob du mich sehen kannst.« Papa ging in die schwarze Nacht hinaus, und nach fünf Minuten sollte ich ans Fenster kommen und Ausschau halten. Für mich war es kein Problem, meinen Vater sofort neben dem Geräteschuppen zu entdecken. Dann schaltete meine Mama das Licht an und starrte mich schon wieder fassungslos an, weil ich anscheinend im Dunkeln sehen konnte. Das Spiel wurde mehrfach wiederholt, aber auch wenn zur Abwechslung meine Mutter hinausging, hatte ich sie blitzschnell gesichtet.
Erst Jahre später erklärten mir meine Eltern, dass sie auf keinen Fall wollten, dass ich zum Objekt wissenschaftlicher Forschungen würde. Deswegen beschlossen sie, vorerst keine Ärzte zurate zu ziehen. Abgesehen davon wollten sie wohl auch vermeiden, dass ich mich mit meiner einmaligen Gabe wichtig machen könnte. Durch mein Aussehen fiel ich sowieso schon aus dem Rahmen, sodass ich nicht zusätzlich durch unglaubwürdige Behauptungen auffallen sollte. Kurz vor meiner Einschulung beschloss meine Mutter allerdings, doch mal mit mir zum Augenarzt zu gehen.
»Ein Sehtest«, sagte sie.
Der Mann im weißen Kittel war ein freundlicher älterer Herr. »Kannst du schon die Zahlen?«, fragte er. Ich war etwas gekränkt, denn ich konnte mehr als das, nämlich lesen und meinen Namen schreiben. Die Prüfung meiner Sehschärfe war keine Herausforderung und schnell beendet.
»Gratuliere«, sagte der Arzt zu meiner Mutter. »Alles bestens, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.«
»Ich kann im Dunkeln sehen …«, begann ich. Der Arzt beugte sich zu mir herunter und tätschelte meinen Kopf.
»Du bist also eine kleine Hellseherin? Aber da bist du nicht die Einzige, das können nämlich viele Kinder! Doch was seht ihr, wenn ihr allein im dunklen Schlafzimmer seid? Immer bloß Gespenster! Dabei wisst ihr doch genau, dass Geister unsichtbar sind und euch die Fantasie einen Streich gespielt hat. Zum Beispiel kann ein weißes Hemd auf einer Stuhllehne …«
»Ich sehe keine Gespenster«, unterbrach ich ihn. »Ich sehe Mörder und Einbrecher!«
Der Arzt lächelte. »Dann solltest du Polizistin werden«, meinte er und an meine Mutter gerichtet: »Am Abend lieber keine Krimis erlauben!« Dann reichte er ihr zum Abschied die Hand, mir wuschelte er erneut übers Haar.
Im Laufe der Zeit musste ich feststellen, dass man mir sehr oft und fast beiläufig über meinen schwarzen Schopf strich. Es mochte daran liegen, dass ich etwas kleiner war als gleichaltrige Kinder, vielleicht auch, weil mein rundes Gesicht mit der flachen, aber breiten Nase und den mandelförmigen Augen einen Beschützerreflex auslöste. Doch ich empfand diese Geste, die wohl meistens freundlich gemeint war, als übergriffig.
Einmal im Monat aßen meine Eltern und ich in einem altmodischen Wirtshaus, wo es meistens lange dauerte, bis das Gewünschte auf den Tisch kam. Um die Wartezeit zu überbrücken, spielten wir immer das Spiel »Ich sehe was, was du nicht siehst«, dazu musste man noch die betreffende Farbe ergänzen. Nun war es allerdings so, dass ich zwar in allen dunklen Ecken etwas entdeckte, was für andere unsichtbar war, aber nicht erkennen konnte, ob dieser Gegenstand nun rot, blau, gelb oder grün war. Ich sagte deshalb immer bloß: »Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist grau.« Meine Eltern spielten mit und waren froh, wenn ich trotz meines Hungers gut gelaunt blieb, bis meine Fritten endlich auf dem Tisch standen.
Als ich in der vierten Klasse war, kam ein Polizist in unsere Schule. Wir sollten unsere Fahrräder mitbringen, um unter seiner Aufsicht im Schulhof auf einem Parcours mit Miniverkehrsschildern zu trainieren. Außerdem gab es theoretischen Unterricht im Klassenzimmer, wo wir die wichtigsten Regeln kennenlernten und auf alle möglichen Gefahren hingewiesen wurden. Meine Mitschüler und ich waren fasziniert, hauptsächlich allerdings vom netten Polizisten. Als er uns beim Abschied fragte, ob auch einer oder eine von uns später zur Polizei gehen wolle, meldete ich mich begeistert. Außer mir waren es noch drei Jungs.
»Warum meinst du, dass dieser Beruf genau der richtige für dich ist?«, fragte mich der Beamte.
»Weil ich in der Nacht sehen kann«, sagte ich stolz, aber etwas unüberlegt, denn meine Mitschüler lachten.
»Na, wunderbar, was du so alles kannst!«, sagte der Polizist und lächelte. »Zum Glück ist die Dunkelheit für uns nicht mehr so problematisch wie in den Zeiten von Räuber Hotzenplotz, denn wir sind mit Nachtsichtgeräten und Wärmekameras ausgestattet. Aber du hast sicherlich noch einen besseren Grund für deinen Berufswunsch.«
Ich war geistesgegenwärtig genug, um schnell zu reagieren. »Natürlich! Ich möchte dafür sorgen, dass Diebe und Mörder geschnappt werden.«
»Sehr gut!«, sagte der Polizist und fragte anschließend meine Mitbewerber nach ihren Motiven. Unser Klassensprecher wollte auch gelobt werden und gab an, dass ihm Sicherheit und Ordnung über alles gingen. Der zweite wollte mit dem Hubschrauber auf Verbrecherjagd gehen. Der dritte Junge war etwas einfach gestrickt, aber ehrlich. »Ich will tatütata machen«, sagte er. Doch im Grunde fanden auch seine beiden Kumpel nichts erstrebenswerter, als mit Sirenengeheul im Streifenwagen durch die Gegend zu rasen.
Mir war es aber eine Lehre, mit meiner Inselbegabung lieber nicht anzugeben, denn man lächelte mitleidig oder hielt mich für eine dreiste Lügnerin. Als ich etwas älter war, suchte ich im Internet nach einer Erklärung für das Phänomen, fand es aber nur bei Luchsen oder Katzen, deren schlitzartige Pupillen sich bei Dunkelheit weiten können. Bei Menschen kommt in seltenen Fällen zwar auch eine angeborene Spaltbildung vor, aber das sogenannte Iriskolobom gilt eher als körperliche Einschränkung und trifft auf mich nicht zu.
Mein Elternhaus lag am Rande der Stadt, gleich hinter unserem großen Garten begann der Wald. Seit ich als kleines Mädchen den schwarzen Mann unter dem Kirschbaum entdeckt hatte, waren meine Eltern vorsichtiger, ja fast ängstlich geworden. Der Scheinwerfer, den man vom Wohnzimmer aus bedienen konnte, reichte ihnen nicht. Alle Fenster sowie die Terrassentür erhielten Zusatzsicherungen, eine Alarmanlage und eine Videoüberwachung wurden angeschafft. Abends wurden im Parterre die Rollläden heruntergelassen. Der Bewegungsmelder im Garten erwies sich allerdings als Fehlkauf, denn es gab häufig unerwünschten Alarm durch allerlei Getier. Ich konnte meistens erkennen, ob es ein Vogel oder ein Kaninchen war. Daraufhin wurde dieses Gerät nicht mehr eingeschaltet, weil sich auch die Nachbarschaft über den schrillen Heulton beschwerte.
Tagsüber fand ich unseren großen Garten eher langweilig, aber mit zehn Jahren liebte ich ihn bei Nacht, denn ich fühlte mich durch die tierischen Besucher niemals einsam, sondern vereint mit der Natur. Über mir kreisten Eulen, Fledermäuse und Nachtfalter, um mich herum huschten Ratten, Marder, Waschbären und immer wieder ein bildschöner Fuchs. Doch er wollte nicht gezähmt werden wie beim Kleinen Prinzen, duldete mich aber immerhin in seinem Revier und betrachtete mich nicht als Rivalin oder gar Feindin. Anfangs hielt ich mich nur im Garten auf und mied den angrenzenden Wald. Aber mit der Zeit wurde ich mutiger, spazierte durch das Törchen hinaus und entdeckte eine neue Welt voll rätselhafter Lebewesen.
Ich lernte rasch, fremdartige Laute dem jeweiligen Tier zuzuordnen, stellte fest, dass Rehe nachts zwar meistens schlafen, aber bei Gefahr bellen können wie ein Hund. Ich hörte, dass Ratten quiekten wie Schweine und Waschbären knurrten wie ein Wolf. Die Nachtigall ist schon seit Ewigkeiten die Königin und außer Konkurrenz. Leider habe ich sie nur selten sehen können, denn sie ist kleiner als eine Amsel und sehr unauffällig. Aber sie hat es nicht nötig, sich wie ein Pfau in Schale zu werfen, denn ihre Lieder gehen zu Herzen wie das Ständchen von Franz Schubert. Allerdings ist Frau Nachtigall noch nie eine Sängerin gewesen, nur ihr Ehemann ist der wahre Caruso.
Tiere zu beobachten macht ja fast allen Menschen Freude, aber bei mir war es mehr: Ich betrachtete sie als meine eigentlichen Kameraden, denn es gab keine gleichaltrigen Kinder in meiner Nähe. Leider blieb diese Freundschaft eine einseitige Angelegenheit, weil mich die Tiere zwar duldeten, aber wahrscheinlich wenig Sympathie für mich empfanden. Deswegen beneidete ich meine Mutter, die mit viel Eifer tagsüber im Garten grub, pflanzte und jätete und ein Amselmännchen mit Regenwürmern sowie mehrere Eichhörnchen mit Nüssen handzahm gemacht hatte.
Irgendwann hatten sich meine Eltern daran gewöhnt, dass ich mich in der Dunkelheit draußen aufhielt. Sie fanden es auch nicht gefährlich, weil ich mich ja nie auf der Straße oder gar mit zwielichtigen Typen herumtrieb. Die Zeiten, als die Räuber noch im Wald wohnten, sind schon lange vorbei. Mein Vater nannte mich »Nachteulchen«, aber meine Mutter wünschte sich eigentlich, dass ich mich in meiner freien Zeit lieber mit Kultur als mit Natur beschäftigte. Sie war eine Leseratte und erzählte mir gern, wie sie in meinem Alter mit der Taschenlampe im Bett las, weil man ihr das Licht ausgeknipst hatte. Diesen Zustand empfand sie als sehr behaglich – geborgen in einem warmen Bett mit einer spannenden Lektüre und dem Kick, etwas Verbotenes zu tun. Dabei begriff sie nicht, dass ich oft und gern im Dunkeln las, aber das geheime Nachtleben der Natur fast noch interessanter fand.
Als ich schließlich eine weiterführende Schule besuchte, wollte ich mich zwar gern mit gleichaltrigen Mädchen anfreunden, aber es gelang mir nicht. Auch deswegen behielt ich meine spezielle Gabe lieber für mich. Ich wurde sowieso kritisch beäugt, weil ich die Einzige in der Klasse war, die exotisch aussah. Auf keinen Fall wollte ich zusätzlich noch als Angeberin dastehen.
Ich war von Anfang an eine gute Gymnasialschülerin, in den meisten Fächern sogar sehr gut. Im Aufsatz konnte ich glänzen, Englisch und später auch Französisch lernte ich mit Leichtigkeit. Auch in den musischen Bereichen gehörte ich zu den Besten. Meine Schwächen zeigten sich bloß beim Hochsprung und manchmal auch ein bisschen in Mathematik. Allerdings war ich nicht das einzige Mädchen, das sich da schwertat. Dazu kam, dass wir ab der zehnten Klasse einen unsympathischen Mathelehrer bekamen, der überhaupt kein Verständnis für die Minderbegabten zeigte und sich hauptsächlich mit den Stars beschäftigte. Und ausgerechnet er wurde unser Betreuungslehrer und begleitete uns auf unserer ersten längeren Klassenfahrt nach Tirol.
Die Jugendherberge lag etwas außerhalb eines kleinen Städtchens und war der ideale Ausgangspunkt für die geplanten Bergwanderungen. Zwar stammen meine Vorfahren aus den Anden, aber meine relativ kurzen Beine sind keine guten Voraussetzungen für einen zügigen Aufstieg. Doch ich war ausdauernd und geriet nie aus der Puste, sodass ich nach stundenlangem Wandern nicht so erschöpft war wie alle anderen. Herr Bredebusch, unser Lehrer, hatte sich wohl nicht ohne Grund überlegt, dass es bequemer für ihn war, wenn die Gruppe abends todmüde in die Federn sank und keine Lust auf ein ausgedehntes Nachtleben verspürte. Abgesehen davon gab es sowieso keine Kneipen oder andere Orte der Verführung in der Nähe.
Anscheinend gab es eine Vorschrift, dass jeweils ein Lehrer und eine Lehrerin die Klassen begleiten sollten. In unserem Fall war es außer dem unbeliebten Mathelehrer noch eine Referendarin. Von Anfang an beobachteten wir mit Argusaugen, wie die beiden Blicke tauschten, sich wie zufällig berührten und insgesamt den Eindruck gegenseitiger Sympathie vermittelten. Herr Bredebusch war allerdings wesentlich älter als sie und hatte eine Frau und zwei Kinder, die kaum jünger waren als wir. Katja Schuster war dagegen fast selbst noch eine Schülerin, sie musste ständig üben, um uns von ihrer Autorität und ihrem interessanten Unterricht zu überzeugen.
Nach einem langen und anstrengenden Wandertag lagen wir müde in unseren Stockbetten und schwatzten immer langsamer und leiser, weil die Ersten bereits eingeschlafen waren. Gegen elf Uhr herrschte Stille.
Ich musste allerdings noch mal auf die Toilette, schlüpfte in die Hausschuhe und huschte aus dem Schlafsaal. Ob unsere Lehrer auch schon schliefen oder unten im Speisesaal einen Absacker tranken? Aber dort war es bereits ebenso dunkel wie draußen in der Natur, weil an jenem Tag keine Sterne am Himmel zu sehen waren. Aus Neugierde oder vielleicht auch aus einer Ahnung heraus trat ich vor die Tür. Die Herberge war von einem kleinen Garten umgeben. Zwischen Gebüsch aus Latschenkiefern stand am hintersten Ende eine Bank, wo man an klaren Tagen einen spektakulären Rundblick auf das Bergpanorama hatte – und genau dort bewegte sich etwas. Als ich mich längsseits heranpirschte, erkannte ich deutlich unsere Aufsichtspersonen in eindeutiger Position. Fasziniert und wie gebannt musste ich eine Weile zuschauen – so wie damals wohl der schwarze Mann unterm Kirschbaum in unser Wohnzimmer gespäht hatte.
Als ich schließlich mit klopfendem Herzen wieder im Bett lag, gingen mir tausend Gedanken im Kopf herum. Es war unerhört, was ich soeben beobachtet hatte! Wie sollte ich mich jetzt verhalten? Die Sache publik machen? Niemand würde mir glauben, denn ich konnte keine Beweise erbringen. Man würde es für die Rache einer Schülerin halten, die sich bei ihren Matheklausuren ungerecht beurteilt fühlte.
Oder lag hier etwa eine einmalige Chance? Ich könnte Herrn Bredebusch damit drohen, seine Frau über den Seitensprung zu informieren und nur dann Stillschweigen zu wahren, wenn er mir in Mathe eine Eins statt einer Zwei gab.
Konnte das gut gehen? Wahrscheinlich war es eine saudumme Idee. Am Ende würde ich sogar von der Schule fliegen, denn ich saß am kürzeren Hebel.
Doch ich malte mir in dieser schlaflosen Nacht eine Zukunft als Erpresserin aus, denn mit einer Kamera mit Blitzfunktion könnte ich auch bei absoluter Dunkelheit brauchbare Belege herstellen. Vielleicht sogar mit dem großen Vorteil, dass man auch die Farbe erahnen konnte. Denn die einzige Schwäche meiner Eulenaugen besteht darin, dass ich bei Dunkelheit die Welt zwar sehe, aber nur in Schwarz-Weiß.
2Der böse Hund
Meine Eltern und ich konnten unsere neue Nachbarin nicht leiden, schon weil wir ihr unseren weitverbreiteten Nachnamen Müller nicht gönnten und man sie am Ende für eine Verwandte halten konnte. Doch auch alle anderen Bewohner unserer Straße wollten möglichst wenig mit ihr zu tun haben. Wo immer es möglich war, verbreitete sie gemeine Gerüchte über ihre Mitmenschen oder machte zumindest bösartige Andeutungen. Meine Mutter ärgerte sich besonders darüber, dass diese Frau eine starke Raucherin war, denn der Geruch zog oft in unseren Garten hinüber, aber dagegen konnte man leider nichts unternehmen. Obwohl die qualmende Giftspritze schon mehr als siebzig Jahre auf dem krummen Buckel hatte, takelte sie sich auf wie eine jugendliche Nutte.
»Hoffentlich wird sie nicht so alt, wie sie aussieht«, pflegte mein Vater zu sagen. Weil er sich ihren Doppelnamen nicht merken konnte, nannte er sie Frau Müller-Wauwau oder die Frau ohne Herz und Busen.
Zum Glück grenzte der kleine Garten der Alten nur für ein kurzes Stück an den unseren und wurde überdies durch eine Hecke abgetrennt. Wir sagten uns zwar höflich guten Tag, vermieden aber längere Gespräche. Die Probleme begannen erst, als sie sich einen kleinen, aber aggressiven Hund zulegte.
Frei lebende Tiere waren zwar nicht meine Intimfreunde, aber immerhin meine Kameraden. Wir kannten und respektierten uns. Mit Katzen, die als Freigänger herumstrolchten, hatte ich gelegentlich angebändelt, aber ich sah es nicht gern, wenn sie Singvögel jagten. Hunde hatte es bisher keine in unserer Straße gegeben, da fehlte mir die Erfahrung. Wahrscheinlich hätte ich mich mit einem zutraulichen Nachbarhund auch schnell angefreundet, aber in diesem Fall war es nicht möglich. Der Köter betrachtete mich von Anfang an als Feindin und knurrte böse, wenn er mich bloß witterte. In einem Punkt machte er mir sogar Konkurrenz: Er konnte zwar nicht im Dunkeln sehen, aber dafür angeblich Millionen Mal besser riechen als ein Mensch, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.
Als besonders empörend empfand es unsere Familie, dass er sein Geschäft stets in unserem Garten erledigte, denn er konnte ohne Weiteres durch die Ligusterhecke schlüpfen. Als leidenschaftliche Gärtnerin ärgerte sich meine Mutter ganz besonders. Wenn sie die Nachbarin höflich darauf hinwies, wurde allerdings jegliche Mitschuld abgestritten und behauptet, es handele sich gar nicht um eine hündische Hinterlassenschaft, sondern um den Kot eines Fuchses. Daraufhin schritt nun auch mein Vater fluchend zur Tat und dichtete die Grenze durch einen zusätzlichen Zaun aus Maschendraht ab.
»Jetzt wird sie hoffentlich mit ihrem Wadenbeißer spazieren gehen, damit er woanders hinscheißt«, sagte mein Papa, denn er fand es auch nicht in Ordnung, dass der Hund nie ausgeführt wurde.
»Dazu ist sie zu faul«, meinte meine Mutter. »Aber sie wird sich noch wundern, wie viele Häufchen sich ansammeln, wenn die nicht täglich beseitigt werden.«
Doch der Frieden währte nicht lange, schon nach wenigen Tagen hatte der Hund offenbar ein Schlupfloch entdeckt und benutzte unseren Garten erneut als Toilette, ohne dass wir den Täter je in flagranti erwischt hätten. Mein Vater war ratlos, denn er inspizierte seinen Zaun akribisch und fand nicht die kleinste Lücke. Dass ein so kleiner Hund die Hecke im Sprung überwinden würde, kam nicht infrage. Auch ein heimlich gegrabener Tunnel wurde nicht gefunden.
»Schmeiß doch die Hundehaufen einfach zurück über den Zaun«, sagte mein Vater. Aber meine Mama zierte und ekelte sich, obwohl sie am meisten darunter litt, wenn ihr Gemüse besudelt wurde.
»Vielleicht stellt ihm die Hexe abends eine Rampe hin, wie man es für Rollstuhlfahrer macht«, schlug ich vor. Da der Hund bei seinem Toilettengang tagsüber leider nie überführt werden konnte, wollte ich mich in einer Samstagnacht auf die Lauer legen, um dem Geheimnis endlich auf die Spur zu kommen.
Es war zwar noch nicht frostig, aber nachts schon kühl. Meine Eltern blieben unten im Wohnzimmer, die Rollläden hatten sie wie immer heruntergelassen und die Gardinen zugezogen. Ich begab mich bereits um neun in das obere Stockwerk und machte dort kein Licht an. Eingepackt in einen dicken Pullover setzte ich mich rittlings aufs Fensterbrett und behielt die Hecke im Auge. Es war etwa elf, als ich sah, wie die böse Nachbarin samt Fifi das Haus verließ, sich zügig der Grenze näherte, den Hund packte, einfach über die Hecke hob und zu uns hinunterplumpsen ließ. Der Kläffer hatte es offenbar eilig, wusste genau, was zu tun war, hockte sich sofort zwischen zwei Weißkohlköpfe und beendete seine unziemliche Tat in Windeseile. So weit war alles klar – aber wie kam der Sünder wieder nach Hause? Auch das konnte ich beobachten.
Der Hund rannte durch unseren großen Garten, da er bei dem angrenzenden Grundstück anscheinend eine Passage kannte, die zur Straße führte. Ich sprang von meinem Ausguck herunter, rannte über den Flur zur Frontseite unseres Hauses und beobachtete, wie der Vierbeiner in gestrecktem Galopp auf sein Zuhause zu sauste. Dort ging nach wenigen Minuten die Außenbeleuchtung an, die Hexe machte die Haustür auf, und der Hund war sofort wieder drinnen. Ein abgekartetes und eingeübtes Spiel.
Meine Eltern waren empört, als ich ihnen die Sachlage brühwarm mitteilte. »Nicht der Köter ist der Verbrecher, sondern seine Besitzerin«, fanden sie und überlegten, wie man die Angelegenheit zu einem friedlichen Ende führen könne. Es war klar, dass die Hexe wieder alles abstreiten würde.
»Man könnte Rattengift auslegen«, schlug mein Vater vor.
»Auf keinen Fall, mit Sicherheit würde eine Ratte den Köder finden, und die würde wiederum vom Fuchs gefressen!«, sagte ich.
Auch meine Mutter protestierte. »Dann lieber gleich die Hexe in den Backofen schieben«, sagte sie.
Ich hatte eine bessere Idee. Meine Mutter überwand ihren Ekel und ließ mit einer Brikettzange die Hundekacke eine Woche lang in eine Plastiktüte gleiten. Dann kam meine große Stunde, weil ich wieder oben auf der Lauer lag und meinen Eltern per Handy sagen konnte, wann die Nachbarin samt Kläffer ihren Garten betrat. Mein Vater hatte sich Panzerhandschuhe besorgt, schnappte sich den jaulenden Hund beim geplanten Toilettengang, klemmte ihn zwischen seinen Beinen fest und hielt ihm die Schnauze zu. Ich musste den stinkenden Beutel an seinem Halsband befestigen. Dann ließen wir den Feind entkommen und freuten uns alle drei auf das fassungslose Gesicht unserer Nachbarin. Wir hatten gesiegt! Nach und nach besserte sich das aggressive Verhalten des Hundes sogar, denn die Alte ging jetzt jeden Abend ein wenig mit ihm spazieren. Allerdings hatte ich schnell entdeckt, dass sie das Tageslicht beim Gassigehen mied, weil sie die Häufchen ihres Köters nicht vorschriftsmäßig aufsammelte, sondern einfach liegen ließ.
Meine Eltern besaßen ein Abo für die städtischen Bühnen, einmal im Monat gingen sie ins Theater. Wenn mein Vater keine Lust hatte, was allerdings oft vorkam, sprang eine Freundin meiner Mutter ein. Als ich vierzehn wurde, kam ich sogar häufiger mit als mein Papa. Von Brechts Dreigroschenoper war ich so beeindruckt, dass ich mir die DVD meiner Eltern immer wieder anschaute. Ich hörte die Songs so oft, dass ich sie bald alle mitsingen konnte. Am meisten faszinierten mich die Schlussstrophen:
Denn die einen sind im Dunkeln,
Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte,
Die im Dunkeln sieht man nicht.
Waren diese Worte nicht wie für mich geschrieben, sozusagen als Verpflichtung, meine besondere Gabe für gemeinnützige Zwecke einzusetzen und mich für die Bekämpfung von Armut, Ausgrenzung und Ungerechtigkeit zu engagieren? Schließlich konnte ich im Dunkeln sehen!
Als Kind hatte ich vorgehabt, Polizistin zu werden, später wollte ich aber Zoologie studieren, und zwar mit dem Schwerpunkt nachtaktive Tiere. Die Filme, die sich meine Eltern abends im Fernsehen anschauten, interessierten mich nur, wenn sie von Expeditionen in ferne Länder handelten. Es musste spannend sein, herumzureisen und nächtliche Streuner in anderen Erdteilen zu beobachten, zum Beispiel Erdferkel in der Kalahari, Fingertiere auf Madagaskar oder Schuppentiere in Namibia. Doch als Erstes wollte ich in das Land meiner Herkunft fliegen, denn im peruanischen Hochland gab es nachtaktive Nagetiere, verwandt mit den Chinchillas. Meine Eltern lächelten verständnisvoll und zeigten sich interessiert. Ich war selbst in den MINT-Fächern eine so gute Schülerin, dass mir jeder Beruf offenstand.
Mit fünfzehn beschloss ich jedoch, Sozialarbeiterin zu werden. Viel wusste ich zwar nicht über diesen Beruf, aber es ging wohl darum, Menschen in Krisenzeiten und schwierigen Lebenssituationen zu helfen, zum Beispiel den Obdachlosen. Spannend stellte ich mir auch die Arbeit im Strafvollzug vor oder mit stigmatisierten und besonders vulnerablen Gruppen. Meine Mutter sagte zuerst nichts zu meinem Vorhaben, mein Vater schüttelte den Kopf und wirkte äußerst skeptisch.
Ich wusste, dass die jahrelange Kinderlosigkeit eine starke Belastung für meine Eltern gewesen war, denn sie wünschten sich von Anfang an eine große Familie. Eigentlich hätten sie eine ganze Rasselbande adoptieren können, Platz genug gab es in unserem Haus. Ob ich sie enttäuscht hatte und sie es deswegen lieber bei einem Einzelkind belassen hatten? Fanden sie mein Aussehen zu exotisch? Eigentlich konnte das nicht sein, denn sie hatten sich ja ganz bewusst für die Adoption eines südamerikanischen Babys entschlossen. In meiner Klasse war ich die Beste, zu Hause war ich ordentlich, räumte mein Zimmer auf, hatte im Gegensatz zu meinen Mitschülern noch niemals Nachhilfe gebraucht und liebte Vater und Mutter. Sie konnten zufrieden mit mir sein, für mich wäre es jedoch lustiger gewesen, wenn ich Geschwister gehabt hätte.
Auf meine Frage erfuhr ich schließlich, warum sie kein zweites Mal ein Kind aufnehmen wollten. Mit mir hätten sie schließlich enormes Glück gehabt, und das sei nicht selbstverständlich. Die Freunde ihrer Cousine, erzählte meine Mutter, hätten nämlich ein Kind aus Südasien adoptiert, bei dem nach ein paar Monaten eine schwere geistige Behinderung diagnostiziert wurde. Man vermutete Drogenmissbrauch bei der leiblichen Mutter. Anscheinend wollten meine ängstlichen Eltern kein Risiko mehr eingehen und gaben sich zufrieden mit mir, ihrer wohlgeratenen Tochter. Mich erinnerte diese Geschichte an die Familie einer Klassenkameradin, die sich einen Hund aus dem Tierheim geholt hatte, einen Straßenhund aus Rumänien, der anscheinend in seinem bisherigen Leben traumatisiert worden war und sich nicht anfassen ließ. Falls es jemand behutsam wagte, wurde er gebissen. Nach wochenlangen vergeblichen Versuchen wurde der Hund wieder zurückgebracht. Ob man mit mir bei Fehlverhalten ebenso verfahren wäre?
Ursprünglich hatten meine Eltern andere Pläne gehabt. Nach der Heirat gab meine Mutter ihren Beruf als fest angestellte Redakteurin auf und schrieb nur alle zwei Wochen einen Artikel über Wohnen, Kochen oder Gartengestaltung. Eine unerwartet große Erbschaft wurde von meinen Eltern verwendet, um dieses stattliche alte Haus zu kaufen und es mit einer Kinderschar zu bevölkern. Erst als sie nach jahrelangen Enttäuschungen erfuhren, dass ihr Wunsch wohl nur durch eine verbotene Leihmutterschaft möglich wäre, dachten sie über Alternativen nach. Das Ergebnis war ich. Als ich in die Kita kam, wurde das Haus umgebaut, wir haben nun alle drei ein eigenes Bad wie in einem Hotel, und im Dachgeschoss ist ein Gästezimmer mit einem zusätzlichen Badezimmer entstanden, das