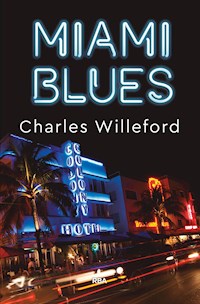Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PULP MASTER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Pulp Master
- Sprache: Deutsch
Einbruch, Diebstahl, Brandstiftung: Dem selbstgefälligen Kunstkritiker James Figueras ist schier jedes Mittel recht, um seinen Namen als Koryphäe des Kunstbe triebes verewigen zu können. Als ihm der wohlhabende amerikanische Kunstsammler Cassidy ein Interview mit dem verscholle- nen, weltberühmten französischen Künstler Jacques Debierue in Aussicht stellt, der plötzlich im sumpfigen Süden Floridas wieder aufgetaucht sein soll, kann er der Versuchung nicht widerstehen, mit einem Handstreich zu unsterblichem Ruhm zu gelangen. Doch Cassidy vermittelt ihm diese Gelegenheit nicht aus reiner Nächstenliebe. Als Gegenleistung will er ein Gemälde von Debierue für seine Sammlung, und James Figueras soll es für ihn stehlen ... und wenn er dafür über Leichen gehen muss!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I Kapitel Eins
I Kapitel Zwei
I Kapitel Drei
I Kapitel Vier
I Kapitel Fünf
I Kapitel Sechs
II Kapitel Eins
II Kapitel Zwei
II Kapitel Drei
II Kapitel Vier
III Kapitel Eins
III Kapitel Zwei
III Kapitel Drei
III Kapitel Vier
Impressum
Zum Autor
Zu den Übersetzern
Pulpmaster Backlist
Ketzerei in Orange
Charles Willeford
Nichts ist.
Wenn etwas wäre, wäre es nicht erkennbar.
Wenn es erkennbar wäre, wäre es nicht mitteilbar.
Gorgias
Für den großen verstorbenen
Jacques Debierue
1886-1970
Memoria in aeterna
Nichts ist.
I Kapitel Eins
Vor zwei Stunden hatte mir der Mann vom Bahnexpress die Kiste mit der eben erschienenen Internationalen Enzyklopädie der Kunst in mein Apartment in Palm Beach geliefert. Ich hatte den Lieferschein unterschrieben, den Thermostat der Klimaanlage um drei Grad höher gestellt, in der Küche den Tischlerhammer hervorgekramt und die Kiste aufgestemmt. Vierundzwanzig wunderschöne, leinengebundene Bände, cremefarbenes Dünndruckpapier, Büttenrand. Sechs arbeitsreiche Jahre der Vorbereitung, mehr als 2500 Illustrationen — 436 Farbtafeln — und jeder der gründlich recherchierten Artikel geschrieben und namentlich gezeichnet von einem anerkannten Experten des jeweiligen Fachgebiets der Kunstgeschichte.
Zwei Artikel stammten von mir. Und mein Name, James Figueras, wurde von anderen Kritikern in drei weiteren Artikeln erwähnt. Mich zu zitieren hieß, Bestätigung ihrer eigenen Auffassungen durch eine Kapazität zu erfahren.
In meiner Augenwelt, in der Welt der Kunstkritik, wo weniger als fünfundzwanzig Männer — und keine Frauen — sich ihren Lebensunterhalt als hauptberufliche Kunstkritiker verdienen (die Kunstrezensenten der Zeitungen zählen nicht), bedeutet die Tatsache, dass mein Name als Autorität in dieser ultimativen Enzyklopädie genannt wird, ERFOLG — und zwar in Großbuchstaben. Ich dachte einen Augenblick darüber nach. Nur 25 hauptberufliche Kunstkritiker in Amerika, bei einer Bevölkerung von mehr als 200 Millionen! Das ist in der Tat eine kleine Anzahl von Leuten, die fähig ist, Kunst zu betrachten, zu verstehen und ihre Interpretation schriftlich so zu formulieren, dass jeder, der will, teilhaben kann an diesem ästhetischen Erlebnis.
Clive Bell hat behauptet, Kunst sei ›signifikante Form‹. Dagegen habe ich nichts einzuwenden, aber er hat seine These nie bis zu ihrer nahe liegenden Schlussfolgerung fortgeführt: Es ist der Kritiker, der die Form(en) für den Betrachter signifikant werden lässt. In sieben Monaten werde ich meinen fünfunddreißigsten Geburtstag feiern. Ich bin der jüngste Experte, der in der Enzyklopädie mit seinem Namen zeichnet, und — so begriff ich im gleichen Augenblick — sollte ich lange genug leben, dann hatte ich alle Chancen, der größte Kunstkritiker Amerikas, vielleicht sogar der Welt zu werden.
Mit Zartgefühl hob ich die schweren Bände aus der Kiste und stellte sie in einer Reihe auf meinen Schreibtisch.
Die komplette Enzyklopädie kostete, wenn man sie noch vor dem eigentlichen Erscheinungsdatum zum Subskriptionspreis bestellte — und die meisten Universitäten, Colleges und großen Bibliotheken würden dieses Angebot nutzen —, dreihundertfünfzig Dollar plus Versandkosten. Nach ihrem Erscheinen muss man für die Enzyklopädie fünfhundert Dollar auf den Tisch legen; zusätzlich bekommt man die Option auf ein alljährlich erscheinendes Kunstjahrbuch zum Preis von nur zehn Dollar (mit dem gleichen guten Papier, dem gleichen attraktiven Einband).
Da zeitgenössische Kunst nun mal mein Fachgebiet ist, versteht es sich von selbst, dass mein Name in diesen Jahrbüchern vertreten sein wird.
Natürlich hatte ich schon vor Monaten die Korrekturfahnen gelesen, dennoch widmete ich mich jetzt ausführlich meinem 1600-Wörter-Aufsatz über Die Kunstund das Kind im Vorschulalter, las ihn mit der Befriedigung, die jeder gut geschriebene, fachkundige Text dem Leser verschafft. Der Aufsatz ist eine straffe Zusammenfassung meines Buches Die Kunst und das Kind im Vorschulalter, das wiederum eine überarbeitete Version meiner Magisterarbeit an der Columbia University war.
Dieses Buch machte mich zum Kunstkritiker, und gleichzeitig war das Buch ein Fehlschlag. Ich sage, das Buch war ein Fehlschlag, weil zwei pädagogische Institute an zwei großen Universitäten das Buch als Standardlektüre für kinderpsychologische Seminare übernahmen, was darauf hindeutete, dass die betreffenden Pädagogen weder die Thesen des Buches begriffen hatten noch etwas von Kindern oder Psychologie verstanden. Immerhin hatte mir das Buch dazu verholfen, dem Beruf des Dozenten für Kunstgeschichte zu entrinnen und stattdessen Autor und Kunstkritiker zu werden.
Thomas Wyatt Russel, Herausgeber des Magazins Fine Arts: TheAmericas, der das Buch gelesen und verstanden hatte, offerierte mir einen Vertrag als Kolumnist und freier Mitarbeiter, der mit vierhundert Dollar im Monat dotiert war. Fine Arts: The Americas bringt der Stiftung, die es trägt, jährlich mindestens fünfzigtausend Dollar Verlust ein und ist mit Abstand die erfolgreichste Kunstzeitschrift in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Zugegeben, vierhundert Dollar im Monat sind eher eine klägliche Summe. Aber mein Name im Impressum dieses prestigeträchtigen Magazins war das Instrument, das ich brauchte, um als freier Autor meine Artikel auch an andere Zeitschriften verkaufen zu können. Mein Einkommen aus diesen Arbeiten war naturgemäß unregelmäßig, aber zusammen mit dem festen, wenn auch kümmerlichen Monatsgehalt genügte es — solange ich unverheiratet blieb, was ich mir aber fest vorgenommen hatte — um mich vor dem ungeliebten Lehrerdasein zu bewahren und vor der frostigen Enge der Museumsarbeit, den beiden einzigen Alternativen, wenn man sich zu einem Examen in Kunstgeschichte entschlossen hatte. Natürlich gab es immer noch den Bereich der Werbung, doch niemand opfert dem eingehenden Studium der Kunstgeschichte bewusst seine Zeit — eine Grundvoraussetzung für ein Examen —, um anschließend in die Werbebranche einzusteigen, auch wenn man dort richtig Geld verdienen konnte.
Ich klappte das Buch zu, schob es zur Seite und griff nach Band III. Meine Finger zitterten — ein wenig —, als ich mir eine Zigarette anzündete. Ich wusste, warum ich mich so lange mit dem Aufsatz über Vorschulkinder abgegeben hatte, auch wenn es mir zuwider war, dies zuzugeben. Lange Zeit (ich versuchte mir weiszumachen, dass ich nur meine Zigarette zu Ende rauchen wollte) war ich körperlich außerstande, meinen Artikel über Jacques Debierue in Band III aufzuschlagen. Jede Scheußlichkeit, die Dorian Gray beging, zeigte sich auf seinem hinter verschlossenen Türen gehaltenen Porträt, und was mich betraf, stellte sich mir manchmal die Frage, ob irgendwo ein versteckter Filmprojektor vor sich hin surrte und wieder und wieder die Ereignisse jener beiden Tage in meinem Leben vorführte. Wie alles andere sollte auch das Böse mit der Zeit gehen, und ich war kein Kunstliebhaber des Fin de Siècle wie Dorian Gray, ich war Profi und genauso gegenwärtig wie das gleißende Sonnenlicht Floridas draußen vor meinem Fenster.
Trotz der Klimaanlage schwitzte ich so heftig, dass meine dicken Koteletten feucht und klebrig wurden. Hier in diesem wunderschönen Buch stand sie endlich, die bittere Wahrheit über mich. Schuldete ich Debierue meinen gegenwärtigen Ruf und Erfolg oder hatte Debierue seinen Erfolg und seinen Ruf mir zu verdanken?
»Wo immer du den Schmerz antriffst«, schreibt John Heywood, »wird er dir nicht gefallen.« Der Gedanke an Debierue schmerzte mich wirklich — und ich mochte diesen anhaltenden Schmerz nicht, ebenso wenig wie mich selbst. Aber nichts, nichts auf dieser Welt konnte mich daran hindern, meinen Artikel über Jacques Debierue zu lesen ...
I Kapitel Zwei
Gloria Bentham hatte nicht die blasseste Ahnung von Malerei, was sie aber nicht daran gehindert hatte, eine erfolgreiche Kunsthändlerin und Galeristin in Palm Beach zu werden. Sich zu behaupten und darüber hinaus noch ein wenig mehr als das zu schaffen, wenn während der Saison mehr als dreißig gewerbliche Galerien von morgens bis abends geöffnet waren, war keine schlechte Leistung, auch wenn die aufblühende Kunstbewegung der letzten Jahre es möglich gemacht hatte, beinahe jedes Kunstobjekt zu einem fast beliebigen Preis an den Mann zu bringen. Dennoch — Menschenkenntnis ist für einen Händler wichtiger als Kunstverständnis, und Gloria zeigte in ihrer feinfühligen, zurückhaltenden, unscheinbaren Art die Gabe, den Leuten geduldig zuzuhören — einen Wesenszug, der oft für Verständnis gehalten wird.
Als ich auf der A1A Richtung Norden fuhr, von Miami nach Palm Beach, dachte ich an Gloria, um nicht an andere Dinge denken zu müssen, aber es befriedigte mich nicht sonderlich. Ich hatte mich für die längere, langsamere Strecke und gegen den Sunshine Parkway entschieden, um eine zusätzliche Stunde zu nutzen und meine Gedanken zu ordnen hinsichtlich dessen, was ich über die Malerei von Miami schreiben wollte, und ich wollte eine Stunde länger einem Problem — falls es noch ein Problem war — namens Berenice Hollis aus dem Weg gehen. Nichts ist einfach, und ich bin nur deshalb ein guter Kritiker, weil ich hinter das tiefe, dunkle Geheimnis der Kritik gekommen bin. Das Denken, der Prozess des Denkens und der Mensch, der denkt, sind ein und dasselbe. Und wenn das so ist — und ich führe mein Leben, als sei es so —, dann sind auch der Mensch, der malt, die Malerei und der Prozess des Malens ein und dasselbe. Nichts und niemand ist jemals einfach, und Gloria war geradezu versessen darauf, dass ich nach Palm Beach kam, um bei der Vernissage ihrer neuen Ausstellung dabei zu sein. Die Ausstellung war nicht wichtig, noch war die Idee einzigartig. Das Ganze war nur vernünftig.
Sie veranstaltete eine Doppelausstellung: naive haitianische Malerei und die Arbeiten eines jungen Malers aus Cleveland namens Herb Westcott, der zwei Monate in Pétionville, Haiti, verbracht und die lokale Szenerie gemalt hatte. Der Kontrast würde Westcott schlecht und die Primitiven gut aussehen lassen, weil er Profi war und sie auf naive Weise unprofessionell waren. Gloria würde die Primitiven mit 600 Prozent Aufschlag auf den Einkaufspreis verkaufen, und selbst wenn die meisten Käufer die Bilder nach einer Woche zurückbrächten (nicht viele Leute können mit haitianischen Primitiven leben), würde sie immer noch einen Gewinn machen. Und in den Augen der Sammler, die naive Malerei nicht ausstehen konnten, würde Westcotts Handwerk gegenüber den Haitianern derart überlegen wirken, dass er in einer solchen Tandemausstellung zweifellos einige Bilder mehr verkaufen würde als in einer One-Man-Show ohne den Vorteil des Vergleichs.
Indem ich an Gloria dachte, hatte ich für kurze Zeit vermieden, meine Gedanken Berenice Hollis zuzuwenden. Meine Lösung für das Problem Berenice war eine Art sanfter Overkill; einerseits hatte ich gehofft, es werde funktionieren, andererseits nicht. Sie war Englischlehrerin an einer High School (elfte Klasse) und kam aus Duluth, Minnesota. Sie war nach Palm Beach geflogen, um sich ein paar Wochen in der Sonne zu erholen, nachdem sie sich eine Zyste aus dem Kreuz hatte operieren lassen — keine ernste Operation, aber sie war für einige Zeit krankgeschrieben, und die nutzte sie. Ihre helle Haut war nach und nach safrangelb und dann golden wie Ahornsirup geworden. Die Narbe am Steißbein hatte sich von ihrer anfänglich wütend roten Farbe gräulich eingefärbt, um schließlich im Grau in Grau einer leicht runzligen Grisaille zu verblassen.
Unsere Romanze hatte ähnliche Schattierungen und Nuancen angenommen. Ich hatte Berenice in der Four Arts Gallery kennen gelernt, wo ich über eine Toulouse-Lautrec-Wanderausstellung berichtet hatte, und sie wollte nicht wieder nach Duluth zurück. Das wäre für mich so weit in Ordnung gewesen (ich hätte niemanden in aller Aufrichtigkeit zur Rückkehr nach Duluth ermuntern können), aber ich hatte den Fehler begangen, sie bei mir einziehen zu lassen, eine törichte Entscheidung, die mir damals wie eine großartige Idee vorgekommen war. Sie war ein kräftiges Mädchen vom Lande — drall ist ein besseres Wort —, mit üppigreifen Formen, kornblumenblauen Augen und einer wilden, dunkelblonden Mähne, die sich über ihren Rücken ergoss. Abgesehen von der heftzweckengroßen Narbe über ihrem Steißbein, die man kaum bemerkte, war ihre sonnenwarme, süß duftende Haut makellos. Ihre blauen Augen hatten dank ihrer Kontaktlinsen einen samtigen Blick. Aber sie war nicht wirklich gutmütig, wie ich zuerst gedacht hatte, sondern nur faul. In meinem kleinen Apartment war kaum Platz für eine Person, geschweige denn für eine weitere, und Berenice breitete sich in alle Richtungen aus. Wer sie zum Ausgehen oder für eine Party angezogen sah, hätte nicht geglaubt, dass das Zusammenleben mit ihr ein derartiges Tohuwabohu bedeutete — Kleider verstreut über alle Sitzgelegenheiten, nasse Badetücher, Bikinis auf dem Fußboden, im Bad stank es nach Badesalz, Puder, Parfüm und Salben, eine kräftige Mischung, die so überwältigend war, dass ich mir beim Rasieren die Nase zuhalten musste. Der Zustand der Kochnische war noch schrecklicher. Niemals spülte sie Tassen, Töpfe, Teller oder Pfannen, und einmal erwischte ich sie dabei, wie sie das zerlassene Fett von Speck in den Abfluss schüttete.
Mit der Schlamperei konnte ich leben. Doch das Hauptproblem bestand darin, dass Berenice ständig anwesend war und ich gleichzeitig in meinem Apartment schreiben musste.
Es hatte meiner gesamten Überzeugungskraft bedurft, Tom Russel dazu zu überreden, dass ich während der Saison über die Gold Coast berichten durfte. (Die offizielle Saison in Palm Beach beginnt an Silvester mit einem langweiligen Dinnerball im Everglades Club und findet irgendwann um den 15. April herum ihr Ende.) Tom willigte schließlich ein, lehnte es jedoch ab, mir zusätzlich zu meinem Gehalt Spesen zu zahlen. Also musste ich in Palm Beach nicht nur mit meinem monatlichen Honorar auskommen, ich musste von meinen kargen Ersparnissen auch noch den Flug bezahlen (von den restlichen 250 Dollar kaufte ich mir ein Auto). Nur weil ich meine mietgebundene Bude im Village für das Doppelte vermieten konnte, kam ich zurecht. Gerade mal so.
Ich arbeitete zweimal so hart und schrieb viel bessere Artikel als in New York, um Tom Russel davon zu überzeugen, dass die Gold Coast ein prosperierendes Zentrum amerikanischer Malerei war, das von den seriösen Kunstzeitschriften viel zu lange vernachlässigt worden war. Um ehrlich zu sein, war dem noch nicht so, doch es fanden sich stellenweise Anzeichen dafür, dass sich etwas bewegte. Floridas einheimische Maler reproduzierten immer noch das Klischee impressionistischer Palmen und Meerespanoramen, dennoch hatten genug angesehene Maler aus New York und Europa Florida inzwischen für sich entdeckt und stellten in Galerien von Jupiter Beach bis Miami aus. Somit gab es während der Saison hinreichend neue Ausstellungen, um meine Kolumne zu füllen, und mindestens ein bedeutender Maler zeigte seine Bilder lange genug, dass ich ihn mit einer meiner umfassenden Abhandlungen würdigen konnte. Während der Saison ist in Florida eine Menge Geld im Umlauf, und Maler stellen natürlich überall dort aus, wo das Geld bei potentiellen Käufern locker sitzt.
Solange ich Berenice die ganze Zeit in dem winzigen Apartment um mich hatte, konnte ich nicht schreiben. Sie tappte barfuß umher, leise und verstohlen, wie es nur ein fast siebzig Kilogramm schweres Mäuschen zustande bringt — bis ich mich beschwerte. Dann setzte sie sich stillvergnügt irgendwohin, las nichts, tat nichts, sondern starrte mich nur liebevoll von hinten an, während ich vor meiner Hermes-Schreibmaschine saß. Ich hielt das nicht aus.
»Worüber denkst du nach, Berenice?«
»Über nichts.«
»Doch, du denkst über mich nach.«
»Nein, tu ich nicht. Los, schreib weiter. Ich stör dich nicht.«
Aber sie störte mich doch, und ich konnte nicht schreiben. Ich hörte sie nicht einmal atmen, so leise war sie, aber ich ertappte mich immer wieder dabei, wie ich die Ohren spitzte, ob ich sie nicht doch hören konnte. Es bedurfte einiger Mühe, mich mental zu wappnen (denn im Grunde bin ich ein freundlicher Mistkerl), und schließlich bat ich Berenice in netter Form, sie möge verschwinden. Sie wollte nicht. Ein wenig später wurde ich garstig und mein Ton schroffer. Sie stritt nicht mit mir, aber sie war auch nicht bereit zu gehen. Bei solchen Gelegenheiten gab es ihrerseits nicht mal Widerspruch. Sie sah mich nur ernst an, mit weit geöffneten kornblumenblauen Augen, in denen die Kontaktlinsen ins Schwimmen gerieten, bis die unterdrückten Tränen flossen, während sie sich gleichzeitig bemühte, ihre mächtigen, atemlosen Schluchzer zurückzuhalten — und damit machte sie mich fertig. Für gewöhnlich verließ ich dann unwiderruflich die Wohnung, um ein paar Stunden später zur rituellen Versöhnung und einer wilden Nummer im Bett zurückzukehren.
Aber ich schaffte meine Arbeit nicht. Arbeit ist wichtig für einen Mann. Nicht einmal die schöne Helena könnte mit einer Hermes-Schreibmaschine konkurrieren. So schön sie auch sein mag, eine Frau ist eben nur eine Frau, aber zweitausendfünfhundert Wörter sind ein Artikel. In meiner Verzweiflung stellte ich Berenice ein Ultimatum. Ich erklärte, ich führe nach Miami, und wenn ich vierundzwanzig Stunden später zurückkäme, solle sie verdammt noch mal aus meinem Apartment und aus meinem Leben verschwunden sein.
Tatsächlich aber kam ich nach drei Tagen zurück; vierundzwanzig Stunden hatte ich zur Sicherheit noch drangehängt. Ich rechnete damit, dass sie noch da sein werde. Ich wünschte mir sogar, dass sie da wäre, doch paradoxerweise wollte ich auch, dass sie weg war, und zwar für immer.
Ich parkte auf der Straße, klappte das Verdeck an meinem Chevy zu — einem sieben Jahre alten Kabrio — und ging über den gefliesten Innenhof auf die mit Stuck verzierte Außentreppe zu. Auf halber Treppe hörte ich das Telefon in meiner Wohnung im ersten Stock. Ich blieb stehen und wartete; es klingelte noch dreimal. Berenice wäre außerstande gewesen, ein Telefon viermal läuten zu lassen ohne abzunehmen, und so wusste ich, dass sie weg war. Noch bevor ich die Tür aufgeschlossen hatte, hörte das Klingeln auf.
Berenice war weg, und das Apartment war sauber. Es war natürlich nicht fleckenlos sauber, aber sie hatte sich redlich bemüht, alles aufzuräumen. Das Geschirr war gespült und eingeräumt, und der Linoleumboden war — wenn auch halbherzig — gewischt worden.
Ein verschlossener Umschlag mit einem hingekritzelten James auf der Vorderseite lehnte an meiner Schreibmaschine, die auf dem Klapptisch vor dem Fenster stand.
Liebster, allerliebster James,
du bist ein Scheißkerl, aber ich glaube, das weißt du selbst. Ich liebe dich immer noch, aber ich werde dich vergessen. Ich hoffe bloß, ich werde niemals unsere guten Zeiten vergessen. Ich fahre zurück nach Duluth — komm mir ja nicht nach. B.
Wenn sie nicht wollte, dass ich ihr folgte, weshalb schrieb sie mir dann, wohin sie fuhr?
Im Papierkorb lagen drei Papierbälle. Rohentwürfe für den endgültigen Brief. Zuerst wollte ich sie lesen, aber dann überlegte ich es mir anders. Ich würde die endgültige Version akzeptieren. Ich zerknüllte Brief und Umschlag und warf beides in den Papierkorb.
Ich spürte einen tiefen Verlust und zugleich ein unvernünftiges Aufwallen von Wut. Ich konnte Berenice buchstäblich noch riechen und wusste, dass ihre feminine Mischung aus Moschus, Schweiß, Parfüm, stechend riechendem Hautpuder, Lavendelseife, mit Kräuterkissen gepolsterten Kleiderbügeln, Essig und allem anderen Hübschen, das ihre Anwesenheit mit sich gebracht hatte, für alle Zeit in der Wohnung hängen würde. Ich bemitleidete mich selbst und ich bemitleidete Berenice und zugleich machte sich Begeisterung in mir breit, weil ich sie endlich los war, obwohl ich wusste, dass ich sie in den schrecklichen nächsten Wochen wie verrückt vermissen würde.
Es war noch reichlich Zeit bis zur Vernissage in Glorias Galerie. Ich zog mein Sporthemd aus, streifte mir die Slipper von den Füßen und setzte mich an den Klapptisch, der mir als Schreibtisch diente, um meine Notizen aus Miami durchzusehen. Die drei Tage in Dade County waren keine Zeitvergeudung gewesen. Ich hatte bei Larry Levine in Coconut Grove gewohnt. Larry war Grafiker; ich kannte ihn aus New York, und seine Frau Paula war eine ausgezeichnete Köchin. Ich würde Larry mit einer kurzen Anmerkung zu seinen neuen Tierdrucken in meiner Kolumne entschädigen.
Ich hatte genügend Notizen für einen 2500-Wörter-Artikel über eine ›Southern Gothic‹-Ausstellung zum Thema Leben und Umwelt, die ich in North Miami gesehen hatte, und einen netten Aufhänger für meine Kolumne am Heftende, und zwar eine Anmerkung zu Harry Trumans Brille. Der Anstoß dazu war von Larry ausgegangen.
Ein Mechaniker in South Miami, ein Verehrer Trumans, hatte an Lincoln Borglum geschrieben, der nach dem Tod seines Vaters die monumentalen Präsidentenköpfe am Mount Rushmore fertig gestellt hatte, und den Bildhauer gefragt, wann er denn Trumans Kopf den anderen hinzufügen werde. Lincoln Borglum, der anscheinend mehr Sinn für Humor hatte als sein verstorbener Vater Gutzon, behauptete in seiner scherzhaften Antwort, er sehe sich dazu außerstande, weil es zu schwierig sei, Trumans Brille nachzubilden. Der Mechaniker, ein Mann namens Jack Wade, nahm Borglum beim Wort und fertigte eine Brille.
Es war ein gewaltiges Gestell von mehr als sieben Meter Breite, mit einem Stahlrahmen, der dick mit emaillierter Goldbronze überzogen war. Die Brillengläser waren aus Isolierglas.
»Das Isolierglas verhindert, dass die Brille an kalten Tagen allzu sehr beschlägt«, erklärte Wade.
Ich hatte drei Schwarz-Weiß-Polaroids von Wade und seiner Brille gemacht; eines der Bilder war scharf genug, um die Geschichte zu illustrieren. Die Brille war ein hervorragendes Ergebnis handwerklichen Könnens, und ich hatte Mr. Wade vorgeschlagen, sie einem Optiker zu Werbezwecken zu verkaufen. Er hatte empört reagiert.
»Nein, bei Gott«, sagte er entschieden, »diese Brille ist für Mr. Truman, wenn seine Büste am Mount Rushmore fertig ist!«
Das Telefon klingelte.
»Wo warst du?«, fragte Gloria mit schriller Stimme. »Ich versuche schon den ganzen Nachmittag, dich zu erreichen. Berenice hat gesagt, du seist abgereist und würdest vielleicht nie mehr zurückkommen.«
»Wann hast du mit Berenice gesprochen?«
»Heute Vormittag, gegen halb elf.«
Das war ein Hammer. Wäre ich nach vierundzwanzig Stunden zurückgekommen — oder nach achtundvierzig oder nach sechzig —, dann wäre Berenice jetzt noch hier. Mein Timing war perfekt gewesen, aber ein bisschen weh tat es doch.
»Ich war in Miami, arbeiten. Aber Berenice ist abgereist, und sie kommt nicht mehr zurück.«
»Ein Streit zwischen Verliebten? Erzähl Gloria alles.«
»Ich möchte nicht darüber reden, Gloria.«
Sie lachte. »Kommst du zur Vernissage?«
»Ich hab doch gesagt, ich komme. Was ist denn so wichtig an haitianischer Malerei aus zweiter Hand, dass du den ganzen Tag versuchst, mich an die Strippe zu bekommen?«
»Westcott ist ein guter Maler, James, weißt du. Ein erstklassiger Zeichner.«
»Sicher.«
»Du klingst komisch. Ist alles in Ordnung?«
»Alles in Ordnung. Und ich werde da sein.«
»Worüber ich mit dir reden wollte ... Joseph Cassidy wird auch da sein, und er kommt, weil er dich kennen lernen will. Das hat er mir gesagt. Du weißt, wer Mr. Cassidy ist, oder?«
»Weiß das nicht jeder?«
»Nein, nicht jeder. Nicht jeder braucht ihn!« Sie lachte. »Aber er hat uns eingeladen — dich und mich und ein paar andere. Wir sollen nach der Vernissage bei ihm zu Abend essen. Er hat ein Penthouse im Royal Palm Towers.«
»Ich weiß, wo er wohnt. Wieso will er mich kennen lernen?«
»Hat er nicht gesagt. Aber er ist der größte Sammler, der je in meiner kleinen Galerie gewesen ist, und wenn ich ihn als Kunden binden kann, brauche ich keine anderen mehr.«
»Dann verkaufe ihm keine Primitiven und keinen Westcott.«
»Warum nicht?«
»Er interessiert sich nicht für konventionelle Malerei. Versuche nicht, ihm irgendetwas zu verkaufen. Warte, bis ich mit ihm gesprochen habe, dann werde ich dir etwas vorschlagen.«
»Danke, James.«
»Nicht der Rede wert.«
»Bringst du Berenice mit?«
»Ich sagte doch, ich möchte nicht darüber reden!«
Sie lachte noch, als ich den Hörer auf die Gabel legte.
I Kapitel Drei
So sehr mir der Ausdruck ›Schnorrer‹ auch missfällt — kein anderes Wort beschreibt passender, wozu ich mich im Laufe meines Aufenthaltes an der Gold Coast entwickelt hatte. Während der Saison trifft man in Palm Beach auf unterschiedlichste gesellschaftliche Kreise und diese haben wenig gemein mit den sozialen Gruppen in Miami oder Miami Beach, die sich nicht unbedingt freiwillig entweder zu den ›weißen angelsächsischen Protestanten‹ — kurz WASPs genannt — oder zu den jüdischen Gruppierungen zählen. In Lauderdale besteht der Geldadel natürlich aus aufrechten WASPs.
Ich gehörte keiner Gruppe an, bewegte mich aber an der Peripherie von allen, und das verdankte ich meinem Beruf. Ich traf Leute auf Vernissagen, wo zumeist Cocktails serviert werden, und weil ich jung war und allein stehend und noch dazu einen akzeptablen Beruf vorzuweisen hatte, lud man mich auch zu Dinners, Cocktailpartys, Polospielen, Bootsfahrten, mitternächtlichen Soupers und Barbecues ein. Diese Einladungen führten dazu, dass ich anderen Gästen vorgestellt wurde, was wiederum für gewöhnlich neue Dinnereinladungen zeitigte. Und einige Künstler an der Gold Coast, Leute wie Larry Levine zum Beispiel, kannte ich schon aus New York.
Nach zwei Monaten in Florida hatte ich eine Menge Bekannte und Beziehungen, aber keine Freunde. Ich erwiderte keine der Dinnereinladungen, und Bars, Nachtklubs und Restaurants, wo ich womöglich auf der Rechnung sitzen blieb, musste ich meiden. Doch einer, der nie die Rechnung übernimmt, gewinnt auch keine Freunde. Dennoch war ich der Ansicht, dass meine diversen Gastgeber und Gastgeberinnen durch meine Anwesenheit in ihrem Hause hinreichend entschädigt wurden. Ich unterhielt mich bestens mit den langweiligsten Typen und ich war der außergewöhnliche Mann bei Dinners, wo unverheiratete heterosexuelle Männer Seltenheitswert besaßen, und wenn ich in Stimmung war, konnte ich Geschichten erzählen oder die Unterhaltungen über einen toten Punkt hinwegretten.
Ich besaß zwei Dinnerjackets, eines aus rotem Seidenbrokat und ein normales aus weißem Leinen. Das weiße wies Lippenstiftspuren auf, weil eine beschwipste Berenice mich in die Schulter gebissen hatte, als wir von einer Party nach Hause fuhren. Seither war ich gezwungen, ausschließlich das rote Brokatjackett zu tragen.
Während ich die sechs Blocks zu Fuß ging, die zwischen meinem Apartment und Glorias Galerie lagen, stellte ich ein paar Überlegungen zu Joseph Cassidys Einladung zum Abendessen an. Eine gesellschaftliche Einladung war nichts Ungewöhnliches, aber Gloria hatte gesagt, er wolle mich treffen, und ich fragte mich, weshalb. Cassidy war nicht nur als Sammler berühmt, sondern auch als Strafverteidiger. Die enormen Einkünfte aus seiner Kanzlei in Chicago hatten ihm die Möglichkeit gegeben, seine Kunstsammlung aufzubauen.
Er besaß eine der schönsten Privatsammlungen zeitgenössischer Malerei in Amerika, und so kam ich zu der Schlussfolgerung, die mir in diesem Augenblick am nächsten zu liegen schien: Er wollte, dass ich einen Katalog schrieb. Und wenn das nicht der Grund war, weshalb er mich sprechen wollte (meines Wissens war zu dieser Sammlung noch kein Katalog erschienen), so hatte ich doch große Lust, ihm diesen Vorschlag zu machen. Ein solcher Auftrag würde sich für mich — wie auch für Cassidy — in mehrfacher Hinsicht bezahlt machen. Ich könnte ein bisschen Geld nebenher verdienen, ein paar Monate in Chicago verbringen, ein wenig über Malerei und Maler des Mittleren Westens schreiben — und schließlich könnte mein Name auf dem veröffentlichten Katalog meiner Karriere nur förderlich sein.
Je länger ich über diese Idee nachdachte, desto größer wurde meine Begeisterung, aber als ich bei der Galerie eintraf, war sie durch die Einsicht gedämpft, dass ich Cassidy einen solchen Vorschlag nicht würde machen können. Wenn er es vorschlug — schön. Aber ich konnte den Mann bei einem gesellschaftlichen Anlass nicht einfach um einen Job angehen, ohne dabei das Gesicht zu verlieren.
Und was hatte ich einem Mann wie Cassidy sonst zu bieten? Mein Stolz (nennen Sie es Machismo), den ich überzog und der oft nur aufgesetzt war, war angeboren: ein Erbteil meines puerto-ricanischen Vaters. Aber dieser Stolz war nun mal vorhanden, und ich hatte manche Gelegenheit verstreichen lassen, mich voranzubringen, weil ich mich zunächst immer gefragt hatte, was mein Vater unter ähnlichen Umständen getan hätte.
Als ich in der Galerie stand, hatte ich mir die Idee bereits aus dem Kopf geschlagen.
Gloria zog ihre schmalen Lippen über ihrem Pferdegebiss zurück, streifte meine rechte Kotelette mit ihrem Mund und packte mich schmerzhaft und mit der Kraft eines Schraubstocks am Arm, um mich an die Bar zu führen.
»Kennst du diesen Mann, Eddy?«, fragte sie den Barkeeper.
»Nein.« Eddy schüttelte gelassen den Kopf. »Aber mir ist bekannt, was er trinkt.« Er goss zwei Fingerbreit Cutty Sark über zwei Eiswürfel und reichte mir den Pappbecher.
»Danke, Eddy.«
Eddy arbeitete tagsüber im Hiram’s Hideaway in South Palm Beach, aber er war ein beliebter Barkeeper, und im Laufe der Saison engagierten ihn viele Gastgeberinnen für ihre abendlichen Partys. Meistens traf ich ihn ein- bis zweimal die Woche an verschiedenen Orten. Jeder, dachte ich, braucht heutzutage ein bisschen was nebenher. Einen festen Job und noch etwas anderes. Gloria zum Beispiel hätte die hohe Saisonmiete für ihre Galerie nicht aufbringen können, wenn sie die Räume nicht gelegentlich abends für Dichterlesungen oder für Sitzungen von Selbsterfahrungsgruppen vermietet hätte. Dabei verabscheute sie diese Gruppen. Sie behauptete, dass Leute, die es nötig hätten, Dichtern beim Lesen zuzuhören oder sich in Selbsterfahrungstreffen zu quälen, allesamt Kettenraucher seien, die nie die von ihr bereitgestellten Aschenbecher benützten.
Eddy arbeitete an einem weiß gedeckten Klapptisch. Dahinter hatte er Scotch, Bourbon, Gin und Wermut für Martinis und einen Plastikbehälter mit Eiswürfeln aufgebaut. Ich trat zurück, um jemand anderem eine Chance auf einen Drink zu geben, und nahm einen der hektografierten Kataloge, die auf dem Tisch im Foyer lagen. Gloria begrüßte an der Tür die Neuankömmlinge, geleitete sie zuerst an einen Tisch, wo sie sich ins Gästebuch eintragen sollten, und dann an die Bar.
Glorias Vernissagen waren keineswegs exklusiv. Neben jenen Leuten, deren Namen auf ihrer Gästeliste standen, erhielten auch die PR-Direktoren der Hotels in Palm Beach Einladungen, und die gaben sie an potentielle Käufer unter ihren Gästen weiter. Die langweiligen Hotelgäste, die sich durch die gedruckte Einladung zu einer privaten Vernissage geehrt fühlten, zeigten sich entzückt von der Aussicht, auf dieser Veranstaltung die echte Palm-Beach-Society kennen zu lernen und kauften gelegentlich sogar ein Bild. Und wenn sie es taten, bekam der PR-Direktor des betreffenden Hotels ein Sportsakko oder ein neues Paar Schuhe von Gloria. Infolgedessen war das Publikum einer von Gloria veranstalteten Vernissage oftmals eine ziemlich schräge Ansammlung von Leuten. Heute waren sogar zwei Teenager vom Palm Beach Junior College da; aufgeregt betrachteten die Mädchen die Primitiven und machten sich mit Kugelschreibern Notizen in ihre Kladden.
Herbert Westcott, erfuhr ich aus dem Katalog, war siebenundzwanzig Jahre alt, ein Absolvent der Western Reserve, der auch an der Art Students League in New York studiert hatte. Er war auf diversen Ausstellungen vertreten gewesen, in Cleveland, an der Art Students League und in Toronto, Kanada. Ein Mr. Theodore L. Canavin aus Philadelphia hatte ein paar seiner Bilder erworben. Die Exponate hier waren allesamt jüngste Arbeiten, entstanden in den letzten drei Monaten auf Haiti. Ich blickte von meinem Katalog auf. Der Künstler war mühelos auszumachen. Er war nicht groß — ungefähr einen Meter siebzig —, sonnengebräunt und hatte einen spärlichen hellbraunen Bart. Westcott trug einen zweireihigen blassblauen Palm-Beach-Anzug, ein Hemd in Zartrosa und keine Krawatte, und im Moment belauschte er ein Ehepaar mittleren Alters, das sein größtes Bild betrachtete — eine Marktszene aus Port au Prince, die zu zwei Dritteln aus zitronengelbem Himmel bestand.
Er war ein guter Zeichner, wie Gloria gesagt hatte, aber er hatte seine Farben tropfend übereinander laufen lassen, um seinen Kompositionen den Anschein von Zufälligkeit zu geben. Diese Tropferei — ein unreflektiertes Erbe Jackson Pollocks — war unsinnig. Er hatte Talent, natürlich — aber mit dem Talent fängt das Malen erst an. Seine haitianischen Männer und Frauen waren schokoladenfarben getönt und schattiert, nicht schwarz; aber vielleicht wäre mir das gar nicht aufgefallen, wären die haitianischen Bilder an der Wand gegenüber nicht gewesen, auf denen die Figuren tatsächlich schwarz waren.
Das Dutzend haitianischer Gemälde, das Gloria hatte auftreiben können, war wirklich überraschend gut. Sie hatte sogar einen frühen Marcel aus der Zeit um 1900, der sich in seiner Bescheidenheit von den zeitgenössischen Primitiven mit ihrem Hang zu kühnen Rot- und Gelbtönen derart unterschied, dass er die Aufmerksamkeit des Betrachters fesselte. Die Szene war typisch haitianisch: Ungefähr dreißig Leute bei einem Voodoo-Ritual, mit einer gelangweilten, komisch wirkenden Ziege als Mittelpunkt; aber das Bild war grau, schwarz und weiß — ganz ohne die üblichen Grundfarben. Marcel war, wie ich mich erinnerte, ein früher Primitiver, der seine Leinwände mit Hühnerfedern bemalt hatte, weil er sich Pinsel nicht leisten konnte. Das Bild sollte nur fünfzehnhundert Dollar kosten, und jemand würde ein gutes Geschäft machen, wenn er diesen Marcel kaufte ...
»James!« Gloria umklammerte meinen Ellbogen. »Ich möchte dich mit Herb Westcott bekannt machen. Herb, das ist Mr. Figueras.«
»Guten Tag«, sagte ich. »Gloria, woher hast du den Marcel?«
»Später«, antwortete sie. »Unterhalte dich doch erst mal mit Herb.« Sie wandte sich ab und ihr langer, sommersprossiger Arm nahm Kurs auf einen alten Tattergreis mit rot geschminkten Wangen.
Westcott befummelte seinen spärlichen Bart. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe, Mr. Figueras — Gloria hat mir gesagt, dass Sie kommen —, aber ich dachte, Sie tragen einen Bart ... «
»Nur noch auf dem Foto zu meiner Kolumne. Ich sollte es mal auswechseln lassen, aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Bild, und ich habe noch kein neues. Ich hatte meinen Bart ungefähr ein Jahr lang, bevor ich ihn abrasierte. Sie sollten aber nicht an Ihrem Bart herumzupfen, Mr. Westcott ... «
Hastig ließ er die Hand sinken und trat von einem Fuß auf den anderen.