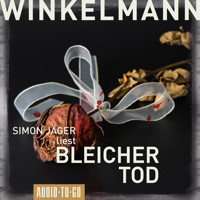9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lauf um dein Leben Das Mädchen hat Angst. Seit Tagen ist sie in einem Verschlag unter der Erde gefangen. Jemand wirft Laufkleidung herunter und lässt die Klappe offen. Sie klettert aus ihrem Gefängnis und beginnt zu rennen. In die Freiheit. In den Wald. Da zischt der erste Pfeil haarscharf an ihrem Kopf vorbei ... Dries Torwellen hat geschworen, seine Nichte zu finden, die von zu Hause ausgerissen ist. Die Spur führt ihn zu einer Lodge in den tiefen Wäldern Kanadas. Ihre Betreiber werben mit einem einzigartigen Urlaubserlebnis. Einem Erlebnis, das alle Grenzen sprengt ... Der neue Thriller von Andreas Winkelmann: eine grausame Menschenjagd in den Wäldern Kanadas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Andreas Winkelmann
Killgame
Thriller
Über dieses Buch
Lauf um dein Leben
Das Mädchen hat Angst. Seit Tagen ist sie in einem Verschlag unter der Erde gefangen.
Jemand wirft Laufkleidung herunter und lässt die Klappe offen. Sie klettert aus ihrem Gefängnis und beginnt zu rennen. In die Freiheit. In den Wald.
Da zischt der erste Pfeil haarscharf an ihrem Kopf vorbei ...
Dries Torwellen hat geschworen, seine Nichte zu finden, die von zu Hause ausgerissen ist. Die Spur führt ihn zu einer Lodge in den tiefen Wäldern Kanadas. Ihre Betreiber werben mit einem einzigartigen Urlaubserlebnis. Einem Erlebnis, das alle Grenzen sprengt ...
Der neue Thriller von Andreas Winkelmann: eine grausame Menschenjagd in den Wäldern Kanadas.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2017
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildungen da-kuk/Getty Images; pedrosola/shutterstock
ISBN 978-3-644-21991-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Werner, der mich jagen lehrte.
Jährlich verschwinden in Deutschland rund 100000 Personen. Die Hälfte taucht innerhalb einer Woche wieder auf, innerhalb eines Monats sogar 80 Prozent. Die Gesamtzahl der Vermisstenfälle liegt recht konstant zwischen 5000 und 6000. Zur Hälfte Kinder und Jugendliche. Meistens tauchen jugendliche Ausreißer von selbst wieder auf, die Aufklärungsquote liegt bei 99 Prozent. Bei den «dauerhaft Vermissten» läuft die Suche 30 Jahre weiter, bevor der Aktendeckel geschlossen wird.
Neben der Polizei gibt es weitere Stellen, die nach Vermissten suchen, zum Beispiel der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Sie alle leisten Hervorragendes.
Aber manchmal braucht es einen Verlorenen, um einen Verlorenen zu finden.
Help! I’m Vicky.
I’m Lara. Please help me.
Verzeih mir, Mama. Andrea.
Silke 09/2010
Nadine 10/2011
Don’t forget me. Lilly.
Ich will nicht sterben. Karin.
Wie es die anderen vor ihr getan hatten, nahm auch sie einen Stein vom Boden auf und ritzte ihren Namen ins Holz.
Denn jeder Mensch braucht einen Grabstein.
Teil 1
Der Gottlose flieht,
auch wenn niemand ihn jagt.
Sprüche Salomons 28,1
Licht sickerte durch eine schmale Dehnungsfuge zwischen zwei Brettern. Wenn sie den Arm ausstreckte, konnte sie ihren kleinen Finger bis zum zweiten Glied in diesen Spalt stecken, nicht weiter, und dann spürte sie einen schwachen Luftzug, den Wind, den sie draußen in den Bäumen rauschen hörte.
Nie zuvor war sie so lange vom Tageslicht abgeschnitten gewesen, nie hatte sie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, welche Auswirkungen es auf einen Menschen hatte, den Blick nicht gen Himmel richten zu können, die Wärme der Sonne nicht spüren zu können. In den letzten Tagen war dieser schmale Spalt zu ihrem Nabel der Welt, das wenige Licht zu ihrem Lebenssinn geworden.
Es war nicht kalt hier drinnen, jedenfalls nicht sehr, und sie hatte Decken, mit denen sie sich in den Nächten nach den Vergewaltigungen, wenn sie am ganzen Körper zitterte, innerlich wie äußerlich, zudecken konnte. Aber die Wärme einer Decke war nicht zu vergleichen mit der von Sonnenstrahlen. Sie gingen tiefer, wärmten von innen, legten einen wohligen Kokon ums Herz und die Seele. Besonders um die Seele, jenes körperlose Gefäß des eigenen Bewusstseins, in das Gott einen Tropfen des Heiligen Geistes gegeben hatte.
Früher hatte sie nicht an so etwas geglaubt, aber wenn es der Weg war, das hier zu überstehen, dann würde sie ihn gehen. Etwas anderes blieb ihr nicht übrig. Denn sie würden wiederkommen, schon bald. Sie würden sie aus der hölzernen Kammer zerren, hinein ins Licht des Lagerfeuers, das flackernd und zischend an der Schwärze ringsum nagte. Sie würden sie wegzerren von diesem schmalen Spalt voller Hoffnung, und wenn sie ihn wiedersah, würde er ein wenig kleiner und das Licht ein wenig schwächer geworden sein. Sie wusste nicht, ob sie den Tanz am Feuer noch einmal überstehen würde. Zweimal hatten sie sie hinausgezerrt, diese stummen Männer mit der unmenschlichen Gier in den Augen. Zweimal hatten sie sie an Körper, Geist und Seele zerfetzt, so gnadenlos wie Maschinen, mechanisch, kalt und leblos.
Sie hörte ein Geräusch.
Ein bekanntes Geräusch.
Es klang, als würde Luft gleichmäßig durch perforierte Membranen gesogen und wieder ausgestoßen. Es klang, als würde etwas atmen, dessen Größe und Macht sie sich nicht einmal annähernd vorzustellen vermochte. Immer wenn das Licht in dem schmalen Spalt matter geworden und schließlich gänzlich erloschen war, war dieses Geräusch erklungen. Die ersten Male hatte es sie geängstigt, jetzt hatte sie sich daran gewöhnt. Es war Struktur, wo es keine gab, war Gewöhnung, wo nur Chaos herrschte. Bis zu dem Moment, da das Geräusch sich entfernte und kurze Zeit später die stummen Männer kamen, labte sie sich daran wie an dem schmalen Streifen Sonnenlicht.
Sehen und Hören, sonst nichts.
«Da bist du ja wieder.»
Sie erschrak vor ihrer eigenen Stimme. Sie klang alt und brüchig.
«Schön, dass du da bist.»
Keine Antwort, natürlich nicht, nur dieses gleichmäßige Atmen. Unter anderen Umständen hätte sie das Geräusch dem Wind zugeschrieben, der sich in den Ästen der Bäume verfing, aber die jetzigen Umstände verlangten nach mehr. Alles in ihr schrie danach, nicht allein hier zu sein, auf Beistand hoffen zu können in den dunkelsten Stunden, selbst wenn dieser Beistand nur aus unmenschlichen Geräuschen bestand.
«Ein Wort, ein Laut, und wir schneiden dir die Zunge heraus und braten sie über dem Feuer, während du zusiehst.»
Das war einer der wenigen Sätze, die die ansonsten stummen Männer gesprochen hatten, und da sie am eigenen Leib erfahren hatte, wie schwer es war, keinen Laut von sich zu geben, wenn männliche Gier sie innerlich zerriss, ahnte sie, dass das Geräusch von einem anderen Opfer stammte, das es nicht geschafft hatte, seine Schreie hinunterzuschlucken. Ihr selbst war es nur gelungen, weil sie in den letzten Jahren ihres jungen Lebens gelernt hatte, Schmerz, Wut und Trauer mit niemandem zu teilen und in den schwärzesten Momenten diese Empfindungen in sich hineinzufressen. Sie war geübt darin, ihren Schmerz zu verbergen.
«Geht es dir gut? Wie lange bist du schon hier?»
Sie flüsterte, denn sie wusste nicht, ob die Männer sie nicht doch hören konnten.
«Kannst du mir helfen?»
Für einen Moment war das Schnaufen und Schnauben ganz nah, und sie glaubte, durch den Spalt einen gewaltigen Schatten sehen zu können. Dann vibrierte die hölzerne Klappe, unter der sie gefangen gehalten wurde, und etwas Sand rieselte ihr in die Augen. Sie musste sich abwenden, die Körner aus ihren Augen wischen, und als sie wieder aufsah, entfernte sich das Geräusch und verklang schließlich völlig.
Und dann waren sie wieder da.
Die stummen, gierigen Männer.
Mit seiner Zwillingsschwester Jessica teilte Dries Torwellen sich außer seiner Seele noch die Augenfarbe, die Haarfarbe, die Gesichtszüge und den Charakter. Hellblaue Augen, blondes Haar, ein kantiges Kinn, schmale Lippen und eine markante Nase. Dickköpfig bis zur Sturheit, selbstbewusst, mitunter zu empfindlich und deshalb schnell beleidigt. Nicht alles persönlich zu nehmen, was einem die Welt und die Menschen darin antaten, erforderte einen langen Lernprozess. Dries hatte ihn mit seinen sechsunddreißig Lebensjahren noch nicht vollständig durchlaufen, war aber auf einem guten Weg. Jessica hatte dazu nicht genug Zeit gehabt. Fünfundzwanzig Jahre waren zu wenig. Zu wenig für alles. Und doch genug, um der Welt etwas zu hinterlassen.
Dries betrachtete die Porträtaufnahme von Jessica und erinnerte sich an den Tag, an dem das Foto entstanden war. Sie waren mit ihren Eltern an der Küste gewesen. Ein toller Sommerferientag mit einem perfekten blauen Himmel. Sie waren sechzehn, und zum letzten Mal verbrachten sie mit ihren Eltern die Ferien auf dem Campingplatz an der Ostsee. Der Wohnwagen stand noch immer dort, vielleicht war er ein wenig bemoost, vielleicht rostete die Achse und waren die Fenster blind, aber soweit Dries wusste, fuhren Mama und Papa immer noch jeden Sommer dorthin. Sie waren solche Menschen, beständig, zuverlässig, allem Neuen gegenüber skeptisch. Jessica und er waren anders, und damals, mit sechzehn, war das besonders deutlich geworden. Jessi hatte es ihm nicht haargenau berichtet, aber in jenem Sommer hatte sie ihre Jungfräulichkeit verloren. Im Mondlicht am Strand zu einer Zeit, da ihre Eltern sie in einem der beiden kleinen Zelte vor dem Wohnwagen wähnten, in dem sie und Dries schliefen, weil es drinnen zu eng und zu heiß war, vor allem aber, weil draußen zu schlafen die ultimative Freiheit bedeutete. Es war ihr Sommer der Abenteuer gewesen, nie zuvor und nie mehr danach hatte Dries das Leben so intensiv gefühlt wie in jenen Tagen. Den salzigen Geruch der See. Den heißen trockenen Sand am Körper. Den warmen Wind im Haar, die gedämpften Geräusche der anderen Urlauber, das sehnsüchtige Rufen der Möwen dazwischen. Haut und Lippen und Haar des Mädchens, mit dem er rumgeknutscht hatte. Mehr war nicht gelaufen. Jessi war ihm, was das anging, ein paar Nasenlängen voraus. Im Nachhinein betrachtet, war sie es in fast allen Belangen gewesen, so als hätte sie instinktiv gewusst, dass ihr weniger Zeit zur Verfügung stand als ihrem Bruder. Dries war der Jüngere, weil er eine Minute später das Licht des Kreißsaals erblickt hatte. Kein so großer Vorsprung für seine Schwester, aber in ihrer Beziehung hatte diese Minute Bedeutung. Bei Entscheidungen, bei Streitigkeiten oder wenn sie versucht hatten, sich gegenseitig mit ihren Träumen zu übertreffen.
An jenem Tag am Strand hatte Jessi mit einem Finger die Welt als großen Kreis in den Sand gezeichnet, darin kleine Kreise für die Kontinente, und dann hatte sie mit der Fingerspitze in jeden Kreis getippt und mit fester Stimme gesagt, sie wolle all diese Länder bereisen. Da hatte Dries noch nicht ein einziges Mal daran gedacht, die Welt zu erkunden. Doch am Ende war es er, der viele dieser Länder zu sehen bekam, wenn auch nur die Krisenherde, die weniger schönen Orte, die Landstriche, die beinahe tagtäglich in der Tagesschau auftauchten und die von den Einheimischen nicht selten als Hölle empfunden wurden.
In jenem Sommer hatte niemand an den Tod gedacht.
Dabei hatte er direkt hinter ihnen gestanden und Maß genommen.
Hatte sich vielleicht an den vor Energie sprühenden Augen seiner Schwester erfreut und Pläne geschmiedet, wie er diese Lebenslust, diese Unbändigkeit für sich gewinnen konnte. Denn der Tod war so, das wusste Dries mittlerweile. Die Alten waren ihm egal, die kamen sowieso, es waren die Jungen, die ihn interessierten, die Vitalen, denn nur in diesem Alter fand ein Kampf statt, und auf den Schlachtfeldern blieben Opfer zurück, um die geweint wurde. Vielleicht stand der Tod einfach auf intensive Erfahrungen, so wie Jessica und Dries Torwellen in jenem Sommer an der Ostsee.
Jessicas Tod lag elf Jahre zurück. Dries konnte sich kaum noch an ihr Lachen, an ihre Stimme oder an ihre spektakulären Wutausbrüche erinnern, aber sobald er dieses alte Foto betrachtete, das er in seiner Brieftasche aufbewahrte, brachte der Blick in ihre intensiven hellblauen Augen das Gefühl der Liebe zurück, die er für sie empfunden hatte.
Und deshalb war er heute hier.
Die kleine Ortschaft Bernwald mit ihren sechstausend Einwohnern lag zwanzig Kilometer von Frankfurt entfernt in den sanften Hügeln des Taunus, umgeben von dichten Laub- und Tannenwäldern. Es war ein romantischer, stiller Ort, in dem Menschen lebten, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchten. Dries war seit Jessis Tod einige Male auf dem örtlichen Friedhof gewesen, in elf Jahren vielleicht vier oder fünf Mal, mehr war nicht möglich gewesen. Die Organisation setzte ihn rund um den Globus ein, und er hatte nie einen Auftrag abgelehnt. Urlaub war etwas für Menschen mit innerem Frieden, nicht für einen Nomaden wie ihn.
Bernwald steckte voller schmerzhafter Erinnerungen. Und der Besuch, der ihm bevorstand, würde unangenehm werden. Er wurde nicht erwartet, und wenn sich in den letzten Jahren nichts geändert hatte, dann war er in diesem Haus kein gerngesehener Gast. Dries war das egal, er würde sich nicht abwimmeln lassen und die Informationen, die er benötigte, irgendwie bekommen. Das war er Jessi schuldig.
Er parkte seinen alten Landrover am Anfang einer Sackgasse. An deren Ende lag das Haus, zu dem er unterwegs war, aber er wollte nicht, dass der Bewohner ihn zu früh bemerkte, eventuell die Klingel abstellte und sich verbarrikadierte. Der Himmel war hoch und locker bewölkt, die Temperatur angenehm, der Duft von Weißdornhecken lag in der Luft. Irgendwo mähte jemand seinen Rasen, in großer Entfernung bellte ein Hund. Auf einer Anhöhe in Sichtweite drehten sich träge die schlanken weißen Flügel einiger Windkrafträder. Sie waren die einzige Neuerung, ansonsten war in diesem alten, gewachsenen Wohngebiet alles beim Alten geblieben. Wahrscheinlich lebten in den Häusern rechts und links der einspurigen Straße immer noch dieselben Menschen wie damals. Es waren normale Häuser mit normalen Leuten, nach Dries’ Auffassung ein wenig spießig, und er wusste, dass Jessi es ebenso empfunden hatte. Für eine, die die Welt erobern wollte, musste diese Straße wie ein Gefängnis gewesen sein.
Er näherte sich dem roten Backsteinbungalow mit der Nummer 35 und blieb im Schutz einer Tanne vor dem Jägerzaun stehen. Das Grundstück machte einen verwahrlosten Eindruck. Der Rasen war viel zu lang, in den Beeten wucherte Unkraut, die Büsche und Hecken waren ewig nicht mehr gestutzt worden. Auf dem Rasen lag ein eingewachsener gelber Wasserschlauch wie die abgestreifte Haut einer Schlange, in der Einfahrt stapelten sich vier blankgefahrene Autoreifen neben einem Haufen Holz, wahrscheinlich alte Möbel, die jemand aus dem Haus entfernt hatte. Die Fenster waren blind vor Schmutz, die Gardinen zugezogen. Es wirkte nicht so, als würde in dem Haus noch jemand wohnen.
Dries aber wusste es besser.
Deshalb stieg er über den niedrigen Jägerzaun hinweg und ging mit langen Schritten auf die Eingangstür zu. Ohne zu zögern drückte er auf den Klingelknopf. Drinnen läutete der Gong, den er von früheren Besuchen kannte. Bei dem Geräusch zog sich sein Magen zusammen. Seine Erinnerung verknüpfte es mit dem Gesicht seiner Schwester, denn immer, wenn er diesen Gong gehört hatte, war sie es gewesen, die vor Freude strahlend an die Haustür gekommen und ihm um den Hals gefallen war.
Dries klingelte noch einmal.
Und noch einmal.
Als er sich gerade zur Rückseite des Hauses aufmachen wollte, um es an der Terrassentür zu versuchen, bemerkte er durch das gelbe Glas in dem Holzelement neben der Eingangstür eine Bewegung. Jemand befand sich auf dem Flur, vielleicht schon eine ganze Weile, wollte aber wohl nicht die Tür öffnen. Es gab keinen Spion, folglich konnte derjenige nicht wissen, dass Dries vor der Tür stand, es sei denn, er hatte ihn bereits auf dem Weg zum Haus beobachtet.
Dries schlug mit der Faust gegen die Tür.
«Klaus, hier ist Dries. Mach auf. Ich weiß, dass du da bist.»
Drinnen huschte jemand weg.
«Ich schwöre dir, ich gehe hier nicht weg, bis wir miteinander geredet haben.»
«Wir haben nichts zu bereden, hau ab.»
Klaus stand direkt hinter der Tür.
«Erst sagst du mir, wo Nia ist.»
«Schläft oben.»
«Weck sie auf, ich will mit ihr sprechen.»
«Verpiss dich.»
Dries schlug erneut zu, kräftiger als zuvor. Der massiven Eichenholztür machte das nichts aus, seiner Hand schon. Ein scharfer Schmerz schoss bis in seine Schulter hinauf. Er konnte spüren, wie sich der Metallsplitter bewegte, der noch immer in seinem Muskel steckte.
«Hör zu! Meine Eltern haben mich angerufen, ich weiß, dass Nia nicht da ist. Mir ist es scheißegal, was du mit deinem Leben machst, aber Nia geht mich etwas an.»
Dries hatte nicht damit gerechnet und bereits zum nächsten Schlag ausgeholt, da sprang die Haustür plötzlich auf. Mit erhobener Faust stand er seinem viel kleineren Schwager Klaus Herford gegenüber und erschrak zutiefst darüber, was die vergangenen elf Jahre aus dem Mann gemacht hatten.
Als Jessi sich in Klaus verliebt hatte, war sie siebzehn und er zwanzig gewesen. Er war es gewesen, der sie in jenem Sommer an der Ostsee entjungfert hatte, und zurückblickend konnte man sagen, dass damit das ganze Unglück begonnen hatte. Damals war Klaus durchtrainiert und sportlich gewesen, ein begeisterter Fußballer mit professionellen Ambitionen. Seine Schwester hatte sich in einen Mann verliebt, dem die Frauen nachschauten, der eloquent war und sich gut zu kleiden wusste. In jemand völlig anderen als den, der jetzt vor Dries stand.
Der heutige Klaus war fett und aufgequollen, und es war kein gesundes pralles Fett von zu viel Essen, sondern weiches, schwammiges Gewebe, wie es so oft mit starkem Alkoholkonsum einherging. Sein Haar war schütter und klebte am Kopf, die Haut im Gesicht war fahl und unrein, der Blick getrübt. Er trug eine graue Jogginghose, die dringend gewaschen werden musste, dazu ein weißes, löchriges T-Shirt. Er roch nach Nikotin und Rum.
«Sieh an, der große Held», spottete Klaus Herford und zog verächtlich die Mundwinkel nach unten. «Mal wieder im Lande und gleich auf Krawall gebürstet.»
«Hallo, Klaus, schön, dich zu sehen», sagte Dries, um die Situation zu entspannen.
«Spar dir den Scheiß. Was willst du? Ich hab zu tun.»
«Lässt du mich rein?»
«Wozu?»
«Weil ich mit dir über Nia reden will.»
«Es geht aber nicht immer alles so, wie du willst. Nia ist meine Tochter und geht dich nichts an.»
Dries hatte geglaubt, in den letzten Jahren etwas mehr Geduld mit Menschen wie seinem Schwager entwickelt zu haben, bemerkte jetzt aber, dass das ein Irrtum war. Seine Zündschnur war immer noch so kurz wie damals, als er achtzehn gewesen war, und er ließ sich noch immer zu Kurzschlussreaktionen hinreißen.
Er schlug seinem Schwager die Tür aus der Hand. Sie knallte gegen die Wand. Dries betrat den Flur, drängte Klaus beiseite, als existiere er nicht, und ging durch bis ins Wohnzimmer.
Klaus protestierte nicht einmal. Er wusste, es hatte keinen Sinn. Schließlich war er mit Jessica verheiratet gewesen, einer Hälfte der Torwellen-Zwillinge, und die hielt man nicht auf, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatten.
Das Wohnzimmer war ein Schlachtfeld.
Überall lagen Kleidungsstücke herum. Der Tisch war mit leeren Bierdosen und überquellenden Aschenbechern zugestellt. Zeitungen stapelten sich hüfthoch, hauptsächlich der Kicker und ähnliche Fußball-Fachblätter. Über dem großen LED-Fernseher hing eine deutsche Flagge an der Wand, wahrscheinlich ein Überbleibsel der Weltmeisterschaft in Brasilien, die vor wenigen Tagen zu Ende gegangen war.
«Die Weltmeisterschaft gefeiert?», fragte Dries.
«Du kannst mich, Schwager.»
Klaus ließ sich auf die Couch fallen und verschränkte die Arme vor der Brust. Dries fragte sich, ob er nur soff oder auch Drogen nahm. Seine Mutter hatte so etwas angedeutet, aber ihre Vermutung beruhte auf den Beobachtungen der Nachbarschaft, und die mussten nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen.
«Kein Wunder, dass Nia abgehauen ist.»
«Wenn dir mein Einrichtungsstil nicht gefällt, dann hau doch auch ab.»
Klaus hustete laut und ungesund, beugte sich vor, nahm eine Zigarette aus einer leeren Bierdose, deren Deckel er abgetrennt und sie damit zum Behältnis umfunktioniert hatte. Noch während er hustete, zündete er die Zigarette an und steckte sie sich zwischen die Lippen.
«Hör zu», begann Dries in versöhnlichem Tonfall. «Ich bin nicht gekommen, um mit dir zu streiten. Ich will dir helfen.»
«Wer sagt, dass ich Hilfe brauche?»
«Meine Eltern.»
«Die müssen es ja wissen.»
«Sie haben dir ebenfalls Hilfe angeboten.»
«Irrtum. Sie wollten Nia und haben versucht, sich einzumischen. Das ist etwas vollkommen anderes. Aber das kapiert ihr ja nicht, weil immer alles nach eurem Kopf gehen muss.»
Dries seufzte, ging zur Terrassentür und sah in den hinteren Garten hinaus. Dort sah es ähnlich ungepflegt aus wie vor dem Haus. Die rote Schaukel aus Metall stand immer noch in der hinteren rechten Ecke. Sie rostete, ihre Füße waren eingewachsen, das Sitzbrett mit Grünspan überzogen. Kurz sah Dries sich selbst, wie er seine sechsjährige Nichte Nia anschubste. Immer höher in den Himmel, weil sie es so wollte, weil sie keine Angst kannte und so entzückend jauchzte, wenn es in ihrem Bauch kribbelte. Er hatte viel zu wenig Zeit mir ihr verbracht. Gerade in den letzten Jahren. Eigentlich wusste er überhaupt nicht, was für ein Mensch Nia geworden war.
«Wenn du dir schon nicht helfen lassen willst, dann rede wenigstens Nia zuliebe mit mir.»
«Nia ist erwachsen, sie kann tun und lassen, was sie will.»
«Sie ist vor vier Monaten achtzehn geworden und alles andere als erwachsen. Und wie lange ist sie jetzt weg? Vier Wochen? Bist du nicht auf die Idee gekommen, sie zu suchen?»
Klaus zuckte mit den Schultern und paffte seine Zigarette.
«Sie hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass sie mich nicht wiedersehen will.»
«Und das wundert dich? Ich meine … sieh dich mal um …»
Dries breitete die Arme aus.
«Du lebst in einem Schweinestall. Du säufst, du arbeitest nicht, du lässt dich total gehen. Und nach allem, was ich gehört habe, warst du Nia gegenüber aggressiv.»
«Ach, waren wir laut genug für die Nachbarn, ja?»
Dries war nahe dran, die Beherrschung zu verlieren. Es kotzte ihn an, wie gleichgültig dieser Mann war, wie demonstrativ er sein Selbstmitleid auslebte. Was Dries in diesem Moment davon abhielt, Klaus zu packen und seinen Kopf draußen in den veralgten Gartenteich zu tauchen, war das Bild über der Vitrine an der rechten Raumseite.
Ein Porträt von Jessi, aufgenommen am Tag ihrer Hochzeit.
Großer Gott, war sie eine Schönheit gewesen!
Dries ging hinüber und starrte das Foto an. Darauf strahlten ihre Augen noch stärker als auf dem verblichenen Bild, das er seit Jahren mit sich herumtrug. Sie war gebräunt, ihr blondes Haar professionell frisiert, ihr Gesicht geschminkt. Sie hätte ein Model sein können, aber auf Äußerlichkeiten hatten sie nie Wert gelegt, ja sogar Menschen verspottet, die sich über ihr Aussehen definierten.
Das Foto gehörte zu einer Art Schrein. Daneben standen noch einige kleinere, gerahmte Fotografien sowie Dinge, die Jessica wichtig gewesen waren. Unter anderem der schwarze Gürtel, den sie sich im Karate erkämpft hatte. Dries streckte die Hand aus, er wollte den Gürtel anfassen, doch die laute Stimme ließ ihn zurückschrecken.
«Finger weg!», schrie Klaus. Er schnellte aus der Couch und kam herüber. «Ich warne dich, fass das ja nicht an. Diese Dinge gehören dir nicht. SIE gehört dir nicht.»
Dries ließ sich von seinem Schwager beiseitedrängen, der sich schützend vor den Schrein postierte. Sein Gesicht drückte Entschlossenheit aus. Dries gab nach. Es hatte keinen Sinn, seinem Schwager seine körperliche Überlegenheit zu demonstrieren.
«Sie hat nie irgendwem gehört. Weder mir noch dir», sagte Dries leise.
Klaus starrte ihn an. Er zitterte am ganzen Körper, seine Augen glänzten feucht. Seine Kiefer mahlten, und er schloss immer wieder die Hände zu Fäusten. In diesem Mann tobte große Wut, sie fraß ihn inwendig auf, fand aber doch nicht genug Nahrung und wandte sich deshalb gegen alles und jeden. Diese Wut hatte Nia vertrieben und Klaus zu einem einsamen Menschen gemacht. Zumindest das konnte Dries seinem Schwager nachempfinden, denn auch er kannte sich mit der zerstörerischen Kraft der Wut aus.
«Doch», sagte Klaus mit schwacher Stimme, «sie hat mir gehört, und es ist verdammt noch mal nicht fair, dass sie nicht mehr da ist.»
«Nein, ist es nicht. Und was jetzt? Aufgeben? Deine Tochter auch noch verlieren? Oder endlich den Arsch hochkriegen und etwas ändern?»
«Lass mich mit diesem Psycho-Gequatsche in Ruhe. Jessi ist tot, daran kann ich rein gar nichts ändern.»
Dries schüttelte den Kopf. «Elf Jahre, und du kriegst die Kurve nicht. Ich verstehe es nicht.»
«Kann ich mir vorstellen. Du hast sie ja auch sitzenlassen.»
Falscher Satz, schoss es Dries durch den Kopf. Ganz falsch und sehr gefährlich.
Er ging einen schnellen Schritt auf seinen Schwager zu und tippte ihm mit dem Finger gegen die Brust. Dabei hatte er das Gefühl, sein Finger versinke in dem wabbeligen Gewebe.
«Sag das noch einmal, und ich …»
«Was? Schlägst du mich dann, ja? Weil du die Wahrheit nicht ertragen kannst? Scheiße, was bildest du dir eigentlich ein? Kommst hierher nach wer weiß wie vielen Jahren und tust, als könntest du alles geraderücken, als wärst du der große Heilsbringer. Meinst du, Nia würde auf dich hören? Nia hört nur noch auf sich selbst, da ist sie genau wie ihre Mutter. Sie hat beschlossen, auf eigene Faust zu leben, und ich kann sie nicht davon abhalten. So einfach ist das. Aber warum erzähle ich dir das alles überhaupt? Ich bin dir und deiner verdammten Familie keine Rechenschaft schuldig. Hau ab, Mann, hau bloß ab und lass mich für alle Zeiten in Ruhe.»
Jetzt liefen Klaus die Tränen über das Gesicht, ob aus Wut oder Schmerz, konnte Dries nicht sagen, aber er spürte Mitleid mit seinem Schwager und beschloss, ihn nicht weiter zu bedrängen. Ohne die Information, die er brauchte, würde er jedoch nicht gehen.
«Ich habe gehört, Nia sei ins Drogenmilieu abgerutscht. Wenn dich das Schicksal deines einzigen Kindes nicht interessiert … okay, deine Sache. Sag mir den Namen ihres Freundes, und ich bin weg.»
«Welcher Freund?»
«Gab es mehrere?»
«Mehr, als du dir vorstellen kannst.»
«Dann den letzten.»
«Alexander.»
«Kein Nachname?»
«Kenne ich nicht.»
«Dann lass mich einen Blick in ihren PC werfen.»
«Den Teufel werde ich tun. Ich sag’s noch mal: Nia geht dich nichts an, und jetzt verschwinde aus meinem Haus, bevor ich die Polizei rufe. Oder hast du da noch Freunde, die dich decken, so wie damals?»
«Gib mir wenigstens ihre Handynummer.»
«Sie hat kein Handy. Hau ab!»
Dries gab auf, es hatte keinen Sinn. An der Tür drehte er sich noch einmal um, betrachtete Klaus Herford, diesen kleinen, in sich zusammengefallenen Mann ohne Rückgrat, ohne Kraft. Ein Säufer, der in Selbstmitleid verging, weil das einfacher war, als zu kämpfen. Dries’ Mitleid verwandelte sich in Abscheu. Solche Typen hatte er nie leiden können, und in der Welt, in der er lebte, kamen sie auch nicht vor.
«Du machst dir etwas vor, wenn du glaubst, Jessi hätte dir gehört», sagte er. «Sie war der freieste Mensch, den ich kannte. Und wenn sie nicht von dir schwanger geworden wäre, hätte sie dich nie geheiratet. Dann wäre sie mit mir um die Welt gezogen. Das bisschen Glück, das du hattest, verdankst du Jessi und Nia, aber du bist nicht mal in der Lage, dich dafür zu revanchieren.»
Die Flammen tanzten bereits. Orangerote Teufel schleuderten sengende Hitze in die Nacht. An den Rändern der Wahrnehmung, wo Licht und Dunkelheit ihren eigenen Kampf ausfechten, versperrte eine schwarze Barriere den Blick. Außerhalb davon vielleicht die Freiheit, vielleicht der erlösende Tod, innerhalb des glühenden Zirkels die Hölle, das Versprechen von Schmerz und Leid. Und die Männer: vom Feuer rot gefärbte Gesichter mit glänzenden Augen. Mit Blut hatten sie sich merkwürdige Symbole auf Brust, Bauch und Rücken gemalt. Striche und Kreise ohne erkennbaren Sinn. Wie ihre Oberkörper waren auch die Füße bloß. Sie starrten ihren nackten Körper an, nichts blieb verborgen, aber das war egal. Ihre Scham war bereits beim ersten Mal gestorben. Sie wusste, was passieren würde, und fand sich damit ab. Einer nach dem anderen würde über sie herfallen und ihr weh tun. War einer fertig mit ihr, wurde sie an den nächsten übergeben, es war, als existiere zwischen ihnen einen strenge Hierarchie, die die Reihenfolge festlegte.
Sie fiel auf die Knie und blickte ins Feuer. Es war einige Meter entfernt, und doch spürte sie die tödliche Hitze auf ihrer nackten Haut. Die Männer würden es nicht verhindern können, wenn sie sich hineinstürzte, aber ihre Angst vor dem Feuertod war zu groß. Noch gab es Hoffnung. Noch hatte sie sich nicht vollkommen aufgegeben.
«Nicht», sagte sie, als der erste Mann hinter sie trat, ihr Haar packte und ihren Kopf mit einem heftigen Ruck zurückriss.
«Bitte nicht.»
Ein Flüstern, das im Knacken, Zischen und Knistern des Feuers unterging.
Hände überall. Weiche Hände ohne Schwielen, die tasteten, zerrten und zogen.
Und dann plötzlich das Brüllen!
Es kam von außerhalb des Zirkels, aus der Schwärze, die sich dem Feuer widersetzte. Irgendetwas bewegte sich dort, groß und mächtig und in der Lage, die Männer in Aufruhr zu versetzen. Die weichen Hände verschwanden von ihrem Körper, sie wurde nach vorn gestoßen, fiel auf den staubigen Boden, riss aber sofort den Kopf hoch, um zu beobachten, was geschah.
Die Männer hatten Angst, zogen sich ans Feuer zurück und behielten mit irrlichternden Blicken den schwarzen Rand ihrer Manege im Auge. Dort krachte und knackte es, Zweige brachen, Äste splitterten, ganze Bäume wurden niedergemäht. Und das Brüllen! Dieses infernalische, animalische und zutiefst archaische Brüllen. Es ließ die Erde erzittern. Je lauter es wurde, desto näher rückten die Männer ans Feuer. Die Flammen versengten bereits die Härchen auf ihrer Haut, so nah dran waren sie. Das Mädchen selbst befand sich nun zwischen den Männern und dem finsteren Rand. Plötzlich war sie da, die Möglichkeit zur Flucht. Zehn Schritte höchstens, und sie würde mit der Finsternis verschmelzen. Aber was dann? Was wartete dort auf sie? Welches Lebewesen war in der Lage, solche Laute auszustoßen? Und wenn schon die stummen Männer Angst davor hatten, musste sie es dann nicht um ein Vielfaches fürchten?
In diesem Moment lernte sie, dass die Furcht vor dem Ungewissen stärker ist als die Furcht vor dem Bekannten, auch wenn das Bekannte noch so entsetzlich ist. Sie bewegte sich nicht, blieb im Staub hocken, beobachtete den Waldrand und spürte die gleiche Angst, die auch ihre Peiniger spüren mussten. Die Männer sprachen nicht, sie hielten sich nahe beim Feuer, zwei hatten brennende Äste herausgezogen und hielten sie hoch wie Waffen. Licht gegen Dunkelheit, Hitze gegen Todeskälte.
Bäume bewegten sich, als rüttele jemand daran. Büsche schüttelten sich. Für einen winzigen Moment glaubte sie, im dichten Blätterwerk glutrote Augen sehen zu können, die sie anstarrten. Dann waren sie aber auch schon wieder fort, und das erneute Brüllen, diesmal so nahe, dass sie die Schallwellen auf ihrer Haut spürte, ließ sie in panischer Angst rückwärts zum Feuer krabbeln. Auf das Feuer und die Männer zu, vor denen sie eben noch hatte fliehen wollen.
Das Brüllen erklang noch ein weiteres Mal, dann verstummte es.
Plötzlich raschelte es in den Büschen. Zweige teilten sich, und eine Gestalt trat in den Feuerkreis.
Das Mädchen schrie.
Rainer Kampen ließ die Göre nicht aus den Augen. Seit einer Viertelstunde lungerte sie vor dem Regal mit den Süßigkeiten herum, sah sich immer wieder verstohlen um und machte sich damit so verdächtig, als trüge sie ein Schild um den Hals mit der Aufschrift «Ladendieb».
Ihr langes blondes Haar wirkte ungepflegt, die Kleidung war schmutzig, der kurze Jeansrock am Hintern dreckig. Das ärmellose grüne Oberteil saß eng, schmiegte sich um ihre schmale Taille und die kleinen Brüste. Die Göre hatte eine gute Figur, das sah Kampen sofort. Gertenschlank, lange braune Beine und dazu noch ein markantes Gesicht mit ausgeprägten Sommersprossen. An einem anderen Ort und mit einer Blume im Haar wäre sie als Hippiebraut durchgegangen, aber in seinem Laden war sie nichts weiter als eine Schlampe von der Straße, die versuchte, ihn zu beklauen. Aber nicht mit ihm. Rainer Kampen hatte die Schnauze voll von diesen Jugendlichen, die glaubten, für nichts bezahlen zu müssen. Sie waren respektlos und frech, und seiner Meinung nach gehörten die alle eingesperrt. Nur ließen die Bullen sie immer wieder laufen. Drei minderjährige Ladendiebe hatte er in den vergangenen zwei Wochen erwischt und festgehalten, bis die Bullen kamen. Die hatten die Kids zwar mit zur Wache genommen, dort aber nur die Personalien aufgenommen und die Eltern informiert. Ein paar Tage später standen die Kids dann wieder in seinem Laden, lachten ihn aus und ließen etwas mitgehen, wenn er nicht hinsah.
Die Gesellschaft war vor die Hunde gegangen. Als ehrlicher Kaufmann konnte man heutzutage ohne Konsequenzen beklaut und verhöhnt werden. Aber dieses Flittchen würde sich noch wundern. In zehn Minuten schloss der Laden, sie musste jetzt langsam aktiv werden, wenn sie noch etwas mitgehen lassen wollte.
Rainer Kampen befand sich hinter einer Spiegelglaswand in seinem Büro. Über einen kleinen Monitor beobachtete er die Blondine, die sich in einem leeren, unbeobachteten Gang wähnte. Während sie weiterhin die Auslage mit Süßigkeiten betrachtete, als könne sie sich nicht entscheiden, stopfte Kampen einen Schokoladenkeks nach dem anderen in sich hinein. Krümel blieben auf seinem dicken Bauch liegen, doch das störte ihn nicht. Er hatte nur Augen für diese Ladendiebin mit den kleinen Titten und dem festen runden Arsch.
Da!
Sie griff zu. Ein Fünferpack Snickers wanderte mit einer schnellen Bewegung in ihre kleine Handtasche.
Rainer Kampen sprang auf. Die restlichen Kekse fielen zusammen mit den Krümeln von seinem Bauch zu Boden. Eilig verließ er sein Büro, betrat den Verkaufsraum und arbeitete sich über Umwege zur Kasse vor, damit die Blondine ihn nicht zu früh bemerkte. Die Kids hier in der Gegend kannten ihn, sie wussten, was drohte, sobald er durch den Laden stürmte. Die Blondine hatte er zwar noch nie zuvor gesehen, aber es konnte nicht schaden, umsichtig zu sein, denn diesen Fang wollte er sich auf keinen Fall entgehen lassen.
Er gab Franco, dem jungen Italiener, der in den Abendstunden die Kasse machte, ein Zeichen, postierte sich an den Obstkörben neben der Eingangstür und tat so, als sortiere er fauliges Obst aus.
Die Blondine erschien an der Kasse und legte eine 0,5-Liter-Flasche Mineralwasser für fünfundneunzig Cent aufs Band. Sie hatte das Kleingeld abgezählt in der Hand, ließ es in den Teller fallen und wollte mit gesenktem Kopf den Laden verlassen.
Rainer Kampen stellte sich ihr in den Weg. Auch wenn das Mädchen noch so dünn war, an seinen einhundertdreißig Kilo kam sie nicht vorbei.
Sie sah ihn an, ihre Augen flackerten.
«Darf ich einen Blick in deine Handtasche werfen», sagte Rainer Kampen.
Sie war nah an einer Panik, ihr Kopf zuckte herum auf der Suche nach einem Ausweg.
«Nein … warum?»
Natürlich! Aufmüpfiger Tonfall, obwohl sie ertappt worden war. Die waren alle gleich, spielten sich auf, als wären sie es, denen Unrecht angetan wurde. Da stieg ihm schon wieder die Galle hoch.
«Weil ich dich dabei beobachtet habe, wie du Snickers in deine Tasche gesteckt hast. Ich hab das sogar auf Video, du kannst also leugnen, so viel du willst, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, Blondie.»
Ihre Lider flatterten, sie war jetzt den Tränen nahe.
«Ach ja … die … oh, tut mir leid, die habe ich total vergessen.»
«Jaja, ist klar, das hab ich schon viel zu oft gehört. Siehst du das Schild da?»
Rainer Kampen deutete auf ein weißes Klebeschild an der Kasse. Darauf stand, dass jeder Ladendieb zur Anzeige gebracht wurde, hundertfünfzig Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen musste und Hausverbot erhielt.
«Bitte … ich hab das echt vergessen, ich wollte nicht klauen.»
Die erste Träne lief, und Kampen freute sich wie ein kleiner Junge zu Weihnachten. Diese Tussi rettete ihm kurz vor Feierabend den Tag. Er liebte es, wenn sie winselten und ihn anflehten, nicht die Polizei zu rufen.
«Kannst du alles der Polizei erzählen», sagte er und genoss es, wie sie unter der Drohung endgültig zusammenbrach.
Sie öffnete die Handtasche, holte die Snickers heraus und legte sie auf das Kassenband. Ihre Hand zitterte.
«Bitte … es tut mir leid, ich wollte das nicht.»
Okay, der Blick aus ihren hellblauen Augen war wirklich mitleiderregend, und wie sie so vor ihm stand, abgerissen, abgebrannt, wehrlos, aber durchaus hübsch anzusehen, kam ihm eine andere Idee. Sie konnte es wiedergutmachen.
«Wir gehen mal in mein Büro, das muss ja nicht jeder mitbekommen», sagte er. Und dann, an Franco gewandt: «Du kannst abschließen und gehen, ich kümmere mich um den Rest.»
Rainer Kampen packte die Blondine am Handgelenk und führte sie ab. Sie ließ es sich gefallen, wehrte sich nicht, in ihrem gertenschlanken Körper schien keine Kraft zu stecken. Ihre Haut war warm und klebrig vom Schweiß, er konnte sie riechen, so nahe war er bei ihr. Auch wenn sie wahrscheinlich ein paar Tage nicht geduscht hatte, roch sie gut – nach Sommer. Nach Haut, die im Laufe des Tages einmal nass geworden war, vielleicht im Brunnen in der Fußgängerzone, vielleicht im See im Stadtpark, und danach unter der Sonne getrocknet war. Rainer warf einen Blick auf die Innenseiten ihrer dünnen Arme, konnte aber keine Einstichstellen entdecken. Heutzutage musste das nicht viel heißen, vielleicht spritzte sie kein Heroin, schnupfte dafür aber Meth oder irgendeinen anderen Scheiß. Wenn sie es tat, tat sie es noch nicht lange, denn bis auf ihre Kraftlosigkeit wirkte sie gesund.
Ein echter Glücksgriff.
Rainer Kampen bugsierte sie in sein kleines, stickiges Büro hinter der Spiegelglasscheibe, drückte sie auf den einzigen Besucherstuhl und ließ sich selbst auf dem Schreibtischstuhl nieder. In dem grellen Licht der Neonröhre unter der Decke, die er beim Hereinkommen eingeschaltet hatte, betrachtete er sie aus einem Meter Abstand in aller Ruhe.
Sie saß auf der Kante des Stuhls, hielt die Knie zusammengepresst und drückte mit beiden Händen den kurzen Rock in den Schritt. In diesem Moment sah sie wie fünfzehn aus.
«Wie alt bist du?»
«Achtzehn.»
«Ohne Scheiß?»
«Hören Sie, wenn ich …»
«Nein, Süße, du hörst zu. Ich habe dich beim Ladendiebstahl ertappt, und das ist kein Kavaliersdelikt. Es liegt jetzt an dir, ob ich die Polizei rufe oder nicht. Kannst du die Snickers bezahlen?»
Sie senkte das Kinn und schüttelte den Kopf.
«Hab ich mir gedacht. Und was meinst du, wie wir diese dumme Situation lösen?»
«Ich weiß nicht … sagen Sie es mir.»
«Nun … du bist wirklich achtzehn?»
«Wenn ich es doch sage.»
«Hast du deinen Personalausweis dabei?»
Wieder schüttelte sie den Kopf.
«Tja, das ist blöd. Aber ich glaube dir einfach mal. Du siehst aus, als könntest du achtzehn sein. Du siehst überhaupt ziemlich gut aus.»
Sie sah zu ihm auf, lächelte schüchtern und warf ihm einen aufreizenden Blick zu. Verletzlich, anmutig und auf einzigartige Weise erotisch. Dieses kleine Luder wusste genau, was hier lief.
«Entspann dich ein wenig, du wirkst so verkrampft», sagte Kampen, streckte die Hand aus, legte sie auf ihr rechtes Knie und drückte das Bein nach außen. Er musste kaum Kraft aufwenden, bereitwillig spreizte sie die Beine.
«Warst viel in der Sonne, was? Bist richtig schön gebräunt. Überall oder nur da, wo ich es sehe?»
«Weiß nicht.»
Kampen lachte leise und streichelte ihr Knie. Sie hatte wunderbar glatte Haut.
«Aber klar weißt du das, eine wie du weiß so was ganz genau. Wie man Männern den Kopf verdreht und so, nicht wahr. Warum läufst du sonst in diesem kurzen Fummel herum.»
Er schob den Saum ihres Rocks ein Stück hinauf. Die kleine Schlampe rutschte von ihm weg, hob das Kinn und sah ihn an.
«Ich zeige dir, wie braun ich bin, aber ich lasse mich nicht von dir begrapschen. Wenn dir das nicht reicht, du notgeiler Arsch, dann ruf die Polizei. Ist mir scheißegal.»
Jetzt wurde sie doch noch widerspenstig, aber das gefiel Kampen.
«Du ziehst alles aus, sonst haben wir keinen Deal.»
Ihr Blick fraß sich an seinen Augen fest, und das gefiel ihm überhaupt nicht. Da war etwas an ihr, das ihm fast ein bisschen Angst machte. Aber noch ehe er es sich überlegen konnte, stand sie ohne ein weiteres Wort auf und zog das Top über ihren Kopf hinweg aus. Kampen lehnte sich zurück und genoss die Show. Hatte er also mit seiner Vermutung doch richtiggelegen: Die Kleine rettete ihm den Abend.
Unter dem Top trug sie einen weißen Sport-BH. Ohne zu zögern, zog sie auch den aus. Ihre Titten waren klein, aber schön straff, und die Nippel standen keck nach oben. Er stand eigentlich mehr auf dicke Brüste, aber an ihrem Körper sahen die kleinen Teile richtig scharf aus. Es passte halt alles zusammen.
Sie verharrte mit den Händen am seitlich angebrachten Reißverschluss des Rocks. Ihr Blick war zu Boden gerichtet, ihr schmaler Brustkorb hob und senkte sich unter schnellen Atemzügen. Sie rang mit sich, überlegte, ob sie das wirklich tun sollte. Eine Nutte schien sie nicht zu sein, sonst würde es sie nicht solche Überwindung kosten. Wie es aussah, hatte er hier eine Jungfrau vor sich, eine Ausreißerin, die erst seit ein paar Tagen von zu Hause fort war. Sie war forsch und selbstbewusst, keine Frage, aber dies hier war eben nicht das, was sie sich unter einem Leben in Freiheit vorgestellt hatte.
Kampen wurde immer geiler. Wenn er es richtig anstellte, würde sie ihm vielleicht sogar einen blasen.
«Na los, weiter doch, denk an unseren Deal», forderte er sie auf. «Oder soll ich doch die Polizei rufen. Die sind in ein paar Minuten hier, kein Problem.»
Das half.
Sie zog den Reißverschluss herunter. In dem stillen Büro klang das sehr laut, und das Geräusch ließ Kampen genussvoll aufstöhnen. Er rieb sich den Schritt.
Blondie ließ den Rock an ihren schmalen Schenkeln hinuntergleiten und trat aus dem Stoffkreis. Sie trug einen weißen Slip, der verhältnismäßig sauber aussah. Kampen hatte erwartet, dass sie die Arme vor der Brust verschränken und die Hände vor den Schritt halten würde, doch das tat sie nicht. Ihre Arme hingen locker herunter, und nach kurzem Zögern schaffte sie es tatsächlich, ihn anzusehen.
«Reicht das?», fragte sie mit diesem aufsässigen Unterton in der Stimme.
«So kann ich doch nicht sehen, ob du nahtlos braun bist, Süße.»
«Bin ich nicht.»
«Ja, vielleicht, aber ich würde mich gern selbst davon überzeugen. Außerdem … denk an unseren Deal.»
Er griff zum Telefonhörer und nahm ihn ab.
«Schon gut», sagte Blondie, schob ihre Daumen unter den Saum des Slips und streifte ihn rasch ab. Er rutschte hinunter und blieb an ihren schmalen Knöcheln hängen. Jetzt trug sie nur noch die Sneakers und ein ledernes Halsband. Sie war tatsächlich nicht nahtlos braun. Es sah beinahe so aus, als trüge sie ihren Slip noch, so weiß war sie dort. Zwischen den Beinen war sie mal rasiert gewesen, aber der dunkle Schatten verriet, dass das schon ein paar Tage zurücklag. Von ihrem Bauchnabel schlängelte sich ein Tattoo bis unter ihre linke Brust. Es war eine buntschillernde Schlange mit weit aufgerissenem Maul, und es sah so aus, als schlüge sie ihre Giftzähne in die Brust.
«Schönes Tattoo.»
Er streckte die Hand aus, doch sie wich zurück.
«Nicht anfassen!»
«Süße, du kannst mich doch hier nicht so scharfmachen, und dann läuft nichts. Wenn ich dich nicht anfassen darf …»
Ein lautes Klopfen an der Bürotür schnitt Kampen das Wort ab. Zum Teufel noch mal, er hatte dem Itaker doch gesagt, er sollte nach Hause gehen!
«Was ist?»
«Hier ist jemand von der Gewerbeaufsicht, der Sie sprechen möchte», sagte Franco durch die geschlossene Tür.
Das hatte gerade noch gefehlt. Wieso kam der jetzt, der Laden war doch seit ein paar Minuten geschlossen? Außerdem war die Kontrolle erst für morgen angekündigt. Verdammte Scheiße, ausgerechnet in diesem Moment.
«Zieh dich an», flüsterte Kampen der Blonden zu.
Die hatte schon damit begonnen. In weniger als einer halben Minute war sie wieder angekleidet.
«Ein Wort, und ich zeige dich trotzdem an, denk an das Video», warnte er das Flittchen, schloss die Bürotür auf und schubste sie raus.
Franco trat beiseite, warf ihr einen fragenden Blick zu, sagte aber nichts.
«Hau ab und lass dich nie wieder hier blicken», rief Kampen dem Mädchen nach.
Dann sah er sich im Laden um, konnte aber außer Franco niemanden entdecken. «Wo ist der Typ von der Gewerbeaufsicht?», fuhr er den jungen Italiener an.
Franco ging ein paar Schritte rückwärts.
«Ich glaube, der zieht sich gerade für dich aus, Fettsack.»
Der kleine Laden in Bahnhofsnähe hatte bis zweiundzwanzig Uhr geöffnet. Draußen war es längst dunkel, als Franco auf die Straße lief. Die Luft war warm und stickig, es roch nach Staub, Abgasen und Urin. Gleich nebenan befand sich zwischen zwei Gebäuden eine dunkle Nische, die gern als Toilette missbraucht wurde. Nicht selten übernachteten Gestalten darin, denen das Leben übel mitgespielt hatte, einmal hatte die Polizei frühmorgens eine Leiche aus der Nische gezogen. Überdosis.
Franco sah sich um und entdeckte das Mädchen. Im Schein der Straßenlaternen war sie nicht mehr als ein schmaler Schatten, einsam und verletzlich, beinahe schon ätherisch.
Franco hatte geahnt, was passieren würde, als der fette Rainer Kampen sich am Ausgang seines Ladens positionierte. Es war nicht das erste Mal, dass dieser widerliche Drecksack bei weiblichen Ladendieben zudringlich wurde. Einmal hatte er eine richtige Abreibung bekommen, aber die meisten ließen es sich gefallen. In der Regel waren es Junkies, denen alles egal war. Dieses Mädchen aber, das hatte Franco sofort erkannt, als sie ihm an der Kasse einen hilfesuchenden Blick zugeworfen hatte, war anders. Sie war kein Junkie.
Mit seiner Aktion hatte Franco den Job bei Kampen geschmissen, aber das war ihm nicht besonders schwergefallen. Der fette Sack war ein nerviger, immer unzufriedener Boss, dem man nie etwas recht machen konnte. Seit einem halben Jahr arbeitete Franco immer von fünf bis Ladenschluss an der Kasse. Kampen zahlte schlecht, und das Geld kam nicht immer pünktlich, aber einen Job zu finden war nicht so einfach, deshalb hatte Franco es so lange dort ausgehalten.
Vor einem Jahr war er aus Italien nach Deutschland gekommen, mit nicht mehr als einer abgeschlossenen Mechaniker-Ausbildung und dem Traum von einem besseren Leben. In seiner Heimat gab es keine Arbeit, die große Krise hatte die Jobs gefressen. In Deutschland, so hatte es geheißen, fand jeder Arbeit, der was konnte. Aber das war so falsch wie nur irgendwas. Franco hatte festgestellt, dass es gravierende Unterschiede in der Ausbildung gab und die Firmen hier ganz andere Anforderungen stellten. In zwei Werkstätten hatte er es versucht und war beide Male rausgeflogen. Zurück nach Italien konnte er aber nicht, die Demütigung wäre zu groß gewesen. Vor seinen Kumpels, die alle dortgeblieben waren, hatte er angegeben und von seinem zukünftigen großen Haus und dem Porsche geschwärmt, den er fahren würde. Außerdem hasste Franco seinen Vater und der ihn. Was sollte er also dort?
Das blonde Mädchen war Richtung Taunusanlagen gerannt und hatte den kleinen Park beinahe erreicht. Mit ihren langen Beinen war sie schnell unterwegs, und Franco befürchtete, sie würde zwischen den Bäumen und Büschen verschwinden. Es gab zahllose Verstecke dadrinnen, vor allem aber war der Park nachts ein gefährlicher Ort. Ein Tummelplatz für Junkies, Dealer und Männer, die auf der Suche nach einer schnellen Nummer waren.
Franco rief ihr zu, sie solle warten, und sie fuhr herum.
«Hey», sagte er, und plötzlich fehlten ihm die Worte.
Sie sagte nichts, sah ihn nur an, und ihr Blick ging bis tief in seinen Bauch. Es lag etwas Durchdringendes und Forschendes darin. Sie traute ihm nicht, obwohl er ihr gerade geholfen hatte. Er hielt ihr die Packung Snickers hin, die er aus dem Laden hatte mitgehen lassen.
«Ich würde sagen, das sind jetzt deine.»
Sie taxierte ihn weiterhin reglos.
«Warum tust du das?», fragte sie schließlich.
Franco zuckte mit den Schultern. «Weil ich den Fettsack nicht leiden kann und sowieso längst kündigen wollte. War der richtige Zeitpunkt, fand ich.»
Einen Moment noch ruhte ihr Blick auf ihm, und Franco spürte, wie er unter seiner italienischen Bräune rot wurde. Dann nahm sie ihm die Snickers ab.
«Danke.»
«Kein Problem. Wenn du willst, gehe ich mit dir zur Polizei, und wir zeigen den Fettsack an.»
Sie schüttelte den Kopf. «Nein, auf keinen Fall.»
«Okay, deine Entscheidung.»
Sie riss die Packung auf, nahm einen Riegel heraus, riss auch den auf, biss davon ab und schloss für einen Moment die Augen.
«Ich hatte heute noch nichts», erklärte sie.
«Das ist das Erste, was du heute isst?»
Das blonde Mädchen nickte.
«Ich lade dich auf einen Burger ein, okay? Gleich da drüben ist ein Burger King.»
«Und was versprichst du dir davon?»
«Dass du was Vernünftiges isst und satt wirst.»
«Ein Burger ist was Vernünftiges?»
«Klar, was denn sonst?»
«Du diebischer Itacker!», kam es plötzlich laut von hinten. «Komm sofort zurück. In der Kasse fehlt Geld.»
Der fette Kampen kam auf sie zugewatschelt.
«Komm mit!», sagte Franco, ergriff die Hand des Mädchens und zog sie mit sich. Gemeinsam rannten sie in den Park, und nach wenigen Schritten hatte die Dunkelheit unter den Bäumen sie verschluckt. Sie rannten immer weiter, Franco hielt das Tempo hoch, er wollte hier auf keinen Fall stehen bleiben. Er rechnete damit, dass das Mädchen sich gegen seinen Griff wehren würde, aber das tat sie nicht. Sie liefen am Beethoven-Denkmal vorbei, vor dem eine Gruppe Jugendlicher mit Bierflaschen in den Händen saß und lautstark debattierte, und verließen den Park über die Neue Rothofstraße.
Ein wenig außer Atem, blieben sie auf dem Bürgersteig stehen, und sie nahm ihre Hand aus seiner.
«Du hast ihm Geld geklaut?», fragte das Mädchen.
Franco griff in seine Hosentaschen und zog einen Fünfziger hervor.
«Das erste Mal, ich schwöre es, aber er hat es verdient.»
«Du hättest alles nehmen sollen.»
«Ja, aber für ein ordentliches Essen reicht es. Was ist, nimmst du meine Einladung an?»
«Wenn es auf Kosten dieses Arschlochs geht, auf jeden Fall.»
Zum ersten Mal lächelte sie, und ihre gebräunte Gesichtshaut wirkte unter dem rötlichen Licht der Bogenlampe wie Bronze, die Sommersprossen auf dem Nasenrücken und den Jochbeinen wie darin eingeschlossene Kupfersplitter. Ihre Augen, die bisher ernst und auch ein wenig traurig dreingeblickt hatten, lächelten mit, ihr Gesicht wurde offener.
«Wie heißt du?», fragte Franco.
«Snake.»
«Schlange? Das ist dein Name?»
«So lange, bis ich dir einen anderen nenne.»
Sie gingen in das Fastfood-Restaurant in der Fressgasse. Vor der Eingangstür saß ein alter Mann auf einem Stück Pappe am Boden, vor sich eine kleine Plastikschale, in der ein paar Münzen lagen. Er hatte langes Haar, einen langen grauen Bart, trug zerschlissene Kleidung, und seine Fingernägel waren lang und gelb. Neben ihm lag ein Hund, für den der Ausdruck «räudiger Köter» offenbar erfunden worden war. Um die Schnauze herum war sein Fell so grau wie der Bart seines Besitzers, seine Augen waren gerötet und nässten stark. Er war zwar nicht mager, machte aber keinen gesunden Eindruck. Mensch und Tier stanken gleichermaßen.
Im Inneren des Restaurants, gleich hinter der Tür, lag ein Junge auf einer Sitzbank. Auf dem Tisch davor stand ein Tablett mit Müll und einem geleerten Pappbecher darauf. Der Junge schien nach dem Essen zusammengebrochen zu sein. Er schlief tief und fest.
An einem anderen Tisch saßen vier stiernackige Gestalten mit tätowierten Armen. Alle vier trugen Tanktops, Armeehosen und bis auf wenige Millimeter geschorenes Haar, es sah aus, als gehörten sie einer geheimen Terroreinheit an. Sie stopften Burger und Pommes in sich hinein und warfen jedem, der das Restaurant betrat, feindselige Blicke zu. Die Beintaschen ihrer Armeehosen waren ausgebeult.
Mitten im Laden lief ein Typ herum, der einen hervorragenden Jesus-Darsteller abgegeben hätte. Er war dürr, sein löchriges Shirt schlotterte an seinem Oberkörper herum. Das lange Haar fiel fettig auf seine Schultern. Er war barfuß, trat auf am Boden liegenden Pommes herum und schien es nicht einmal zu bemerken. Er faselte vor sich hin, immer wieder denselben Satz, den niemand außer ihm selbst verstand.
Direkt vor dem Tresen, an dem die Bestellungen aufgegeben wurden, standen zwei Backpacker, ein Junge und ein Mädchen, beide nicht älter als fünfundzwanzig. Ihre Rucksäcke waren riesig, außen hingen Isomatten, abgelaufene Schuhe und allerlei Krimskrams daran.
Snake betrachtete die beiden mit einem sehnsüchtigen Gefühl in der Brust. Den Rucksack aufsetzen, die Schuhe schnüren, den ersten Schritt machen auf einer Reise, von der sie nicht wusste, wohin sie führen und wann sie enden würde. Einfach unterwegs sein, das unerträgliche Leben zu Hause weit hinter sich lassen, immer dem Horizont entgegen. Mit diesen Gedanken war sie aufgebrochen und doch nicht weiter gekommen als bis in diesen Moloch, der sich Metropole nannte.
Alles war anders gelaufen, als sie es sich vorgestellt hatte, und ehe sie richtig verstand, was mit ihr geschah, war sie mittellos auf der Straße gelandet und hatte unter einer Brücke schlafen müssen. Denn wenn man kein Geld in den Taschen hatte, war die Stadt ein lebensfeindlicher Raum voller Gefahren, und mittlerweile litt sie unter der überall präsenten Aggressivität und der ständigen Anspannung. Jede Nacht die Angst davor, ausgeraubt oder vergewaltigt zu werden. Jede Nacht Tränen der Verzweiflung und das Schwanken zwischen Durchhalten und reumütig nach Hause Zurückkehren.
Der fette Sack hatte sie am richtigen Abend erwischt. Durch den Hunger und die beginnende Unterzuckerung war sie körperlich am Ende und kaum noch Herrin ihrer Gedanken gewesen. Wenn sie vorher gewusst hätte, dass der junge Italiener hinter der Kasse auf ihrer Seite war, dann hätte sie einen Fluchtversuch unternommen. Insofern war Franco irgendwie auch schuld daran, dass sie in dem stickigen Büro vor den glänzenden Augen dieses widerlichen Fettsacks einen Strip hatte hinlegen müssen. Aber er hatte es wiedergutgemacht. Franco schien ein netter Junge zu sein. Aber vielleicht täuschte sie sich auch, und er verstellte sich, weil er sich eine schnelle Nummer erhoffte.
Tja, sie würde es herausfinden.
Nachdem die beiden Backpacker bedient worden waren und mit ihren Tabletts zu einem Tisch abschoben, waren Franco und sie an der Reihe. Snake hielt sich im Hintergrund. Sie hatte Franco gesagt, was sie wollte: Pommes, Cheeseburger und eine Coke. In ihrem früheren Leben hatte sie nie so etwas gegessen, allein schon deshalb nicht, weil es im Umkreis von fünfzig Kilometern kein einziges Fastfood-Restaurant gab. Sie fand den Geschmack auch jetzt nicht besonders toll, aber für den Moment machte es satt, es war billig, und sie war eingeladen, da durfte man nicht wählerisch sein.
Während Franco auf die Bestellung wartete, sah sie sich nach einem Tisch um. Der Laden war schmal, erstreckte sich aber weit in die Tiefe. Hinten schien es am ruhigsten zu sein. Die Backpacker waren vorn geblieben. Soweit Snake sehen konnte, hockte dort hinten nur ein einsamer alter Mann. Er klammerte sich regelrecht an einem Pappbecher fest und starrte stumpfsinnig hinein.
«Brauchst du Mayo oder Ketchup?», riss Franco sie aus ihren Gedanken.
«Auf keinen Fall.»
Sie ging voran, Franco folgte ihr mit dem Tablett. Zwei Tische von dem alten Mann entfernt ließen sie sich nieder. Der Geruch, den die Pommes ausströmten, ließ ihren Magen verkrampfen. Noch nie im Leben hatte sie solchen Hunger gespürt wie heute. Dieser Tag war wirklich der absolute Tiefpunkt bisher, da hatte die demütigende Show im Laden gut hineingepasst.
«Buon Appetito», sagte Franco und lächelte sie an. Er hatte ein aufrichtiges Gesicht mit strahlenden, braunen Augen. Darin lagen keinerlei Hinterhältigkeit oder Niedertracht.
Snake stopfte die ersten Pommes in sich hinein, als gelte es, einen Wettkampf zu gewinnen. Ihr Magen schien ein Fass ohne Boden zu sein. Hoffentlich hatten die genug Nachschub hier.
«Ich hab noch nie ein Mädchen so essen sehen», sagte Franco und grinste. «Dabei bist du so dünn, wie machst du das?»
«Zwei Tage nichts essen», antwortete Snake mit vollem Mund. Sie leckte sich das Salz von den Lippen und Fingerspitzen und trank von der kühlen Coke. In diesem Moment schmeckte der Fraß einfach wundervoll.
«Du bist Italiener?», fragte sie, um das Gespräch von sich abzulenken. Auch wenn Franco ein netter Typ war, hatte sie nicht vor, ihm allzu viel von sich zu erzählen.
«Si! Allerdings ein Halbblut. Mutter Italienerin, Vater Deutscher. Bis zu meinem zehnten Lebensjahr haben wir in Hamburg gelebt, dann ist meine Familie zurück nach Rom. Sie hatten Heimweh.»
«Aber du bist wieder hier.»
«Ja, ich bin wieder hier.»
Da lag viel Traurigkeit in seinen Worten. Aus Höflichkeit hätte sie ihn fragen können, ob er allein zurückgekommen war und warum. Aber sie biss ein großes Stück von dem Cheeseburger ab und hatte den Mund so voll, dass sie kein Wort mehr herausbrachte.
«Das war ja ein halber Burger auf einmal!», rief Franco aus. «Respekt.»
Sie schüttelte nur den Kopf und kaute, wischte mit dem kleinen Finger etwas Dressing von ihrer Oberlippe und leckte es ab. Sie wusste, dass sie in diesem Moment ein unmögliches Bild abgab, es war ihr egal. Der Hunger, so viel hatte sie gelernt, veränderte einen Menschen. Bis vor wenigen Tagen hatte sie das Eigentum anderer Leute respektiert und nie zuvor gestohlen.
«Du hast zum ersten Mal geklaut, oder?», fragte Franco, als könne er ihre Gedanken lesen.
Snake sah ihn an. Schwarzes gelocktes Haar, braune Augen mit südländischer Glut darin, braune Haut, ein Lederband mit silbernem Christophorus-Amulett um den Hals, ein einfaches Shirt zu einer modischen Jeans. Schlanke Figur, wahrscheinlich gut trainiert. In einer anderen Situation hätte sie ihn als den typischen italienischen Macho eingeschätzt, der hinter jedem Mädchen her war und es als Majestätsbeleidigung empfand, wenn eine ihn abblitzen ließ. Eben als den Typ Mann, auf den sie überhaupt nicht stand. Aber dieser erste Eindruck wäre falsch gewesen. Franco besaß eine gute Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen. Welcher Junge hatte das heutzutage noch? Das waren doch alles nur noch selbstbezogene Egoisten.
«Hat man das gemerkt?», fragte sie.
Er nickte. «Und wie. Du hast viel zu lange vor dem Regal gestanden, sogar ich hatte dich schon bemerkt. Da hatte der Fettsack dich sicher schon ein paar Minuten über die Videocams angegafft. Hingehen, zugreifen, rausmarschieren, als sei nichts gewesen – so machen die anderen das. Dir konnte man am Gesicht ansehen, dass du klauen willst.»
«Nicht so laut.»
«Interessiert hier eh keinen.»
Wieder aßen sie eine Weile schweigend. Snake merkte, wie schnell jetzt die Sättigung einsetzte. Hatte sie eben noch auf genug Nachschub gehofft, glaubte sie nun, keinen Bissen mehr hinunterzubekommen. Sie ließ sich gegen das Rückenpolster sacken, stöhnte und legte sich die Hand auf den aufgeblähten Bauch.
«Puh, das reicht für eine Woche.»
Franco betrachtete sie mit einem kleinen Lächeln in den Mundwinkeln.
«Verrätst du mir deinen wirklichen Namen?»
«Du bist neugierig.»
«Sind alle Italiener, männlich wie weiblich. Und wir sind furchtbare Klatschmäuler. Sobald ich deinen Namen weiß, werde ich jedem erzählen, was für ein Vielfraß du bist.»
«Gefällt dir Snake nicht?
«Schlangen sind gefährlich.»
«Vielleicht bin ich das auch.»
«Ganz sicher sogar, aber ich würde gern auch die andere Seite kennenlernen.»
«Woher willst du wissen, dass es eine andere Seite gibt?»
«Ich habe Augen im Kopf. Man muss dich nur ansehen.»
«Und was siehst du?»
Franco stellte den Becher beiseite, kam ganz nach vorn an den Tisch heran und sah ihr in die Augen. Snake hielt seinem Blick stand, aber einfach war es nicht. Seine Augen berührten etwas in ihr.
«Energie», sagte Franco. «Lebenswillen, aber auch Traurigkeit. Ehrlichkeit, aber auch Unbeugsamkeit. Und vor allem einen freien Geist.»
Snake zwinkerte. Sie hatte das Gefühl, ihre Augen würden feucht.
«Warum nennst du dich Snake?», fragte Franco.
Sie hob ihr Shirt ein kleines Stück an und zeigte ihm einen Teil des Schlangentattoos auf ihrem Bauch.
«Das ist eine Regenbogenboa. Ich liebe Schlangen, seit ich denken kann. Sie sind unabhängig, anpassungsfähig, wunderschön, stark und schnell.»
«Und tödlich.»
«Nur wenn man sie reizt.»
«Würdest du auch gern so sein?»
«Vielleicht bin ich längst so.»
«Wunderschön und stark auf jeden Fall.»
Snake bemerkte, dass der alte Mann hinten in der Ecke von seinem Becher aufsah und ihren nackten Bauch anstarrte. Schnell ließ sie das Shirt fallen.
«Ich glaube, du baggerst mich an.»
«Du bist gar nicht mein Typ.»
«Warum nicht?»
«Weil du auf solche Männer wie den fetten Kampen stehst.»
«Arschloch.»
Sie warf ihm eine Pommes ins Gesicht. Er hob sie vom Tisch auf und aß sie.
«Du brauchst keine Angst vor mir zu haben», sagte Franco. «Und wenn du nicht weißt, wo du heute Nacht hinsollst, kannst du in meiner Bude schlafen – ohne Hintergedanken.»
«Du bist Italiener.»
«Ja, aber mein Vater ist Deutscher, also bin ich ein Gentleman.»
Snake musterte ihn einen Moment schweigend und dachte dabei an das Versteck unter der Fußgängerbrücke beim Park, in dem sie die letzten drei Nächte verbrachte hatte. Eine schmale Nische direkt unter den Eisenträgern, in der sie im Dunkeln fast unsichtbar war. Sie passte gerade so hinein, musste sich aber liegend hineinschieben. Dieses trockene Versteck teilte sie sich mit Ameisen und Spinnen, aber bisher war es wenigstens sicher gewesen. Geschlafen hatte sie dort jedoch kaum. Die Geräusche, wenn jemand über die Brücke ging, waren viel zu laut. Fahrradreifen klangen wie wispernde Zungen. Und dann die ständige Angst, doch entdeckt zu werden. Vielleicht von Typen, die das Leben einer Obdachlosen für wertlos hielten.
Sie sagte ja und hoffte, dass Franco ihr Vertrauen nicht missbrauchen würde.
D