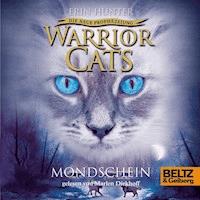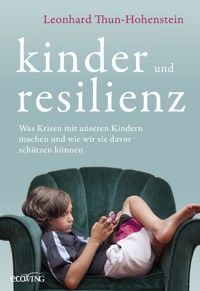
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Resilienz stärken: Krisen und Angst bei Kindern begegnen Jeder Mensch kennt Krisen. Gerade durch die Coronapandemie, den Ukrainekrieg und den Klimawandel haben Kinder und Jugendliche bereits in erheblichem Maße Unsicherheit und Ängste erlebt. Vor diesem Hintergrund gibt der Kinder- und Jugendpsychiater Leonhard Thun-Hohenstein zunächst einen Überblick über deren emotionale Entwicklung. Dann zeigt er auf, was Krisen überhaupt sind und was sie für junge Menschen bedeuten. Er erläutert, wie die kindliche Resilienz gestärkt werden kann und wie eine erfolgreiche Krisenprävention aussieht, die Kinder und Jugendliche auf schwierige Zeiten vorbereitet. - Wissenswertes über seelische Widerstandsfähigkeit und Krisenbewältigung bei Jugendlichen - Hervorragend aufbereiteter Ratgeber für Pädagog:innen und interessierte Eltern - Einführung in kindliches und jugendliches Verhalten, viele Fallbeispiele - Resilienz fördern im Jugendalter – detailliertes Wissen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie Wie Krisen entstehen und wie Jugendliche lernen können, damit umzugehen In der Pubertät finden zentrale emotionale Entwicklungsaufgaben statt. Deshalb sind wir Menschen in dieser Phase besonders labil und anfällig für Lebenskrisen. Thun-Hohenstein erläutert die normale psychische Entwicklung in diesem Alter, den Umgang Jugendlicher mit ihren Gefühlen und wie sich Stress auf sie auswirkt. Das Buch beantwortet die Frage "Was ist Resilienz?" und ordnet sie speziell für die jugendliche Psyche ein. Verschiedene Fallbeispiele aus der beruflichen Praxis des Autors zeigen, wie hilfreich die erworbene Resilienz sein kann. Das umfassende Werk bietet Strategien zur Begleitung und Bewältigung von Krisen im Jugendalter auf der Grundlage medizinischer Erfahrungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Leonhard Thun-Hohenstein
KINDER UND RESILIENZ
Was Krisen mit unseren Kindern machen und wie wir sie davor schützen können
Die im Buch auftretenden Personen (Kinder und Jugendlichen sowie ihre Bezugspersonen) sind fiktiv. Ihre Fallgeschichten beruhen jedoch auf den realen Erfahrungen des Autors.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2023 Ecowing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Garamond Premier Pro
Lektorat: Caroline Metzger, Wien
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: Georg Kukuvec, Salzburg
Autorenillustration: Claudia Meitert/carolineseidler.com
Printed by GGP Media
ISBN: 978-3-7110-0324-9
eISBN: 978-3-7110-5346-6
Ich widme dieses Buch den vielen Kindern und Jugendlichen und ihren Familien, die mich bereichert haben und von denen ich die wesentlichen Dinge lernen durfte.
Inhalt
Vorwort – Warum dieses Buch?
1.Zur normalen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Die Bedeutung der Emotion
Die frühkindliche Entwicklung
Das Selbstkonzept
Genetik, die Rolle der Eltern und der Umwelt
Das bio-psycho-soziale Modell
Die Entwicklungsaufgaben
Lebensereignisse
2.Was Krisen sind und warum sie entstehen
Krise und schöpferischer Prozess
Die Entwicklung einer Krise
Die Rolle von Stress bei der Entstehung von Krisen
Zum Problem der Einordnung von Krisen
Krisen auf der makrosystemischen Ebene
Krisen auf der exo- und mesosystemischen Ebene
Krisen auf der mikrosystemischen Ebene
3.Fallbeispiele
Carolina – eine Pubertätskrise
Amina – eine psychosoziale Krise
Moritz – eine Mischung aus Reifungskrise und pädagogischer Krise
Kevin – eine psychosoziale Krise
Sunny – eine psychosomatische Krise
Valerian – eine Identitätskrise mit Suizidalität
4.Resilienz, Prosilienz und positive Lebensgestaltung angesichts von Krisen
Was bedeutet eigentlich Gesundheit?
Zum gelingenden und guten Leben
Die Resilienz
5.Vom Umgang mit Krisen
Der schöpferische Prozess als Basis
Krisenprävention auf der Makroebene
Krisenprävention auf der Mesoebene
Krisenprävention im Exosystem
Krisenprävention auf der Mikroebene
Krisenintervention
Allgemeine Regeln der Krisenintervention
Dank
Anmerkungen
Verwendete und weiterführende Literatur
Zum Autor
Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war, stets kannst du im Heute von Neuem beginnen.
Buddha
Vorwort – Warum dieses Buch?
»Ich habe das Gefühl, als ob ich an die Wand gefahren wäre.« Dies waren die ersten Worte von Ben, der im Juni 2020 bei mir in der Ambulanz saß. Es war die Zeit nach dem ersten Lockdown infolge der Covid-19-Pandemie. Er war ein schlaksiger, hochgewachsener, anscheinend gut trainierter vierzehnjähriger Junge, der wegen eines massiven Gewichtsverlustes mit seiner Mutter zu mir gekommen war. Er besuchte die vierte Klasse eines renommierten Gymnasiums, hatte viele Freunde und war Leistungssportler in einer für seinen Heimatort typischen Sportart. Dann war der unerwartete Lockdown gekommen – keine Schule, kein Training, kein Ausgang. Das normale Leben war maximal unterbrochen worden. Um den Schock einerseits und die Tatenlosigkeit andererseits zu bewältigen, hatte er begonnen, in seinem Zimmer immer ausdauernder Sport zu betreiben: Sit-ups, Liegestütze – alles, was eben in einem Zimmer möglich war. Gleichzeitig hatte er im Internet die Welt der Diäten entdeckt, und so kam es, dass er in den letzten sechs Wochen vor unserem ersten Zusammentreffen das Essen nahezu eingestellt, sich nur mehr vegan ernährt und durch die Kombination aus wenig Nahrung und viel Sport massiv an Gewicht verloren hatte. Er hatte sich in die Anfangsphase einer Magersucht verwickelt.
Der junge Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer akuten Lebenskrise, die durch eine externe Krise, die Covid-19-Pandemie, und die damit verbundenen politischen Bewältigungsstrategien (Lockdown, Homeschooling, Social Distancing) ausgelöst worden war.
In meinem Berufsleben als Kinderarzt und Kinder- und Jugendpsychiater durfte ich viele Menschen, vor allem natürlich Kinder und Jugendliche, durch leichtere oder schwere Krisen begleiten und ihnen ins Leben zurückhelfen. Das war manchmal sehr anspruchsvoll und mit einer hohen Verantwortung für Leib und Seele meiner Patienten verbunden, aber es war jedes Mal auch äußerst bereichernd. Jede dieser Lebenssituationen war anders, es waren unterschiedlichste Lebensgeschichten, es fanden sich verschiedene Einflussfaktoren, und in erster Linie waren die Persönlichkeiten in ihrer Vielfältigkeit, in ihrer Belastung und Verletztheit herausfordernd. Aber vor allem war und ist es beglückend, Menschen nach einer überstandenen Krise auf ihrem neuen Weg zu sehen und zu begleiten, die wieder erwachende Lebensfreude zu unterstützen und mit ihnen an Lösungen für ihr Leben zu arbeiten.
Gerade in den letzten drei Jahren haben viele Kinder und Jugendliche bedingt durch die großen, allgemeinen Krisen, allen voran die Covid-19-Pandemie, auch persönliche Krisen erlebt. Die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen haben deutlich zugenommen, was zu langen Wartezeiten in den Ambulanzen und Praxen der behandelnden Professionen führt. Viele dieser Probleme kann man verstehen, wenn man mehr weiß über die Entstehungsbedingungen von psychischen Erkrankungen, wenn man die verschiedenen Formen von Stress kennt und den Umgang damit lernt.
Dieses Buch soll einen aktuellen Einblick geben, wie die Wissenschaft die kindliche Entwicklung versteht und welche Einflüsse sich dabei bemerkbar machen. Wir sind diesem Prozess – obwohl er so komplex ist – nicht ausgeliefert. Wir können und müssen die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, so wie unsere eigene, aktiv gestalten. Was das heißt, welche Voraussetzungen und Mittel man dafür braucht, aber auch in welche Krisen man im Laufe des Lebens stürzen kann, wird dieses Buch erklären.
Krisen können – entsprechend der Systemischen Therapie – auch als Chance auf eine schnelle, sinnvolle und positive Veränderung verstanden werden, die bis zu ihrem Auftreten nicht möglich war. Dabei zeigen sie sich in unterschiedlichen Formen, von Alltagskrisen bis zur traumatischen Krise, global oder lokal, rasch herankommend oder sich schleichend entwickelnd. Verschiedenste Umstände können in eine Krise führen, und sie produziert viele verschiedene Symptome. Je akuter und deutlicher sie ausfällt, umso eher besteht eine Chance auf Veränderung. Inmitten einer schweren Krise ist das System, die Familie, sind Patient:innen eher bereit, unübliche Copingstrategien anzuwenden und neue Lösungen zu suchen. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Resilienz, eine Eigenschaft, die es dem Menschen ermöglicht, trotz schwerer Bedingungen und Schicksalsschläge ein gelingendes Leben zu führen. Diese muss allerdings schon bei Beginn der Krise vorhanden sein.
Für ein Verständnis von Krisenentstehung und -verlauf und dadurch auch den Aufbau einer präventiven Haltung ist es wichtig, die verschiedenen Systemebenen unserer Gesellschaft zu beleuchten. Ein umfassendes Wissen über die Entwicklung von Krisen führt zur besseren Fähigkeit, sie auch bewältigen zu können. Darum soll in diesem Buch zunächst beschrieben werden, was Krisen sind, welche Arten es gibt, wie wir sie verstehen und inwiefern wir sie sogar nutzen können. Außerdem möchte ich Anregungen zu einem neuen Krisenverständnis geben, nämlich Krisen als nahezu normale und für die Entwicklung des Menschen und einer Gesellschaft notwendige Ereignisse anzusehen. Damit verbunden, sollen Anregungen zur Krisenbewältigung gegeben werden. Wichtig ist dabei, dass Krisen nur bewältigt werden können im Zusammenspiel des Individuums, das die Krise bewältigen möchte, das bereit ist, aktive Schritte zu setzen, und den supportiven Strukturen wie Eltern, Partner:innen, Sozialsystem und Gesellschaft. Insbesondere ist es mir deshalb ein Anliegen, Eltern, Erzieher:innen und anderen Lebensbegleiter:innen von Minderjährigen Anregungen zu geben, deren Krisen als mit einer großen Lernchance verbundene Situationen zu betrachten. So soll dieses Buch auch dazu beitragen, dass so manche Krisenentwicklungen früher erkannt und den Helfer:innen Mittel und Wege aufgezeigt werden, bei der Bewältigung unterstützend einzuwirken. Dies werde ich basierend auf dem Verständnis der normalen seelischen Entwicklung junger Menschen beschreiben, damit die Betroffenen und ihre Umgebung in Krisenzeiten die Zuversicht nicht verlieren und stattdessen Mut fassen können, sich in einen aktiven Modus der Krisenbewältigung zu entwickeln.
Eine wesentliche Voraussetzung für das Verstehen von Krisen ist die Kenntnis, wie sich Kinder eigentlich normalerweise entwickeln, wie ihre Persönlichkeit entsteht und welche Faktoren Einfluss darauf haben. Welche Eigenschaften benötigen sie für die Bewältigung der Herausforderungen des Lebens? Zu Beginn werde ich mit Ihnen deshalb einen kurzen und kompakten Gang durch die wichtigsten Prinzipien der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen machen, sodass wir uns – ausgestattet mit diesem Wissen – dann der Krise widmen können.
1. Zur normalen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Die Entwicklung des Menschen ist für mich eines der faszinierendsten Felder der Medizin oder überhaupt der Wissenschaft. In der Dynamik der Entwicklungsprozesse und in der Energie der Kinder, diese bewältigen zu wollen, liegt für mich das grundlegende Verständnis für den Menschen.
Sie haben sicher schon kleine Kinder dabei beobachtet, eine neue Fertigkeit wie das Gehen zu erwerben. Die physische Grundausstattung gibt den ungefähren Zeitraum vor (zehnter bis achtzehnter Lebensmonat) und schafft die Voraussetzungen für diesen Entwicklungsschritt: Muskelkraft, Aufrichtung, Koordination, Aufmerksamkeit, Sensorik, alles ist genau dafür geschaffen, um in diesem Moment das Gehen erlernen zu können. Man sieht die ersten mühsamen Versuche, sich hochzuziehen, aufzurichten, das erste Mal frei zu stehen. Und dann kommt endlich der erste Schritt, aber da sieht man auch rasch die Grenze – der erste Sturz ist meist schnell passiert. Dieses Vorgehen wiederholt sich zigmal, bis das Gehen schlussendlich funktioniert. Ich bewundere dabei immer die Ausdauer, die Geduld, das Immer-wieder-Aufstehen und das unendlich kreative Lösungsversuchsprogramm, das Kinder hierbei an den Tag legen. Sie zeigen eine nahezu unaufhaltsame Energie des Lernenwollens, des Sich-entwickeln-Wollens, das unzählige kleine Niederlagen, man könnte auch sagen kleine Krisen, beinhaltet. Diese halten aber nicht auf, sondern spornen weiter an, es wieder und wieder zu versuchen. Vielleicht hilft zum besseren Verständnis ein Vergleich aus dem Garten. Sie kennen sicher die Glyzinie, auch Blauregen genannt, die uns im Frühjahr mit ihrem betörenden Duft und Tausenden wunderschönen blauen oder weißen Blüten verwöhnt. Der Blauregen ist eine Rankpflanze aus der Gruppe der Lianen, mit sich entsprechend windenden Sprossen, die dann zunehmend verholzen. Die Wuchskraft dieser Pflanze ist enorm, sie gedeiht ohne Dünger, ohne besondere gärtnerische Maßnahmen. Sie bedarf aber besonderer Pflege: Am Anfang benötigt sie eine Schlinghilfe, ein Seil oder eine Säule, an der sie sich hochwinden kann. Ist sie einmal hochgeklettert und hat Fuß gefasst, kann sie bis zu dreißig Meter hoch werden. Das heißt, sie wächst und wächst und wächst weit über alle Grenzen hinaus. Ähnlich kann die Entwicklungsenergie von Kindern gesehen werden, sie wollen wachsen, lernen, entdecken, die Welt verstehen, ihre unglaubliche Energie investieren. Aber sie brauchen – genauso wie der Blauregen – Anleitung, »Rankhilfen« und Grenzen, also Strukturen, die ihr Wachstum regeln, es dabei aber nicht zerstören, die ihnen selbst und ihrer Umwelt zugutekommen. Die enorme Energie des Wachstums gilt es also in produktive, befriedigende und die Entwicklung fördernde Bahnen zu lenken. Erziehung heißt demzufolge, dem Kind Anleitung in Form einer »Rankhilfe« zu geben, Struktur und Halt zu bieten durch Lebensrhythmus, Verlässlichkeit, Trost und Schutz. Es geht um die Begleitung eines zu schützenden Geschöpfes, das aber mit ungeheurer Energie, Wissensdurst, Erfahrungslust und Neugier die Welt entdecken und verstehen will. Das Erziehungsziel ist ein Mensch, der auf sich vertrauen kann, gelernt hat, mit inneren und äußeren Spannungen und Belastungen umzugehen, und dabei seine Entwicklung selbstständig und autonom verfolgen kann.
Entwicklung ist ein Prozess, der alle Ebenen des Körpers miteinschließt, von den einzelnen Zellen (z. B. unreife Markzellen, die zu weißen Blutkörperchen werden) bis zu den Organen und dem Gesamtorganismus. Sie wird als die Summe aller Reifungs-, Differenzierungs- und Integrationsprozesse gesehen und ist messbar an quantitativen Veränderungen, wie Körpergröße, Gewicht oder Kopfumfang, und qualitativen Veränderungen, wie die Entwicklung vom Kriechen zum Gehen. Sie verläuft für alle Menschen sehr ähnlich, in einer bestimmten Reihenfolge, in eine Richtung – von klein zu groß, von undifferenziert zu differenziert –, und ist normalerweise nicht umkehrbar. Allerdings gibt es sehr individuelle Verläufe, wie es auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Kulturen gibt. Grundlage dieses gesamten Entwicklungsprozesses und des menschlichen Verhaltens im Allgemeinen ist das Organ in unserem Kopf: das Gehirn. Es besteht aus Millionen Zellen und Neuronen, die ein riesiges Netzwerk bilden. Dieses Netzwerk dient einerseits dazu, die Welt zu »übersetzen«, denn das Hirn hat ja in seiner knöchernen Halterung, dem Schädel, keinen direkten Zugang zur Welt. Andererseits muss es die erhaltenen Informationen in einen sinnvollen Zusammenhang bringen und mit internen Prozessen abstimmen, damit eine möglichst gute Anpassung des Individuums an seine Umgebung – und damit sein (Über-)Leben – gelingen kann. Dieses Übersetzungsprogramm ist bei der Geburt erst in seinen Grundzügen angelegt und bedarf der regelmäßigen »Fütterung« mit Informationen und Hilfe bei deren Einordnung. Neurobiologisch wird es gesteuert von den evolutionsbezogenen »alten« Hirnanteilen, also Hirnstamm, Kleinhirn und Mittelhirn, die für die sensorische Wahrnehmung, deren Analyse und Einordnung sowie die bedürfnisgesteuerten Aktivitäten verantwortlich sind. Das »neuere« Hirn, im Wesentlichen der sogenannte Neokortex, die Hirnrinde, ist zuständig für die Steuerung und Regulierung der vom älteren Hirn kommenden Anforderungen und Bedürfnisse. Der Prozess, diese Steuerung zu erwerben, besteht aus dem lebenslangen Erwerb von Erfahrungen und, vonseiten der Umwelt, der Erziehung. Die Erfahrungen sind zuständig für den Aufbau der Hirnarchitektur, die sozialen Beziehungen und die Bindungserfahrungen sind für die Vernetzung, die sogenannten Regelkreise (circuits) im Gehirn, von großer Bedeutung.1
Sehen wir uns das mal ganz konkret am Beispiel eines neugeborenen Kindes an. Anfangs sind viele Verhaltensweisen – wie das Saugen – reflektorisch gesteuert. Mit zunehmendem Alter und dadurch auch zunehmender Erfahrung verschwinden diese Reflexe und machen der aktiven Nutzung dieser Anteile Platz. So kann das Kind nach der Geburt nur Nahrung aufnehmen, indem der Saug- und Schluckreflex ausgelöst wird. Dies geschieht durch Einführen eines Schnullers, der Brustwarze oder eines Fingers in den Mund. Trinken ist ja eine sehr komplexe Fertigkeit, braucht es doch eine Koordination des Saug- und Schluckaktes mit dem äußerst komplexen System der Atmung. Erst mit zunehmender Erfahrung kann das Kind also aktiv trinken.
Ein etwas älteres Kind kann schon Gegenstände halten, sie abtasten und in den Mund stecken – das orale Erkunden ist das erste der funktionellen Spielverhalten, wie auch der Kinderarzt und Wissenschaftler Remo H. Largo schreibt.2 Dabei steckt das Kind einen Gegenstand, zum Beispiel einen Schlüssel, in den Mund. Die Zunge und die Lippen erkunden dann die Form, die Temperatur, die Oberfläche, vielleicht auch das Gewicht. Diese sensorischen Informationen werden auf einer Netzwerkkarte, ähnlich einer Karteikarte im Gehirn, gesammelt und so als erste Information über diesen wahrgenommenen Gegenstand abgespeichert. Die nächsten Schritte des Spielverhaltens beinhalten dann das Hinzufügen manueller (Bewegung) und taktiler (Oberfläche, Gewicht etc.) Informationen, dann kommen visuelle Aspekte (Farbe, Form) hinzu, schlussendlich wird der Gegenstand dann entsprechend seiner Funktion verwendet (funktionelles Spiel). Mit der Benennung des Gegenstandes durch die Eltern oder die Umgebung werden die bisher gesammelten Informationen mit einem abstrahierenden Begriff verbunden, der dann aktiv in der Kommunikation eingesetzt werden kann. Nun ist die Karteikarte »Schlüssel« in groben Zügen angelegt. Zukünftige Informationen, etwa dass es unterschiedliche Schlüssel gibt oder der Begriff Schlüssel auch ganz abstrakt verwendet werden kann, folgen in den nächsten Jahren, unsere Karteikarten können ein Leben lang angereichert werden. Dieses Lernprinzip der multisensorischen Informationsaufnahme und deren Verknüpfung mit kognitiven Informationen stellt die Basis all unseres Lernens dar, und zwar lebenslang. Es ist daher naheliegend, dass Lernumgebungen für alle Altersstufen multisensorisch und kognitiv anregend gestaltet werden müssten. Das heißt aber auch, dass jedes Kind, jeder Mensch sich seine subjektive Welt konstruiert, niemand von uns kann die Realität der Welt als solche unabhängig von Erfahrungen erkennen. Aus diesem Grund ist die Kommunikation über die Welt, also das gegenseitige Erklären, das Sich-Austauschen, das Erzählen von Geschichten, das Narrativ über eine Familie oder mich selbst, die zentrale, das Selbst konstituierende Kraft.
Die Bedeutung der Emotion
In der Beobachtung von sich entwickelnden Kindern ist das Phänomen der unglaublichen Lernenergie und Unermüdlichkeit regelmäßig zu beobachten, ebenso die gewaltige Fehlertoleranz. Fehler gehören von Anfang an dazu, das gilt übrigens auch für die Eltern – fehlerlose Eltern wären nicht auszuhalten –, und das Gelingen ist dann die Belohnung für die lange Lernzeit und das Durchhalten. Mit dieser Belohnung ist jedes Mal auch eine Stärkung der betroffenen Netzwerke verbunden, mit dem Scheitern ihre, zumindest teilweise, Erneuerung. Mittels positiver oder negativer Verstärkung ergänzt ein weiterer Hirnbereich die multisensorische und kognitive Wahrnehmung: der Gefühlsbereich. Jede Information, die in den Körper und ins Gehirn kommt, wird emotional gefärbt. Man kann sich das bildhaft vergegenwärtigen, indem man sich vorstellt, dass knapp nach Informationsaufnahme im Gehirn das limbische System die Informationen wie eine Malerin anfärbt oder wie ein Postmitarbeiter einen Stempel darauf drückt und sie dann in die Speicher weiterschickt. Damit sind nun nicht nur die sensorischen und kognitiven Informationen im Gehirn vermerkt, sondern auch die emotionale Bedeutung, die damit verbunden war. Unsere Netzwerkkarten enthalten also die Informationen aus den sensorischen Wahrnehmungsorganen wie Augen, Ohren, Haut etc. sowie jene aus den verschiedenen Körperregionen und Organen, die mit der Informationsaufnahme verbunden waren, wie auch die Reaktion des Gesamtorganismus. Nehmen wir als Beispiel einen Weihnachtsbaum. Erste, damit verbundene Eindrücke sind wahrscheinlich der Duft zu Weihnachten und auch damit verbundene Gefühle wie Wärme oder Geborgenheit. Dann folgt durch einen Besuch im Wald das Bild vieler Nadelbäume, Schnee auf den Ästen, Berührungen, später kommen vielleicht auch Arbeiten mit einem Baum hinzu oder das Feuermachen aus trockenen Ästen. Aus all diesen Einzelerinnerungen, die im Gehirn an unterschiedlichen Plätzen gespeichert werden, entsteht ein Netzwerk an Informationen. Mit dem Erwerb der Sprache wird ein Begriff an dieses Netzwerk geknüpft, sodass der Mensch sich jedes Mal bei Erwähnung des Wortes »Weihnachtsbaum« die erwähnten Erinnerungen herbeiholen und mit ihnen arbeiten kann. Gleichzeitig ermöglicht diese Wahrnehmungs- und Erinnerungsstruktur eine rasche und komplexitätsreduzierte Kommunikation. Erinnerung hat dabei viele Facetten und – wenn man gelernt hat, diese zu nutzen – viele verschiedene Quellen: das kognitive Gedächtnis, das Körpergedächtnis, das emotionale und das episodische Gedächtnis sowie noch einige mehr. Leider kann sich das manchmal auch ungünstig auswirken, wie wir beim Schmerzgedächtnis oder beim Traumagedächtnis beobachten können.
Um zu verstehen, welchen Einfluss Gefühle auf unsere Entwicklung haben, braucht es zunächst eine Begriffsdefinition. Diese ist in Wissenschaft und Forschung nicht eindeutig, ich beziehe mich auf jene aus dem Buch Emotionsbezogene Psychotherapie des Psychiaters und Psychotherapeuten Claas-Hinrich Lammers.3 Eine Emotion ist demnach ein kurzes, von einem Stimulus abhängiges Erleben von Reizen, also Wahrnehmungen aus Körper und Sinnen, das begleitet ist von Motivation, Ausdruck und Kognition. Das heißt, eine Emotion setzt sich aus einem körperlichen Geschehen - einer bestimmten hormonellen Konstellation und sensorischen Informationen, einem typischen Verhalten (z. B. einem Gesichtsausdruck), einer gedanklichen Beteiligung (»Ich freue mich«) und einer Motivation (Worüber freue ich mich, was bringt es mir?) zusammen. Hinzu kommt eine subjektiv empfundene Komponente, die man dann als Gefühl bezeichnet. Emotionen dienen dazu, unsere Grundbedürfnisse, also die sogenannten basalen Bedürfnisse jedes Lebewesens (Nahrung, Fortpflanzung und körperliche Unversehrtheit), zu befriedigen. Sie fungieren als eine Art Schaltkreis für die hereinkommenden Informationen: Sie geben eine rasche Bewertung als Reaktion auf einen (bewussten oder unbewussten) Reiz in Bezug auf unsere Bedürfnisse; sie bewirken eine Anpassung des Organismus an die jeweilige Situation (z. B. Herzfrequenzänderung bei Freude oder Stress) und, was vor allem für die Kommunikation und Interaktion ganz wichtig ist, sie steuern unseren Ausdruck. Aus dem Zusammenspiel der Emotionen, der subjektiven Wahrnehmung/Gefühle und der dazugehörigen Kognition und Reaktionen entsteht die emotionale Intelligenz. Diese ist notwendig, um den Ausdruck anderer Menschen oder die Bedrohlichkeit einer Situation erfassen und eine angemessene Reaktion finden zu können. Die emotionale Intelligenz ist auch selbst an der Regulation unserer Emotionen beteiligt. Gerade in Krisenzeiten ist es enorm wichtig, sich dieser Mechanismen bewusst zu werden und damit zu arbeiten. Denn Emotionen und Gefühle sind Teil der Resonanz und des Gefühls der Entfremdung, die für Krisenzeiten recht typisch sind.
Emotionen lassen sich überdies in Basisemotionen und komplexe Emotionen unterscheiden. Zu den Basisemotionen zählen Freude, Überraschung, Trauer, Zorn, Angst, Ekel und Verachtung. Gerade in Krisenzeiten sind diese letztgenannten Emotionen hochaktiv. Komplexe Emotionen sind zusammengesetzt aus den basalen Emotionen, den Erfahrungen und den kognitiven Prozessen. Sie entstehen in den vielen verschiedenen Begegnungen, die ein Mensch hat, und den damit verbundenen Erinnerungen. Sie bewerten Situationen und werden daher als reflexive und/oder moralische Emotionen bezeichnet. So können negative oder traumatische Erfahrungen unsere komplexen Emotionen dramatisch verändern und zu massiven Trauerreaktionen, Rückzug oder Depression führen. Die komplexen Emotionen dienen im Wesentlichen dazu, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zur Familie oder zu Bindungspartner:innen zu gestalten.
Fassen wir das bisher Behandelte kurz zusammen: Der Mensch mit seiner genetischen Grundausstattung erwirbt respektive konstruiert mithilfe seiner multimodalen Wahrnehmung und der Verarbeitung dieser Informationen ein Bild der Welt und ein Bild von sich selbst, das insbesondere durch die Beziehungen zu den nahen Angehörigen geprägt wird. Stark davon beeinflusst werden auch die Entwicklung der menschlichen Beziehungsfähigkeit und die damit eng verbundene Fähigkeit, sich selbst zu mögen und sich versorgen zu lernen (Selbstentwicklung und Selbssteuerung). Für das Verständnis von persönlichen Krisen, deren Bewältigung und ganz allgemein der Reaktion darauf ist dies wiederum von zentraler Bedeutung.
Aus dem Zusammenspiel von Interaktion, Emotion, Bewertung und Verhalten sowie dem dazugehörigen Feedback entwickeln sich Muster, die für bestimmte Interaktionen typisch sind. Aus diesen typischen Mustern entsteht mit der Zeit eine Rolle, wie der Psychiater und Soziologe Jakob Levy Moreno das bezeichnet hat.4 Er definiert sie als eine (Re-)Aktionsform im Hier und Jetzt, die auf die spezifische Situation mit situationsadäquatem Verhalten reagiert und die Summe aus Emotion, kognitiver Bewertung, Antizipation und motorischer Durchführung bildet. Es gibt demnach verschiedene Rollen: körperliche, psychische, psychosomatische und soziale. Ein Beispiel für eine körperliche Rolle ist etwa der Esser – diese Rolle wenden wir dann an, wenn das Setting dazu gegeben ist, also am Esstisch zu Hause, am Würstelstand oder im Restaurant. Die psychischen Rollen sind jene, die seelische Zustände widerspiegeln: die Traurige, der Wütende etc. Die psychosomatischen Rollen sind all jene, die körperliche und seelische Phänomene verbinden, wie zum Beispiel im Fall von Kopfschmerzen. Soziale Rollen wiederum werden durch die Gesellschaft definiert, also Sohn, Lehrerin, Kindergartenpädagoge und so weiter. Eine Rolle benötigt einen »Rollenspieler« und eine Umgebung, in der sie auf Resonanz stößt und die auch bestimmte Erwartungen an ihre verschiedenen Formen hat. Aus der Summe dieser Rollen und des Rollenrepertoires jedes einzelnen Menschen ergibt sich dessen Persönlichkeit.
Die frühkindliche Entwicklung
Wie entwickelt sich nun das Selbst, vor allem ein selbstfürsorgliches Selbst, das auf Krisen vorbereitet und für Fehler gewappnet ist, das nach Lösungen sucht und sich kreativ und spontan in die Welt einbringt? Die wichtigste Schule diesbezüglich ist die Beziehung zu den Eltern.
Die Eltern-Kind-Beziehung nimmt ihren Anfang bereits lange vor der Geburt. Die meisten Eltern haben bereits vor der Geburt ihres Nachwuchses ein »Kind im Kopf«, also eine vorausschauende Vorstellung von ihrem zukünftigen Kind und ihrem Elternsein. Die Elternschaft entsteht demnach nicht erst ab dem Moment der einsetzenden Schwangerschaft, sie entsteht in Ansätzen schon im Kleinkindalter bei den Mutter-Vater-Kind-Spielen, entwickelt sich lebenslang und durchläuft verschiedene Phasen (Stages of Parenthood).5 Das »Kind im Kopf« wird ebenso wie unsere Entwicklung aus den Erfahrungen des Lebens, vor allem der Kindheit und der Beziehungserfahrungen mit unseren Eltern, gespeist. So haben die meisten Eltern schon während der Schwangerschaft sehr konkrete Vorstellungen von ihrem Kind – spätestens nach der ersten Ultraschalluntersuchung. Wenn das neugeborene Kind gut mit dieser Vorstellung zusammenpasst – Remo H. Largo spricht dann von einem Fit, einer Passung6 –, sind Tür und Tor offen für eine gute Eltern-Kind-Beziehung. Ist das aber nicht der Fall, passen die Erwartung und das Kind also gar nicht zusammen, Largo nennt das einen Misfit, eine Nicht- oder nur Teilpassung, dann bedarf es eines mehr oder weniger schwierigen Anpassungsprozesses der Eltern an das reale Kind. Ein solcher Misfit kann zum Beispiel auftreten, wenn das Kind schwer krank ist oder eine vorübergehende oder dauerhafte Beeinträchtigung festgestellt wird. Hier würde diese Familie aufgrund des Misfits bereits die erste, manchmal sehr schwerwiegende Krise durchmachen. Ich erinnere mich an eine Familie, die ein Kind mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte bekommen hatte. Die Mutter hatte unmittelbar nach der Geburt einen psychischen Schock und lehnte ihr Kind ab, sie meinte, das sei nicht ihr Kind, man habe es ihr untergeschoben. Es bedurfte einerseits der medizinischen Korrektur der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, aber vor allem einer längeren psychologischen Begleitung der Mutter und des Kindes, um eine zufriedenstellende Mutter-Kind-Beziehung zu erreichen.
Manchmal ist eine solche Neugeborenen-Krise auch die Folge von medizinischen oder psychischen Krisen der Mutter oder des Kindes während der Schwangerschaft. Häufig geht es aber auch um unbedeutend scheinende Faktoren wie die Tatsache, dass das Geschlecht des Kindes nicht mit dem erwünschten übereinstimmt, dass die Haarfarbe nicht den Vorstellungen entspricht und andere, kleinere Misfits. Diese können aus der Sicht der Eltern sehr wichtig sein und die bedingungslose Annahme des und Liebe zum Neugeborenen deutlich schmälern und so den Beginn und Ausgangspunkt der Eltern-Kind-Beziehung nachhaltig beeinträchtigen.
Kehren wir zur kindlichen Entwicklung zurück: Das Neugeborene wird in der Versorgung durch seine Eltern aufgefangen, seine Grundbedürfnisse nach Nahrung, Schlaf und Geborgenheit werden gestillt. Auch hier entstehen nun – allerdings in anderen Hirnarealen – ebenfalls Netzwerkkarten, diesmal solche, die die Beziehung betreffen. Manche Autor:innen bezeichnen dieses Netzwerk als das inner working modell, die Repräsentanz der Summe aller Beziehungserfahrungen mit den Eltern beziehungsweise den Hauptbezugspersonen. Auch hier wird die Basis durch sensomotorische und multimodale Informationen gebildet: Wie die sanfte Hand der Mutter das Kind streichelt oder wiegt und beruhigt, das Sättigungsgefühl nach einem Fläschchen, das lebendige und bewegte Getragenwerden auf dem Arm des Vaters, die Stimmmodulationen der Eltern und viele mehr. Wichtige Erfahrungen sind hier die bedingungslose Annahme und eine bedürfnisorientierte Versorgung, die Entwicklung von Tages- und Beziehungsstrukturen parallel zu den physiologisch sich entwickelnden und heranreifenden Wach- und Schlafphasen. Das Resultat dieser Phase ist wieder ein Netzwerk, ein inneres Gefühl der Sicherheit, des Vertrauens in die Eltern. Der Psychoanalytiker Erik Erikson beschreibt die Entstehung des Urvertrauens als den wichtigsten Entwicklungsschritt in dieser Zeit.7 Teil dieser Entwicklung ist die Spiegelung des Babys im Ausdruck der Eltern, das Mitschwingen mit den Rhythmen des Säuglings, die Verlässlichkeit der Versorgung und das Ermöglichen von spontanen, offenen Lernräumen.
Zusammenfassend zeigt das Grundgerüst der menschlichen Entwicklung den Menschen als ein aktiv lernendes Wesen, das im Rahmen der angeborenen Möglichkeiten für sich ein Bild von der Welt entwickelt. Über den Austausch mit seiner Umwelt wird dieses Bild weiter geformt. Alle Erfahrungen werden in Netzwerken im Gehirn gespeichert und bei jeder neuen Wahrnehmung genutzt und verändert – wir bezeichnen diese Fähigkeit als Plastizität des Gehirns. Die sich ständig erweiternden Erfahrungen sind Grundlage und Hintergrund des jeweils gezeigten Verhaltens und der Persönlichkeit, also der Gesamtheit der individuellen Eigenschaften eines Menschen, die ihn zeitlich stabil und in verschiedenen Kontexten auszeichnen und von anderen unterscheidbar machen. Laut dem aktuellen Stand der Forschung ist die Entwicklung der Persönlichkeit demnach von Anfang an die Folge einer interaktionalen Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Wichtige Prozesse dieser Wechselwirkung sind der ständig wechselnde Zustand von Fit und Misfit, oder Passung und Nicht-Passung, wobei Letztere für die Entwicklung zumeist wichtiger, weil herausfordernder, ist (siehe dazu auch das Kapitel Krise und Schöpferischer Prozess).
Das Selbstkonzept
Ein wichtiger Teil der Entwicklung der Persönlichkeit ist die Entwicklung eines Selbstkonzepts, das sich zusammensetzt aus der Summe der Erfahrungen, der kognitiven Prozesse und dem Wissen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens über sich selbst entwickelt. Der Säuglingsforscher, Psychologe und Psychoanalytiker Daniel Stern hat ein Modell der Selbstentwicklung beschrieben, das vom Körper ausgeht, die Beziehungen zur Welt inkludiert und eine stufenweise Entwicklung beschreibt.8 Stern nimmt dabei an, dass es bereits ein Selbst gibt, lange bevor sich ein Selbstbewusstsein oder ein Selbstkonzept bilden. Am Anfang des Lebens, also in den ersten Monaten nach der Geburt, steht demnach das »auftauchende Selbst«. Ich war als Kinderarzt einige Jahre in der Geburtenabteilung eines Krankenhauses für die Gesundenuntersuchung der Neugeborenen zuständig. Beobachtet und vergleicht man diese Babys, stellt man fest, wie unterschiedlich die Verhaltens- und Kommunikationsweisen bereits in diesem Alter sind. Man hat es schon da offensichtlich mit sehr ausgeprägten Persönlichkeiten zu tun. Daher ist das Konzept des auftauchenden Selbst so gut nachvollziehbar: Es integriert alle sinnlichen Erfahrungen mit dem eigenen Körper und dessen Interaktion mit der Umwelt, weswegen die Art und Weise, wie Eltern mit ihren Babys umgehen, sich entsprechend auswirkt – im Positiven wie im Negativen.
Die nächste Entwicklungsstufe nennt Stern das »Kernselbst«, das um den siebten bis zehnten Monat entsteht und sich dann ein Leben lang weiterentwickelt. Das Kernselbst ist die Summe aller körperlichen, motorischen, sensorischen und emotionalen Erfahrungen, die in Summe die eigenen Grenzen und die Abgegrenztheit zur Welt beinhalten. Ab dem fünfzehnten Lebensmonat beginnt sich das »subjektive Selbst« zu entwickeln, das heißt, hier wird zunehmend bewusst wahrgenommen und die Erfahrungen und Erlebnisse in das erste Gesamtkonzept eines Ich eingebaut. Ein berühmtes Beispiel für den Nachweis der Entwicklung des subjektiven Selbst ist der Spiegel- oder Rouge-Test: Wenn man einem Kind einen roten Punkt auf die Stirn klebt und es dann vor einen Spiegel stellt, wird es erst ab circa zwei Jahren diesen Punkt als auf der eigenen Stirn befindlich erkennen und somit sich selbst als Subjekt bewusst wahrnehmen. Mit zunehmender Sprachentwicklung kommen dann auch die verbalen Benennungen, Attribute und Ausdrucksweisen hinzu, die in der sprachlichen Auseinandersetzung mit der Umwelt helfen, das Ich zu entwickeln und zu lernen, es abzugrenzen. Einen ersten Ausdruck dieses »verbalen Selbst« findet man in der Trotzphase, die eine ausgeprägte erste Manifestation des Willens darstellt. Sie macht die Ausprägung des kindlichen Ichs manches Mal sehr fordernd erlebbar. Im »erzählenden Selbst«, das sich ab dem dritten bis vierten Lebensjahr ausformt, beginnt das Individuum sein Selbst im Sinne einer Erzählung über sich selbst zu entwickeln. Es geht nun im Wesentlichen darum, dem eigenen Dasein einen Sinn zu geben und die eigene Verortung in der Welt in das Selbstbild zu integrieren. Es entsteht ein sogenanntes Narrativ, die Transaktionsanalytik bezeichnet dieses Selbst-Narrativ als »Skript«, wie bei einem Drehbuch. Wir sind also gewissermaßen unsere eigenen Drehbuchschreiber:innen, was wiederum gut zu den Theorien der Konstruktivist:innen passt, die davon ausgehen, dass wir uns unsere Welt selbst konstruieren. Es soll daher schon hier festgehalten werden (Näheres dazu im Kapitel Die Resilienz), dass dieses Skript oder Narrativ auch verändert werden kann – das ist nicht leicht, aber es geht!
Zur Entwicklung des Selbst gehört auch noch die Entwicklung der Identität, die die soziale Wahrnehmung einer einzelnen Person als kontinuierlich und einzigartig umfasst. Identität entsteht aus dem Zusammenspiel der Selbstwahrnehmung und der Aufnahme und Rückmeldung durch andere, dem Fremdvergleich.
Der Soziologe Hartmut Rosa hat sich in seinem Buch Resonanz sehr tiefgründig mit der Beziehung des oder der Einzelnen zur Welt auseinandergesetzt und sich mit den Phänomenen der Welterfahrung und der Weltaneignung beschäftigt.9 Resonanz (lat. resonare für widerhallen oder ertönen) beschreibt im Wesentlichen eine Beziehung zwischen schwingenden Körpern wie zum Beispiel zwei Stimmgabeln – hier aber auch zwischen zwei oder mehreren Menschen. Rosa stellt sich die Fragen, wie ein Mensch die Welt erfährt und wie er sie für sich nutzen kann, welche Prozesse dabei ablaufen und welchen Phänomenen man dabei begegnet. Im Zentrum seiner Betrachtungen stehen zwei Begriffe: die Resonanz und die Entfremdung. Rosa postuliert, dass sich bei dem Prozess der Resonanz nicht nur neurophysiologische Phänomene ereignen, wie wir sie bereits bei der Emotionsentwicklung gesehen haben. Er meint auch, dass zwischen den verschiedenen Hirnarealen und dem aus diesem hervorgebrachten System, dem »Geist«, Resonanz entsteht. Man könnte das eine »innere Resonanz« nennen. Daraus entwickelt sich dann die Resonanz mit dem Gegenüber oder die Resonanz mit der Welt – es geht dabei um die Beschreibung von Beziehungsqualitäten, zum Beispiel der Beziehung zur Welt, zu einer anderen Person oder zur Familie. Wie der Philosoph Martin Buber dies schon sehr früh formuliert hat: »Am Du werden wir erst zum Ich.«10 Rosa unterscheidet Resonanz außerdem in Bezug auf Synchronizität und Responsivität. Letztere kann man verstehen, wenn zwei Körper jeweils auf die Schwingung des anderen reagieren, Synchronresonanz dagegen meint das gleichmäßige Schwingen zweier Körper. Beide Vorgänge sind entwicklungspsychologisch betrachtet grundlegende Voraussetzungen für eine Begegnung zwischen Menschen, insbesondere in der Eltern-Kind-Beziehung. Rosas Resonanzbegriff meint also eine Antwortbeziehung, die gegenseitige Reaktion auf das Schwingen des einzelnen. Resonanzerfahrungen zwischen Menschen oder zwischen einer Person und der Welt können nur dann entstehen, wenn die kognitiven und evaluativen Netzwerke mit unserem Handeln und Sein übereinstimmen. Das bedeutet, dass Resonanz eine emotionale Form der Weltbeziehung ist, also ein Beziehungsmodus, der voraussetzt, dass beide Seiten mit eigener Stimme sprechen und die Individuen ausreichend konsistent und offen genug sind, um sich erreichen zulassen. Das können Beziehungen in der Familie sein, auch zu Freund:innen oder Kolleg:innen. Wenn Resonanz sich einstellt, entsteht ein Gefühl des Angenommenseins, des Gesehenwerdens, kurz der wahren Begegnung. Das Resonanzgefühl ist somit auch ein Gefühl der Geborgenheit in der Welt.
Bei einem Baby oder Kleinkind stellt die Haut einen wichtigen Teil der Resonanzbeziehung dar, das ungeborene Kind lebt durch sie bereits in der Gebärmutter in einer vorgeburtlichen Resonanzbeziehung mit seiner Mutter. Fragen Sie Mütter über ihre Verbindung zu ihrem ungeborenen Kind, werden Sie – im wahrsten Sinne des Wortes – berührende Beziehungsantworten bekommen. Das Kind wird bereits als Persönlichkeit erlebt, es boxt, tritt oder hat Schluckauf, die Herzfrequenz wird wahrgenommen, und all diese Äußerungen werden von der Mutter interpretiert. Umgekehrt erleben auch viele Mütter, wie sehr ihr Baby auf ihre Lebensweise reagiert und sich darüber ebenfalls Beziehung herstellt. Nach der Geburt ist diese Beziehung kurzfristig abrupt unterbrochen und kann durch die Berührung durch die Mutter wiederhergestellt werden. Es müssen sich also beide Seiten neu auf diese Resonanzbeziehung einstellen.
Versuchen Sie, sich kurz eigene Resonanzerfahrungen zu vergegenwärtigen, sich also eine Situation in Erinnerung zu rufen, in der Sie mit einem Menschen, der Natur, einem Kunstobjekt oder einem Musikstück ein Gefühl des Schwingens hatten, das auch beantwortet wurde. Wahrscheinlich war das dann das, was Hartmut Rosa als Resonanz beschreibt. Sie können Ihre Resonanz mit der Welt auch daran ermessen, wie sehr Sie sich aufgehoben fühlen in der momentanen familiären, politischen oder gesellschaftlichen Situation. Ob Sie also Teil einer Gruppe sind, die gleiche Werte hat, und dies für Sie eine Art gesellschaftliche Geborgenheit bietet, oder ob die momentane Situation der Welt Sie eher zur Entfremdung einlädt.
Entfremdung ist der Gegenspieler der Resonanz, die das Individuum in Abstand zu seinen Nächsten oder der ihn umgebenden Welt bringt, bei der sich die Gegenüber indifferent oder gar feindlich gegenüberstehen. Entfremdung ist also ein Zustand, in dem die Weltaneignung misslingt, die Welt wird dann als kalt, abweisend und starr erlebt. Rosa beschreibt als Folge davon die Depression als einen Zustand, in welchem alle Resonanzen taub und stumm geworden sind. Das Subjekt lässt sich nicht mehr »berühren«.
Erik Erikson konnte Rosas Konzepte der Resonanz und Entfremdung aufgrund seines Alters noch nicht kennen, aber seine Beschreibung der Identitätsentwicklung hat viel mit Passung und Resonanz versus Nicht-Passung und Entfremdung zu tun. Er beschreibt verschiedene, dem jeweiligen Alter entsprechende Entwicklungsabschnitte als Soll-Krisen der Identitätsentwicklung, die man heute als Entwicklungsaufgaben bezeichnen würde. Seine Hypothese besagt, dass sich bei deren Bewältigung ein bestimmtes basales Gefühl, man könnte auch sagen ein Lebensgefühl, als Grundaffekt konstituiert und bestehen bleibt. Bei Nichtgelingen oder Nicht-Passung der neuen Situation macht sich ein negativer Grundaffekt breit. Als Beispiel eines positiven Grundaffektes habe ich bereits das Urvertrauen genannt. Der negative Gegenaffekt dazu ist das Misstrauen gegenüber dem Leben, also eine Form der Entfremdung im Sinne Rosas. Das Urvertrauen ist wohl die Grundresonanz unserer Existenz. Sie können Ihres jederzeit überprüfen, indem Sie beobachten, ob Sie sich zum Beispiel beim Busfahren, als Beifahrer im Auto oder Flugzeugpassagier wohlfühlen oder ob Sie Angst haben, also der Situation misstrauen. Die Phasen der Identitätsentwicklung lassen sich auch als Entwicklungskrisen interpretieren.
Die acht Stufen der Identitätsentwicklung nach Erikson können wie folgt zusammengefasst werden:
Die acht Stufen der Identitätsentwicklung nach Erik Erikson
Genetik, die Rolle der Eltern und der Umwelt
Wenden wir uns nun den Einflüssen auf die Dynamik der Entwicklung über die Zeit zu. Es stellt sich im allgemeinen Diskurs ja oft die Frage, ob die Entwicklung vorgegeben ist und entsprechend einem inneren genetischen Programm abläuft oder es Erziehung und Umwelt sind, die den wesentlicheren Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes haben. Für beide Positionen gab es in der Vergangenheit schlüssige Konzepte und auch wissenschaftliche Belege. Es gab heftige fachliche Auseinandersetzungen, nature versus nurture, also Natur oder Anlage versus Erziehung oder Umwelt, waren die beiden Extrempositionen. Durch die immer besser und komplexer werdenden Forschungsmöglichkeiten, das Aufkommen neuer Beobachtungsmethoden und zahlreiche Langzeitstudien hat sich in den letzten Jahrzehnten die Auffassung durchgesetzt, dass die Entwicklung aller Lebewesen, besonders aber die des Menschen, ein äußerst komplexes und dynamisches Geschehen ist und dass einfache Erklärungen hier nicht greifen. Es ist – wenn man so will – ein systemisches Geschehen. Ein Individuum in einer bestimmten Umgebung interagiert mit dieser, und bei jeder Interaktion verändern sich alle Interaktionspartner. Das heißt, bei jeder Interaktion zwischen Kind und Umwelt verändern sich auch die Netzwerkkarten, und die Entwicklung schreitet voran. Je emotionaler und intensiver die Interaktion ist, umso wirksamer die Veränderungen auf der neuronalen Ebene.
Sie haben sicher schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Sie sich mit Menschen, mit denen Sie sich auf eine gemeinsame, konzentrierte Tätigkeit einlassen, sei es spielend oder arbeitend, verbundener fühlen, vielleicht sogar vertrauter. Gleichzeitig ist der Lernfaktor in diesen Situationen um ein Vielfaches höher, das heißt, gemeinsam etwas zu entwickeln bringt mehr, als allein zu lernen. Diese Erkenntnis hat bereits zu weitreichend veränderten Lehr- und Schulkonzepten geführt, sich aber leider noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Doch was genau passiert, wenn Menschen so fokussiert und konzentriert miteinander sind?













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)