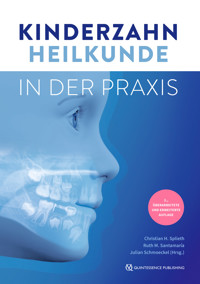
Kinderzahnheilkunde in der Praxis E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Quintessence Publishing
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Kinderzahnheilkunde hat sich seit der Erstauflage dieses Buches vor knapp 20 Jahren zu einem etablierten und innovativen Fach entwickelt, das viele spannende neue Ansätze bietet. Hervorzuheben ist hierbei die Veränderung im Verständnis von Karies, das wirksame Möglichkeiten für eine Kariesinaktivierung oder die Restauration von Zähnen "ohne Bohren" ermöglicht. Außerdem stehen heute vielfältige Methoden für das Verhaltensmanagement bei Kindern und der Einsatz der Lachgassedierung zur Verfügung, die eine Behandlung ebenfalls erleichtern. Die Neuauflage des Buches folgt einem modernen, evidenzbasierten, partizipativen und auf Prävention, Diagnostik und Frühbehandlung ausgerichteten Gesamtkonzept für die Kinderzahnheilkunde. Dieses ist im Kontext von Grunderkrankungen, Dysgnathien und Funktion sowie der Betreuungssituation einschließlich dem Erkennen von Entwicklungsstörungen und Kindesmisshandlung eingeordnet. Praktische Beispiele, Abbildungen und Fälle, Ablaufdiagramme, Abrechnungshinweise sowie Checklisten erleichtern die Umsetzung im Praxisalltag. Viele Themen und Techniken werden mit zusätzlichen Videosequenzen, die über QR-Codes abgerufen werden können, verdeutlicht. Das Lehrbuch richtet sich an Zahnärztinnen und Zahnärzte, an Prophylaxeteams sowie Studierende und möchte mit seinem umfassenden Überblick die zahnärztliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen unterstützen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KINDERZAHN
HEILKUNDE
IN DER PRAXIS
Ein Buch – ein Baum: Für jedes verkaufte Buch pflanzt Quintessenz gemeinsam mit der Organisation „One Tree Planted“ einen Baum, um damit die weltweite Wiederaufforstung zu unterstützen (https://onetreeplanted.org/).
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://dnb.ddb.de> abrufbar.
Postfach 42 04 52; D–12064 Berlin
Ifenpfad 2–4, D–12107 Berlin
© 2024 Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Lektorat, Herstellung und Reproduktionen:
Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-86867-693-8
Vorwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
durch den Erfolg der ersten Auflage des Buchs „Kinderzahnheilkunde in der Praxis“ war jetzt eine Neuauflage notwendig. Das Konzept eines praktischen Leitfadens für die zahnärztliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen haben wir beibehalten, aber neue Aspekte, wie die Einigung mit den Pädiatern auf eine evidenzbasiertere Fluoridempfehlung für Kleinkinder, die Einführung von Präventionsleistungen vom ersten Zahn an im kassenzahnärztlichen System, die Entwicklung neuer minimalinvasiver Kariestherapieoptionen, der erhebliche Wissenszuwachs bei Epidemiologie und Therapie der Molaren-Inizisiven-Hypomineralisation (MIH) sowie in der Traumatologie wurden systematisch eingearbeitet.
Kinder sind immer noch eine wichtige und relevante Patientengruppe in der Zahnarztpraxis und, wenn sie nicht adäquat betreut werden können, sucht die ganze Familie oft über kurz oder lang eine andere Praxis auf.
Trotz aller Verbesserungen in der Kariesprävention ist der Kariesrückgang im Milchgebiss nicht befriedigend. Viele Kinder haben daher immer noch ihren ersten zahnärztlichen Kontakt nach einer wegen Zahnschmerzen schlaflosen Nacht. Die erste Behandlung bestand leider oft in der Trepanation eines Milchzahnes und der Wiedereinbestellung für die Extraktion. Moderne Kinder- und Jugendzahnheilkunde kann auch in der Familienzahnarztpraxis mehr leisten. Gerade das Kariesmanagement hat sich deutlich weiterentwickelt und es umfasst jetzt Prävention und Therapie als ganzheitlichen Ansatz. Eine umfassende Betreuung beinhaltet Prävention, Früherkennung und -therapie von oralen Erkrankungen, um ein gesundes und funktionstüchtiges orales System für das Erwachsenenalter zu erzielen.
Kinder und Jugendliche sind aber keine kleinen Erwachsenen und das Patientenrechtegesetz sowie das Rollenbild Patienten-Zahnärzte haben sich stark gewandelt, was besondere veränderte Kommunikationsmechanismen erfordert. Aufgrund der anhaltenden Entwicklung des oralen Systems, dem temporären Charakters des Milchgebisses und der nicht immer ausreichenden Aufmerksamkeitsspanne bzw. Kooperation durch das Kind hat die Kinderzahnheilkunde inzwischen viele eigenständige, zahnärztliche Maßnahmen evidenzbasiert entwickelt, die sich klar von der Erwachsenenbehandlung unterscheiden. Das vorliegende Buch versucht, alle relevanten Fachbereiche der Zahnmedizin bei Kindern abzudecken. Trotzdem ist es bei einem Querschnittsfach wie der Kinderzahnheilkunde nicht möglich, auf alle Aspekte in einem einzigen Lehrbuch detailliert einzugehen. Ziel dieses Buches ist es, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Prophylaxefachkräfte und Studierende bei ihrer alltäglichen Arbeit in der Kinderbehandlung zu unterstützen. Auch für die Spezialisierung z. B. in einem Masterstudiengang Kinderzahnheilkunde eignen sich die vorgeschlagenen Konzepte. Nach einer Beschreibung der anatomischen und psychischen Entwicklungsprozesse werden die wesentlichen oralen Erkrankungen, ihre Risikofaktoren und Möglichkeiten der Prävention bzw. Therapie dargestellt. Dies umfasst vor allem Karies und pulpale Folgen, MIH, Dysgnathien, Parodontopathien, Traumata, aber auch prothetische Versorgungen sowie das Erkennen von Entwicklungsstörungen und Kindesmisshandlung. Die verbal sehr schwierig zu vermittelnden Techniken wie z. B. die Verhaltensformung werden mit Videosequenzen verdeutlicht, wobei aus technischen Gründen im Umgang mit den Kindern keine „Spielfilmqualität“ erreicht werden konnte.
Nicht alle Zahnärztinnen und Zahnärzte müssen alle Behandlungsmaßnahmen bei Kindern durchführen können, aber es sollten alle relevanten Diagnosen gestellt werden können, eigene Grenzen erkannt und ggf. eine rechtzeitige Überweisung vorgenommen werden. Die Behandlungen durch die jeweiligen Spezialisten werden in Kapitel 4 in Grundzügen skizziert, um dem überweisenden Hauszahnarzt einen Überblick über die zu erwartende Behandlung zu geben.
Für die sehr kollegiale Zusammenarbeit bei der Erstellung der einzelnen Beiträge möchte ich mich bei allen Fachkollegen aus Praxis und Universität und den neuen Mitherausgebern PD Dr. R. Santamaria und PD Dr. J. Schmoeckel ganz herzlich bedanken.
Ganz besonders möchte ich meiner Frau Kathleen Splieth für die hilfreiche zweite Meinung, das Korrekturlesen und die familiäre Unterstützung während der Realisierung dieses Buches danken. Gleiches gilt für die Herstellung des Buches durch Frau Petra Jentschke. Weiterhin schulde ich meinen Kindern Johanna und Helene sowie vielen meiner Patientinnen und Patienten Dank und Anerkennung für ihre geduldige Mitarbeit bei der Fotodokumentation.
Abschließend möchte ich im Namen des gesamten Autorenteams allen Leserinnen und Lesern eine erfolgreiche Umsetzung in der Alltagsarbeit der zahnärztlichen Praxis und damit verbunden eine hohe langfristige orale Lebensqualität für die Kinder wünschen.
Christian Splieth
Inhalt
Vorwort
Inhalt
Herausgeber / Autoren
1 Wachstum und Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen
1.1 Körperliche Entwicklung
1.1.1 Wachstumsphasen
1.1.2 Steuerung des Wachstums und Wachstumsstörungen
1.1.3 Erscheinungsformen des Wachstums
1.1.4 Schädelwachstum und -formung
1.1.5 Wachstum des Gesichtsschädels
1.1.6 Wachstum des Unterkiefers
1.1.7 Wachstum des Hirnschädels
1.2 Säugling (Geburt bis 1 Jahr)
1.2.1 Orale Entwicklung
1.2.2 Verhalten und psychische Entwicklung
1.3 Kleinkind (1–3 Jahre)
1.3.1 Orale Entwicklung
1.3.2 Verhalten und psychische Entwicklung
1.4 Kindergartenkind (3–6 Jahre)
1.4.1 Orale Entwicklung
1.4.2 Verhalten und psychische Entwicklung
1.5 Schulkind (6–12 Jahre)
1.5.1 Orale Entwicklung
1.5.2 Verhalten und psychische Entwicklung
1.6 Jugendliche (12–18 Jahre)
1.6.1 Orale Entwicklung
1.6.2 Verhalten und psychische Entwicklung
2 Von der Anamnese zur Behandlungsplanung
2.1 Anamnese
2.2 Zahnärztliche Untersuchung
2.2.1 Extraorale Untersuchung
2.2.2 Mundschleimhaut, Zunge, Gaumen
2.2.3 Zähne
2.2.4 Röntgendiagnostik
2.3 Kindeswohlgefährung / -misshandlung
2.3.1 Karies und Kindeswohl
2.3.2 Kindesmisshandlung
2.3.3 Symptome, Diagnose und Dokumentation von Kindesmisshandlung
2.3.4 Handlungsempfehlungen
2.4 Integrierte Behandlungsplanung
2.5 Aufklärung und Dokumentation
2.5.1 Kinderzahnmedizinische Dokumentation
2.5.2 Verwaltung der Behandlungsunterlagen
2.5.3 Röntgendokumentation
3 Routinebehandlungen beim Kind
3.1 Gewöhnung an den Behandlungsstuhl
3.2 Risikospezifisches Kariesmanagement: Non- und minimalinvasiv
3.2.1 Kariesepidemiologie
3.2.2 Kariesätiologie
3.2.2 Kariesrisiko, Kariesaktivität
3.2.3 Initialläsionen
3.2.4 Präventionspläne
3.2.5 Häusliche Mundhygiene
3.2.6 Ernährung
3.2.7 Fluoride
3.2.8 Chlorhexidin
3.2.9 Professionelle Zahnreinigung
3.2.10 Prophylaxe für Fissuren / Fissurenversiegelung
3.2.11 Durchführung der Fissurenversiegelung
3.2.12 Prophylaxeprogramme
3.3 Lokalanästhesie beim Kind
3.3.1 Anatomische Bedingungen
3.3.2 Instrumentarium
3.3.3 Techniken zur Lokalanästhesie
3.3.4 Arzneimittel zur Lokalanästhesie
3.3.5 Nebenerscheinungen und Komplikationen
3.3.6 Aktuelle Trends in der Kinderzahnheilkunde
3.4 Kofferdam bei Kindern und Alternativen
3.5 Kariesentfernung und nichtrestaurative Therapien
3.5.1 Prinzipien und Optionen zur Behandlung kariöser Läsionen
3.5.2 Kariesentfernung und chemomechanische Kariesentfernung
3.5.3 Nichtrestaurative Kariestherapien
3.6 Restaurative Therapie
3.6.1 Faktoren für die restaurative Therapie
3.6.2 Auswahl des Füllungsmaterials
3.6.4 Matrizensysteme
3.6.5 Beurteilung der Restaurations-materialien für die Milchzähne
3.6.6 Stahlkrone (klassische Technik)
3.6.6 Ästhetische Kronen im Milchgebiss
3.6.7 Evidenz des Erfolgs / Misserfolgs von Füllungsmaterialien
3.7 Lückenhalter und Kinderprothese
3.7.1 Lückenhalter
3.7.2 Kinderprothesen
3.8 Milchzahnendodontie
3.8.1 Therapieziele im Milchgebiss
3.8.2 Besonderheiten der Milchzähne
3.8.3 Diagnostik und Therapieplanung
3.8.4 Direkte / Indirekte Pulpaüberkappung
3.8.5 Vitalamputation (Pulpotomie)
3.8.6 Wurzelkanalbehandlung (Pulpektomie)
3.8.7 Maschinelle Aufbereitung
3.9 Oralchirurgische Verfahren
3.9.1 Extraktion von Milchzähnen
3.9.2 Extraktion von permanenten Zähnen
3.9.3 Entfernung / Freilegung von retinierten Zähnen
3.9.4 Frenuloplastik
3.9.5 Autotransplantation
3.9.6 Nachsorge
3.10 Traumabehandlung
3.10.1 Untersuchung
3.10.2 Verletzungsformen
3.10.3 Kronenfraktur
3.10.4 Kronen-Wurzeltrauma
3.10.5 Wurzelfrakturen
3.10.6 Konkussion und Subluxation
3.10.7 Extrusion / Luxation
3.10.8 Intrusion
3.10.9 Totalluxation
3.10.10 Milchzähne
3.10.11 Bleichen von verfärbten Zähnen
3.11 Kieferorthopädische Aspekte für Kinderzahnärzte
3.11.1 Anamnese
3.11.2 Grundlagen der kieferorthopädischen Diagnostik
3.11.3 Kieferorthopädische Prävention und Therapie
3.12 Basismaßnahmen beim Auftreten eines Notfalles
3.12.1 Kardiopulmonale Reanimation
3.12.2 Aspiration
3.12.3 Asthma bronchiale
3.12.4 Anaphylaxie
3.12.5 Lokalanästhetika-Intoxikation
3.12.6 Krampfanfall
3.12.7 Hypoglykämie
3.12.8 Vasovagale Synkope
3.12.9 Hyperventilation
4 Spezialisierte Behandlungen beim Kind
4.1 Entscheidungsfindung in der spezialisierten Kinderzahnheilkunde
4.2 Das unkooperative Kind
4.2.1 Techniken der Verhaltensführung und hypnotische Kommunikation
4.2.2 Hypnotische Kommunikation
4.3 Sedierung und Intubationsnarkose
4.3.1 Sedierung in der (Kinder)Zahnheilkunde
4.3.2 Intubationsnarkose (ITN)
4.4 Karies, Strukturstörungen, Trauma
4.4.1 Frühkindliche Karies
4.4.2 Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH)
4.4.3 Dentinogenesis imperfecta (DGI)
4.4.4 Komplexe Traumafälle
4.5 Betreuung von chronisch kranken und behinderten Kindern
4.5.1 Anamnese und Untersuchung
4.5.2 Zahnärztliche Betreuung
4.6 Parodontale Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen
4.6.1 Gingivitis
4.6.2 Parodontitis
4.7 Behandlung von Lippen-Kiefer-Gaumen-Segel-Spalten
4.7.1 Interdisziplinäre Betreuungskonzepte
4.7.2 Aufgaben von Kinderzahnärzten
4.7.3 Kieferorthopädische Behandlung
4.8 Prothetik bei Kindern und Jugendlichen
4.8.1 Einzelzahnkronen
4.8.2 Adhäsivbrücken
4.8.3 Implantate
4.8.4 Nachsorge und Übergabe
5 Praxiskonzepte für die Kinderbehandlung
5.1 Familienpraxis
5.2 Spezialisierte Kinderpraxis
Herausgeber
Prof. Dr. Christian H. Splieth
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Priv.-Doz. Dr. Ruth M. Santamaría
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Priv.-Doz. Dr. Julian Schmoeckel
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Autoren
ZÄ Maria Abdin
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Dr. Ahmad Al Masri
Poliklinik für Kiefertorthopädie und
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Dr. Mostafa Alzahar
Poliklinik für Kieferorthopädie
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
ZA Mohamed Baider
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Prof. Dr. Britta Bockholdt
Institut für Rechtsmedizin
Universität Greifswald
Kuhstr. 30, 17489 Greifswald
Prof. Dr. Hansjörg Cremer†
Dittmarstr. 54, 74074 Heilbronn
Prof. Dr. Jochen Fanghänel
Poliklinik für Kieferorthopädie
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
OÄ Dr. med. Cornelia Gibb
Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin
Universitätsmedizin Greifswald
Ferdinand-Sauerbruch-Str.
17475 Greifswald
Prof. Dr. Elmar Hellwig
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie
Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Hugstetter Str. 55, 79106 Freiburg i.Br.
Dr. Ulrike Hintze
Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Krankenhaus Wittmund
Dohuser Weg 10, 26409 Wittmund
ZA Björn-Christian Hübner
Klinik und Poliklinik für
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie/Plastische Operationen
Universität Greifswald
Ferdinand-Sauerbruch-Str.
17475 Greifswald
OA Dr. Lukasz Jablonowski
Poliklinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Endodontologie
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
ZÄ Manasi R. Khole
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Prof. Dr. Karl-Friedrich Krey
Poliklinik für Kieferorthopädie
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Dr. Anne S. Lauenstein-Krogbeumker
Milchzahnsafari GmbH
Am Tuttenbrocksee 5, 59269 Beckum
Prof. Dr. Fritz U. Meyer
Klinik und Poliklinik für
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie/Plastische Operationen
Universität Greifswald
Ferdinand-Sauerbruch-Str. 17475 Greifswald
Dr. Mhd S. Mourad
Poliklinik für Kieferorthopädie &
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42 17475 Greifswald
Dr. Rebecca Otto
Zahnarztpraxis für Kinder Paradiesstr. 6 07743 Jena
Prof. Dr. Dr. Andrea Rau
Klinik und Poliklinik für
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie/Plastische Operationen
Universität Greifswald
Ferdinand-Sauerbruch-Str.
17475 Greifswald
Dr. Sabine und Dr. Jan Rienhoff
Kinderzahnarztpraxis Magic Dental
Hunaeusstraße 6 30177 Hannover
Dr. Tania Roloff
Zahnarztpraxis für Kinder
Holstenplatz 20b
22765 Hamburg (Altona)
Priv.-Doz. Dr. Ruth M. Santamaría
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetter Str. 55 79106 Freiburg i. Br.
Priv.-Doz. Dr. Julian Schmoeckel
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Dr. Andreas Söhnel
Poliklinik für Prothetik, Werkstoffkunde und Alterszahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Prof. Dr. Christian H. Splieth
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Mitsuhiro M. Tsukiboshi, DDS
Tsukiboshi Dental Clinic
5-14, Genji, Kanie-cho, Amagun
Aichi 497-0055, Japan
ZÄ Annina Vielhauer
Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde
Universität Greifswald
Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald
Prof. Dr. Ulrich Wiesmann
Institut für Medizinische Psychologie
Universität Greifswald
Walter-Rathenaustr. 48
17487 Greifswald
1 Wachstum und Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen
1.1 Körperliche Entwicklung
J. Fanghänel
Der Bauplan des menschlichen Körpers ist letztlich ein Ergebnis von Wachstum, Entwicklung und Differenzierung. Einen der fundamentalen Vorgänge im Entwicklungsprozess stellt das Wachstum dar. Es handelt sich um ein komplexes Geschehen, an dem quantitative, qualitative und formale Veränderungen gleichermaßen beteiligt sind. Dieser Prozess ist ein zeitabhängiger, biologischer Vorgang, der während des gesamten prä- und postnatalen Lebens stattfindet. Er vollzieht sich auf molekularer, subzellulärer, zellulärer Ebene, auf Organ- und Körperebene gleichzeitig und äußert sich in Größen-, Form- und Proportionsveränderungen. Dabei spielen Zellproliferation, -wachstum, -migration aber auch Vermehrung der Interzellularsubstanz eine kausale Rolle. Das Wachstum unterliegt dem Einfluss vieler Faktoren (Abb. 1.1-1).
Abb. 1.1-1 Faktoren, die das Körperwachstum beeinflussen.
1.1.1 Wachstumsphasen
Die menschliche Ontogenese ist sowohl prä- als auch postnatal durch verschiedene Etappen des schnellen und langsamen Wachstums gekennzeichnet. Dabei kann das Körperlängenwachstum (Abb. 1.1-2) als messbarer Parameter des Wachstums herangezogen werden.
Abb. 1.1-2 Darstellung der mittleren Körpergröße von Jungen und Mädchen. Ein deutliches Sättigungswachstum ist zu erkennen, d. h. zum Ende des Beobachtungszeitraums hin nimmt die Wachstumsintensität monoton ab (Messwerte nach J. Karlberg4).
In der pränatalen Entwicklung finden in den ersten beiden Monaten sowie in der Mitte der intrauterinen Phase besonders rasche Wachstumsvorgänge statt. Postnatal ist die Wachstumsgeschwindigkeit vor allem im 1. Lebensjahr sehr groß. Die Körpergröße eines Jungen beträgt mit 2 Jahren etwa 50 % der definitiven Größe, mit 3 Jahren etwa 55 %, mit 7 Jahren 70 % und mit 12 Jahren 85 %. Vom 5. Jahr an bis zum Eintritt der Pubertät können die Zuwachsraten pro Jahr mit 5 – 6 cm veranschlagt werden. Bis zum Abschluss des Wachstums werden rhythmische Schwankungen mit Perioden der Fülle (Massenwachstum) und der Streckung (Längenwachstum) festgestellt. Die erste Füllperiode liegt zwischen dem 1. und 4., die erste Streckung zwischen dem 5. (6.) und 7., die zweite Füllperiode zwischen dem 8. und 10. und die zweite Streckung zwischen dem 11. (12.) und 15. Lebensjahr. In der Reifungsperiode zwischen dem 15. und 20. Jahr finden Massen- und Längenwachstum gleichzeitig, bei Mädchen früher als bei Jungen, statt.
Bei Mädchen und Jungen ist das Längenwachstum im Prinzip bis zum 10. Lebensjahr etwa gleich, wobei Jungen von Geburt an durchschnittlich etwas größer sind als Mädchen. Mit Beginn der Pubertät kommt es zu einem Pubertätswachstumsschub („Pubertätsakzeleration“), der bei Mädchen früher einsetzt. Damit ist die Längenentwicklung bei Mädchen vorübergehend intensiver als bei Jungen. Der bei Jungen später einsetzende Wachstumsschub führt dazu, dass der Geschlechtsunterschied in der Körperhöhe bald ausgeglichen wird. Da das Längenwachstum bei Jungen länger (20 Jahre) anhält als bei Mädchen (18 Jahre), übertrifft die Körperhöhe der Jungen die der Mädchen (Abb. 1.1-2). Durchschnittlich sind Frauen etwa 10 cm kleiner als Männer. In Europa betragen die Mittelwerte der Körpergröße ♂ 1,80 m und ♀ 1,68 m.
1.1.2 Steuerung des Wachstums und Wachstumsstörungen
Wachstumssteuerung
Wachstumsprozesse werden von zahlreichen Faktoren gesteuert und beeinflusst (Abb. 1.1-1). Das Körperwachstum ist aufgrund der vielfältigen Einflussmöglichkeiten großen Schwankungen unterworfen. Die mittlere Körpergröße beträgt in Deutschland bei Neugeborenen 51,5 cm (± 3,5 cm), 43,4 cm (± 2,9 cm), bei 18-/19-Jährigen 180 cm (± 13 cm), 168 cm (± 11 cm). Innerhalb der Schwankungsbreite bei Normalwuchs, Normosomie (170 – 190 cm, 158 – 178 cm), können Konstitutionsunterschiede festgestellt werden.
Wachstumsstörungen
Eine kausale Rolle spielen Störungen von Zellproliferation, Zellwachstum, Zellmigration, aber auch Synthesestörungen der Interzellularsubstanz.
Abweichungen von den Mittelwerten der Körperhöhe lassen sich als bestimmte Formen von Wachstumsstörungen klassifizieren:
Klein- / Minderwuchs, Mikrosomie (-10 bis -30 cm Abweichung),
Zwergwuchs, Nanosomie (mehr als -30 cm Abweichung),
Groß / Hochwuchs, Makrosomie (+10 bis 30 cm Abweichung),
Riesenwuchs, Gigantismus (mehr als +30 cm Abweichung).
Wachstumsverzögerungen, die auch oft mit Fehlbildungen vergesellschaftet sein können, treten bei einer Reihe von Erbkrankheiten, z. B. bei Chondrodysplasie, Osteogenesis imperfecta und beim Down-Syndrom auf. Minderwuchs wird beobachtet nach Genuss der Schwangeren von Alkohol (sog. Alkoholembryofetopathie), bei Vitamin-A-Mangel oder -Überschuss, bei Vitamin-D-Mangel und Sauerstoffmangel während der Schwangerschaft.
Überproduktion von Wachstumshormon STH führt dagegen zu Riesenwuchs.
1.1.3 Erscheinungsformen des Wachstums
Die Wachstumsprozesse können verschiedenen Charakters sein, auch aufgrund des unterschiedlichen Ursachengefüges. Beim Säugling, Kleinkind, Kindergartenkind, Schulkind und beim Jugendlichen sind diese Prozesse besonders eindrucksvoll zu erkennen.
Größenzu- und Größenabnahme
Wachstum bedeutet in erster Linie Größenzu- und -abnahme. Liegt ein „Positivwachstum“ vor, so vergrößern sich Körper- und Organgewichte bzw. die Körperlänge. Wenn im Verlaufe des Lebens die katabolischen Stoffwechselprozesse (Abbaustoffwechselprozesse) überwiegen, kommt es zu regressiven Vorgängen (Rückbildungsvorgänge, z. B. bei Rückbildung des Thymus nach der Pubertät). Es liegt dann ein „Negativwachstum“ vor.
Proportionsverschiebungen
Während des Wachstums unterliegt der menschliche Organismus zahlreichen Proportionsverschiebungen. Die Ursache liegt darin, dass einzelne Körperabschnitte und Organe mit unterschiedlicher Geschwindigkeit diskontinuierlich wachsen. Daraus resultieren Veränderungen ihrer relativen Größe. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, wie sich die folgenden Verhältnisse verändern:
Die Kopfhöhe entspricht beim 6-jährigen Kind etwa ein Sechstel, beim Neugeborenen ein Viertel, beim Erwachsenen dagegen ein Achtel der Körperlänge (Abb. 1.1-3).
Der Hirnschädel ist beim Neugeborenen verhältnismäßig größer als der Gesichtsschädel, da er sich durch die schnellere Expansion des Gehirns und der Sinnesorgane entsprechend entwickelt. In der Postnatalperiode kommt es mit dem Durchbruch der Zähne, der nachfolgenden Verstärkung der Kiefer und der Ausbildung der Nasennebenhöhlen zu einer zunehmenden Vergrößerung des Gesichtsschädels.
Der Nabel liegt beim Neugeborenen etwa in der Körpermitte und rückt allmählich höher. Schon beim 6-Jährigen und beim Erwachsenen liegt er in der oberen Körperhälfte. Die Körpermitte liegt beim Erwachsenen in der Höhe der Symphyse (Abb. 1.1-3).
Kopf und Rumpf des Neugeborenen sind relativ groß, die Gliedmaßen, besonders die Beine, sind relativ kurz. So beträgt z. B. die Entfernung Schambeinfuge – Fußsohle beim Neugeborenen drei Achtel, beim Erwachsenen die Hälfte der Körperlänge. Das bedeutet, dass vor allem die Gliedmaßen beim Erwachsenen relativ länger sind (Abb. 1.1-3).
Abb. 1.1-3 Veränderungen der Körperproportionen während des Wachstums. Alle Individuen werden auf die gleiche Größe gebracht (Messwerte nach A. Stratz3).
Anpassungswachstum
Wenn sich ein Organ an bestimmte Funktionszustände anpassen muss, sprechen wir von einem Anpassungswachstum. Wir unterscheiden dabei ein funktionelles (mit vorhandenen Strukturen mehr zu leistende Arbeit), strukturelles (Vergrößerung und Vermehrung spezifischer Organbausteine) und ein biochemisches (durch Hormon ausgelöste Wachstumsvorgänge) Anpassungswachstum. Ein typisches Beispiel für ein Anpassungswachstum sind angeborene Herzfehler (Vitien). Hier werden die Herzkammern unterschiedlich in einem besonderen Maße belastet. Daraus resultieren Vergrößerungen der muskulären Herzkammerwände (Herzmuskelhypertrophie).
Rhythmik
Wachstumsprozesse können sich phasenhaft und rhythmisch vollziehen: oszillierendes Wachstum. So wachsen Kinder und Jugendliche im Sommer schneller als im Winter, also in einem Jahresrhythmus.
Akzeleration
1.1.4 Schädelwachstum und -formung
Der Entwicklung des Schädels und des Kopfes liegt das postnatale Schädelwachstum zu Grunde, das auf folgenden Prozessen beruht:
dem chondralen Wachstum, das interstitiell vom Knorpel ausgeht,
dem suturalen Wachstum, das appositionell in den Schädelnähten erfolgt,
dem periostalen Wachstum, das appositionell dem Periost obliegt.
Alle Vorgänge reihen sich in ein harmonisches Miteinander ein. Dabei erfolgt die Wachstumssteuerung nach einem genetischen Programm und wird durch Umwelteinflüsse beeinflusst.
Chondrales Wachstum
Die Bedeutung der Synchondrosen für das Knochenwachstum ist mit dem des Epiphysenknorpels in Röhrenknochen im Sinne einer Expansion (Abb. 1.1-4) vergleichbar. Es hält so lange an, bis der Knorpel verknöchert ist. Knorpel gibt es am Schädel in den Synchondrosen der Schädelbasis,5 im Nasenseptum, in der Symphyse des Unterkiefers sowie auf der Gelenkfläche des Caput mandibulae.
Abb. 1.1-4 Die Wirkung der Synchondrosen und der Suturen bei der Expansion der Schädelbasis. Pfeile: Expansionsrichtung.5
Die Synchondrosis sphenooccipitalis übt eine Stemmkörperwirkung auf das Mittelgesicht aus. Sie schließt sich bis zum 20. Lebensjahr, bei Mädchen etwas früher als bei Jungen. Damit ist auch das Längenwachstum der Schädelbasis beendet.
Die Wachstumsaktivitäten des knorpligen Nasenseptums sind umstritten, zumindest sind sie im Erwachsenenalter nicht mehr nachweisbar. Der Nasenknorpel hat eine funktionelle Bedeutung für die Abstützung der Nase, weniger für das Wachstum.
Die Wachstumspotenzen des Knorpels in der Symphysis mandibulae für die Formung der Mandibula halten bis zum 1. Lebensjahr an.
Die Wachstumsaktivitäten des Gelenkknorpels des Caput mandibulae sind bis in das Erwachsenenalter zu verfolgen.
Suturales Wachstum
Das suturale Wachstum (Abb. 1.1-4) geht von den Osteoblasten des Bindegewebes der Suturen aus. Die aktiven Wachstumszonen einer Sutur befinden sich somit an den Knochenenden. Bis zum Erwachsenenalter verschwindet die osteoblastische Schicht weitgehend, und entsprechend vermindern sich auch die Wachstumsaktivitäten. Mit der knöchernen Überbrückung der Schädelnähte endet das suturale Wachstum; die Pfeilnaht schließt sich mit dem 20. Lebensjahr, alle anderen viel später.
Für die Zahnmedizin sind vor allem folgende kraniofazialen Suturen von Bedeutung, die sich zu Systemen7 zusammenfassen lassen:
Das sagittale Suturensystem verläuft entsprechend der Pfeilnaht von hinten nach vorn über das Schädeldach und setzt sich beim Neugeborenen zwischen den Stirnbeinen, Nasenbeinen, Oberkiefern bis zu beiden Unterkieferhälften nach vorn und unten fort. Das sagittale Suturensystem ist hauptsächlich für das Breitenwachstum des Hirn- und Gesichtsschädels zuständig.
Das kraniofaziale und maxilläre Suturensystem trennen den vorderen Teil des Hirnschädels von den Gesichtsknochen bzw. diese vom Oberkiefer. Ihre Wachstumsaktivitäten tragen dazu bei, dass das Mittelgesicht nach unten und vorn gedrängt wird. Einige Suturen können bis ins hohe Alter offen bleiben, was für die Behandlung von Oberkieferprotrusionen bei Erwachsenen von praktischer Bedeutung ist.
Verfrühter Schluss der Suturen (prämature Synostosen) führt zu Schädeldeformitäten. Bei vorzeitiger Pfeilnahtsynostose entsteht der Scaphocephalus (Kahnschädel), bei vorzeitigem symmetrischem Schluss der Kranznaht der Oxycephalus (Turmschädel), bei ungleichmäßiger Synostose der Kranznaht der Plagiocephalus (Schiefschädel) sowie bei vorzeitiger Fusion der Stirnnaht der Trigonocephalus (Keilschädel).
Periostales Wachstum
Diese Wachstumsform, welche ein Dickenwachstum vom Periost bewirkt, beruht auf den Aktivitäten der Osteoblasten im Stratum germinativum des Periosts, wobei gleichzeitig an anderer Stelle eine Knochenresorption durch Osteoklasten erfolgen kann. Verlaufen Apposition und Resorption von Knochengewebe mit unterschiedlichen Intensitäten, kommt es zur unterschiedlichen Modellierung des Knochens. Dieser Vorgang hat auch für das proportionale Wachstum sowie für die Ausformung eine besondere Bedeutung (Abb. 1.1-5). Das periostale Wachstum bleibt während des ganzen Lebens erhalten, ebenso gehen alle Umbauvorgänge im Knochen weiter.
Abb. 1.1-5 Modellierung des Oberkiefers (rechter Oberkiefer von lateral) durch periostales Wachstum.1-3
1.1.5 Wachstum des Gesichtsschädels
Relation Gesichts- und Gehirnschädel. Ihre Entwicklung ist ein dynamischer Prozess. Mit der Vergrößerung des Gehirns und der Verkleinerung der Kiefer hat sich der Gesichtsschädel unter und etwas vor dem Hirnschädel verlagert. Damit liegt ein Stockwerkbau vor: Mund-, Nasen- und Augenhöhlen liegen übereinander. Die Entwicklung der Zähne und Alveolarfortsätze, die stärkere funktionelle Inanspruchnahme durch die Kaumuskeln sowie die mit der Ausbildung der Nasennebenhöhlen verbundene Pneumatisation sind die hauptsächlichen Faktoren, die das beschleunigte Wachstum des Gesichtsschädels in der postnatalen Entwicklung bewirken.
Zahl und Größe der Zähne spielen eine große Rolle. Dabei zeigt der Gesichtsschädel während der Entwicklung ein rhythmisches Wachstum, das mit dem Durchbruch der Milch- und permanenten Zähne zusammenfällt. Besonders groß ist das Wachstum der Kiefer während der 2. Dentition, bei der in den Kiefern an Stelle der 20 kleinen Milchzähne Raum für die 32 großen permanenten Zähne geschaffen werden muss.
Obergesicht. Es zeigt nach der Geburt zunächst die größte Wachstumsgeschwindigkeit, was sich aus der Verbindung mit dem Hirnschädel bzw. -wachstum (Zerebralisation) erklärt. Die Geschwindigkeit nimmt jedoch kontinuierlich ab und ist ab dem 12. Lebensjahr verlangsamt.
Mittelgesicht. Dieses wächst dagegen zunächst langsamer. Bis zum 7. Lebensjahr geht sein Wachstum hauptsächlich von den kraniofazialen und maxillären Suturensystemen (s. o.) sowie z. T. von den Synchondrosen und dem knorpligen Nasenseptum aus. Nach dem 7. Lebensjahr dominiert dann das periostale Wachstum. Das vertikale Wachstum des Mittelgesichts erfolgt zunächst mit der Entfaltung der Nasenregion. Der obere ethmoidale Abschnitt entfaltet sein volles Wachstum in der frühen Kindheit unter dem Einfluss der sich entwickelnden Riechschleimhaut.
Das Wachstum des unteren maxillären Teils wird hauptsächlich durch die Nasenatmung stimuliert und hält bis zum Ende der Kindheit an. Die funktionellen Impulse der Nasenatmung bewirken eine Erweiterung des unteren Nasengangs. Diese ist eine Voraussetzung für die unbehinderte Nasenatmung. Kommt es zu einer Verlegung des nasalen Luftwegs, z. B. bei starken Wucherungen der Rachenmandeln (adenoide Vegetationen), dann treten Wachstumshemmungen des Mittelgesichts auf. Durch Resorptionen auf der nasalen Seite und Knochenappositionen auf der oralen Seite wird der Gaumen nach unten verlagert.
Eine weitere Größenzunahme erfährt das Mittelgesicht mit der Ausbildung des Alveolarfortsatzes beim Durchbruch der Zähne und trägt zum Vertikalwachstum bei. Das Tiefenwachstum des Mittelgesichts erfolgt durch periostale Knochenappositionen an der äußeren Oberfläche bei gleichzeitigen Resorptionen in den Augenhöhlen, der Nasenhöhle, den Nasennebenhöhlen und der Mundhöhle. Der Hauptzuwachs erfolgt durch Knochenapposition von dorsal am Tuber maxillae. Ursächliche wachstumsfördernde Stimuli entstehen mit der Entwicklung und dem Durchbruch der Zuwachszähne. Nach der Eruption des oberen 3. Molaren (18. Lebensjahr) ist das appositionelle Wachstum am Tuber maxillae beendet.
Sekundäre Formveränderungen erfolgen unter Apposition und Resorption an den umliegenden Knochen (Os lacrimale, Os palatinum, Vomer, Proc. pterygoideus des Os sphenoidale). Als ursächliche Faktoren sind hier die durch den Kaudruck erzeugten Druck- und Zugspannungen im Knochen zu nennen, die auch zur Entstehung der Kaudruckpfeiler führen. Die Formung des Gaumens ist nicht nur von der Ausbildung des Alveolarfortsatzes, sondern auch von der Atmung abhängig. Mundatmer haben zumeist einen hohen Gaumen.
1.1.6 Wachstum des Unterkiefers
Knöcherne Grundlage. Die Mandibula ist die Grundlage des Untergesichts. Nach ihrem Verknöcherungsmodus gehört sie zum Desmocranium. Die Ossifikation beginnt in der Mitte jeder Unterkieferhälfte und breitet sich nach medial und distal aus. Eine Ausnahme machen der Gelenkkopf und die Kinnregion, die durch chondrale Osteogenese von Sekundärknorpel entstehen. Der Sekundärknorpel bildet sich in der 10. Woche und ist als chondrales Wachstumszentrum zu werten, das einer hormonellen Steuerung unterliegt. Eine verminderte Produktion des Wachstumshormons (STH) führt zur Mikrognathie und eine vermehrte Bildung zur Progenie. Bei einseitiger Störung des kondylären Wachstums, z. B. durch ein Trauma, entsteht eine Laterognathie.
Synostosierung beider Unterkieferhälften erfolgt zum Ende des 1. Lebensjahres. Mit ihr verschwindet der Knorpel der Symphysis mentalis. Die Wachstumspotenzen des kondylären Knorpels halten jedoch, wenn auch mit abnehmender Intensität, bis in das Erwachsenenalter an. Der Unterkieferast verlängert sich nach hinten oben, und der Kieferwinkel verkleinert sich. Dieser Prozess wird durch periostale Knochenanlagerungen im Bereich des Kieferwinkels unterstützt (s. Kap. 1-5, Abb. 1.5-5).
Knochenappositionen. Durch sie kommt es am hinteren Rand des Unterkieferastes, einschließlich des Gelenkköpfchens, bei ausgewogenen Resorptionen an seiner vorderen Kante sowie durch die Bildung des Kinns zur Verschiebung des Unterkiefers nach vorn. Der Knochenanbau am ventralen Unterkieferrand sowie die Entstehung des Alveolarteils bewirken gleichzeitig eine Verlagerung nach unten. Diese Wachstumsverschiebungen sind auch am Richtungswechsel des Foramen mentale erkennbar. Die ursprünglich rechtwinklig austretenden Leitungsbahnen weichen mit fortschreitendem Wachstum nach hinten oben ab, wodurch der scharfe vordere, untere Rand des Foramen mentale entsteht.
Die Wachstumsbewegung des Unterkiefers nach vorn und unten wird durch Rückwärtsverlagerung der Fossa mandibularis an der Schädelbasis z. T. kompensiert. Ein vermehrter Knochenabbau oberhalb des Kinns führt zu einer Eindellung, die in der Kieferorthopädie S-Punkt genannt wird. Auf Grund spezifischer Wachstumsstimuli kann man den Unterkiefer in verschiedene Funktionseinheiten gliedern. Diese sind:
Pars alveolaris, die mit dem Durchbruch der Zähne entsteht,
Proc. condylaris, der sich unter der Funktion des Kiefergelenks vergrößert.
Proc. coronoideus, der sich durch die Zugwirkung des M. temporalis verlängert,
Angulus mandibulae, der durch die Zugwirkung der Masseter-Pterygoideus-Schlinge verstärkt wird,
Protuberantia mentalis, die unter dem Einfluss der Spannungen des Basalbogens und der Muskulatur entsteht.
1.1.7 Wachstum des Hirnschädels
Relation. Hirn- und Gesichtsschädel wachsen nicht mit derselben Geschwindigkeit. Beim Neugeborenen ist der Hirnschädel im Vergleich zum Gesichtsschädel wesentlich weiter und größer entwickelt. Sein Wachstum steht im engen Zusammenhang mit dem des Gehirns (Zerebralisation), das bis zum 10. Lebensjahr nahezu seine endgültige Größe erreicht hat. Bei Abflussstörungen des Liquor cerebrospinalis während des Wachstums ist der Nahtverschluss verhindert, und der Hirnschädel vergrößert sich zum „Wasserkopf“ (Hydrocephalus).
Zerebralisation. Sie erfolgt hauptsächlich durch die Entfaltung des Endhirns (Telencephalon). Der Hirnstamm zeigt dagegen als phylogenetisch ältester Teil des Gehirns ein relativ konservatives Wachstum. Durch Vergrößerung des Stirnlappens wird der Schädel verlängert und durch die des Schläfenlappens verbreitert. Dabei kommt es zum Absenken der umliegenden Teile der Schädelbasis und zur Verlagerung des Gesichtsschädels nach unten vorn. Der Wachstumsdruck des Gehirns hat auch eine extendierende Wirkung auf die Synchondrosen und Suturen, wodurch chondrales und suturales Wachstum stimuliert werden (Abb. 1.1-4). Das periostale Wachstum wird ebenfalls beeinflusst und besorgt die Vertiefung der Schädelgruben.
Letztlich sei erwähnt, dass die Entwicklung der Schädelbasis genetisch gesteuert wird, während die Ausformung des Hirns – z. T. des Gesichtsschädels durch umgebende Strukturen / Faktoren modelliert wird. Moss5 fasst letztere unter dem Begriff der „Funktionellen Matrix“ zusammen.
Literatur
1. Enlow DH. The human face. New York, Evanston, London: Harper & Row, 1968.
2. Fanghänel JF, Behr M, Proff P. Teratologie heute. Greifswald: Kiebudruck & Werbung, 2014.
3. Waldeyer A. Anatomie des Menschen. In: Fanghänel J, Pera F, Anderhuber F, Nitsch R (Hrsg.). Berlin, New York: W. de Gruyter, 2002.
4. Karlberg J. The human growth curve. In: Ulijeszek St J, Johnston FE, Preece MA (eds). Human Growth and Development. Cambridge: Cambridge University Press, 1998:108–115.
5. Moss ML. A theoretical analysis of the functional matrix. Acta Biotheoret (Leiden) 1968;18:195–202.
6. Schumacher GH. Anatomie für Zahnmediziner. Lehrbuch und Atlas, 3. Aufl. Heidelberg: Hüthig, 1997.
7. Scott JH, Dixon AD. Anatomy for students of dentistry, ed 4. Edinburgh, London, New York: Churchill Livingstone, 1978.
1 Wachstum und Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen
1.2 Säugling (Geburt bis 1 Jahr)
Ch. Splieth, U. Wiesmann
Größe*:
45–54 cm (Geburt) bis 70–80 cm (12 Monate)
Gewicht*:
3–4 kg (Geburt) bis 8,5–11 kg (12 Monate)
(*jeweils 3 %- bis 97 %-Perzentile1)
1.2.1 Orale Entwicklung
Die orale Entwicklung von Säuglingen ist vor allem auf das Wachstum, die Nahrungsaufnahme, Auseinandersetzung mit der Umwelt, Atmung und Lautbildung abgestimmt. Hierbei kommt der Beherrschung des Schluckreflexes durch die Ausbildung von Afferenzen und Efferenzen eine besondere Bedeutung zu. Das Mittel- und Untergesicht, die wesentlich durch die Maxilla und Mandibula bestimmt werden, und insbesondere die Alveolarfortsätze weisen eine sehr geringe Höhe auf (Abb. 1.2-1 a und b), die aber mit der weiteren Zahnentwicklung stetig zunimmt.
Abb. 1.2-1a und b Geringe Höhe von Unter- und Mittelgesicht im 1. Lebensjahr.
Die schon in der fünften Embryonalwoche beginnende Entwicklung der Zähne schreitet bis zum Durchbruch der ersten Milchzähne mit 6–8 Monaten weiter fort (Tab. 1). Die Schwankungen zwischen Frühzahnern, die bereits mit einem durchgebrochenen Zahn geboren werden können, und Spätzahnern, die noch nach 12 Monaten keinen durchgebrochenen Zahn aufweisen, sind erheblich.
Zahnfehlbildungen können in den verschiedenen Entwicklungsstadien entstehen (Abb. 1.2-2):
Abb. 1.2-2a und b Anomalien entstehen bei der Bildung (a) der Zahnkeime und deren Mineralisation (b).
Initiation (Hypo- / Hyperdontie, Dystopie / Verlagerung)
Proliferation (fehlende bzw. überzählige Höcker und Wurzeln, Fusion bzw. Zwillingsbildung (dentes geminati) von Zahnanlagen)
Histologische Differenzierung (Strukturanomalien wie Amelogenesis / Dentinogenesis imperfecta)
Morphologische Differenzierung (Formanomalien wie Zapfenzähne, Makro- / Mikrodontie und Dens-in-dente)
Apposition (Hypoplasien)
Kalzifikation (Hypokalzifikationen bzw. Hypomineralisationen/MIH).
Bei allen Zähnen, die zum Zeitpunkt der Geburt gebildet werden, kann eine Neonatallinie im Schliffpräparat abgelesen werden. Perinatale Komplikationen wie z. B. eine Frühgeburt können zu einer Mangel- oder Fehlversorgung der Zahnkeime führen und damit zu strukturellen Veränderungen. In Tabelle 1 kann der ungefähre Stand der Mineralisation der Milchzähne bei der Geburt abgelesen werden. Bei den bleibenden Zähnen können die Spitzen von ersten Molaren und zentralen Inzisivi mineralisiert sein und da diese Zähne dann in Folge weiter mineralisieren, liegt es nahe, dass sich auch in diesem Zeitfenster häufig die initiale Schädigung einer klassischen Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation von 1ern und 6ern ereignet. Rückwirkend kann aus dem Zeitpunkt der Bildung damit bei Fehlbildungen der Schädigungszeitpunkt abgeschätzt werden. Dies ist forensisch z. B. bei Tetracylinverfärbungen oder Fluorosen interessant.
Tabelle 1 Mineralisation und Durchbruch der Milchzähne2
Zahn
Beginn der Mineralisation (embryonal)
Bereits bei Geburt mineralisierte Anteile
Durchbruch (postnatal)
Mittlerer Schneidezahn
14. Woche
Koronal zu zwei Dritteln
6. – 8. Monat
Seitlicher Schneidezahn
16. Woche
Koronal zur Hälfte
8. – 12. Monat
Eckzahn
17. Woche
Koronal zu einem Drittel
16. – 20. Monat
1. Milchmolar
15. Woche
Okklusalfläche
12. – 16. Monat
2. Milchmolar
18. Woche
Höckerspitzen
20. – 30. Monat
Hypoplasien, Hypokalzifikationen und Verfärbungen können dabei jeweils durch verschiedene Faktoren entstehen:
systemisch (Fluoride, Tetracycline, Allgemeinerkrankungen etc.
lokal (entzündliche Prozesse, Traumata
erblich (Amelogenesis bzw. Dentinogenesis imperfecta)
Orale Probleme
orale Fehlbildungen
Zahnungsbeschwerden
kariöse Initialläsionen
Bei Säuglingen stehen orofaziale Entwicklungsanomalien im Vordergrund, da normalerweise der Zahndurchbruch erst mit dem sechsten Lebensmonat beginnt. Schwere Fehlbildungen wie Syndrome, Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten oder Gesichtsspalten treten selten auf und werden meist schon bei oder sogar vor der Geburt durch das medizinische Betreuungspersonal diagnostiziert. Für das Therapiekonzept sollten frühzeitig zahnärztliche Spezialisten herangezogen werden (Kap. 4.7).
Dagegen sind Einschlusszysten (missverständlich benannt als Epstein Perlen, Bohn Knoten; besser Lamina dentalis-Zysten, s. Kap. 2.2.2) deutlich häufiger (je ca. 20 – 50 % aller Kinder). Sie stellen sich als kleine, feste, weißliche bis graue Läsionen der palatinalen oder alveolaren Mukosa dar, die manchmal mit durchbrechenden Zähnen verwechselt werden und keiner Therapie bedürfen.19
Sie können mit Gingiva-/Alveolarzysten bei Neugeborenen verwechselt werden, die sich durch ihre laterale Position auf dem Alveolarkamm unterscheiden lassen.
(Granularzell-)Epulitiden beim Neugeborenen sind seltene, gutartige Läsionen im vorderen Teil des Mundes am Alveolarkamm, die schon gelegentlich in Uterus diagnostiziert werden, und häufiger bei Mädchen (8:1) und im Oberkiefer (3:1) vorkommen. Diese gestielte Schwellung kann chirurgisch entfernt werden, wenn sie die Nahrungsaufnahme und die Respiration behindert. Bei vollständiger Entfernung sind Rezidive unwahrscheinlich.
Das mütterliche Stillen ist hinsichtlich der Zusammensetzung der Ernährung und der Entwicklung des oralen Systems der Flaschennahrung vorzuziehen. Dabei können dentes natales oder dentitio praecox (frühzeitiger Durchbruch von Milchzähnen) das Stillen erschweren.
Zahnungsbeschwerden. Das Zahnen kann mit Schmerzen, Reiben auf den Kieferkämmen, verstärktem Speichelfluss und schlaflosen Nächten einhergehen. Beißringe aus Kunststoff können Erleichterung verschaffen. Bei besonderem Leidensdruck der Kinder bzw. Eltern kann auch ein Oberflächenanästhetikum (Dentinox®) verschrieben werden, wobei die Haftung an den Kieferkämmen nicht hoch ist und die Gebrauchsanweisung und die Dosierung strikt eingehalten werden sollten, um jegliche Toxizität zu vermeiden. Zur Beruhigung ist der Schnuller dem Daumenlutschen vorzuziehen.
Betreuungsziele beim Säugling
Aufbau eines Betreuungsverhältnisses zum Kind bzw. zur Familie
Inspektion (orale Fehlbildungen, Zahndurchbruch, kariöse Initialläsionen, Plaque)
Gesunde, zahngerechte Ernährung zur Vermeidung von Flaschenkaries
Aufklärung über Kariesätiologie
Etablierung von Mundhygiene durch die Eltern
Optimale Fluoridnutzung ab dem ersten Zahn
1.2.2 Verhalten und psychische Entwicklung
Der Säugling ist völlig von den Eltern, insbesondere der Hauptbezugsperson abhängig. Die Mutter-Kind-Beziehung ist alleine aufgrund des Stillens in der Regel dominant und prägend. Das Wachstum und die Entwicklung des Kindes sind rasant. Die Verdreifachung des Gewichtes geht mit einer permanenten Veränderung der Fähigkeiten des Kindes und dessen Verhältnis zu seiner Umwelt einher. In den ersten 6-8 Monaten entwickeln sich Ernährungs-, Hygiene- und Schlafmuster. Mit der sich steigernden körperlichen Aktivität des Kindes und dem Wachstum nimmt die Länge der Wach- und Schlafphasen zu und nähert sich einem festeren Tag-Nacht-Rhythmus an. Für die Hauptbezugsperson bedeutet dies ebenfalls eine Stabilisierung ihres Rhythmus. Damit wird auch die Hauptbezugsperson wieder aufnahmefähiger und interessierter an Kontakten und Informationen von außen.
Aus biologischer Sicht hat das Neugeborene zwei Aufgaben: Körperliches Wachstum und Weiterentwicklung des Gehirns. Dazu braucht es eine große Menge an Energie, die über die Nahrung aufgenommen wird, bei gleichzeitiger Schonung des Organismus. Das erklärt das hohe Schlafbedürfnis des Säuglings in den ersten Lebensmonaten: Um ein optimales Wachstum zu ermöglichen, wird möglichst wenig Energie durch geistige und motorische Aktivität verbraucht.
Das Verhaltenssteuerungssystem besteht aus einer Verflechtung von Schreien (Erregungsaufbau), Schmecken und Saugverhalten (Nahrungsaufnahme), von oral-manuellem Kontakt (Selbstberuhigung) und Blickverhalten (Informationsaufnahme). Wahrnehmungsfähigkeit und motorische Kompetenzen des Säuglings sind sehr eingeschränkt, jedoch für den „Nahbereich“ – der Interaktion mit den Pflegepersonen – erstaunlich gut ausgestattet. Das motorische Verhaltensmuster besteht aus allgemeinen und in den ersten zwei Monaten zielungerichteten Bewegungen (z. B. Winden des Körpers, stoßende Bewegungen der Extremitäten). Das Neugeborene ist mit reflexartigen Schemata ausgestattet (z. B. Schauen, Hören, Saugen, Greifreflex), die es im Verlauf der Entwicklung kontinuierlich anwendet, ausweitet, differenziert und miteinander koordiniert.
Das Saugen, dem neben der Nahrungsaufnahme auch eine besondere psychologische Bedeutung zukommt, dient der Balance zwischen Erregung und Beruhigung einerseits und der kognitiven Verarbeitung von Außenreizen andererseits.
In den ersten Lebensmonaten wird jede Form des Unbehagens – Hunger, Unruhe, Unwohlsein, Schmerzen, Reizüberflutung und -deprivation – durch Schreien ausgedrückt. Säuglinge unterscheiden sich in der Häufigkeit und Intensität des Schreiens. Irritable Kinder (sogenannte „Schreikinder“) sind solche, die aus dem geringsten Anlass schreien und sich nicht so leicht wieder beruhigen lassen. Das Schreien stellt sowohl für die Säuglinge als auch für die Eltern eine Belastung dar (Schlafdefizite, Insuffizienzgefühle, negative Gefühle gegenüber dem Kind).
Nach sechs bis 10 Monaten stabilisiert sich der Organismus des Säuglings. Die Tageswachzeiten verlängern sich, und des Nachts stellt sich eine zusammenhängende Schlafphase ein. Auch in der motorischen Entwicklung finden eindrucksvolle Veränderungen statt. Das Kind wechselt häufig seine Lage und Position (Lokomotion – vom Sitzen über das Krabbeln zum ersten Stehen) als Folge der Gehirnreifung. Das Greifen kristallisiert sich immer deutlicher heraus als Medium des Erkundungsverhaltens (Gegenstände werden ertastet und befingert – weniger häufig zum Mund geführt). Greifbewegungen, die bald auch zweihändig ausgeführt werden, koordinieren sich zunehmend mit dem visuellen System (Hand-Auge-Koordination). Das Greifen und das Schauen bzw. intensive Betrachten bilden mehr und mehr eine Einheit.
Die kognitive Entwicklung in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres ist beeindruckend. Es stellt sich eine zunehmende Differenzierung in der Begriffsbildung oder im Sozialverhalten ein. Säuglinge ab diesem Alter können z. B. Erwachsene und Kinder sowie zwischen Alltagsgegenständen unterscheiden. Zentral ist die Entwicklung der Objektpermanenz im achten Monat: Das Kind lernt, nach vor seinen eigenen Augen versteckten Gegenständen zu suchen, d. h. es hat eine kognitive Repräsentation von der Existenz der Objekte verinnerlicht. Viele Kinder werden in Gegenwart fremder Menschen emotional auffällig: sie zeigen sich ängstlich und „Fremdeln“ („Acht-Monats-Angst“). Das bedeutet, dass sich ebenfalls eine Form der Personpermanenz entwickelt. Ferner erwirbt das Kind erste Grundlagen eines kausalen Verständnisses. Es entdeckt, dass bestimmte Handlungsweisen ein Mittel zu einem bestimmten Zweck darstellen.16,17 Später werden erworbene Handlungsschemata auf verschiedene neue Situationen angewendet und ausprobiert, bis schließlich neue Handlungsschemata durch Kombinieren bereits erworbener Schemata („aktives Experimentieren“) entdeckt werden.16,17
Ab dem 6. Monat ist die Kommunikation noch immer sehr stark durch das nonverbale Verhalten bestimmt (Mimik, Gestik, Körperhaltung). Das Kind wird zunehmend fähiger, das nonverbale Verhalten der Erwachsenen zu lesen.
Im ersten Lebensjahr befindet sich der Säugling in völliger Abhängigkeit von seinen Eltern (oder anderen Pflegepersonen). Wichtigster Ansprechpartner für erste Maßnahmen der Zahn- und Mundhygiene stellt demnach die Familie dar. Wichtigste Zielperson für zahnärztliche Interventionen ist demnach i. d. R. die Mutter. Bei der zahnärztlichen Beratung ist zu beachten, in welcher Phase der Problemverarbeitung (z. B. Pflege des ersten Zahnes, Zuckerkonsum) die Hauptbezugsperson sich befindet. Es macht einen Unterschied, ob die Hauptbezugsperson
sich ihres Problemverhaltens überhaupt nicht bewusst ist (Phase des unreflektierten Verhaltens),
sich bereits mit dem Problemverhalten kognitiv auseinandersetzt (Phase der Reflexion),
bereits Schritte zur Änderung des Problemverhaltens unternommen hat (Phase der Aktivität) oder
das erwünschte Verhalten bereits eine Zeit über praktiziert (Phase der Verhaltensstabilisierung).
Je nachdem, auf welcher Stufe eine Hauptbezugsperson anzutreffen ist, hat es Konsequenzen für die zahnärztliche Intervention. Dies gilt im Übrigen für alle Entwicklungsstufen des Kindes.
1.3 Kleinkind (1–3 Jahre)
Ch. Splieth, U. Wiesmann
Größe*:
70–80 cm (1 Jahr) bis 90–102 cm (3 Jahre)
Gewicht*:
8,5–11 kg (1 Jahr) bis 12,5–17 kg (3 Jahre)
(* jeweils 3 %- bis 97 %-Perzentile1)
1.3.1 Orale Entwicklung
Alle Zähne des Milchgebisses brechen in der Kleinkindphase durch (Kap. 1.2, Tab. 1). Ein frontal lückiges Milchgebiss ist dabei physiologisch (Abb. 1.3-1), und es bietet Platz für die größeren, permanenten Zähne. Da die bleibenden Zähne noch gebildet werden, können gerade bei der Apposition und Kalzifikation noch Fehlbildungen (Hypoplasien bzw. Hypokalzifikationen/-mineralisationen) durch systemische (Fluoride, Tetracycline, etc.) und lokale (entzündliche Prozesse, Traumata) Faktoren entstehen. Die perinatal mineralisierenden permanenten Inzisivi und ersten Molaren sind dabei besonders häufig als Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) davon betroffen.
Abb. 1.3-1 Lage der Zahnkeime (8-10); Modell von Maxilla (2) und Mandibula (3) bei einem einjährigen Kind.
Die Zahnkeime der bleibenden Frontzähne sind in der Aufbissaufnahme dorsal von den Milchzahnkeimen gelegen (Abb. 1.3-2). Mit dem Durchbruch der Zähne nimmt die Höhe des Alveolarkammes zu. Der aufsteigende Ast des Unterkiefers ist noch sehr flach, das Foramen mandibulare liegt unter der Okklusionsebene, was bei Leitungsanästhesien zu berücksichtigen ist (Abb. 1.3-1).
Abb. 1.3-2 Schemazeichnung einer Aufbissaufnahme mit Lage der Milchzähne (dunkel) und Zahnkeime (hell) in Maxilla (links) und Mandibula (rechts) bei einem ca. einjährigen Kind.
Orale Probleme
Frühkindliche Karies, Fissurenkaries an Milchmolaren
Zahnungsbeschwerden
Frontzahntrauma
Multiple kariöse (Initial-)Läsionen aufgrund der häufigen Zufuhr von Kohlenhydraten aus Saugerflaschen sind der Hauptgrund für einen Besuch beim Zahnarzt (Prävalenz bei 3-Jährigen ca. 14 %, Abb. 1.3-3, s. Kap. 4.5). Schmelzbildungsstörungen an Milchzähnen sind dagegen sehr selten!
Abb. 1.3-3 Läsionen an Milchzähnen sind meist kariesbedingt und keine Schmelzbildungsstörungen. Frühkindliche Karies ist typischerweise flächig und betrifft initial die zuerst durchbrechenden Frontzähne.
Frontzahntraumata passieren häufig in der Phase des Laufenlernens. Glücklicherweise liegen die Zahnkeime der permanenten Frontzähne nicht in der Längsachse der Milchzähne, sondern weiter palatinal, so dass Intrusionen bei sehr kleinen Kindern seltener zu bleibenden Zahnschäden führen (Abb. 1.3-2 und 1.3-4, s. Kap. 3.10). Traumata können leider kaum präventiv angegangen werden und sind aufgrund der Dialogunfähigkeit der Kinder oft schwierig zu behandeln.
Abb. 1.3-4 Bei axialen Intrusionen sind bei sehr kleinen Kindern Schäden an den bleibenden Zähnen unwahrscheinlicher (links), da der Zahnkeim palatinal liegt, als bei 3- bis 5-Jährigen (rechts), wenn sich der Zahnkeim direkt über dem Milchzahn befindet.
Zahnungsbeschwerden s. Kap. 1.2.1.
Betreuungsziele beim Kleinkind
Aufbau eines Betreuungsverhältnisses zum Kind bzw. zur Familie
Vertrautmachen mit zahnärztlicher Praxis
Inspektion (orale Fehlbildungen, Zahndurchbruch, kariöse (Initial-) Läsionen, Plaque)
Gesunde, zahngerechte Ernährung zur Vermeidung von Flaschenkaries
Aufklärung über Kariesätiologie
Verbesserung der Mundhygiene durch die Eltern
Optimale Fluoridnutzung
Kontrolle von Lutschhabits und ggf. Abstellung
1.3.2 Verhalten und psychische Entwicklung
Mit zunehmender Mobilität und sprachlichem Ausdrucksvermögen entsteht bei dem Kind ein Drang zur Selbstständigkeit, der um das 2./3. Lebensjahr in einer Trotzphase mündet. Dieser Trotz, der gekennzeichnet ist durch eine hohe Erregbarkeit und heftigen körperlichen und affektiven Reaktionen, ist nicht entwicklungsbedingt, sondern ein Ausdruck der Entdeckung des Ichs. Mit den sich differenzierenden kognitiven Fähigkeiten und den Wahrnehmungen innerer Vorgänge (Gefühle und Motivationszustände) macht das Kind die Erfahrung, dass eigene Vorstellungen, Pläne und Wünsche der Mitwelt entgegengestellt werden können. Das Kind wird (im positiven Sinne) eigensinnig. So lehnt es z. B. häufig Handlungen der Eltern (z. B. Windeln, Füttern, Zähneputzen) ab und will vieles alleine machen. Das Kind lotet seinen Freiraum aus, wie weit es sich den Forderungen der Pflegepersonen gegenüber behaupten kann.
Trotzreaktionen führen innerhalb der Familie zu Konflikten. Auf Seiten des Kindes stellen sich danach häufig ambivalente Gefühlshaltungen ein. Es spürt den Druck der Eltern, wenn sie nicht nachgeben, und die Liebe zu den Eltern kehrt sich kurzzeitig in zuweilen heftige Ablehnung um. Daraus können u.a. Schuldgefühle resultieren. Als Reaktion darauf versucht das Kind, sich der Liebe der Eltern zu versichern oder durch provokantes und widersetzliches Verhalten eine Entsühnung durch Strafe herbeizuführen. Dem elterlichen Erziehungsverhalten kommt die schwierige Aufgabe zu, diesen Konflikt angemessen zu lösen.
Das Kind verliert seine Trennungsangst erst ab dem zweiten bzw. dritten Lebensjahr. Diese heftige emotionale Reaktion auf eine Trennung von der Hauptbetreuungsperson (i. d. R. die Mutter) ist Ausdruck eines Bindungsverhaltens zu dieser Hauptbezugsperson, das für die Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle spielt. In diesem Zusammenhang ist die Entdeckung des eigenen Selbst (z. B. das Erkennen des eigenen Gesichtes oder Körpers im Spiegel) eine wesentliche Errungenschaft. Wie bereits die Funktion der Trotzphase zeigt, finden erste wichtige Entwicklungsschritte zu einer eigenständigen Persönlichkeit statt (Individuation). Auf dem Weg dahin muss es sich kontinuierlich Trennungs- und Loslösungserfahrungen aussetzen, und hat die Möglichkeit, in Abständen in der Nähe der Mutter Schutz zu suchen und emotional „aufzutanken“. Kinder zeigen bedeutsame interindividuellen Unterschiede im Bindungsverhalten, die sich später in deutlichen Persönlichkeitsunterschieden manifestieren.
Ab dem ersten Lebensjahr findet eine erste Gewissensbildung statt. Das Kind internalisiert Normen und Wertvorstellungen der Eltern. Es entwickelt, unabhängig davon, ob es sich daran hält oder nicht, eine Vorstellung davon, was „gut“ und „böse“, was „erlaubt“ und „verboten“ ist. Es bildet sich eine autonome Instanz heraus (im psychoanalytischen Sinne ein „Über-Ich“), die für das Denken, Fühlen und Verhalten der Kinder eine entscheidende Bedeutung hat. Gewissensverstöße lösen emotionale Reaktionen hervor („Gewissensbisse“), und das Kind zeigt häufig angepasstes Verhalten, um diese negativen Emotionen nicht erleben zu müssen.
Mit etwa einem Lebensjahr stellt sich das selbstständige Laufen ein. Mit dieser neuen Fähigkeit ist eine Erweiterung des kindlichen Neugier- und Explorationsverhaltens hinsichtlich Variabilität und Komplexität verbunden. Neben der Zeigegeste lernt das Kind die nonverbalen Signale des Nickens und Verneinens (Kopfschütteln) adäquat einzusetzen. Es zeigen sich erste Ansätze der Sprachentwicklung in Form von Einzelwörtern. Das Kind versteht verbale Handlungsaufforderungen und kommt ihnen nach. Es ist in der Lage, Ereignisfolgen zu behalten. Ereignisfolgen im Sinne von „Ritualen“ haben einen sehr hohen Stellenwert, weil sie Sicherheit und Orientierung bieten. Kinder legen großen Wert darauf, dass bestimmte Rituale (z. B. der Ereignisablauf des Zu-Bett-Gehens) eingehalten werden.
Die grundlegenden Veränderungen im Alter von 18–24 Monaten lassen sich wie folgt charakterisieren: Die motorischen Fähigkeiten werden weiter ausdifferenziert und stetig erweitert. Beispielsweise wird aus dem ersten, unsicheren Laufen ein Rennen und Hüpfen. Die linguistische Kompetenz entfaltet sich: Ungefähr mit 18 Monaten bilden Kinder Zwei-Wort-Sätze, mit ca. 28 Monaten Drei-Wort-Sätze. Vokale und gestische Kommunikationsweisen finden Eingang in das Verhaltensrepertoire. Kognitive Veränderungen lassen sich als Entwicklung der Fähigkeit beschreiben, intentional vorzugehen, d. h. eigene Handlungen auf ein Ziel hin auszurichten, und Handlungsergebnisse auf die eigene Person zu beziehen („Selbermachen wollen“). Ab dem zweiten Lebensjahr sind Kinder zu gesundheitsförderlichem Verhalten (Zähneputzen) unter Anleitung motivierbar, weil es neue Handlungsmöglichkeiten und ein neues Ausprobieren bietet. Die Eltern sind hier aufgefordert, die Motivierbarkeit des Kindes zu unterstützen und durch gezielte Hilfestellungen mitzuhelfen, dass es ein Gesundheitsverhalten erlernt und Spaß an dessen Ausführung hat. Das setzt eine Gesundheitsmotivation auf Seiten der Eltern voraus, die es von zahnärztlicher Seite zu unterstützen gilt.
Mit 2 bis 3 Jahren versteht das Kind einfache Sätze fremder Personen und kann prinzipiell in zahnärztliche Maßnahmen mit einbezogen werden. Insgesamt gesehen ist die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder sehr kurz, so dass nur ein eingeschränktes Training und minimale professionelle Maßnahmen möglich sind. Es finden sich Ansätze des ersten sog. Symbolspiels („so tun als ob“). Das Kind wird zunehmend in der Lage, sich eine eigene Wirklichkeit zu schaffen und darin zu versinken. Gesundheitserzieherische Maßnahmen sollen daher ab dem dritten Lebensjahr in spielerischer Form erfolgen und die Phantasie und Vorstellungswelt anregen.
Präventionsbemühungen sollten bei Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren ebenfalls familienzentriert sein. Die Familie (bzw. die Pflegeperson) ist der natürliche Lebensraum des Kindes und bestimmt die Ausbildung von gesundheitsrelevanten Habits (z. B. Konsum von Süßigkeiten). Es ist wichtig, innerhalb der Familie gesundheitsrelevante Rituale zu entwickeln (z. B. nach jeder Mahlzeit und insbesondere vor dem Zu-Bett-Gehen die Zähne putzen), die von den Kindern dann selbst eingefordert werden können.
1.4 Kindergartenkind (3–6 Jahre)
Ch. Splieth, U. Wiesmann
Größe*:
90–102 cm (3 Jahre) bis 110–127 cm (6 Jahre)
Gewicht*:
12,5–17 kg (3 Jahre) bis 16–28 kg (6 Jahre)
(* jeweils 3 %- bis 97 %-Perzentile1)
1.4.1 Orale Entwicklung
Maxilla und Mandibula sind fast vollständig mit den Keimen der permanenten Zähne gefüllt (Abb. 1.4-1), was bei Traumata, periapikalen Prozessen und zahnärztlichen Behandlungen (Injektion, Extraktion, Wurzelbehandlung) des Milchgebisses zur Schädigung wie z. B. Hypoplasien, Dilazeration und Dysplasien der permanenten Zähne führen kann.
Abb. 1.4-1 Maxilla mit Milchzähnen und Zahnanlagen bei einem 5-jährigen Kind.
Die Ausdehnung der Kiefer bis zum zweiten Milchmolaren ändert sich kaum. Aufgrund der Entwicklung der bleibenden Zähne wachsen lediglich die basalen und distalen Anteile der Kieferkämme, während das komplette Segment des Milchgebisses konstant bleibt. Dies ermöglicht die Eingliederung von Kinderprothesen, da keine wiederholte Anpassung an das Wachstum nötig ist und das Wachstum nicht gehemmt wird. Approximale kariöse Defekte der Milchmolaren oder deren vorzeitiger Verlust können zu einem Aufwandern der Molaren und damit zu einem symptomatischen Engstand führen.
Bei der Mineralisation der bleibenden Zähne können noch Hypoplasien bzw. Hypokalzifikationen oder Verfärbungen durch systemische (Fluoride, Tetracycline, etc), idiopathische (z. B. präeruptive Läsionen oder MIH) und lokale (entzündliche Prozesse wie Turner-Zahn oder Traumata) Faktoren entstehen (Kap. 1.5, Tab. 1). Im OPG sind mit 5–6 Jahren mit Ausnahme der Weisheitszähne alle angelegten Zähne zu erkennen (Abb. 1.4-2). Systemischen Erkrankungen (Diabetes mellitus, Immundefekte, Leukämie), Infektionen (Scharlach, Masern, Windpocken, Herpes simplex) bedingen häufig Veränderungen der Mundschleimhaut und sind abzuklären (s. Kap. 2.2).
Abb. 1.4-2a und b OPG eines 3-jährigen und eines 5-jährigen Jungen.
Eruptionszysten sind oft im Zusammenhang mit noch nicht durchgebrochenen Zähnen zu beobachten. Klinisch zeigen sich Eruptionszysten als durchscheinende bis bläuliche Schwellung, am häufigsten im Oberkiefer bei dem Durchbruch der zentralen Schneidezähne, aber auch die ersten bleibenden Molaren können betroffen werden.
Weiterbestehende Lutschhabits sollten in diesem Alter abgestellt werden, da sie in einem frontal offenen Biss und einer Unterkieferrücklage resultieren (Abb. 1.4-3). Idealerweise ist das Milchgebiss in der Front lückig (Abb. 1.4-3). Zwangsbisse (z. B. einseitiger Kreuzbiss) und ausgeprägte Progenien (sag. Stufe > 6mm) führen zu ungünstigen Wachstumsprozessen, die durch eine kieferorthopädische Frühbehandlung korrigiert werden sollten (s. Kap. 3.12).
Abb. 1.4-3 Lutschoffener Biss: Daumen- oder Schnullerlutschen sollten im Kindergartenalter abgewöhnt, die konsequente Mundhygiene angewöhnt werden.
Orale Probleme
Karies an Milchmolaren
Symptomatischer Engstand aufgrund vorzeitigen Milchmolarenverlustes
Lutschoffener Biss
Karies und Folgeerkrankungen stellen das größte orale Problem dar, aber auch erworbene (lutschoffener Biss, symptomatischer Engstand) und genetisch bedingte Dysgnathien sind bei ca. 50 % der Kinder vorhanden. Die kinderzahnärztliche Betreuung sollte alle oralen Erkrankungen und Funktionsstörungen, aber auch allgemeinmedizinisch relevante (Entwicklungs-)Veränderungen einschließen. Die (kinder)zahnärztliche Betreuung sollte als selbstständige Säule neben dem Kinderarzt etabliert werden.
Mit 5 bis 6 Jahren tritt oft ein dumpfer Wachstumsdruck im Bereich der ersten permanenten Molaren auf, der als „Zahnschmerz“ wahrgenommen wird.
Betreuungsziele bei Kindergartenkindern
Vertiefung des Betreuungsverhältnisses
Vertrautmachen mit zahnärztlichen Maßnahmen
Gesunderhaltung des Milchgebisses
Eingehende Untersuchung
Vermeidung von kariogenen Ernährungsgewohnheiten
Entwicklung der manuellen Geschicklichkeit fürs Zähneputzen
Optimale Mundhygiene durch Nachputzen der Eltern
Optimale Fluoridnutzung
ggf. Entwöhnung von Lutschhabits
Abb. 1.4-4 Das Milchgebiss weist idealerweise Lücken zwischen den Frontzähnen auf.
1.4.2 Verhalten und psychische Entwicklung
Nach Piaget16,17 befindet sich das 3-jährige Kind im Stadium des voroperatorischen, anschaulichen Denkens. Es ist in seiner abstrakten Denkfähigkeit noch stark eingeschränkt. Kinder glauben, was sie sehen (naiver Realismus). Das Denken ist stark abhängig von Anschauungen, weniger von Regeln und Begriffen. Kinder wissen nicht nur, dass Objekte beständig sind (Objektpermanenz), sondern sie beginnen auch zu lernen, dass die Identität von Objekten trotz Veränderungen des Aussehens erhalten bleibt. Das voroperatorische Denken ist gekennzeichnet durch Zentrierung auf ein oder wenige Merkmale. Das Kind ist nicht in der Lage, auf mehrere Wahrnehmungen gleichzeitig zu achten. Piaget spricht vom Egozentrismus des Kindes, wenn er dessen Schwierigkeit beschreibt, sich Dinge aus der Perspektive eines anderen anzusehen. Das Denken kennzeichnet sich durch eine eingeschränkte Beweglichkeit. Damit können Kindergartenkinder keine eigenständige Verantwortung für ihre Ernährung, Hygiene oder ärztliche Behandlung übernehmen.
Die Gedächtnisspanne (Kurzzeitgedächtnis) des 3-Jährigen ist verglichen mit älteren Kindern und Erwachsenen gering. 3-Jährige besitzen noch nicht in dem Maße strategische Kompetenzen für Behaltensleistungen im Langzeitgedächtnis. Zudem ist ihre Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit geringer. Dennoch lässt sich zeigen, dass Vorschulkinder durchaus Memorierstrategien erwerben können. Das Problem besteht lediglich in der spontanen Umsetzung.
Die Aufmerksamkeitsspanne ist mit drei Jahren noch nicht sehr ausgeprägt. Es ist eine ausgesprochene „Flüchtigkeit“ in der Aufmerksamkeitslenkung festzustellen. Kinder in diesem Alter sind durchweg von ihrer Neugiermotivation getrieben und sind daher leicht ablenkbar. Sie sind nicht zu einer „systematischen Beobachtung“ fähig, sondern reagieren impulsiv auf Anreize in ihrer Umgebung.
Das 3-jährige Kind zeichnet sich bereits durch eine beachtliche linguistische Kompetenz aus. Es ist in der Lage, Sätze in beeindruckender Komplexität zu bilden und zu formulieren. Im Alter von fünf Jahren ist es in der Lage, fast schon wie ein Erwachsener, Sprache gezielt und differenziert einzusetzen. Es formuliert Wünsche, Bitten, Vorschläge, Fragen und es ist in der Lage, sprachlich Begründung für sein Verhalten zu geben. Es zeichnet sich zunehmend durch grammatikalische Fähigkeiten aus. Mit dem Eintritt in die Schule beherrscht das Kind ca. zweieinhalbtausend Wörter.
Das Spiel als Aktivitätsfeld ist ein besonderes Phänomen der Kindheit. Das Kind ist von sich aus – spontan – an der Ausführung bestimmter Tätigkeiten interessiert (intrinsische Motivation). Der Sinn des Spiels besteht darin zu spielen; es geht nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Der Zweck des Spieles liegt also im Spiel selbst. Im Spiel geht es um die Entfaltung der Phantasie und Vorstellungswelt. Gegenstände, Spielsachen können im Spiel eine neue Bedeutung zugeschrieben werden, so dass in der Vorstellung des Kindes „übliche“ Objektfunktionen geleugnet oder umgedeutet werden. Im Spiel stellen Kinder eigene Regeln auf; sie orientieren sich dabei nicht an Vorgaben, die von außen an sie herangetragen werden. Das Spiel ist eine durch und durch aktive Tätigkeit, zielgerichtet und selbstbestimmt. Die Bedeutung des Sozialspiels und des Regelspiels (abgegrenzt vom Symbolspiel, „so tun als ob“) zeigt die beginnende Fähigkeit zur Rolleneinnahme und –übernahme. Die sozialen Kompetenzen erweitern sich auf diese Weise.
Ein weiteres Ziel des Vorschulalters besteht in der Entwicklung des sozialen Verhaltens in Richtung Kooperation. Waren die ersten sozialen Beziehungen auf die Mutter (Pflegeperson mit Autorität) konzentriert, rücken nun verstärkt andere Kinder in den Blickpunkt. Das Kind muss sich verstärkt mit Gleichaltrigen auseinandersetzen, die eben keine vorgegebene Autorität darstellen. Auf diese Weise hat es die Möglichkeit, selbstsicheres Verhalten zu erlernen (in angemessener Form eigene Wünsche anderen gegenüber vertreten sowie unangemessene Forderungen anderer zurückweisen), prosoziale Einstellungen zu erwerben und sozialen Austausch zu erfahren (gegenseitiges Geben und Nehmen). Über die Rückmeldung anderer Kinder lernt das Vorschulkind sich selbst besser kennen und einschätzen.
Eine wesentliche Aufgabe des frühen Kindheitsalters und ein wesentlicher Schritt für die Persönlichkeitsentwicklung ist die Identifikation mit dem eigenen Geschlecht – die Entwicklung der Geschlechtsidentität. Das Erleben – ein Mädchen oder ein Junge zu sein – ist wichtig für Wohlbefinden und Orientierung.
Präventionsbemühungen in diesem Alter werden besonders wirksam, wenn die Kinder in spielerischer Form die zu vermittelnden Inhalte aufgreifen und auf diese Weise kognitiv verarbeiten können. Bei der Informationsvermittlung ist darauf zu achten, dass das anschauliche Bild in diesem Alter außerordentlich wichtig ist. Kinder haben ein ausgeprägtes Imaginationsvermögen. Besonders hilfreich ist es, Kinder selbst malen zu lassen, was sie über bestimmte sinnvolle Verhaltensmuster (z. B. Zahnpflegeverhalten) denken und empfinden („das Kind zeichnet, was es weiß, nicht, was es sieht“).
Für Interventionen im Bereich der Prävention ist die Familie (Eltern und Kind) nach wie vor der eigentliche Adressat, weil sie die Lebensweise des Kindes bestimmt und kontrolliert. Andererseits übt das Kind auch zunehmend Einfluss auf die Familie aus. So bringt das Kindergartenkind Anregungen aus dem Hort mit nach Hause. Findet das Kind Spaß an „sinnvollen“ Gesundheitsverhaltensweisen (wie z. B. Zähneputzen), die in der Familie selten bzw. unregelmäßig praktiziert werden, kann durch entsprechende zahnärztliche Bemühungen (Informationsgebung an die Eltern und Kommunikationsgestaltung) die dauerhafte Implementierung von Zahnpflegeverhalten in der Familie (und eine Verhaltensänderung der gesamten Familie) angestrebt und erreicht werden.
Nach einer kurzen Phase des Kennenlernens (Herstellen von Vertrautheit) können Kindergartenkinder in der Praxis als echte Partner behandelt werden, und eine präventive Behandlung macht ihnen Spaß. Die Kinder freuen sich, wenn sie etwas erlernt oder erreicht haben und betonen oft ihre Selbständigkeit. Ein besonderes Lob ist für sie: „Das kannst du ja schon wie ein Großer“. In der Familie nicht genügend geförderte oder gar unterdrückte Kinder sind in diesem Alter oft schon auffällig: Sie haben vor vielem Angst, und emotionale Probleme, die durch heftiges Schreien oder Toben Ausdruck finden, sind bereits fest eingeschliffen. Das Vertrauen in Erwachsene ist reduziert und selbst einfache Maßnahmen wie Zähneputzen gestalten sich schwierig. Die Diskussions- und Verhandlungsfähigkeit sind eingeschränkt. Bei diesen Kindern ist – unabhängig von den Kommunikationsmechanismen in der Familie – ein eigenständiges Vertrauensverhältnis zum Praxisteam aufzubauen (s. Kap. 3.1 und 4.1).
Zahnärztliche Interventionen sollten insbesondere Familien mit Problemen als Zielgruppe beinhalten. Familien können einerseits über die Kindergärten erreicht werden, andererseits könnten mobile Einsätze von Zahnärzten in verschiedenen Stadtteilen einen Kontakt herstellen. Eltern-Merkmale wie Arbeitslosigkeit, geringes finanzielles Einkommen, geringer Bildungsgrad, Alkoholabusus etc. erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Kindern ein angemessenes Ernährungs- und Zahnpflegeverhalten eher nicht vermittelt wird. Hier kann aufsuchende professionelle Förderung z. B. im Kindergarten hilfreich sein.
1.5 Schulkind (6–12 Jahre)
Ch. Splieth, U. Wiesmann
Größe*:
110–127 cm (6 Jahre*) bis 140 cm (12 J)
Gewicht*:
16–28 kg (6 Jahre*)
(* jeweils 3 %- bis 97 %-Perzentile1)
1.5.1 Orale Entwicklung
In der Wechselgebissphase zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr werden die Milchzähne durch die Ersatzzähne der permanenten Dentition ausgetauscht (Tab. 1, Abb. 1.5-1). Das Wurzelwachstum ist jeweils ca. 3 Jahre nach Durchbruch beendet. Die präeruptive Mineralisation der permanenten Frontzähne ist im Wesentlichen abgeschlossen, so dass Fluoride ohne die Gefahr einer Dentalfluorose eingesetzt werden können.
Abb. 1.5-1 OPG eines 7-jährigen Jungen mit multipler Primärkaries, Restaurationen, Sekundärkaries und unterminierender Resorption bei Zähnen 65/26.
Am Anfang (6 J) und am Ende (12 J) der Wechselgebissphase brechen die ersten und zweiten permanenten Molaren als Zuwachszähne durch, was jeweils mit einer Bisshebung einhergeht. Wenn die Milchzahnreihe mit einer distalen Stufe endet (Abb. 1.5-2a), können die ersten permanenten Molaren bereits in ihre reguläre Position durchbrechen. Bei einer End-End-Verzahnung (Abb. 1.5-2b) kann diese Verzahnung erst durch Mesialwanderung und Lückenschluss im Unterkiefer erreicht werden. Die letzte Feinverzahnung findet erst in der Wechselgebissphase II (Stützzonen) statt, insbesondere da der Leeway-Platz (Größenunterschied zwischen den mesio-distalen Kronenbreiten der Milcheckzähne und -molaren im Vergleich zu ihren permanenten Nachfolgern)im Unterkiefer um ca. 1 mm größer ist als im Oberkiefer, so dass die Unterkiefermolaren ca. noch 1 mm weiter nach mesial wandern können. Die Einstellung der Okklusion kann mit einem erheblichen Knirschen einhergehen, das als physiologisch anzusehen ist.
Tabelle 1 Mineralisation und Durchbruch der bleibenden Zähne2
Zahn
Mineralisationsdauer (postnatal)
Durchbruchsalter
Unterkiefer
Oberkiefer
Unterkiefer
Oberkiefer
Mittlerer Schneidezahn
3. Monat bis 5. Lebensjahr
6–7Jahre
7 Jahre
Seitlicher Schneidezahn
11. Monat bis 6. Lebensjahr
3. Monat bis6. Lebensjahr
7 Jahre
8 Jahre
Eckzahn
4. Monat bis5. Lebensjahr
4. Monat bis6. Lebensjahr
9–10 Jahre
11–12 Jahre
1. Prämolar
18. Monat bis 7. Lebensjahr
10 Jahre
10 Jahre
2. Prämolar
24. Monat bis 7. Lebensjahr
11 Jahre
11 Jahre
1. Molar
Geburt bis 4. Lebensjahr
6 Jahre
6 Jahre
2. Molar
30. Monat bis 7. Lebensjahr
12 Jahre
12 Jahre
3. Molar
7. bis 13. Lebensjahr
16–30 Jahre
Abb. 1.5-2a und b Die distale Stufe der Milchmolaren führt meist zu einer eugnathen Verzahnung der ersten permanenten Molaren (oben), bei einer End-End-Verzahnung der Milchmolaren (unten) kann dies erst durch Lückenschluss oder den größeren Leeway-Platz (Differenz zwischen Prämolaren und Milchmolaren) im Unterkiefer erreicht werden.
Mitunter kann der Durchbruch von permanenten Zähnen gestört sein. Besonders häufig ist die unterminierende Resorption am zweiten Milchmolaren durch den ektopische Durchbruch der ersten bleibenden Molaren (Abb. 1.5-1). Dies kann zufällig bei einer Routineröntgenaufnahme oder klinisch durch erhöhte Mobilität oder sogar den vorzeitigen Verlust des zweiten Milchmolaren um das 5. Lebensjahr diagnostiziert werden. Dies erfordert eine angemessene Behandlung wie z. B. das Beschleifen oder Extraktion des zweiten Milchmolaren, um den vollständigen Verlust des Platzes und die Impaktion des zweiten Prämolaren zu verhindern.
Während der Wechselgebissphase I (Inzisivi) ist näherungsweise ablesbar, ob Dysgnathien und insbesondere ein Platzmangel für die permanente Dentition vorliegen werden.
Der deutlich höhere Platzbedarf der permanenten Inzisivi wird durch (Abb. 1.5-3):
Abb. 1.5-3 Die Überlagerung von Milchzahnbogen und permanenten Zähnen zeigt, wie der größere Platzbedarf für die bleibenden Frontzähne kompensiert wird (primär lückiges Milchgebiss, bukkale Inklination der bleibenden Inzisiven und Leeway-Space distal der Eckzähne).
ein Schließen der Lücken im Milchgebiss
den größeren Radius des bleibenden Frontzahnbogens
ggf. den Platzüberschuss im Seitzahngebiet (Leeway-Platz, s. o.) erfüllt.
Mit ungefähr 9 Jahren suchen viele Eltern den Zahnarzt auf, da die Oberkieferfrontzähne fächerförmig und lückig stehen. Diese im Englischen als „hässliches Entlein“ bezeichnete Phase ist physiologisch: Der Durchbruch der permanenten oberen Eckzähne schiebt die Inzisivi ohne kieferorthopädische Therapie zusammen und korrigiert ihren Achsenstand (Abb. 1.5-4). Auch leichte Engstände in der Front können sich durch den Leeway-Platz mit Durchbruch der kleineren Prämolaren alleine auflösen.
Abb. 1.5-4a und b Der Durchbruch der bleibenden Frontzähne führt im Alter von ca. 9 Jahren zu einer Phase mit lückigen, divergierenden Frontzähnen, was sich meist mit dem Durchbruch der permanenten Eckzähne reguliert.
Der Platz für die Zuwachszähne entsteht im Unterkiefer durch Resorption des aufsteigenden Astes im retromolaren Bereich und appositionelles Wachstum im Kieferwinkel, was zu einer distalen Verlängerung der Kieferkämme führt. Weiterhin findet ein enormes Vertikalwachstum statt (Abb. 1.5-5). Mit Durchbruch der zweiten permanenten Molaren kommt es zur definitiven Ausformung der Okklusion und des Kiefergelenkes, dessen Ausformung und Gelenkbahnen sich nach Abschluss des Wachstums nur noch geringfügig verändern lassen.
Abb. 1.5-5 Die Alveolarkämme von Ober- und Unterkiefer sowie die Rami mandibulae wachsen vertikal erheblich zwischen dem ersten und dem 18. Lebensjahr. Auch das Foramen mandibulae verlagert sich relativ nach kranial.
Typische orale Probleme
Karies an Milchmolaren und ersten permanenten Molaren
Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH)
Gingivitis
Dysgnathien
Frontzahntraumata





























