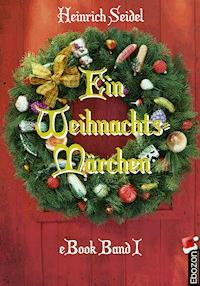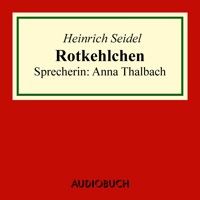Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Heinrich Seidels Werk 'Kinkerlitzchen' ist ein faszinierender Einblick in das Leben der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Das Buch, das in Briefform verfasst ist, zeigt die sozialen Normen und kulturellen Eigenheiten dieser Zeit auf eine humorvolle und satirische Weise. Seidels literarischer Stil zeichnet sich durch seine präzise Beobachtungsgabe und seinen scharfen Verstand aus, was dem Leser eine unterhaltsame, aber auch informative Lektüre bietet. 'Kinkerlitzchen' wird oft als ein Werk des bürgerlichen Realismus betrachtet, das die Alltagswelt auf eine humorvolle und zugängliche Weise darstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kinkerlitzchen
Books
Inhaltsverzeichnis
Zukunfts-Poesie
»Dumme Phrase!« sagte der glattrasirte ältliche Herr mit dem fetten grauen Gesicht und den grossen wasserblauen Augen, der mit mir im Café »Bohnenstengel« an einem Tisch sass. »Dumme Phrase«, wiederholte er noch einmal, rollte heftig die Zeitung zusammen, in der er gelesen hatte, und legte sie mit einem entrüsteten Ruck auf den Tisch: »die grossen Dichter sind die Leuchten der Menschheit! – Blech!« sagte er dann mit grossem Nachdruck und blickte mich herausfordernd an.
»Haben Sie etwas dagegen?« fragte ich sanft, denn der Mann sah sehr wüthend aus, und ich fürchtete, er würde mir was thun, wenn ich ihn nicht diplomatisch behandelte. Eine Zeit lang sah er mich starr an, und um seinen breiten Mund spielte ein halb überlegenes, halb verächtliches Lächeln. Dann ergriff er mit einer erhabenen Armbewegung ein volles Glas Nordhäuser, das die Kellnerin soeben gebracht hatte, goss es mächtig hinab wie zur Besänftigung dessen, das in ihm kochte, und sagte dann verhältnissmässig milde: »Nichts habe ich dagegen, wenn mit den »Leuchten« jene rothen Laternen gemeint sind, die in engen Gässchen brennen und den unerfahrenen Jüngling in den Sumpf locken.«
»Aber Goethe doch . . .,« wagte ich schüchtern einzuwenden.
»Goethe?!« – erwiderte der Mann mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von erhabener Verachtung, während er seine Augen so weit aufriss, dass sie den Eindruck von zwei Hühnereiern mit hellblauen Dottern machten: »Goethe?!« – Meinen Sie vielleicht den »Faust« mit seinem aufgewärmten mittelalterlichen Hexenspuk, dies über die Maassen unmoralische Stück, dessen Hauptanziehungspunkt die Verführung eines kaum dem Kindesalter entwachsenen unschuldigen Mädchens bildet, dieses Stück, dessen Bestandtheile Teufelskram, Mord, Schande, Wahnsinn und Gemeinheit sind? Schaudert Sie nicht, wenn Sie an die »Wahlverwandtschaften« denken und an »Wilhelm Meister's liederliche Lehrjahre«? Was hat »Werther« anders für Nutzen gestiftet, als dass überspannte Jünglinge ihre Studien vernachlässigten, in blauen Leibröcken, gelben Westen und Stulpenstiefeln umherliefen, sich in die Bräute ihrer Freunde verliebten und sich gelegentlich todtschossen? Was sind die »römischen Elegien« anders als Lasterhaftigkeit, in goldenen Schalen dargeboten? Und ist das Leben dieses sogenannten Dichters nicht eine Kette von frivolen Liebschaften bis an sein leider so spätes Ende? O gehen Sie mir mit dieser »Leuchte der Menschheit«!« Entrüstet legte er sich in seinen Stuhl zurück und goss Oel auf die aufgeregten Wogen seiner Gefühle, indem er sein gefülltes Bierglas in einem Zuge leerte.
Zu Boden gedrückt von der gewaltigen Wucht dieses Mannes und halb verschüchtert flüsterte ich zaghaft: »Sie werden Schiller doch gelten lassen?«
Ich sah, wie es in ihm emporkochte, wie eine bläuliche Röthe in sein erdiges Gesicht stieg und seine Augen einen stieren schlagflüssigen Ausdruck annahmen. Aber der Mann kämpfte und bezwang sich, und nach einer Weile gelang es ihm zu antworten, und zwar in einer milden singenden Weise, die durch niedergekämpfte Entrüstung einen ganz besonderen Beigeschmack erhielt.
»Schiller,« begann er fast schmeichlerisch in einer ganz unnatürlich hohen Tonlage, »Schiller, der seine Laufbahn begann mit den »Räubern«, einer Verherrlichung von Raub, Mord, Todschlag und Brandstiftung, Schiller, der Deserteur, ein Mensch, der sich zu seinen Dichtungen erst durch den Geruch fauler Aepfel begeistern musste – Schiller! . . .« Und damit stiess er ein kleines feines in i gestimmtes Gelächter aus und fuhr mit seiner grossen fetten und feuchten Hand über den Tisch, als könne er dadurch das Gedächtniss dieses After-Poeten für ewige Zeiten auslöschen.
Ich war einigermaassen vernichtet und benutzte die Zeit, während der Mann sich ein neues Glas Bier und einen grossen Nordhäuser bestellte, ihn näher zu betrachten. Seine Kleidung: war grau und abgetragen und hing etwas beutelig um den schwammigen Körper; die Aermel und Hosenknie schienen mir blank und etwas fettig zu sein. Ueberhaupt war Reinlichkeit scheinbar nicht die Sache, die dieser Mann als Sport betrieb, denn auf seinem zerknitterten Vorhemde befanden sich einige »Muster ohne Werth« verschiedener Mittagsmahlzeiten, und sein Hemdskragen schien von voriger Woche zu sein, was, da wir schon Donnerstag hatten, auf Ausdauer und Sparsamkeit schliessen liess. Im Grossen und Ganzen sah er aus wie ein alter fetter Kellner in Civil.
Nachdem dieser Mann sich nun durch einen tiefen Schluck aus beiden Gläsern gekräftigt hatte, fuhr er fort: »Und so blicken Sie sich um in dem sogenannten deutschen Dichterwald, überall tritt Ihnen das Laster entgegen. Nehmen Sie Lessing – er war ein Spieler, denken Sie an Bürger und sein Verhältniss zu Molly, denken Sie an Heine u. s. w. u. s. w. Nehmen wir die Neueren, Gottfried Keller zum Beispiel. Hat er nicht im »grünen Heinrich« sich selber geschildert als ein abschreckendes Beispiel. Nehmen wir Reuter! . . .« Hier erhob er sein halbgeleertes Schnapsglas und stürzte den Rest mit einer bezeichnenden Geberde hinab. Dann rief er: »Laura, noch einen Nordhäuser!« und wendete sich wieder zu mir: »Mich plagt ein hässliches Reissen in der Backe, und die Erfahrung hat mich gelehrt, dass kein Mittel besser hilft als dieses Getränk, das ich hasse wie die Pest. Aber ich kehre zu unseren Dichtern zurück. Ich frage nun, darf man solche Liederjahne »Leuchten der Menschheit« nennen und sie der Verehrung preisgeben? Können solche Werke der Jugend zur Bildung, dem Alter zur Erbauung dienen? – Nimmermehr! – Ich will Ihnen sagen, wie ich mir den wahren deutschen Dichter denke. Zunächst wird er als der Sohn einer höchst respectablen Familie in soliden Verhältnissen geboren. Schon in der Wiege wird er sich durch Tugend und Reinlichkeit auszeichnen und eine auf die erhabenen Grundsätze der Moral gestützte Erziehung wird die guten Keime seines Innern zur freudigen Blüthe bringen. Er wird niemals Zucker stehlen, niemals grüne Grasflecke in seine weissen Hosen machen und niemals alte blinde Leute mit faulen Aepfeln werfen. Er wird stets präparirt in die Schule kommen und stets ein Ausbund der Tugend und Vollkommenheit sein, so dass er als Primus omnium die Schule verlässt und das Abiturientenexamen »Eins mit Auszeichnung« besteht. So wird er auf der Universität weiter wandeln als eine wirkliche »Leuchte der Menschheit« und durch alle Examina ungetrübt hindurch gehen, wie der Vollmond, der am wolkenlosen Frühlingshimmel einherstrahlt. Dann, eingelaufen in eine solide bürgerliche Stellung, wird er in seinen Mussestunden Werke dichten, so reinlich wie frischgewaschene Handtücher, Werke voller Moral und Tugend, weil sie nur der Abglanz seiner eignen appetitlichen Seele sind. Man wird vielleicht in seinen Lustspielen nicht lachen und in seinen Trauerspielen nicht weinen, aber man wird mit dem erhabenen Gefühl nach Hause gehen, der Stimme der Tugend und der Moral gelauscht zu haben.« Damit wollte er sich erhaben zurücklehnen, allein nicht ganz orientirt über die Richtung, in der sich die Lehne befand, verfehlte er diese und wäre fast vom Stuhl gefallen. Ueberhaupt war im Verlauf der Zeit eine kleine Veränderung mit ihm vorgegangen, und seine letzte Rede war lange nicht so glatt vom Stapel gelaufen, wie ich sie des besseren Verständnisses halber dem Sinne nach mitgetheilt habe. Er hatte eine seltsame Manier angenommen, mit den Wörtern zu kämpfen und über sie zu stolpern, bei welcher Gelegenheit ihm dann der Zusammenhang der Gedanken entfiel und mühsam wiedergesucht werden musste. Vermuthlich war das fatale Reissen daran schuld, denn ich bemerkte, dass er dem Uebel durch vermehrten Genuss von Nordhäuser zu begegnen suchte, allerdings ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen. Im Gegentheil muss ich bemerken, dass ich von einem jedenfalls sehr tief durchdachten Vortrag über den grossen Werth der Moral, den er folgen liess, keinen Nutzen mehr zu ziehen vermochte, weil er sich für mein Verständniss als zu hoch erwies.
Zuletzt, als seine Rede immer orakelhafter und der Ausdruck seiner Augen immer sauciger wurde, verlangte er zu bezahlen. Obgleich er diesen Act sichtlich in einen Schleier des Geheimnisses zu hüllen versuchte, entging es mir doch nicht, dass die Stillung seines Durstes sieben Gläser Bier, und die Bekämpfung des Reissens ebenso viele grosse Nordhäuser erfordert hatte, woraus man ersehen kann, wie schwer der Arme gelitten haben mag. Nachdem er nicht ohne einige Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben, dass er mit grosser Hartnäckigkeit den rechten Arm in dem linken Aermel unterzubringen suchte, in seinen Ueberzieher gelangt war, verabschiedete er sich nicht ohne mir mehrmals die Versicherung zu geben: »die Mo–moral ist die Hau–hauptsache!« Noch in der Thür drehte er sich um, und trotz des lauten Geräusches in dem Lokal konnte ich aus der Formirung seiner Lippen entnehmen, dass er noch einmal das geliebte Wort Moral aussprach.
Aber in der Thür begegnete ihm die Kellnerin, und nun geschah etwas, das mich in Verwunderung setzte. Nämlich er ging mit seliger Miene, gleich als ob er in diesem holden Wesen eine freundliche Verkörperung seiner geliebten Moral erblicke, auf sie zu und versuchte sie zu küssen. Diese junge Dame aber, gewandt wie der Teufel, entschlüpfte ihm, indem ihren zarten Lippen das geflügelte Wort »Oller Dussel« entfuhr. Der Gute stolperte vorwärts und begab sich plötzlich, mehr dem Gesetz der Schwere als seinen eigenen Intentionen Folge leistend, mit unerhörter Geschwindigkeit und ohne seine Beine dabei zu benutzen, die Treppe hinab. Einige Leute, die gerade von unten kamen, sammelten ihn auf und stellten fest, dass diese übereilte Handlungsweise dem Braven nichts geschadet hatte. Nur hatte es sie verwundert, dass er statt eines Dankes weiter nichts geäussert hatte als in kurzen Pausen: . . . »Aal, . . . Aal!«
Ich aber vermuthe in diesem sonderbaren Ausdruck den letzten Rest seiner geliebten Moral, von der ihm bereits die grössere Hälfte unterwegs abhanden gekommen war.
Seefahrt nach Möen
I.
Eines schönen Sonntags im August machte das Dampfschiff »Rostock« von der Stadt gleichen Namens aus eine Extrafahrt nach der dänischen Kreideinsel Möen. Dieses Schiff fuhr an den Wochentagen des Sommers zwischen Rostock und Nyköping und vermittelte den Postverkehr zwischen Deutschland und Dänemark. Es war tüchtig und wohlgebaut, wenn auch nicht besonders elegant eingerichtet, und für 300 Passagiere konzessionirt. Der Kapitän hiess Zeyssig. Ein Unbefangener würde sich bei diesem Namen nun ein kleines hüpfendes Männchen mit einem zwitschernden Stimmlein vorstellen, allein er würde sich seltsam enttäuscht finden, denn dieser Name passte gerade so zu dieser Persönlichkeit, als wollte man einem Löwen ein blauseidenes Halsband umthun und ihn Zerline nennen. Herr Zeyssig war ein grosser und starker Mann mit einem dunklen Vollbart, einem gebräunten Seemannsgesicht und einer Stimme, die wohl geeignet war, sich gegen Sturm und Unwetter vernehmlich zu machen.
Zu dieser Fahrt hatten sich etwa zweihundert Personen zusammengefunden, theils aus Rostock und Umgegend, theils aus dem Seebad Warnemünde, das der Hafenort von Rostock ist. Der Tag war klar und schön, eine frische westliche Brise sorgte für einigen Wellengang, und somit trat unter fröhlichen und hoffnungsreichen Empfindungen der meisten Reisenden das Schiff aus den Molen von Warnemünde in die offene See hinaus. Ich muss allerdings offen gestehen, dass ich ein wenig in bänglicher Stimmung war. Es war meine erste Fahrt auf offener See und ich fürchtete mich etwas vor der Seekrankheit, nicht gerade vor den körperlichen Unannehmlichkeiten, die sie mit sich bringt, denn »das hielte ich mich wohl aus«, wie Kapitain Pott seine Frau sagt, aber vor der Lächerlichkeit, die ihr anhaftet. Der höchste Fluch dieser Krankheit ist, dass das tiefste und jammervollste Elend der Leidenden von den Gesunden mit dem überlegenen Grinsen mitleidlosen Spottes betrachtet wird, und die Theilnahme selbst der Besten nur ein schwächliches und kümmerliches Gewächs ist. »Wir sehen die Leute gern seekrank, wenn wir's selbst nicht sind,« sagt Mark Twain.
Es ist ein seltsames Gefühl wenn nach der absoluten Ruhe des eingeschlossenen Stromes die erste Brandungswelle das Schiff auf ihre Schultern nimmt, es spielend emporträgt und dann auf eine heimtückische Art plötzlich unter einem wegsinken lässt. Dies bewirkt, dass der Kehlkopf auf eine besondere Art emporsteigt und man die Empfindung hat, es koste einige Mühe, ihn wieder hinabzuschlucken. Dabei blieb es bei mir glücklicher Weise, und ich konnte mich somit in aller Ruhe der Beobachtung der allmählig ausbrechenden Seekrankheit widmen und ihre Symptome feststellen.