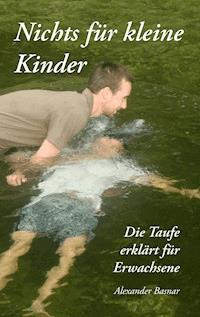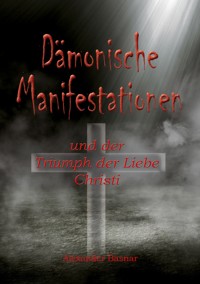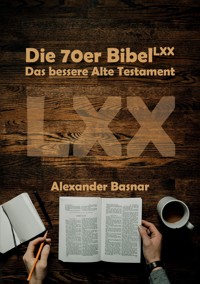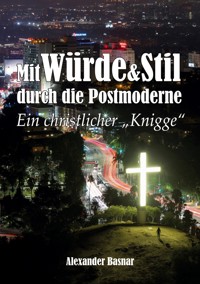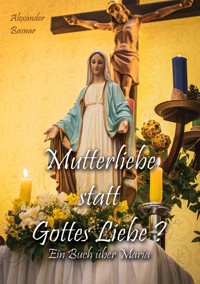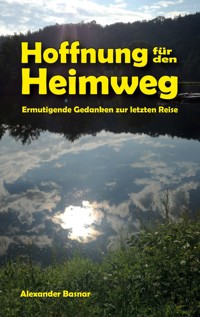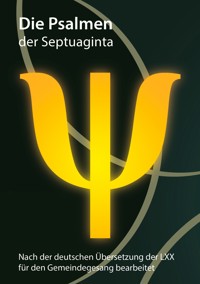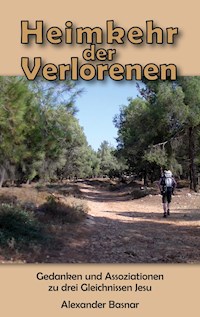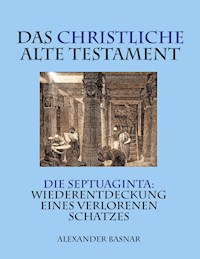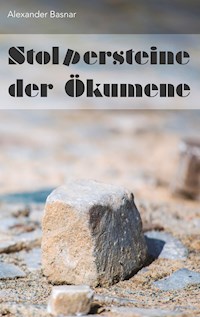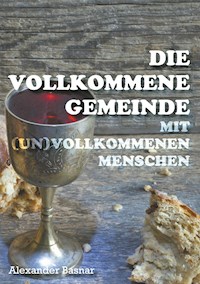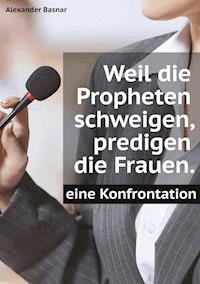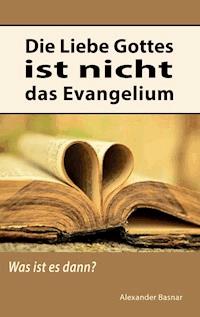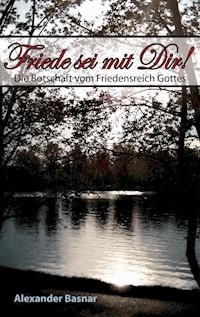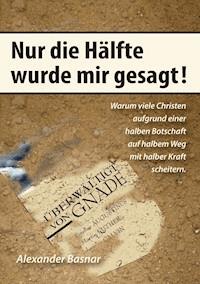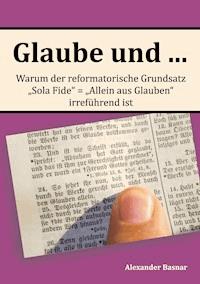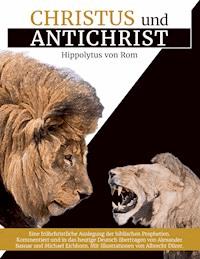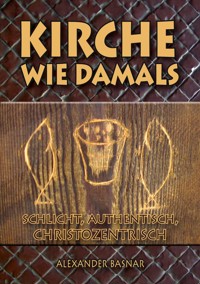
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Kirche Jesu Christi ist in einem schlimmen Zustand, und damit verfehlt sie ihren Auftrag, in dieser Welt für alle Menschen ein eindeutiges und klares Zeugnis vom Herrn Jesus Christus und Seinem Reich zu geben. Sie ist auf mehreren Ebenen gespalten: Zum einen in zahlreiche (buchstäblich 10.000e) Einzelkirchen und Denominationen, zum anderen ist jede dieser Gemeinschaften in progressive und konservative Flügel zerrissen, mit verschiedenen Abstufungen. Nicht wenige dieser Kirchen behaupten von sich, die eine wahre Kirche zu sein. Die Frage, wie es denn wirklich am Anfang war, wird zu selten gestellt, da es den meisten Kirchen doch eher darum geht, sich selbst in ihrem aktu-ellen Zustand zu rechtfertigen. So kommen wir aber nicht weiter und auch nicht näher zueinander. Gibt es eine Lösung? Wie war die Kirche damals?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für diegemeindenchristi
Inhalt
Die Ausgangslage
Paulus ist verwirrt
Der ein für alle Mal überlieferte Glaube
1. Zeuge: Justin der Märtyrer (100-165) über die christliche Taufe
Sieben Aspekte christlicher Einheit
Die Gemeinde, die der Herr gründete
2. Zeuge: Irenäus von Lyon (135-200) Wo ist die apostolische Tradition?
Sieben Merkmale der ersten Gemeinde
3. Zeuge: Johannes Cassian (360-435) Es soll sein wie am Anfang!
4. Zeuge: Die Didaché (um 80 n.Chr.) Das normale Gemeindeleben
Die Familie Gottes
Gottesdienst als Festfeier
5. Zeuge: Tertullian von Karthago (150-220) Das christliche Liebesmahl
Der wahre Stellvertreter Christi
Hirten und Väter
6. Zeuge: Die Apostolischen Konstitutionen (vor 400): . Leitung durch Familienväter
Der Leib Christi
Ein Haus aus lebendigen Steinen
7. Zeuge: Origenes († 253/254) Kein Tempel, keine Bilder, …
Abgesondert von der Welt
Ein schlichtes und bescheidenes Leben
8. Zeuge: Der Diognetbrief (150) Wie Christen in der Welt leben
Schafe unter Wölfen
Das Evangelium des Friedens
9. Zeuge: Martin v. Tours (316-397) Als Christ kann ich nicht kämpfen
Persönliches Nachwort
Anmerkungen:
Die Begriffe „Kirche“ und „Gemeinde“ verwende ich weitestgehend austauschbar, weil beide korrekt das bezeichnen, was im Neuen Testament gemeint ist. „Kirche“ (von kyriake) bedeutet, dem Herrn zugehörig, und Gemeinde (griech: ekklesia) ist die (aus der Welt) herausgerufene Versammlung des Volkes Gottes. „Kirche“ bezieht sich in diesem Buch fallweise auch ausschließlich auf die verfassten kirchlichen Institutionen.
Die Ausgangslage
Die Kirche Jesu Christi ist in einem schlimmen Zustand, und damit verfehlt sie ihren Auftrag, in dieser Welt für alle Menschen ein eindeutiges und klares Zeugnis vom Herrn Jesus Christus und Seinem Reich zu geben. Sie ist auf mehreren Ebenen gespalten: Zum einen in zahlreiche (buchstäblich 10.000e) Einzelkirchen und Denominationen, zum anderen ist jede dieser Gemeinschaften in progressive und konservative Flügel zerrissen, mit verschiedenen Abstufungen. Nicht wenige dieser Kirchen behaupten von sich, die eine wahre Kirche zu sein, allen voran die römisch-katholische Kirche mit einem gewissen historischen Anspruch, andererseits aber auch viele andere Kirchen mit einem theologisch-dogmatischen Anspruch. Andererseits gibt es selbst in diesen auch viele, die jeden Wahrheitsanspruch fahren gelassen haben und am liebsten die ganze Welt in einem Allerweltshumanismus umarmen würden und jeder Religion den gleichen Wert zusprechen – allen voran der gegenwärtige Papst Franziskus, sehr zum Ärger der konservativen Bischöfe. Es ist beschämend, es ist tragisch, es ist vor allem für die Menschen, die der Erlösung bedürfen, ein echtes Drama. Gibt es eine Lösung dieser Situation?
Dazu muss man diese Spaltungen erst verstehen, und das ist gar nicht so einfach. Ich beginne mit einem Gedankenexperiment, ausgehend von einem Auftrag, den Paulus an seinen Schüler Timotheus gegeben hat:
„Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren.“ (2. Timotheus 2,2).
Das, was die Apostel gelehrt haben, soll treu und unverändert von einer Generation zur Nächsten weitergegeben werden. Soweit die Zielvorgabe. Wie gut gelingt das realistischerweise? Mehr oder weniger mangelhaft, denn irgendwann wird etwas vergessen, ein anderes Mal etwas missverstanden, dann ergeben sich Fragen, die die Apostel nicht angesprochen haben, und in der Umwelt tauchen Ideen und Weltanschauungen auf, die in die Gemeinden eindringen wollen. Angenommen, es gelänge jeder Generation, 99% der Lehre und Praxis der Apostel an die nächste weiterzugeben, so würden wir zurecht sagen, dass das „sehr gut“ ist! Aber was bedeutet das im Verlauf der Zeit bis heute, wenn eine Generation im Schnitt 30 Jahre umfasst? In 2000 Jahren sind das 66 Generationen, und die Abweichung von 1% pro Generation schwillt auf 48,5% an.1 Knapp die Hälfte dessen, was die Apostel ihren Nachfolgern anvertraut haben, wäre so verloren. Und da geht es nur um die Quantität, nicht darum, wie sehr zentrale Inhalte betroffen sind.
Man kann das mit einem Schiff vergleichen, dass jahrelang über den Ozean fährt. Mit der Zeit siedeln sich am Rumpf Algen, Muscheln und Seepocken an, welche die Fahrt verlangsamen und den Treibstoffverbrauch erhöhen. Das verursacht jährliche wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe! Darum muss dieser immer wieder einer gründlichen Reinigung unterzogen werden. Sollte das „Schiff Christi“ weniger gut gewartet werden als ein Hochseeschiff?
Ein anderes Gedankenexperiment: Würden die Lehre und Praxis der Kirche jedes Jahr auf einen Prüfstand gestellt, wie wir unsere Autos zum TÜV bringen, könnte man solche Abweichungen bei gewissenhafter Untersuchung erkennen und berichtigen. Was würden wir von einer Fachwerk stätte halten, der irgendwann einmal die Bedeutung der Kupplung ganz wichtig geworden ist, und seither bei der Fahrzeugüberprüfung nur mehr die Kupplung kontrolliert? Kupplung gut, alles gut? Die andere Fachwerkstätte kontrolliert nur die Bremsen. Eine weitere nur die Abgaswerte, und so weiter. Das ist tatsächlich so gekommen, denn praktisch jedes Mal, wenn einem „Reformator“ eine Abweichung vom Ursprung auffiel, betraf das in seiner Wahrnehmung meist nur ein Detail: Die Lehre von der Rechtfertigung, das rechte Sakramentsverständnis, die Kirchenordnung, die Endzeitlehren, die Geistesgaben usw. Entweder hat die Hauptkirche (in der Regel die katholische) deren „Prüfbericht“ angenommen, was tatsächlich selten geschah, oder die Reformatoren wurden ausgeschlossen bzw. spalteten sich ab und gründeten eigene Kirchen. Und weil diese dann wieder meinten, die Kirche „völlig“ reformiert zu haben, obwohl es meist nur eine Teilfrage betraf, erwiesen sich diese reformierten Kirchen in der weiteren Geschichte als äußerst reformunwillig. Zahllose weitere Spaltungen waren die Folge. Wo aber gibt es noch Fachwerkstätten, in denen das ganze Fahrzeug überprüft wird?
Man könnte noch über die „Automarke“ philosophieren. Es gibt Fahrer, die schwören auf Mercedes, und solange sie den Stern sehen, sind sie zufrieden. Stellen wir uns aber vor, der Stern sei das einzige rostfreie Teil an dem Vehikel, die Bremsbeläge wären abgefahren, die Stoßdämpfer hinüber und im Motor funktionieren bei gutem Wetter nur noch zwei Zylinder. So stellt sich so manche selbstbewusste Kirche dar, wenn man sie biblisch betrachtet. Ja, die Marke stimmt vielleicht, aber der Rest ist Schrott! Warum nicht auf einen Skoda wechseln, der servicegepflegt ist und zuverlässig funktioniert? Alle wesentlichen Elemente eines Autos gibt es auch da: Vier Räder, eine Lenkung, einen Motor, usw. Kann man die „Wahre Kirche“ tatsächlich nur an der Marke festmachen, oder sollte man nicht zuerst die Funktionen prüfen?
Jedes Auto hat eine Bedienungsanleitung und ein Servicehandbuch, anhand dessen der Mechaniker das Fahrzeug Schritt für Schritt überprüft, damit er nichts übersieht; für die Kirche ist die Bibel das Servicehandbuch, anhand dessen wir den Zustand und „Reparaturbedarf“ der Gemeinde Christi bestimmen können, sollen und regelmäßig müssen, um die beschriebenen schleichenden Veränderungen korrigieren zu können. Das wurde in den letzten 2.000 Jahren größtenteils unterlassen.
Als Titel des Buches wählte ich deshalb „Kirche wie damals“, weil es – wie wir sehen werden – offenbar der Wille Christi war und ist, dass Lehre und Praxis Seiner Kirche bis zu Seiner Wiederkunft unverändert bleiben. Als Untertitel wählte ich die drei Schlagwörter: schlicht, authentisch, christozentrisch.
Schlicht: Es muss einfach gehalten sein, denn Christus hat einfache Leute in Seine Nachfolge berufen und die Theologen und Schriftgelehrten in aller Regel scharf zurückgewiesen. Gemeinde soll überall entstehen können, wo Menschen zum Glauben kommen und gemeinsam die Bibel lesen. Die Beschreibung biblischer Gemeinde ist leicht zu verstehen, wenn man nicht durch festgefahrene kirchliche Traditionen einen getrübten Blick hat. Zugleich ist es an jedem Ort und zu jeder Zeit einfach zu verwirklichen, auch von ungebildeten Leuten.
Authentisch: Es geht um einen ehrlichen und geradlinigen Glauben, der sich im Leben der einzelnen Christen zeigt, nicht um Gebäude und Institutionen, so prunkvoll sie sein mögen, innen aber hohl sind. Gerade in kleinen Hausgemeinschaften (wie es die ersten Gemeinden waren), lernt man, die Masken abzulegen und einander zu sehen, anzunehmen und zu ertragen wie man ist. In diesem Rahmen kann die Liebe aufblühen und ist dann mehr als eine religiöse Floskel.
Christozentrisch: Der Herr Jesus muss im Zentrum stehen, Ihm müssen die Aufmerksamkeit, Treue und Anbetung aller Christen gelten. Steht Er nicht im Zentrum, tritt etwas anderes an Seine Stelle: die Kirchenorganisation, eine bestimmte Lehrbetonung, Zeichen und Wunder, das Halten der Gebote, das soziale Engagement oder anderes. Steht Christus im Zentrum, wachsen wir in all diesen Stücken in gesunder Weise. Steht jedoch das andere im Zentrum, verlieren wir sowohl Ihn als auch andere Aspekte des Glaubens, der Lehre und der Praxis der Apostel aus den Augen; es wird unausgewogen, ungesund und sektiererisch.
Die Frage, wie es denn wirklich am Anfang war, wird zu selten gestellt, da es den meisten Kirchen doch eher darum geht, sich selbst in ihrem aktuellen Zustand zu rechtfertigen. So kommen wir aber nicht weiter und auch nicht näher zueinander. Eine „Ökumene“, die auf der gegenseitigen Anerkennung der Summe aller Abweichungen in den diversen Kirchen gründet, ist eine Ökumene der Untreue, der Geschichtsvergessenheit, des Relativismus. Mit nichts davon kann das Haupt der Gemeinde wirklich zufrieden sein. Darum will ich einen anderen Weg vorschlagen, einen Weg von den Verästelungen des Kirchenbaumes hinunter zum Stamm und zu den Wurzeln, dorthin, wo es keine trennenden Äste und Zweige gibt und Christus alles und in allen ist.
Ich mache bewusst keine Werbung für eine bestimmte Gemeindebewegung, da jede Konfession ihre Muscheln am Bug und ihre Roststellen hat. Ich sage auch nicht, dass man die Gemeinde oder Kirche, in der man ist, verlassen soll. Das kommt ganz darauf an, wie „fahrtüchtig“ sie noch ist, wie sehr sie sich etwas sagen lässt, oder ob man im Rahmen von Kleingruppen und Hauskreisen beginnen kann, die Dinge zu verwirklichen, welche „Kirche wie damals“ ausmachen.
Ich will aber auch nicht verhehlen, dass ich wesentliche Impulse aus der Täuferbewegung, die vor 500 Jahren in Zürich begonnen hat, übernommen habe, denn diese waren unter den Reformatoren so ziemlich die einzige Richtung, die genau diese Frage nach dem Wesen und der Praxis der ersten Kirche gestellt haben. Mit einigen dieser Gemeinden sind wir auch freundschaftlich eng verbunden. Wir sind an keine ihrer Traditionen gebunden, sind durch die Bibel aber zu weitgehend identen Anwendungen gekommen. Doch auch andere Bewegungen der Kirchengeschichte imponieren mir, wie Paulus schreibt:
„So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch: es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige – alles gehört euch; ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an.“ (1. Korinther 3,21-23).
Meine persönliche Erfahrung ist die: Je mehr Christus bei mir ins Zentrum kam und ich dadurch einen zunehmend ausgewogeneren Zugang zu den verschiedenen Bereichen von Lehre, Kirchengeschichte und Praxis bekam, desto mehr Überschneidungen zu Christen verschiedenster Konfessionen fand ich, denn in aller Regel findet sich das, was in ihrer Bewegung (aufgrund der neuen Entdeckung und der Abgrenzung von anderen) oft überbetont wird, auch in der ersten Kirche in einem gesunden Maß wieder, seien es Geistesgaben, das Verhältnis von Glauben und Gehorsam, Sakramente (besonders, dass die Taufe das „Bad der Wiedergeburt“ ist), Armenfürsorge u.v.a.m. … Gehen wir von den Verzweigungen zu den Wurzeln hinunter, kommen wir uns auch wieder näher, auch wenn es bedeutet, lieb gewordene falsche Traditionen, theologische Fehlschlüsse, historische Missverständnisse und auch kulturelle Prägungen abzulegen. Jeder hat ein Unbehagen, wenn er das Auto zum Service bringt. Und doch fährt jeder mit einem noch größeren Unbehagen, wenn er dies jahrelang unterlässt.
Diesem Buch liegt ein weitaus umfangreicheres Buch zugrunde, das ich vor mehreren Jahren geschrieben habe: „Die vollkommene Gemeinde mit (un)vollkommenen Menschen“ (2019).2 Die Gedanken dazu sammelte ich in den Jahren seit 2005, als ich begann, die Tragweite des Themas mehr und mehr zu begreifen. Den Anstoß dazu gab mir ein bahnbrechendes Buch von David Bercot: „Will the Real Heretics Please Stand Up“ (zu deutsch: „Zurück zum Start“), in dem er die modernen evangelikalen Freikirchen mit der frühen Kirche verglich. Durch ihn lernte ich den Wert der frühkirchlichen Schriften (der ersten Generationen nach den Aposteln) kennen, die mir eine wesentliche Hilfe zum Verständnis der Bibel geworden sind. So kommen sie auch in diesem Buch reichlich zu Wort; am Ende eines Themenabschnitts rufe ich sie in den Zeugenstand, damit wir aus ihren eigenen Worten das hören, was ich zuvor aus der Bibel dargelegt habe.
Dieses Buch mag eine Wirkung haben ähnlich dem, was Gott dem Propheten Jeremia auftrug; für den einen oder anderen Leser mag kein Stein auf dem anderen bleiben:
„Siehe, ich habe dich heute eingesetzt über Völker und über Königreiche, um zu entwurzeln und einzureißen und zu zerstören und wieder aufzubauen und zu bepflanzen.“ (Jeremia 1,10).
Oft muss man erst etwas abreißen, um es neu wieder aufbauen zu können. Wer die Kirche erneuern will, wird sich vor der Abrissbirne nicht fürchten, denn er blickt auf den Neubau, dessen Statik stimmt, durch dessen Dach es nicht mehr tropft, der einen hervorragenden Wohnkomfort bieten wird für die kommenden Generationen, die das Haus bewohnen werden.
Es werden Fragen offen bleiben, weil ich dieses Buch absichtlich kurz halten wollte. Die beiden oben genannten Bücher führen tiefer in die Materie, sowie andere Bücher, die ich über Books on Demand veröffentlicht habe.3 Bedenken wir aber, was Salomo sagte:
„Mein Sohn, hüte dich, viele Bücher zu machen! Es gibt kein Ende. Und viel Studieren bedeutet eine Ermüdung des Fleisches.“ (Prediger 12,12).
Lasst uns daher rasch sein, das Erkannte umzusetzen, denn erst im Tun versteht man Gottes Wort richtig!
Um in das Thema einzuführen, will ich mit einer verwirrenden Situation beginnen:
1 Die 1% rechnen sich mit jeder Generation von einem kleineren Ausgangswert, darum sind es nicht 66% Abweichung. Aber es ist nur eine Veranschaulichung des Problems, wirklich quantifizieren kann man es nicht.
2https://buchshop.bod.de/die-vollkommene-gemeinde-alexander-basnar-9783746024226
3https://buchshop.bod.de/catalogsearch/result/index/?p=2&q=Basnar
Paulus ist verwirrt
Stellen wir uns vor, der Apostel der Heiden, Paulus, wäre vom Herrn in unsere Zeit und Kultur entrückt worden. Er findet sich in einer unserer Städte wieder, und sichtlich verwirrt versucht er, sich in der neuen Umgebung zu orientieren. Da sieht er auf einem der Plätze ein Gebäude, das anders ist als alle anderen: Es hat ein auffallend großes Tor, große, zum Himmel strebende Fenster mit buntem Glas, einen hohen Turm und darauf ein Kreuz, welches ihm seltsam vertraut vorkommt. Er nähert sich diesem Haus, es ist Gründonnerstag. Aus dem Inneren hört er Orgelmusik. Er öffnet die Türe und betritt eine große Halle, geschmückt mit Bildern und Statuen. Auf den Bänken sitzen verstreut, mit größtmöglichem Abstand zueinander, fünfzehn bis zwanzig Personen, die einer eigenartigen Vorführung beiwohnen. Die Orgel begleitet ein Lied, aber der Gesang ist sehr verhalten. Vorne steht ein Mann in seltsamer Gewandung, Weihrauch liegt in der Luft. Das überlebensgroße Bild einer Frau, die gekrönt wird, ragt hinter einem Steintisch bis fast zum Dach der Halle empor. Paulus geht den Mittelgang nach vorne und setzt sich auf einen Platz in den vordersten leeren Reihen, um zu sehen, was das bedeuten soll.
Ein Mann tritt zu einem Rednerpult und setzt sich die Brille auf: „Wir hören nun die Lesung aus dem Buch Exodus, aus dem 12. Kapitel.“
Paulus ist überrascht. Hier werden die Heiligen Schriften gelesen! Ist das eine Synagoge? Nein, in Synagogen gibt es doch keinen Bilderschmuck, und wer die Frau auf dem großen Bild sein soll, weiß er auch nicht. Er blickt sich um. Da ist kein siebenarmiger Leuchter zu sehen. Die Männer tragen keine Kippa. Es ist alles sehr rätselhaft, aber der gelesene Text ist ihm vertraut.
„Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus; wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen; dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen, und ihr sollt es aufbewahren bis zum vierzehnten Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen: am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot; mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen; und ihr sollt nichts davon übriglassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrigbleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen: eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen, und in Eile sollt ihr es essen; es ist das Passah des Herrn.
Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen; und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde.
Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern; als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. (Exodus 12,1-14)
Wort des lebendigen Gottes.“
Er will gerade „Amen!“ sagen, da hört er, wie die kleine Schar der Versammelten im Chor sagt: „Dank sei Gott!“ „Auch gut“, denkt sich Paulus, „das ist würdig.“ Doch dann schweifen seine Gedanken ab. Von seiner Kindheit an war die Passahfeier der jährliche Höhepunkt im Familienleben. Da pilgerten sie nach Jerusalem, um als gesetzestreue Juden ein Lamm zu opfern und dann gemeinsam zu verspeisen, um sich an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Doch wie groß war die Freude des Apostels, als er erkennen durfte, dass Jesus Christus das wahre Lamm Gottes ist, welches aus einer ganz anderen Knechtschaft befreit, nämlich der des Todes, der Sünde und des Teufels! Welch ein Jubel! Aber warum wird das hier mit einer Grabesstille zur Kenntnis genommen? Haben die Menschen hier nicht begriffen, was in diesem Text ausgesagt wird und wie es sich erfüllt hat? Mit ernster Miene schauen die Zuschauer zum Lesepult.
Es folgt eine zweite Lesung. Diesmal geht eine Frau nach vorne: „Wir hören die Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth, aus dem 11. Kapitel …“
Paulus zuckt zusammen: „Die lesen einen Brief von mir? Hier, in dieser seltsamen Halle? Und warum nennen die mich heiliger Apostel Paulus? Es sind doch alle Christen Heilige, und ich bin nichts Besonderes, außer, dass ich der größte aller Sünder war! Ich habe doch die Gemeinde Gottes verfolgt, ehe Gott mir Barmherzigkeit erwiesen hat …“ Gespannt hört der Apostel zu, was nun vorgelesen wird.
„Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen; denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so dass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht!
Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, und dankte, es brach und sprach: Nehmt, esst! Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird; dies tut zu meinem Gedächtnis! Desgleichen auch den Kelch, nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken; denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen.
Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden; wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander! Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das übrige will ich anordnen, sobald ich komme. (1. Korinther 11,20-34).
Wort des lebendigen Gottes.“
Die wenigen Versammelten antworten im Chor: „Dank sei Gott!“
Paulus kann sich noch gut erinnern, wie unheilig sich die heiligen Korinther bisweilen benommen haben. Da kamen sie abends zur gemeinsamen Mahlzeit zusammen, wo sie alles untereinander teilen und ein Fest feiern sollten zur Ehre ihres Erlösers, doch die wohlhabenderen Christen fingen schon früher zu schmausen an, während die Unfreien und Taglöhner erst später am Abend dazukamen. Da war das meiste schon verspeist worden, und die Weinkaraffen fast völlig geleert. Dieses selbstsüchtige und lieblose Verhalten musste er damals scharf zurechtweisen. Wie soll man in solch einer Uneinigkeit das Brot des Herrn brechen und von Seinem Kelch trinken im Gedenken an Seinen Tod am Kreuz? Hat die Liebe Christi denn keine Liebe in diesen Christen bewirkt?
Paulus sieht sich um: Will man hier, an diesem so völlig ungeeigneten Ort, denn nun solch eine christliche Festfeier halten? Wo ist der gedeckte Tisch? Wo ist der Wein? Wo sind die gemütlichen Sitzgelegenheiten? Warum halten alle Anwesenden größtmöglichen Abstand voneinander als kennten sie einander nicht?
Und war da nicht noch etwas? Hatte Paulus nicht unmittelbar davor (1. Korinther 11,2-16) geschrieben, dass Frauen in der Festversammlung ihren Kopf bedecken sollen?4 Diese Frau tat das nicht. Und hatte er nicht ebenso klar geschrieben, dass Frauen nicht lehren sollen (1. Timotheus 2,12)? Aber gut, das ist offensichtlich keine Gemeinde Christi, aber was ist es dann? Paulus wird in seinen Gedanken unterbrochen, weil nun der ältere Mann in den besonderen Gewändern ans Pult tritt.
Er küsst das Buch, bekreuzigt sich und beginnt singend einen Text aus dem Evangelium vorzutragen:
„Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:
Vor dem Passahfest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen: wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende.
Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich; darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war.
Da kommt er zu Simon Petrus, und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt! Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein.
Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht; denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen; denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.“5
„Lob sei Dir, Christus!“ hallt es verhalten aus den Reihen hinter dem Apostel. Die große Halle verstärkt es aber durch einen beeindruckenden Hall, der ein Gefühl der Ehrfurcht hervorruft. Paulus bekommt eine leichte Gänsehaut.
Er freut sich, dass Johannes schließlich auch ein Evangelium geschrieben hat, aber er konnte es noch nicht lesen. Jahre zuvor wurde Paulus in Rom als Märtyrer hingerichtet, aber die Inhalte waren ihm aus persönlichen Begegnungen und Erzählungen freilich wohlbekannt. Dementsprechend aufmerksam hörte er zu. Ja so ist es: Wenn die Gemeinde nach einem Arbeitstag zur Festfeier zusammenkam, wusch man sich selbstverständlich die Füße, sie waren ja schmutzig. Neu war in der Gemeinde Christi aber, dass man einander die Füße wusch. Das war für manche ein großer Schritt der Selbstüberwindung, aber der gehörte zur „Pädagogik“ des Herrn, der will, dass wir alle uns demütigen und einander dienen.
Tatsächlich fand nun etwas Ähnliches statt. Der Mann, der dieses Zusammenkommen offenbar leitete, lud nun alle nach vorne ein und wusch jedem Besucher einen Fuß – andeutungsweise, nicht besonders gründlich, eher im Sinne einer symbolischen Geste. So hat Paulus es noch nie gesehen, das macht ja gar keinen Sinn! Doch alle ließen es über sich ergehen, er selbst blieb abwartend sitzen und beobachtete es bloß. Schließlich, so dachte er bei sich selbst, gehöre er ja nicht wirklich dazu.
Es folgt eine Ansprache des Leiters, in der er aus den Lesungstexten einige Aspekte hervorhebt. Die Rede ist kurz, kaum 10 Minuten lang, sachlich richtig, aber ohne Appell, ohne praktische Anwendung, ohne Aufruf, das Leben zu ändern, um Christus ähnlicher zu werden. Er bemüht sich dafür um eine eigentümlich salbungsvolle Tonlage.
Paulus ahnt, dass es sich dabei um so etwas wie eine Predigt handeln könnte, aber warum so kurz und blutleer? Gut, er selbst war berüchtigt dafür, dass er das Wort Gottes bis über Mitternacht hinaus predigen konnte, und es ist nur ganz selten ein Zuhörer dabei eingeschlafen (vgl. Apostelgeschichte 20,7-9), aber er konnte sich auch kürzer fassen. Doch nicht einmal 10 Minuten? Das erscheint dem Apostel denn doch sehr wenig – aber vielleicht sollte es gar keine Predigt sein. Aber was sonst? Er findet keine Antwort darauf, doch da geht es bereits weiter im Programm.
Nach einem Lied und einer Art Wechselgesang zwischen dem Leiter und den versammelten Teilnehmern richtet sich die Aufmerksamkeit aller auf einen steinernen Tisch. Darauf steht ein goldener Kelch, abgedeckt mit einem Tuch und ein goldener Teller, auf dem weiße Plätzchen liegen. Der Leiter wiederholt die „Einsetzungsworte“ zum Mahl des Herrn, die bereits in der zweiten Lesung vorkamen. Dann hebt er eines der Plätzchen in die Höhe, worauf von irgendwoher ein Klingelton zu hören ist.
„Geheimnis des Glaubens“, sagt er dazu. Dann bricht er das Plätzchen in zwei Teile und die Teilnehmer dieser Veranstaltung stellen sich in einer Reihe vor dem Tisch auf. Der Leiter gibt jedem ein Plätzchen in die Hand und sagt dazu: „Der Leib Christi, für dich gegeben.“ Diese führen es schweigend zum Mund und verzehren es. Dann nehmen alle wieder Platz und er allein trinkt den Kelch bis zur Neige aus. Daraufhin wischt er diesen mit dem Tuch aus und räumt den Tisch auf.
Sollte das das Brotbrechen gewesen sein? Wo war das Brot? Was waren das für Plätzchen? Warum tranken nicht alle vom Wein? Was war das jetzt wirklich? Paulus ist verwirrt, er kennt sich nicht aus. Manches wirkte vertraut, manches völlig fremd, und der Rahmen passte so gar nicht zu dem, was er als christliche Festversammlung kannte.
Kurz danach wird die Versammlung mit einem Segenswort verabschiedet, und alle verlassen schweigend die kalte, bunt bebilderte Halle und gehen nach Hause. Oder ins Wirtshaus.
Paulus kennt sich nicht aus (so stelle ich mir seinen Gesichtsausdruck vor).
Auch Paulus geht hinaus, doch als er die Türe durchschritten hat, findet er sich plötzlich in seiner Zeit wieder. Er geht über die staubigen Straßen von Ephesus zum Forum und denkt nach, was das wohl gewesen sein mag. Er erzählt niemandem davon. Doch er trifft Timotheus und schärft ihm ein:
„Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren.“ (2. Timotheus 2,2).
Er ahnt schon, wie wichtig es ist, dafür Sorge zu tragen, dass der christliche Glaube und die christliche Praxis nicht verändert oder verfremdet werden. Es wird ein Kampf sein, wie auch der Bruder des Herrn, Judas, in seinem Brief schrieb:
„Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist.“ (Judas 1,3).