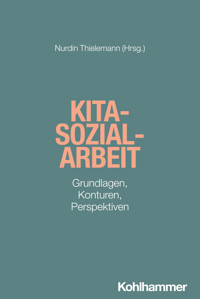
Kita-Sozialarbeit E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kita-Sozialarbeit ist ein noch junges Handlungsfeld Sozialer Arbeit. Mit Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis bildet der Band den aktuellen Diskurs ab und regt dazu an, diesen weiterführend zu gestalten. Dafür werden theoretische, handlungsleitende Grundlagen, die Konturen eines tragfähigen Profils, Organisationsperspektiven und das Verhältnis zu anderen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe besprochen. Zudem finden die vielfältigen Ansätze, die sich bundesweit abzeichnen, genauso Beachtung, wie empirische Studien, die das Verständnis über Wissensbestände der im Handlungsfeld Tätigen erweitern, den Aufgabenhorizont skizzieren oder die Notwendigkeit von Kita-Sozialarbeit belegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
1 Entwicklung(en) und Momentaufnahme(n) – Zur Einleitung
I Grundlagen
2 Kita-Sozialarbeit – Zur Konturierung eines sich entwickelnden Handlungsfeldes
2.1 Suchbewegung und Spannungsfelder – Zur Einleitung
2.2 Ausgangspunkte
2.2.1 Kita-Sozialarbeit und Sozialraum
2.2.2 Lebenslagen und Teilhabechancen von Kindern und Familien als Ausgangspunkt von Sozialer Arbeit in Kitas
2.2.3 Präventionsauftrag bzw. -anspruch der Kita-Sozialarbeit
2.3 Kita-Sozialarbeit als Bindeglied zwischen Frühen Hilfen und Schulsozialarbeit
2.3.1 Übergang Frühe Hilfen – Kita
2.3.2 Übergang Kita – Grundschule
2.4 Kita-Sozialarbeit als professionsbezogener Aushandlungs- und Grenzziehungsprozess
2.4.1 Kita-Sozialarbeit im Professionsgefüge
2.5 Kita-Sozialarbeit als organisationale Herausforderung
2.6 Zielgruppen und Gegenstand der Kita-Sozialarbeit
2.7 Profil
2.8 Suchbewegung und Spannungsfelder – ein Ausblick
3 Gemeinsam stark in Kita und Sozialraum: Die Rolle von Kita-Sozialarbeiter*innen, Akteur*innen in der Kita und weiteren sozialen Diensten
3.1 Einleitung
3.2 Professionsabgrenzung
3.2.1 Akteure im Kontext Kita
3.2.2 Weitere soziale Dienste
4 Kita-Sozialarbeit – Ein neues Handlungsfeld der Sozialen Arbeit. Zur Verknüpfung von Einzelfallarbeit und Sozialraumorientierung
4.1 Einleitung
4.2 Ziel und Kernaufgaben von Kita-Sozialarbeit
4.2.1 Kita-Sozialarbeit begleitet und unterstützt Eltern und Familien
4.2.2 Kita-Sozialarbeit begleitet und unterstützt Fachkräfte in der Kita
4.3 Kita-Sozialarbeit zwischen Einzelfallhilfe und Sozialraumorientierung
4.3.1 Was meint Einzelfallarbeit in der Kita- Sozialarbeit?
4.3.2 Was meint Sozialraumorientierung in der Kita-Sozialarbeit?
4.4 Verknüpfung von Einzelfallarbeit und Sozialraumorientierung – Wie gelingt Kita-Sozialarbeit?
5 Kita-Sozial(raum)arbeit als Möglichkeit zum sozialen Ausgleich – Einblicke in das Sozialraumbudget in Rheinland-Pfalz
5.1 Einleitung
5.2 Sozialer Ausgleich: Ein »frommer Wunsch« – meist ohne Entsprechung in der Praxis
5.3 Der Ausgangspunkt
5.4 Grenzen des Sozialraumbudgets
5.5 Die Ausgestaltung
5.6 Die Praxis
5.7 Die Kita-Perspektive
5.8 Wie Evaluieren?
6 Familienbildung (in) der Kita-Sozialarbeit: aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven
6.1 Einleitung
6.2 Von der Familienbildung in der Kita zur Kita-Sozialarbeit?
6.3 Fallbeispiel
6.4 Vorläufiges Fazit
7 Verstehendes Diagnostizieren als Grundkompetenz von Kita-Sozialarbeiter*innen?!
7.1 Einleitung oder: Kompetenzen von Kita-Sozialarbeiter*innen
7.2 Zur Relevanz der Grundkompetenz des Verstehens bzw. des verstehenden Diagnostizierens
7.3 Zur Grundkompetenz des Verstehens bzw. verstehenden Diagnostizierens in der Praxis
Leitlinie 1: Verstehendes Diagnostizieren bedeutet die Rekonstruktion des Mensch-Umwelt-Verhältnisses
Leitlinie 2: Verstehendes Diagnostizieren bedeutet, sich als Diagnostiker*in empathisch berühren zu lassen und emotionale Brücken zu bauen
Leitlinie 3: Verstehendes Diagnostizieren bedeutet die begründete Entwicklung pädagogischer Ideen
Leitlinie 4: Verstehendes Diagnostizieren bedeutet, Institutionen zu verändern
7.4 Fazit und Ausblick
II Konturen
8 Mit der Praxis im Gespräch. Eine qualitative Erhebung zu Suchbewegungen, Aushandlungsprozessen und Aufgabenhorizonten im Handlungsfeld Kita-Sozialarbeit
8.1 Einleitung
8.2 Methodischer Zugriff
8.2.1 Narratives Interview
8.2.2 Sample
8.2.3 Auswertung der Einzelinterviews nach Kuckartz
8.3 Ergebnisdarstellung
8.3.1 Kita-Sozialarbeit als Suchbewegung
8.3.2 Aushandlungsprozesse zwischen Kita, Eltern und Sozialer Arbeit
8.3.3 Aufgabenhorizonte
8.4 Vom Kommen und Gehen – eine weiterführende Zusammenfassung
9 Wenn Kita-Sozialarbeit die Antwort ist ... – Adressat*innen- und organisationsbezogene Erwartungen an Kita-Sozialarbeit
9.1 Einleitung
9.2 Regionale Projektkontexte
9.3 Das Lehrforschungsprojekt »Kita-Sozialarbeit«
9.4 Ausgangspunkte: Wenn Kita-Sozialarbeit die Antwort ist, was war nochmal die Frage?
9.4.1 Fokus I: Zusammenarbeit mit Eltern und Familien
9.4.2 Fokus II: Zusammenarbeit mit dem Team und der Leitung
9.5 Herausforderungen im Etablierungsprozess von Kita-Sozialarbeit
9.6 Ausblick
10 Wenn Kita-Sozialarbeit wegfällt: Unterstützungslücken für Familien, Kinder und Kita-Teams. Eine Fallstudie
10.1 Einleitung
10.2 Kontextinformationen
10.2.1 Zum Forschungsprojekt
10.2.2 Zur Kita
10.2.3 Kita-Sozialarbeit über das Projekt »KINDER STÄRKEN«
10.3 Methodisches Vorgehen
10.3.1 Datenerhebung
10.3.2 Datenauswertung
10.4 Ergebnisse
10.4.1 Charakter der Kita-Sozialarbeit in der Einrichtung
10.4.2 Unterstützung für Fachkräfte und Eltern
10.4.3 Unsichere Arbeitsbedingungen und Wegfall
10.4.4 Was passiert, wenn Kita-Sozialarbeit wegfällt?
10.5 Wirkungspotenziale von Kita-Sozialarbeit
10.5.1 Unterstützung belasteter Familien und verbesserte Teilhabe von Kindern
10.5.2 Entlastung von Kita-Teams
10.6 Limitationen
10.7 Fazit und Ausblick
10.7.1 Chancen und Potenziale von Kita-Sozialarbeit
10.7.2 Offene Fragen
11 Sozialpädagogische Beratung – Perspektiven der Eltern und der pädagogischen Fachkräfte
11.1 Kita-Sozialarbeit – Versuch einer Begriffsklärung
11.2 Sozialpädagogische Beratung – Skizzierung des untersuchten Projektes
11.2.1 Wissenschaftliche Begleitung
11.2.2 Ausgewählte Ergebnisse
11.3 Zusammenfassung und Diskussion
12 Brücken bauen für Bildungswege: Kita-Sozialarbeit als Wegbereiter zum Schulstart
12.1 Einleitung
12.2 Der Übergang von der Kita zur Grundschule – eine Herausforderung für alle Akteur*innen
12.3 Kita-Sozialarbeit in der Praxis: Maßnahmen zur Übergangsgestaltung
12.3.1 Individuelle Unterstützung
12.2.2 Netzwerkarbeit und institutionelle Kooperation
12.2.3 Präventive Maßnahmen zur Übergangsgestaltung
12.4 Das Projekt »SommerVORschule«: Best Practice für eine gelingendere Übergangsgestaltung
12.5 Einschätzungen zur Wirkung von Kita-Sozialarbeit im Kontext des Übergangs von der Kita zur Grundschule – eine empirische Untersuchung
12.6 Herausforderungen beim Wechsel von der Kita in die Grundschule
12.6.1 Ergebnisse der Befragung der pädagogischen Fachkräfte
12.6.2 Ergebnisse der Befragung der Sozialpädagog*innen/Sozialarbeiter*innen
12.7 Einschätzungen zum Projekt »SommerVORschule«
12.7.1 Gesamteinschätzung durch Grundschullehrer*innen, Sozialpädagog*innen/Sozialarbeiter*innen und pädagogische Fachkräfte
12.7.2 Bewertung der Relevanz der Kita-Sozialarbeit aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte
12.7.3 Bewertung des Projektes aus Sicht der Sozialpädagog*innen/Sozialarbeiter*innen
12.8 Subjektive Rückmeldungen zur »SommerVORschule«
12.9 Fazit und Ausblick
III Perspektiven
13 Chancengerechtigkeit entgegenwirken – Kita-Sozialarbeit als Akteurin im institutionellen und familialen Kinderschutz
13.1 Kita als Schutzraum
13.2 Machtmissbrauch und seine Auswirkungen auf Kinder – ein unliebsames, aber notwendiges Thema für den Kinderschutz in der Kita
13.3 Eltern, Kind und Fachkräfte – ein Beziehungsdreieck unter Druck
13.4 Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – eine geförderte Kindheit
13.5 Statt Chancengerechtigkeit: doppelte Chancenungerechtigkeit für Kinder aus benachteiligten Quartieren
13.6 Kinderschutz als Überschrift für Kita-Sozialarbeit?
13.7 Fazit
14 Kita-Sozialarbeit vernetzt: evidenzbasierter Auf- und Ausbau von Kita-Netzwerken
14.1 Einleitung
14.2 Hintergrund
14.3 Vernetzung aus Perspektive der Kita-Sozialarbeit
14.4 Regionale Netzwerke ausgestalten
14.5 Netzwerkanalyse im Kita-Kontext
14.5.1 Netzwerkgröße
14.5.3 Netzwerkzusammensetzung
14.6 Potenziale für die Kita-Sozialarbeit
14.7 Fazit
15 »Ach, so sehen Sie das?« – Der systemische Ansatz als Zugang zur Arbeit mit Eltern in der Kita-Sozialarbeit
15.1 Einleitung
15.2 Die Kita – ein Ort, viele Systeme
15.3 Familiäre und professionelle Sozialisationsprozesse: Systeme, die sich verbinden
15.4 Systemorientierte Fallanalyse: Eine Erweiterung von Handlungsoptionen
15.5 Fakten neu denken: Perspektivenvielfalt durch systemisches (Hinter-)Fragen
15.6 Überwindung von Systemgrenzen durch Erweiterung der (Kita-)Systemfunktionalität
16 Politische Bildung in der Kita-Sozialarbeit: eine Annäherung
16.1 Einführung
16.2 Politische Bildung in der Sozialen Arbeit
16.3 Der Ansatz der Demokratiebildung in der Kita-Sozialarbeit
16.4 Politische Bildung in der Kita-Sozialarbeit?
16.4.1 (Selbst-)Verständnis der Fachkräfte
16.4.2 Partizipationserfahrungen der Kinder
16.5 Fazit
17 Kita-Sozialarbeit in Berlin – Stationen auf dem Weg zum Modellprogramm
17.1 Einleitung
17.2 In Kürze – Kita-Sozialarbeit in Berlin
17.3 Pilotprojekt Kita-Sozialarbeit
17.4 Von Projekten über die Kommunen ins Land
17.5 Modellvorhaben »Kita-Sozialarbeit«
17.6 Fazit und Ausblick
18 Ergänzende Soziale Arbeit in Kitas im ESF-Programm KINDER STÄRKEN im Freistaat Sachsen
18.1 Einleitung
18.2 Ziele und Konzept des Programms KINDER STÄRKEN
18.3 Auswahlverfahren und »Belastungsindex« im Programm KINDER STÄRKEN
18.4 Lebenslagen von Kindern als Ausgangspunkt des Programms KINDER STÄRKEN
18.5 Maßnahmen, Angebote und Leistungen der zusätzlichen Fachkräfte
18.6 Bedingungen für das Gelingen ergänzender Sozialer Arbeit im Programm KINDER STÄRKEN
18.6.1 Faktor zusätzliche Fachkraft
18.6.2 Faktor kollektive Haltung
18.6.3 Faktor Leitung und Träger
18.6.4 Faktor Sicherstellung von Zusätzlichkeit und Ergänzung
18.6.5 Faktor Kooperation und Netzwerk
18.6.6 Faktor Fachlicher Austausch und Reflexion
18.6.7 Faktor Begleitung und Unterstützung
18.6.8 Faktor Strukturen und Ressourcen
18.6.9 Faktor Kontinuität und Perspektive
18.7 Ist KINDER STÄRKEN jetzt Kita-Sozialarbeit?
19 Vom Status quo zum Quo vadis – Zur Ausleitung
IV Verzeichnisse
Autor*innenverzeichnis
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Der Herausgeber
Nurdin Thielemann ist Professor für Soziale Arbeit an der IU Internationalen Hochschule Magdeburg. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte bilden Professionsentwicklung und Professionalität in der Kindheitspädagogik und der Sozialen Arbeit, Bildung und soziale Ungleichheit, Theorie-Praxis-Transfer und Kita-Sozialarbeit. Nach dem Soziologiestudium promovierte er als Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung im Kolleg ›Bildung und soziale Ungleichheit‹ an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Erziehungswissenschaft.
Nurdin Thielemann (Hrsg.)
Kita-Sozialarbeit
Grundlagen, Konturen, Perspektiven
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-046577-0
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-046578-7epub: ISBN 978-3-17-046579-4
Vorwort
Das Handlungsfeld Kita-Sozialarbeit wird trägerspezifisch, über Modellprojekte, regional begrenzt, aber auch landesweit in einer zunehmenden Anzahl von Bundesländern implementiert und – mal mehr, mal weniger intensiv – wissenschaftlich begleitet. Kita-Sozialarbeit knüpft in seinen Argumentationslinien, Ausgestaltungen und Umsetzungsvarianten an verschiedene wissenschaftliche Annahmen, organisationalen Zielstellungen und berufspolitischen Positionierungen an.
Am 31. Mai 2024 fand der erste bundesweite Fachtag zu Kita-Sozialarbeit an der IU Internationalen Hochschule Leipzig in Kooperation mit dem Deutschen Berufsverband für Sozialarbeit e. V. (DBSH) statt.
Im Kontext des Fachtags wurden Überlegungen angestellt, wie die Inhalte der Vorträge und Workshops gut aufbereitet zur Verfügung gestellt werden können. Mehr noch, einzelne Teilnehmer*innen des Fachtags – aus Wissenschaft und Praxis – wurden auf diese als Einladung adressierten Überlegungen aufmerksam und baten um die Möglichkeit der inhaltlichen Mitgestaltung. Vis-à-vis erkundigte ich mich, ob die Bereitschaft an einer Mitarbeit zu einem Sammelband bestünde. Aus der Idee einer reinen Dokumentation erwuchs die Überzeugung, dass eine bloße Abbildung des Fachtags womöglich schwerlich trägt, da das Thema bundesweit Suchbewegungen bei Sozialarbeiter*innen, Kindheitspädagog*innen, pädagogischen Fachkräften, Kita-Leitungen, Trägern von Kindertagesstätten, Kommunalverwaltungen und vereinzelt Grundschulen auslöst. Es lassen sich dabei Suchbewegungen feststellen, die nicht nur Fragen nach dem ›Was‹ und ›Wie‹ stellen, sondern auch nach Argumentationsgrundlagen für die Implementierung von Kita-Sozialarbeit.
Kita-Sozialarbeit erlangt zunehmend bundesweite Aufmerksamkeit in der frühpädagogischen und sozialarbeiterischen Fachpraxis, den dazugehörigen Fachwissenschaften sowie den kommunalen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Der entstandene Sammelband versucht, die Brücke zwischen den aktuellen, akademischen Diskursen und den praktischen Handlungsansätzen genauso nachzuzeichnen wie zwischen den Ansätzen und Initiativen in den unterschiedlichen Regionen – symbolisch – anhand der versammelten Autorenschaft mit Beiträgen aus Bamberg, Berlin, Bernburg, Dresden, Erfurt, Freiburg im Breisgau, Fürth, Görlitz, Halle an der Saale, Kiel, Koblenz, Leipzig, Ludwigsburg, Magdeburg, Mainz, Merseburg, Regensburg und Rostock.
Der vorliegende Sammelband ›Kita-Sozialarbeit. Grundlagen – Konturen – Perspektiven‹ wird die sich aktuell dynamisch entwickelnde Kita-Sozialarbeit aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive diskutieren, dabei interdisziplinäre Möglichkeiten und mögliche disziplinäre Grenzen sowie praktische Umsetzungsvarianten und Herausforderungen aufzeigen. Der Sammelband ist eine Einladung an Praxis und Wissenschaft, generell an all jene, die Soziale Arbeit in Kitas schätzen und weiterentwickeln wollen.
Nurdin ThielemannMagdeburg, 14. 06. 2025
1 Entwicklung(en) und Momentaufnahme(n) – Zur Einleitung
Nurdin Thielemann
Kita-Sozialarbeit ist ein neues Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, dessen Ansätze weitgehend unabhängig voneinander entstanden sind. Ein Blick auf die einzelnen Bundesländer bzw. die Praxis zeigt, dass es nicht die eine Entwicklung von Kita-Sozialarbeit gibt, sondern vielmehr eine Gleichzeitigkeit von unabhängigen, unterschiedlichen Ansätzen und verschiedenen (Selbst-)Verständnissen. Während es erste landesweite Modellprojekte (z. B. Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt) bis hin zu einer gesetzlichen Rahmung (Rheinland-Pfalz) gibt, finden sich auch kommunale und trägerangeschobene Initiativen (z. B. in Dortmund, im brandenburgischen Senftenberg oder im baden-württembergischen Hohelohekreis u. v. m.). Zudem engagieren sich bundesweit einzelne Sozialarbeiter*innen in Rahmen von Kita-Sozialarbeit, um Träger von der Sinnhaftigkeit Sozialer Arbeit in Kitas zu überzeugen ebenso wie jene, die Kitas als neues Handlungsfeld kennenlernen und Netzwerke und Ausgestaltungsideen suchen.
Seit 2015 ist ein rasches Anwachsen des Handlungsfeldes Kita-Sozialarbeit zu beobachten (Thielemann 2022), welches sich auch ca. zehn Jahre nach seiner beginnenden Expansion als unübersichtlich, in seinen Begriffen uneindeutig und in seinen Ansätzen als wenig ausgeleuchtet darstellt. Kita-Sozialarbeit kann in vereinzelten Bundesländern in der Fläche als konzeptualisiert, gut ausgebaut und sozial- und bildungspolitisch verankert nachgezeichnet werden. Im scheinbaren Widerspruch dazu erscheint Kita-Sozialarbeit in manchen Bundesländern weitgehend unbekannt. Mit Blick auf die berufspraktische, aber auch gesellschaftspolitische, bundesweite Debatte kann immer noch festgestellt werden, dass es bisher keine gemeinsame geteilte Idee einer Praxis (oder Bezeichnung) von Kita-Sozialarbeit gibt. Innerhalb der fachwissenschaftlichen, aber auch handlungspraktischen Auseinandersetzung kann zudem ein Ringen um ein tragfähiges, allgemeingültiges Profil konstatiert werden, da Kita-Sozialarbeit bisher vom jeweiligen lokalen Verständnis und der damit verbundenen Praxis geprägt ist.
Kita-Sozialarbeit ist nicht nur als ein relativ neues Handlungsfeld der Sozialen Arbeit und Kindheitspädagogik zu verstehen, sondern ist damit auch im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe zu betrachten. Karin Böllert (2018) folgend, stellt die Kinder- und Jugendhilfe einen gesellschaftspolitischen Konsens dar. Das Handlungsfeld Kita-Sozialarbeit wird seit ca. zehn Jahren in das zugrunde liegende gesellschaftspolitische Ringen um eben diesen Konsens eingepflegt. In den einleitenden Worten zu ihrem »Kompendium Kinder- und Jugendhilfe« schreibt Böllert, dass die Kinder- und Jugendhilfe
»die soziale Infrastruktur des Aufwachsens junger Menschen und der Unterstützung ihrer Familien, die sozialstaatlich regulierte Angebote der Betreuung, Erziehung und Bildung sowie des Schutzes, der Förderung und Beteiligung beinhaltet, mit dem Ziel der individuellen Befähigung zur Entwicklung selbstbestimmter Lebensentwürfe und gemeinwohlorientierter Lebenspraxen sowie der strukturellen Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe als Ausdruck der Wahrnehmung einer öffentlichen Verantwortung für gleichberechtigte Lebenschancen und den Abbau sozialer Ungleichheiten« (Böllert 2018, S. 4)
darstellt. Im vorliegenden Sammelband werden verschiedene, in diesem Zitat verbürgte Annahmen im Lichte der Kita-Sozialarbeit diskutiert. Die wissenschaftliche Perspektive wird dabei mit Studien unterstützt, um das Handlungsfeld besser zu verstehen. Es darf nämlich gelten, dass es bisher kaum1 Forschung zum Stand der Kita-Sozialarbeit gibt. Dieser steckt in den – Sprichwort getreuen – Kinderschuhen.
Der vorliegende Sammelband adressiert entsprechend Wissenschaftler*innen und Praxisgestalter*innen, versucht die aktuellen wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskussionen nachzuzeichnen sowie Wege der Gestaltung in der Praxis aufzuzeigen. Der aktuellen Suchbewegung im Handlungsfeld Kita-Sozialarbeit Rechnung tragend, vereint der Sammelband Beiträge, die sich thematisch, wenn auch nicht immer trennscharf, in die Schwerpunkte Grundlagen, Konturen und Perspektiven einordnen. Unter Grundlagen subsumieren sich Texte, die zur theoretischen Einordnung von Kita-Sozialarbeit sowie einem Verständnis von elementar damit verbundenen Begriffen beitragen. Der Abschnitt Konturen umfasst Studien, die die Forschungslandschaft zur Kita-Sozialarbeit erweitern und damit das Verständnis vom Handlungsfeld punktuell vertiefen sollen. Unter Perspektiven sind Beiträge gefasst, die Ausgestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Dabei werden nicht nur Ansätze, die bereits in der Praxis umgesetzt werden, besprochen, sondern auch Potenziale andiskutiert.
Im ersten Abschnitt – Grundlagen – unternehmen Nurdin Thielemann, Barbara Lochner, Noreen Naranjos Velazquez, Armin Schneider und Andreas Wiere den Versuch der Schärfung und Vermittlung verschiedener aktueller Diskussionslinien (▸ Kap. 2). Dieses Vorgehen ermöglicht es, Konturen eines noch zu bestimmenden Profils ›Kita-Sozialarbeit‹ aufzuzeigen.
Lara Sielaff beleuchtet in ihrem Beitrag, wie Kita-Sozialarbeit an den Schnittstellen zu pädagogischen Fachkräften, Kita-Leitung und Kita-Fachberatung sowie sozialen Diensten fungiert (▸ Kap. 3). Zudem wird die Relevanz einer Aufgabenverteilung und Professionsabgrenzung besprochen.
Vanessa Schnorr zeigt anhand der Erfahrungen in Rheinland-Pfalz, wie die Kita-Sozialarbeit Einzelfallhilfe und Sozialraumorientierung verbindet, um Familien individuell zu unterstützen und gleichzeitig strukturelle Rahmenbedingungen im Sozialraum zu verbessern (▸ Kap. 4). Sie verdeutlicht dabei, wie durch eine bewusste methodische Gestaltung und enge Kooperation mit Akteur*innen im Sozialraum die Kita-Sozialarbeit nachhaltig zur Chancengerechtigkeit und sozialen Teilhabe von Familien beitragen kann.
Armin Schneider gibt Einblicke in das in Rheinland-Pfalz verankerte Sozialraumbudget (▸ Kap. 5). Sein Beitrag stellt Möglichkeiten, Chancen und Erfahrungen des Sozialraumbezuges der Kita-Sozialarbeit dar.
Janine Stoeck und Sandra Frisch zeigen, dass Familienbildungsprozesse sowohl im pädagogischen Handeln von Frühpädagog*innen als auch durch Kita-Sozialarbeiter*innen stattfinden (▸ Kap. 6). Es wird herausgearbeitet, dass Zuständigkeitsfragen zwischen den Berufsgruppen klärungsbedürftig sind und fallspezifisch, kontext- sowie einrichtungsbezogen unterschiedlich ausfallen müss(t)en. Im Beitrag gehen die Autorinnen diesem Zusammenhang nach und besprechen ihre Annahmen anhand eines Fallbeispiels.
Bastian Fischer fragt danach, inwieweit Verstehen bzw. verstehendes Diagnostizieren als Grundkompetenz von Kita-Sozialarbeiter*innen angesehen werden sollte (▸ Kap. 7). Ausgehend von aktuellen Überlegungen zu den Kompetenzen von Kita-Sozialarbeiter*innen wird die Relevanz einer solchen Grundkompetenz vor dem Hintergrund der Inklusion von Kindern mit (besonders) herausfordernden Verhaltensweisen anhand eines Fallbeispiels aufgezeigt.
Der zweite Abschnitt – Konturen – beginnt mit einem Beitrag von Nurdin Thielemann, in dem Ergebnisse einer qualitativen Studie vorgestellt werden, die sich mit dem Ankommen von Sozialarbeiter*innen in einem ihnen potenziell unbekannten Terrain (der Kita) befassen (▸ Kap. 8). Besprochen werden Felderschließungs- und Aushandlungsprozesse sowie exemplarische Aufgabenhorizonte seitens der Kita-Sozialarbeiter*innen.
Annegret Gaßmann und Barbara Lochner beleuchten die Rolle der Kita-Sozialarbeit in frühpädagogischen Handlungsfeldern und deren Umsetzung anhand von Ergebnissen eines Lehrforschungsprojekts (▸ Kap. 9). Diskutiert wird, welche »Antworten« von Kita-Sozialarbeit mit Blick auf die Bedarfe von Eltern, Teams und Leitungen erwartet werden und welche Herausforderungen sich im Etablierungsprozess zeigen.
Victoria Jankowicz stellt dar, was passieren kann, wenn Kita-Sozialarbeit wegfällt (▸ Kap. 10). Die Autorin begleitete ein Kita-Team respektive eine Kindertagesstätte auf dem Weg zum Kinder- und Familienzentrum. Während dieses Prozesses entfiel dort die Kita-Sozialarbeit aufgrund einer Finanzierungslücke.
Jens Müller und Elke Reichmann fokussieren die noch unterrepräsentierte Kita-Sozialarbeit in Baden-Württemberg (▸ Kap. 11). Präsentiert werden ausgewählte Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung eines Pilotprojekts in zwei Modellkommunen. Ihre Studie fokussiert Eltern, da diese bei kindlichen und familialen Herausforderungen wichtige Adressat*innen für Kita-Sozialarbeiter*innen darstellen und eine Zusammenarbeit mit ihnen unerlässlich ist.
Der Beitrag von Ute Pospischil und Nurdin Thielemann bespricht die Potenziale und Herausforderungen der Kita-Sozialarbeit in der Übergangsgestaltung zwischen Kita und Grundschule (▸ Kap. 12). Ein besonderer Fokus liegt auf einem in Berlin umgesetzten Projekt namens »SommerVORschule«.
Der Beitrag von Lara Irene Wintzer, Jessica Ferber und Ruth Büllesbach bildet den Auftakt des Abschnitts Perspektiven. Die Autorinnen zeigen, wie Kita-Sozialarbeit die Deutungs- und Handlungsspielräume von pädagogischen Fachkräften im Rahmen der Präventions- und Interventionskette gegen (institutionelle) Kinderrechtsverletzungen zusammen mit den pädagogischen Fachkräften erweitern und wirksam verankern kann (▸ Kap. 13).
Noreen Naranjos Velazquez gibt Impulse für den praxisorientierten Einsatz der egozentrierten Netzwerkanalyse (▸ Kap. 14). Es wird gezeigt, inwiefern diese Methode dazu beitragen kann, ausgewählte Aufgaben der Kita-Sozialarbeit messbar, sichtbar und dadurch greifbar zu machen. Im Vordergrund steht die Frage, wie netzwerkanalytische Kennzahlen als Grundlage für strategische Entscheidungen bzw. der Entwicklung weiterer Konzepte der Kita-Sozialarbeit dienlich sein können.
Der Beitrag »Ach, so sehen Sie das?« (▸ Kap. 15) zeigt, wie der systemische Ansatz in der Kita-Sozialarbeit genutzt werden kann und wie Eltern, Fachkräfte und Institutionen als miteinander vernetzte Systeme agieren können. Mandy Model und Johannes Pecht heben dabei die Rolle der Kita-Sozialarbeit als vermittelnde Instanz hervor und bieten praxisnahe Ansätze zur Förderung eines dynamischen Raums, in der Zusammenarbeit zwischen den Anforderungen der Eltern und den Anforderungen der Kita besser funktionieren kann.
Michael Görtler und Reingard Knauer betrachten die politische Bildung in der Kita-Sozialarbeit unter besonderer Berücksichtigung des Ansatzes der Demokratiebildung (▸ Kap. 16). Dafür werden in einem ersten Schritt der Fokus auf die fachliche Auseinandersetzung mit politischer Bildung in der Sozialen Arbeit gerichtet, in einem zweiten Schritt Demokratiebildung als Ansatz in der Kita-Sozialarbeit diskutiert und in einem dritten Schritt exemplarische Herausforderungen einer Integration politischer Bildung in die Kita-Sozialarbeit skizziert.
Sabine Clausen und Jennifer Brehm beschreiben den erfolgversprechenden Werdegang der Kita-Sozialarbeit in Berlin (▸ Kap. 17). Dies geschieht ausgehend von zunächst singulären Projekten über die kommunale Ausweitung durch die Einbeziehung verschiedenster Akteure bis hin zu einem berlinweit angelegten Modellprogramm.
Der Beitrag von Andreas Wiere stellt Konzept, Praxis und Erfahrungen ergänzender Sozialer Arbeit im Rahmen des ESF Plus-Programms KINDER STÄRKEN in Sachsen vor (▸ Kap. 18). Seit 2016 arbeiten in nunmehr 270 Kitas zusätzliche Fachkräfte als Kita-Sozialarbeiter*innen und orientieren ihre Maßnahmen, Angebote und Leistungen an den spezifischen Lebenslagen von Kindern und Familien.
Abschließend führt Nurdin Thielemann in »Vom Status Quo zum Quo Vadis – Zur Ausleitung« (▸ Kap. 19) ausgewählte Gedanken und Ansätze der Beiträge zusammen und bündelt diese in fünf Standpunkte, um den aktuellen Arbeitsstand zum Handlungsfeld Kita-Sozialarbeit zu bereichern.
Die Einleitung in den Sammelband Kita-Sozialarbeit. Grundlagen, Konturen, Perspektiven abschließend, ist festzuhalten, dass Kita-Sozialarbeit in den eingangs genannten Annahmen zur Kinder- und Jugendhilfe ankert. Böllert resümiert, dass
»die Kinder- und Jugendhilfe das Spiegelbild der Geschichte des bundesrepublikanischen Sozialstaates und der hierin konzipierten Sozial-, Familien-, Bildungs-, Gesundheits-, Kinder- und Jugendpolitik [sei]. Kinder- und Jugendhilfe repräsentiert von daher immer auch die gesellschaftlich anerkannten Vorstellungen davon, wie Kinder und Jugendliche aufwachsen und erzogen werden sollen und welche gerechten Lebensverhältnisse dafür zu gewährleisten« (Böllert 2018, S. 4 f.)
seien. Dieser Aussage Rechnung tragend, scheint es stimmig zum Zeitgeist, dass sich das Handlungsfeld Kita-Sozialarbeit nun vermehrt ausbreitet. Insofern verbindet sich neben der praktischen und wissenschaftlichen Dimension immer auch eine politische Dimension, die Sorge dafür zu tragen habe, Soziale Arbeit in Kitas zunehmend zu legitimieren.
Literatur
Böllert, K. (2018): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Bergert, M. & Schwenzer, V. (2018): Evaluation der Kita-Sozialarbeit in Berlin-Staaken und der erweiterten Elternarbeit in der Kita Arche-Noah: Camino Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im Sozialen Bereich gGmbH. Berlin: Evangelischer Kirchenkreis Spandau, 28. 03. 2019. Online verfügbar unter: https://www.spandau-evangelisch.de/file/710755, Zugriff am 26. 05. 2022.
Brand, R., Koch, M., Rostohar, S. & Sauer, M (2020): Abschlussbericht Kita-Sozialarbeit – Familien eine Stimme geben. Dortmund: Deutscher Kinderschutzbund e. V. Ortsverband Dortmund e. V. Online verfügbar unter: https://dksb-do.eu/wp-content/uploads/2021/03/Abschlussbericht-Bezirksregierung-2020.pdf, Zugriff am 26. 05. 2022.
Drößler, T. (2021): Kita-Sozialarbeit. Versuch einer Verortung im Feld der Kindertagesbetreuung. In: A. Schneider, M. Swat & Alexandra Gottschalk (Hrsg.), Nachhaltige Kita-Sozialräume – gemeinschaftlich entwickeln: Ein Wegweiser für kompetente Beteiligung (S. 190 – 201). Regensburg: Walhalla Fachverlag.
IBEB, Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit, Rheinland-Pfalz (2020): Dokumentation IBEB-Diskursforum zum Thema »Kita-Sozialarbeit eine Profilschärfung für RLP« am 25. 11. 2020. Hochschule Koblenz. Online verfügbar unter: https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/fb_sozialwissenschaften/IBEB/Arbeitsfelder/IBEB-Diskursforum/Dokumentation_IBEBDiskursforum_Kita-Sozialarbeit_20210112.pdf, Zugriff am 10. 07. 2022.
Lochner, B. & Gaßmann, A. (2024): Zusammenarbeit mit Familien in der Kita-Sozialarbeit. In: Sozial Extra 48, 419 – 423. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/s12054-024-00739-z, Zugriff am 25. 03. 2025.
Swat, M. & Reifenhäuser, A. (2022): Praxishandbuch Kita-Sozialarbeit. Weinheim: Beltz Juventa.
Thielemann, N. (2024): Familienorientierung in der Kita- und Schulsozialarbeit. In: Sozial Extra 48, 429 – 432. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/s12054-024-00740-6, Zugriff am 25. 03. 2025.
Thielemann, N. (2022a): Kita-Sozialarbeit – Ziele, Konzepte und Varianten. In: Soziale Arbeit: Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 71 (1), 9 – 14.
Thielemann, N. (2022b): Kita-Sozialarbeit. socialnet Lexikon. Bonn: socialnet. Online verfügbar unter: https://www.socialnet.de/lexikon/29491, Zugriff am 25. 03. 2025.
Zentrum für Forschung, Weiterbildung und Beratung an der ehs Dresden (2021): Das sächsische ESF-PROGRAMM KINDER STÄRKEN – Maßnahmen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen. Online verfügbar unter: https://www.kinder-staerken-sachsen.de/files/2021/12/Kurzversion_Bericht_ESF-Programm_KINDER-STAeRKEN_2021.pdf, Zugriff am 12. 12. 2023.
Endnoten
1Es sind bereits vereinzelte Publikationen entstanden. Unter ihnen Recherchearbeiten (Thielemann 2022a), Verständnisangebote (z. B. IBEB 2020, Thielemann 2022b), Evaluationen (z. B. Bergert & Schwenzer 2018; Brand, Koch, Rostohar & Sauer 2020, Hartung-Beck 2023), theoretische Einordnungen (z. B. Drößler 2021), Umsetzungsunterstützungen für die Praxis (Swat & Reifenhäuser 2022) oder wissenschaftliche Begleitungen (z. B. Begleitung des sächsischen ESF-Plus Programms KINDER STÄRKEN) und Verhältnisbestimmungen (z. B. Lochner & Gaßmann 2024, Thielemann 2024).
I Grundlagen
2 Kita-Sozialarbeit – Zur Konturierung eines sich entwickelnden Handlungsfeldes
Nurdin Thielemann, Barbara Lochner, Noreen Naranjos Velazquez, Armin Schneider & Andreas Wiere
2.1 Suchbewegung und Spannungsfelder – Zur Einleitung
Kita-Sozialarbeit etabliert sich seit mehreren Jahren in städtischen wie ländlichen Kindertageseinrichtungen (Kitas) als Antwort auf Herausforderungen, die sich aufgrund einer sich verändernden Gesellschaft respektive sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen in den Einrichtungen abbilden (DBSH 2022).
Bei den bisherigen Versuchen, sich einen bundesweiten Überblick zu verschaffen, zeigen sich Unterschiede in den Zugängen und der allgemeinen Organisation, beispielsweise in der gesetzlichen Verankerung, den Anstellungsträgern, der Koordination, der räumlichen Verortung, der Zuordnung zur Kita und in den Zielgruppen.
Aufgerufen werden in der Auseinandersetzung professionspolitische wie -theoretische Fragen der Zuständigkeit und Positionierung, der organisationalen Verortung und Entwicklung sowie der Beziehung zu den Adressat*innen. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, Kita-Sozialarbeit als Suchbewegung in diesen Spannungsfeldern darzustellen und zu betrachten. Dabei sollen die Möglichkeiten einer Profilbeschreibung beleuchtet werden.
Diskutiert wird in diesem Zusammenhang, inwiefern Kita-Sozialarbeit als kindheitspädagogisches bzw. sozialpädagogisches Handlungsfeld konzeptionell einzuordnen ist. Dies scheint gerade insofern dringlich, als Kita-Sozialarbeit genau da beginnt, wo originäre Aufgabenbereiche von pädagogischen Fachkräften in der Kita an ihre Grenzen kommen, und sich gleichwohl direkt an klassische Kompetenzfelder der Sozialen Arbeit, etwa die Bearbeitung sozialer Problemlagen und damit verbundener Benachteiligungen, anschließen.
2.2 Ausgangspunkte
Im Folgenden werden drei Diskussionslinien aufgegriffen, die aus verschiedenen Perspektiven Kita-Sozialarbeit als neues Arbeitsfeld in Ergänzung und Erweiterung der Kita begründen: der sozialräumliche Vernetzungsgedanke, Lebenslagen und Teilhabechancen von Kindern und die Gestaltung des Präventionsauftrags.
2.2.1 Kita-Sozialarbeit und Sozialraum
Im Sinne des afrikanischen Sprichwortes »Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf« ist zu überlegen, wie der Sozialraum in modernen urbanen, aber auch ruralen Kontexten neu definiert und in die institutionelle Kindertagesbetreuung einbezogen werden kann oder gar muss. Grundsätzlich spielen bei der Sozialen Arbeit die drei klassischen methodischen Zugänge Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit (Wendt & Bokelmann 2023) auch hier eine Rolle. In der Folge der »Entdeckung des Sozialraumes«, nicht nur als räumliche Abgrenzung, sondern als Aneignungs- und Gestaltungsraum, scheint es nur konsequent, dass mit der Kita-Sozialarbeit oder gar der Kita-Sozialraumarbeit hier ein neuer Anlauf intendiert wird, sozialräumliches oder sozialraumorientiertes Denken in diese sich neu entwickelnde Arbeit zu integrieren. Hier ist zunächst vom Vernetzungsgedanken auszugehen, dahingehend, dass Kita-Sozialarbeit Ressourcen, Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten im Sozialraum entdeckt, bei Bedarf vernetzt, für Kinder und Familien zugänglich macht und hier ggf. Verbindungen schafft. Die Übergänge zu einer Gemeinwesenarbeit, die dezidiert Ressourcen der Umwelt aktiviert und nutzt, sind hier fließend.
»Eine Orientierung an den Lebenswelten und Sozialräumen der Kinder, ihrer Eltern und Familien ist weder Selbstzweck noch eine ganz neue Erkenntnis. Kinder sind und waren nie nur Kinder in der Kindertageseinrichtung, sondern sie bringen ihre Welt, ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit in die Einrichtung und erkunden, entdecken den Art, die Nachbarschaft, die Umgebung, in der sie leben« (Schneider 2015, S. 9).
Der Sozialraum wird aus diesem Verständnis heraus stärker als ein dynamischer, sich verändernder Aneignungsraum verstanden, in dem Partizipation eine große Rolle spielt (Deinet 2010; Hinte 2014; Kessl & Reutlinger 2010; Kröhnert 2025).
2.2.2 Lebenslagen und Teilhabechancen von Kindern und Familien als Ausgangspunkt von Sozialer Arbeit in Kitas
Die Lebenslagen von Kindern und ihren Familien in unserer Gesellschaft sind heterogen: Kinder wachsen in unterschiedlichen Familienformen auf, verfügen über ein ungleiches Maß an materiellen und sozialen Ressourcen und sind in Herkunft, körperlichen Voraussetzungen, Geschlecht, Hautfarbe und/oder Religion divers. Daraus resultieren unterschiedliche gesellschaftliche Positionierungen, Privilegierungen und Diskriminierungen, was sich bereits in frühen Jahren auf ihre gesellschaftliche Teilhabe und Bildungschancen auswirkt. In Bezug auf Kinder in Kindertageseinrichtungen zeigt sich dies erstens hinsichtlich eines ungleichen Zugangs zu Kindertageseinrichtungen (Huebener et al. 2023; Hogrebe et al. 2021). Zweitens haben Kinder und Eltern aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher Positionierungen und Lebenslagen unterschiedliche, mitunter sogar widersprüchliche Bedarfe und Erwartungen an das Angebot der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung, die die Organisation Kita und ihr Personal wiederum unterschiedlich gut zu deuten und aufzugreifen vermag (u. a. Nentwig-Gesemann & Hurmaci 2020). Ein dritter Aspekt ist, dass Kindertageseinrichtungen mit der Anforderung des Ausgleichs ungleicher Startchancen konfrontiert ist, bisherige Forschungsarbeiten aber ein uneinheitliches Bild zeichnen, ob und wie dieser Kompensationsanspruch in Kindertageseinrichtungen erfüllt werden kann (Ghirardi et al. 2023; Anders 2013, S. 262). Betz weist wiederholt darauf hin, dass »Skepsis gegenüber dieser vorschulischen Kompensationseuphorie angebracht« (Betz 2010, S. 114) sei. Vielmehr müssten viertens »ungleichheitsrelevante Begleiterscheinungen« (ebd.) kritisch hinterfragt werden, was bedeutet, Kindertageseinrichtungen als gesellschaftliche Orte in den Blick zu nehmen, an denen soziale Ungleichheiten nicht nur bearbeitet (Gramelt 2020, S. 476), sondern auch reproduziert werden (Simon et al. 2019; Betz 2015).
Initiativen und Programme, die diese lebenslagenbezogenen Aspekte zum Ausgangspunkt nehmen, fragen danach, welchen Beitrag Kita-Sozialarbeit dazu leisten kann, auf manifeste Risiken und Folgen diskriminierender bzw. riskanter Lebenslagen von Kindern zu reagieren, indem zum einen Unterstützungsleistungen für die Kinder und Familien niedrigschwellig in der Kita implementiert, ausgebaut oder verbessert werden sowie zum anderen ein Beitrag zur diversitätsreflexiven Organisationsentwicklung geleistet wird. Diesem Ansatz wird bislang vor allem in Programmen und Initiativen gefolgt. Hierzu zählen beispielsweise das Dresdner Handlungsprogramm »Aufwachsen in sozialer Verantwortung« (Lorenz & Stöcker 2021, 2024) und das sächsische ESF Programm KINDER STÄRKEN (Wiere 2018, Meyer & Wiere 2022) sowie das Thüringer Landesprogramm »Vielfalt vor Ort begegnen« (Lochner et al. 2018).
Insbesondere Programme, die sich hierbei auf Kindertageseinrichtungen in segregierten Wohngebieten und Adressat*innen, die in einem hohen Maß von Benachteiligungen betroffen sind, konzentrieren, tragen dabei dem Rechnung, was Sehm-Schurig (2023, 2024) mit »Doppelkumulation« beschreibt. Demnach stehen soziale Positionierungen und Lebenslagen von Kindern sowie die damit verbundenen Risiken und Folgen für ihr Aufwachsen in einer Wechselwirkung zu strukturellen und fachlichen Beanspruchungen der Kita: Die Belastungen auf Seiten der Kinder und Familien wie auch auf Seiten der Institution verdichten und verstärken sich gegenseitig und dynamisch.
Kitas und andere professionelle Unterstützungssysteme sind Teil der kindlichen Lebenslage, die sowohl förderliche als auch hinderliche Auswirkungen auf die Kinder haben können, etwa in Bezug auf die materielle Versorgung, den psychischen und physischen Gesundheitszustand, die Kompetenzentwicklung, das Verhalten sowie auf die sich entwickelnden Werte und Weltanschauungen (Hock, Holz & Wüstendörfer 2000). Angebote der Kita-Sozialarbeit reagieren auf die im Rahmen der Kita spürbar werdenden Auswirkungen riskanter Lebenslagen und damit verbundenen gesellschaftlichen Positionierungen von Kindern. Einerseits wendet sie sich Formen sozialen Ausschlusses, Teilhabehemmnissen sowie lebenslagenbedingten Unterstützungsbedarfen von Kindern und Familien zu. Andererseits nimmt sie organisationale Praktiken und Routinen in den Blick, um die salutogenetische Qualität der Organisation zu erhöhen (Viernickel & Jankowicz 2022, S. 12) und die im Handeln eingelagerten Mechanismen der Ungleichheitsreproduktion reflexiv zu erfassen und korrigieren zu können (Simon et al. 2019).
2.2.3 Präventionsauftrag bzw. -anspruch der Kita-Sozialarbeit
Eine dritte Perspektive nimmt ihren Ausgangspunkt im Präventionsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe. Konstatiert wird, dass sich im Blick auf die Hilfeformen für Familien mit Kindern von null bis zehn Jahren eine »Präventionslücke« zwischen den Frühen Hilfen und der Grundschulsozialarbeit zeigt. In der Kita-Sozialarbeit wird eine Möglichkeit gesehen, diese Lücke zu schließen, wobei sich interessante Parallelen zu den interdisziplinären Netzwerken Frühe Hilfen abzeichnen, die – ebenso wie Kita-Sozialarbeit – von ihrer Diversität in puncto Zielgruppe, Umsetzung und Themenbereichen geprägt sind. Selbst die begrifflichen Dimensionen von »Frühen Hilfen« lassen sich im bundesweiten, aber auch internationalen Kontext vereinzelt als geradezu diffus beschreiben (Naranjos Velazquez 2023, S. 19). Eine zentrale Parallele von Kita-Sozialarbeit und Frühen Hilfen besteht darin, dass ein primär präventiver Gedanke zugrunde liegt: zeitnahe und unkomplizierte Unterstützung von Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen und damit einem explizit primär-präventiven bzw. selektiven sekundär-präventiven Charakter.
Auf kommunaler Ebene – exemplarisch in Magdeburg – adressiert die Kita-Sozialarbeit »Kitas, deren Familien im besonderen Maße von Bildungsbenachteiligungen und Armut bedroht oder betroffen sind« (Jugendamt Magdeburg, Koordinierungs- und Netzwerkstelle Soziale Arbeit in Kitas).
Teilweise wird Kita-Sozialarbeit sogar als Prävention von Jugendgewalt forciert. Es erscheint sinnhaft, möglichst frühzeitig Unterstützung an Familien zu adressieren, die bspw. in der Pflege sowie Erziehung herausgefordert sind und deren Kinder in der Jugendphase zu deviantem Verhalten neigen. So begründet sich die Finanzierung des Berliner Landesprogramms »Kita-Sozialarbeit 24/25« im Jugendgewaltgipfel 2023, in dem Maßnahmen zur Prävention von Jugendgewalt mit Fördermitteln ausgestattet wurden und »Kita-Sozialarbeit« als siebente von 29 Maßnahmen benannt wird (Berliner Staatskanzlei, 2023) (Thielemann 2025a).
2.3 Kita-Sozialarbeit als Bindeglied zwischen Frühen Hilfen und Schulsozialarbeit
Im Folgenden wird Kita-Sozialarbeit entlang der beiden etablierten und thematisch rahmenden Arbeitsfelder innerhalb der Präventionskette, der Frühen Hilfen und der Schulsozialarbeit eingeordnet sowie Ähnlichkeiten, Parallelen, aber auch Unterschiede betont.
2.3.1 Übergang Frühe Hilfen – Kita
Netzwerke Frühe Hilfen wurden in Deutschland seit 2012 flächendeckend aus- und aufgebaut. Zu einer grundlegenden Idee dieser interprofessionell breit aufgestellten Angebote gehört es, »möglichst frühzeitig Familien Angebote zur Verfügung zu stellen, um ungünstige Entwicklungsverläufe bei Kindern zu verhindern« (Naranjos Velazquez 2023, S. 19). Durch die Nutzung dieser etablierten Strukturen der Frühen Hilfen können Kita-Sozialarbeitende Familien direkt und ressourcenschonend in ein umfassendes Unterstützungsnetz einbinden, das Angebote wie Elternberatung, Familienhebammen und weitere präventive Hilfen umfasst (Naranjos Velazquez 2023, S. 19 – 21). Durch die Anknüpfung an ein bereits etabliertes System reduziert sich der organisatorische Aufwand erheblich und ermöglicht es den Fachkräften, ihre Kapazitäten stärker auf die direkte Arbeit mit den Familien zu fokussieren. Anzunehmen ist, dass eine solche Vernetzung die Effizienz und Qualität der Kita-Sozialarbeit stärkt, da Familien schneller und zielgerichteter passende Angebote finden und nutzen können. Darüber hinaus fördert die Integration in die »Netzwerke Frühe Hilfen« einen sozialräumlichen Ansatz, der die Ressourcen und Potenziale des unmittelbaren Umfelds einbezieht. Dies ermöglicht es der Kita-Sozialarbeit, gezielt Familien in herausfordernden Lebenslagen zu erreichen und zu unterstützen. So kann durch die enge Zusammenarbeit mit Akteur*innen im Rahmen der »Netzwerke Frühe Hilfen« eine frühzeitige, präventive Unterstützung stattfinden, die langfristig zur Chancengleichheit und Stabilisierung der Lebenssituation von Kindern und ihren Familien beiträgt, was auch dem Bildungs- und Teilhabegesetz entspricht. Insbesondere in Kitas in benachteiligten Gebieten mit hohen und komplexen Belastungen in der Adressat*innenschaft wie auch im Sozialraum scheinen diese Vernetzungs- und Unterstützungsleistungen von besonderer Bedeutung zu sein, da diese sonst dem Risiko ausgesetzt sind, »Kitas 2. Klasse« zu sein (Schieler & Menzel 2024). Kita-Sozialarbeit wäre in diesem Sinne sowohl Handlungsziel als auch Handlungsempfehlung (ebd., S. 25 f.). Insgesamt gilt jedoch ebenso für die Kita-Sozialarbeit, wie für Frühe Hilfen, dass interdisziplinäre Vernetzung keinen einheitlichen Weg kennt (Naranjos Velazquez 2023, S. 76).
2.3.2 Übergang Kita – Grundschule
Im Zuge des Präventionsgedanken und der Ermöglichung gelingenderen Übergängen in der Bildung ließe sich Kita-Sozialarbeit geradewegs mit Schulsozialarbeit assoziieren: als professionsbedingte Schicksalsvergemeinschaftung, die Übergänge gestalten kann. Darauf, dass dieses Unterfangen nicht irritationsfrei gelingt, deuten – neben der Tatsache, dass bei Weitem keine flächendeckende Soziale Arbeit an Grundschulen vis-à-vis Soziale Arbeit an Kitas etabliert ist – erste kleine Studien (▸ Kap. 12). So wird auch der Aushandlungsprozess bzgl. der Zuständigkeit als potenziell konflikthaft wahrgenommen. Fraglich ist, ob die Kita-Sozialarbeit die Schulsozialarbeit oder Lehrkräfte in der Grundschule im Prozess der Übergangsgestaltung adressiert oder ob Kita-Sozialarbeit auf institutioneller Ebene (bspw. durch die Etablierung von Arbeitskreisen) die Kita und die Grundschule miteinander verbinden kann.
Die schrittweise Implementierung der Kita-Sozialarbeit wird sozialpolitisch mit den Erfolgen der seit fast 50 Jahren bestehenden Schulsozialarbeit argumentiert (Thielemann 2022a). Die zentralen Gemeinsamkeiten von Kita-Sozialarbeit und Schulsozialarbeit bestehen darin, dass sie auf den Ausgleich von sozialer Benachteiligung, die Gestaltung von Übergängen sowie Vernetzung abzielen (IBEB 2020). Wie Kita- und Schulsozialarbeit mit diesem Auftrag umgehen, ist jeweils sehr unterschiedlich. In dem Versuch, das Verhältnis der beiden Handlungsfelder zu bestimmen, stehen noch viele Diskussionen aus.
Exemplarisch werden zwei Diskurse angerissen: Erstens wird in der rechtlichen Betrachtung deutlich, dass Kita- und Schulsozialarbeit in unterschiedlichen Bezügen agieren. Der Besuch einer Schule in Deutschland ist verpflichtend, was sich auch auf sozialarbeiterisches Handeln in diesem Kontext auswirkt. Die Schulsozialarbeit bildet sich in § 13a SGB VIII ab. Der Besuch einer ist Kita freiwillig und Kita-Sozialarbeit weist (noch) keine rechtliche Grundlage im gleichen Sozialgesetzbuch aus. Dies schlägt sich u. a. darin nieder, dass das Verhältnis vom Träger der Kita-Sozialarbeit und dem Träger der Kita, die Soziale Arbeit anbietet, noch zu eruieren ist. So finden sich aktuell zwei Modelle: Der Träger der Sozialen Arbeit ist gleich der Träger der Kita oder der Träger der Sozialen Arbeit ist ungleich der Träger der Kita. Diese vorherrschenden Modelle sind für die Schulsozialarbeit rechtlich geklärt, denn »Schulsozialarbeit ist eine Aufgabe der Jugendhilfe, die ausschließlich nach den Regeln des SGB VIII erfüllt wird. Das Schulgesetz findet auf sie keine Anwendung« (Kunkel 2013, S. 95). Das heißt, es besteht eine klare Trennung vom Auftrag der Schule und dem Auftrag der Sozialen Arbeit, was wiederum bedeutet, dass der Träger der Sozialen Arbeit unabhängig von der Schule ist; Schule und Soziale Arbeit stehen (rechtlich) nebeneinander. Erste rechtliche Auseinandersetzungen zur Kita-Sozialarbeit, die sich wie das Kitawesen im SGB VIII abbildet, sehen im Gegensatz dazu die Legitimation, die Soziale Arbeit in die Organisationsstruktur der Kita einzubinden (Gerstein 2024). Diese unterschiedlichen rechtlichen Bezüge provozieren sowohl strukturelle als auch inhaltlich unterschiedliche Ausprägungen von Kita- und Schulsozialarbeit. Um diese unterschiedlichen Ausprägungen sprachlich deutlich zu machen und die beiden Bereiche, die notwendig aufeinander zu beziehen sind, auch sprachlich deutlicher zu differenzieren, spricht sich Schneider für die Bezeichnung Kita-Sozialraumarbeit aus (Schneider 2022).
Ein zweiter, von der rechtlichen Vorortung weitgehend unabhängiger Diskursstrang bezieht sich auf die Ebene der Adressat*innen: Während in der Lebensspanne von etwa sieben Jahren bis zur Erfüllung der Schulpflicht, »das Abhängigkeitsverhältnis der Schüler*innen von ihren Familien mit zunehmendem Alter geringer wird, sie mobiler sind und sie sich mit zunehmendem Alter auch unabhängiger mit Freund*innen im Sozialraum bewegen können« (Sakowski & Thielemann 2023, S. 25), sind Kinder im Kita-Alter trotz individueller Entwicklungsdifferenzen in ein enges und dynamisches Beziehungsgeflecht zu ihren Eltern eingebunden und in vielen Fragen auf deren Stellvertretung angewiesen. Entsprechend richtet sich Kita-Sozialarbeit häufig deutlich stärker an Eltern als Adressat*innen als dies bei Leistungen der Schulsozialarbeit der Fall ist.
2.4 Kita-Sozialarbeit als professionsbezogener Aushandlungs- und Grenzziehungsprozess
Aushandlungen und Grenzziehungen, die durch das Hinzukommen der Kita-Sozialarbeit im Professionsgefüge entstehen, stehen im Zentrum der Frage nach Zuständigkeiten und deren Grenzen. In dem 1988 veröffentlichtem Werk »The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor« beschreibt Andrew Abbott die Genese und Gestalt von Professionen. Seine immer noch tragfähige Theorie zur historischen Entwicklung von Professionen, ihrem Ringen um Zuständigkeit und der damit verbundenen Grundlagen für die Zuständigkeiten in den jeweiligen zu bearbeitenden Felder lässt sich auch in der Etablierung des Handlungsfeldes Kita-Sozialarbeit nachzeichnen. Die drei eben benannten Stoßrichtungen lassen sich zusammenfassend darstellen und auf das Handlungsfeld Kita-Sozialarbeit übersetzen:
»Vorstellungen, [...] dass sich Professionen nach einem bestimmten Schema entwickeln, und das gar in unterschiedlichen Gesellschaften in ähnlicher Weise, weist Abbott (1988) theoretisch und empirisch als nicht tragfähig zurück. Professionen bilden sich und wachsen an, teilen sich und vereinigen sich wieder, passen sich an oder sterben ab, höhere Professionen saugen weniger Qualifizierte auf, unterschiedliche, aber ähnliche konkurrieren durchaus über lange Zeit« (Rabe-Kleberg 1996, S. 289).
Mit Blick auf die Entwicklung des Handlungsfeldes Kita-Sozialarbeit lässt sich konstatieren, dass Kita-Sozialarbeit bundesweit durch weitgehend voneinander unabhängige Initiativen entstanden ist. Es gibt also nicht die eine Momentaufnahme oder die eine Entwicklung. Es ist eher eine Gleichzeitigkeit von unabhängigen Ansätzen zu bemerken. So lassen sich beispielsweise in Halle an der Saale erste auch als Kita-Sozialarbeit benannte Ansätze 2002, in Berlin 2005 oder in Rheinland-Pfalz, in Alzey, 2012 finden (Thielemann 2024). Unklar ist, wie sich Kita-Sozialarbeit weiterentwickeln wird. Das gilt sowohl für
1.
die Expansion – bisher darf gelten, dass sie bundesweit weiter anwächst; sie wird bisher nirgends, wo sie verankert wurde, wieder aufgegeben (Thielemann 2024),
2.
die Selbst- und Außendarstellung – es gibt bisher kein kongruentes Bild von Kita-Sozialarbeit als Begriff oder Definition (wenngleich die einheitliche Bezeichnung »Kita-Sozialarbeit« zur Stärkung im Sinne einer einheitlichen, professionellen Identität und Öffentlichkeitswirksamkeit mitsamt verbundener Anforderungen und Leistungen beitragen dürfte) (ebd.) und
3.
die inhaltliche Ausgestaltung und damit die Frage nach Zuständigkeit, dem Ringen um Zuständigkeit mit Fachkräften anderer Professionen und Positionen (z. B. pädagogische Fachkräfte, Kita-Fachberatung, Kita-Leitungen, Fachkräfte für Spracherwerb und Frühförderung), oder, ob – in der Frage nach Profilbildung – eine feste Zuständigkeit überhaupt notwendig erscheint. Mit Lochner und Henn lässt sich formulieren, dass »Soziale Arbeit aufgefordert [ist], ihre Rolle als Übersetzungs- und Vermittlungsinstanz zu qualifizieren, ohne sich in der Suche nach exklusiven Zuständigkeiten zu verlieren« (Lochner & Henn, 2020).
Es bleibt dennoch festzuhalten, dass mit Blick auf Zuständigkeit für die Entwicklung und Begleitung und die Deutung des Handlungsfeld Kita-Sozialarbeit sich aktuell zwei potenzielle Konfliktlinien andeuten: zum einen die sozialarbeiterische Perspektive und zum anderen die kindheitspädagogische Perspektive, die vereinende, zusammenführende, aber auch trennende Perspektiven ausweisen, welche wiederum auf die praktische Gestaltungsebene der Kita-Sozialarbeit durchschlagen können. Im Ansatz von Abbott zur Untersuchung von interprofessionellen Verschiebungen und Veränderungen spielen die Begriffe »jurisdication«, »jurisdication claims« und »jurisdictional control« eine wesentliche Rolle. Es wird gefragt, wer die Kontrolle über was, wann und wie hat. Zuständigkeit (»jurisdiction«) wird in diesem Zusammenhang aber nicht als Zumutung von außen verstanden, sondern als ein Recht, dass auf der Basis von Wissen und Fähigkeiten beansprucht wird (Rabe-Kleberg, 2000).
Mit Abbott lässt sich also weiterführend feststellen, dass potenzielle und reale Auseinandersetzungen zwischen Professionen und den (übergelagerten und durchdringenden) wissenschaftlichen Deutungen die Entwicklungen und Veränderungen der Kita-Sozialarbeit vorantreiben.
Unterschiede in den Handlungskonzepten der Berufsgruppen, die aktuell um die Deutungshoheit von Kita-Sozialarbeit ringen (z. B. Sozialpädagog*innen/-arbeiter*innen, Sozialarbeiter*innen und Kindheitspädagog*innen), ergeben sich in den fachlich-theoretischen Perspektiven und normativen Grundlagen. Sozialarbeiter*innen agieren auf individuelle Bedarfe von Kindern, Eltern und Familien und arbeiten fallgeleitet. Sie richten ihren Blick auf die Abweichung von der Normalität und verweisen auf entsprechende Hilfsangebote. Pädagogische Fachkräfte im Bereich der Frühpädagogik haben hingegen alle Kinder und ihre Familien gleichermaßen im Blick. Sie arbeiten dementsprechend gruppenbezogen und strukturieren den pädagogischen Alltag entsprechend mit Angeboten für alle Kinder. Der Blick ist auf Normalverläufe kindlicher Entwicklung und Unauffälligkeit gerichtet (Drößler 2020, S. 4 f.; Drößler & Sehm-Schurig 2016, S. 14 f.).
Je nach Organisationsmodell von Fachberatung tangiert das Profil dieser unterschiedlich stark mit dem der Kita-Sozialarbeit. Ähnlich wie die Fachberatung ist Kita-Sozialarbeit in ihrer Funktion beratend, unterstützend und begleitend, in der Kindertageseinrichtung verortet und vernetzend in den Sozialraum tätig. Schnittstellen zeigen sich demzufolge bei der Initiierung von Netzwerken im Sozialraum sowie der Unterstützung des Kita-Teams im Rahmen der Elternarbeit. Beide Profile sehen die Beratung des Kita-Teams sowie die fachliche Unterstützung in herausfordernden Praxissituationen vor (Drößler 2020, S. 7). Kita-Fachberatungen dienen als Lots*innen für die Einrichtungen im Gesamtsystem.
2.4.1 Kita-Sozialarbeit im Professionsgefüge
Kita-Sozialarbeit bildet sich zwischen Sozialer Arbeit und Kindheitspädagogik ab, etabliert sich entsprechend zwischen (sozial-)pädagogischer Prävention und sozialarbeiterischer Intervention und ist damit einem Ringen um Deutungshoheit ausgesetzt.
Drößler (2021) unterscheidet, wie unter »(2) Umsetzungsvarianten« aufgeführt, zwei Zugänge bzw. Ansätze zur Kita-Sozialarbeit: additiv-ergänzend und integriert-erweitert. Diese rahmen Kita-Sozialarbeit nicht nur theorienah, sondern legen auch die potenziell gegenüberliegenden Betrachtungen zwischen der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik offen.
Mit der Unterscheidung skizziert Drößler en passé zwei aktuelle Diskurse der Praxis und der wissenschaftlichen Betrachtung, die auf ein Spannungsfeld zwischen Sozialer Arbeit und Kindheitspädagogik verweisen. Übersetzt kann mit Drößlers Einteilung auch nach der (Ein-)Passung Sozialer Arbeit zur, respektive in die Kita gefragt werden. Für die beiden Perspektiven mag es jeweils plausible Argumentationen geben. Für den additiv-ergänzenden Ansatz spräche, dass – weil die Analogie beständig genutzt wird – auch die Schulsozialarbeit sich nicht vom System Schule aus fachlicher und berufsethischer Perspektive vereinnahmen lassen konnte. Auf Grundlage welcher Argumentation solle die Kita-Sozialarbeit dies zulassen?
Für den integriert-erweiternden Ansatz spräche, dass die Koordination der Kita-Sozialarbeit und die Zusammenarbeit mit sämtlichen Fachkräften innerhalb der Kita (z. B. pädagogische Fachkräfte, Leitung, Kita-Beratung etc.) aus der Perspektive des Kitawesens zugänglicher würde. Gleichzeitig gingen hiermit komplexe institutionelle Entwicklungsprozesse der Kita im Sinne einer lernenden Organisation einher, die sich im systemischen Sinne zu den skizzierten lebenslagenbedingten Herausforderungen verhalten und ihre pädagogischen Konzepte und Profile anpassen bzw. erweitern muss. Kita-Sozialarbeit kann hier Impuls gebend sein.
2.5 Kita-Sozialarbeit als organisationale Herausforderung
Eine offene organisationpädagogische Frage ist, wie Kita-Sozialarbeit in die Organisationsentwicklung eingebunden ist: So kann einerseits gefragt werden, was für ein Baustein Kita-Sozialarbeit im Rahmen von Organisationsentwicklung darstellt. Andererseits – und diese Blickrichtung wird im Folgenden eingenommen – kann die Frage gestellt werden, welche Anforderungen an Organisationsentwicklung sich aus dem Einbezug von Kita-Sozialarbeit ergeben.





























