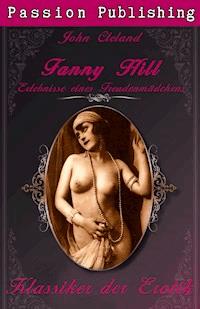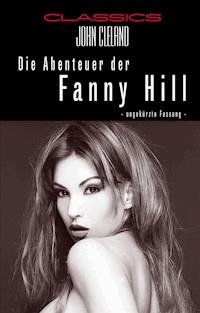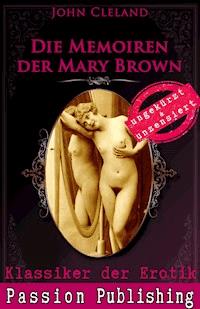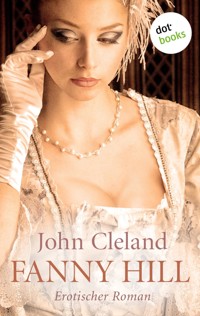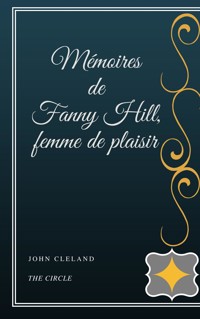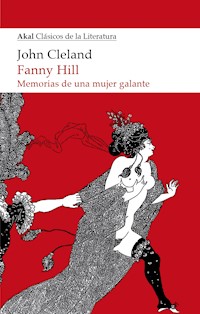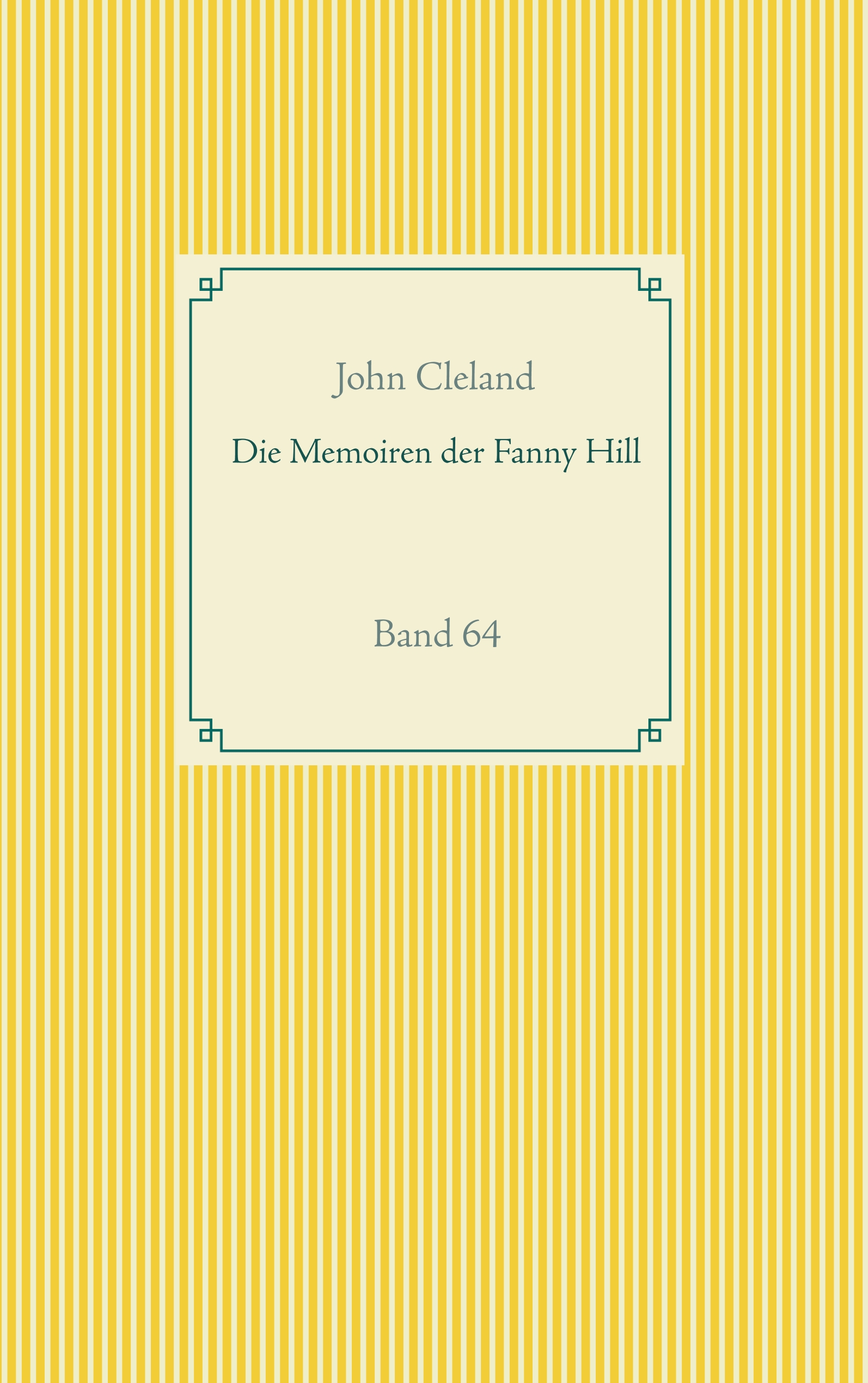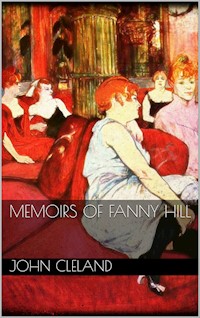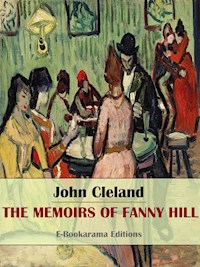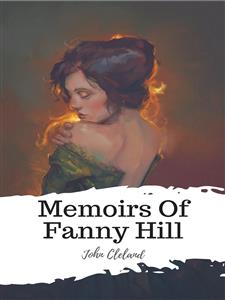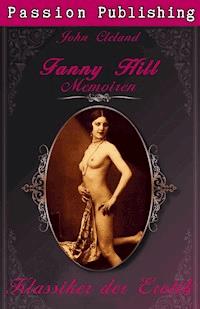
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Passion Publishing
- Kategorie: Erotik
- Serie: Klassiker der Erotik
- Sprache: Deutsch
Teil 2 des beliebten Erotik-Klassikers: Fanny Hills Memoiren Der skandalöseste Erotikroman des 18. Jahrhundert mit der beliebtesten Erotikprotagonistin der Weltliteratur! Fanny Hill kommt als 15-jähriges Waisenkind nach London und wird dort in einem Bordell aufgenommen. Sie schafft es ihrem Schicksal als Prostituierte zu entfliehen und wird von einem jungen Gentleman aus dem Bordell gerettet. Mit ihm lernt sie die wahre Liebe kennen. Als der junge Gentleman nach Übersee geschickt wird bleibt Fanny nichts anderes übrig, als Prostituierte zu werden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dabei lernt sie die Geheimnisse der Erotik kenne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Cleland:
Fanny Hill – MemoirenTeil 2
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Weitere e-books bei Passion Publishing
I.
Wieder einmal hielt sich Frances ungewöhnlich lange im „Cabinet“ auf. Mrs. Burton, vor ihrer Ehe FANNY HILL, die ihrer Kinder Tageslauf aufmerksam überwachte, pochte an die Tür des Ortes, den selbst der König von England zu Fuß auf suchen mußte. „Frances ... !“ — sie dehnte den Namen ihrer Tochter. Und noch einmal: „Frances... !“ Darauf ein unwirsches: „Ich komme ja gleich!“ Mit hochrotem Kopf trat die Dreizehnjährige in den Vorraum, steuerte auf das Waschservice zu und beschäftigte sich angelegentlich mit der Säuberung ihrer Hände.
Dorothee, ihre um ein Jahr jüngere Schwester, hatte die eindringliche Stimme der Mutter ebenfalls vernommen. Wenn Fanny nach Frances rief, nahm ihre Stimme nur selten einen warnenden Unterton an. Unbemerkt war Dorothee hinzugetreten und beobachtete die Szene, deren Gespanntheit nicht zu übersehen war.
„Warum”, fragte Fanny, „hältst Du Dich neuerdings so lange ...“
Aber ihre Älteste fuhr dazwischen: „Maman, bin ich Ihnen darüber Rechenschaft schuldig?“ Sie warf den Kopf in den Nacken, und als sie ihre Schwester entdeckte, schwappte sie ihr eine Handvoll Wasser ins Gesicht. Dann ließ sie beide stehen und entschwand, das Köpfchen hoch erhoben, durch die Halle.
„Maman“, empörte sich Dorothee, „Frances ist höchst ungezogen! Sie ist ein Cochon!“
Mrs. Burton wollte das Mädchen scharf zurechtweisen — das sanfteste und gehorsamste ihrer Kinder, von dem sie selten ein böses Wort hörte. Schon gar nicht dieses verpönte „Cochon“, das sich nach Pariser Muster als Verbrämung des Abartigen in den Sprachgebrauch gewisser Kreise der englischen Society eingeschlichen hatte.
Dorothee entging der fälligen Bestrafung nur dadurch, daß Mrs. Cole auftauchte. Wie immer, wenn kritische Situationen den Frieden des Hauses zu stören drohten. Fannys mütterliche Freundin, seit Jahren der gute Geist des Hauses und der Kinder, stellte eine lapidare Tagesfrage, und Fannys Zorn verrauchte. Dorothee sah sich um eine Auseinandersetzung betrogen. Sie hätte gern Strafe ertragen, dafür aber mit der Mutter einmal ernsthaft über Frances reden wollen.
Fanny machte sich um Frances Sorgen. Nach wem mochte sie geraten sein? Zweifellos hatte sie das Heißblütige von ihr selbst — woher aber das Störrische, Aufbrausende? Gewiß nicht von ihr — und von Charles, ihrem Gatten, auch nicht. War sie in ihrer Liebe zu Charles so hingebungsvoll, wie nur eine Frau dem geliebten Mann gegenüber sein konnte, so brachte Charles in ihren Augen noch mehr Zärtlichkeit und Selbstentäußerung auf. Bisweilen hatte sie das Gefühl, daß Charles zu weich sei, zu wenig „Charakter“ besitze. Zweifellos hatte Frances die Anlage zur Leichtlebigkeit geerbt, die beiden Elternteilen eigen war.
Ganz anders Dorothee. Ihr Wesen neigte dem Ernsthaften, ja der puritanischen Auffassung britischer Prägung zu, dem Lehrhaften, Strengen und Frommen. Sie ging lieber mit dem Gebetbuch als mit einer Puppe zu Bett. Ihre Schwester Frances fand sie oberflächlich und leichtsinnig. Ständig hatte sie an ihr etwas auszusetzen.
Edward, das jüngste der drei Burton-Kinder, versuchte mit der Diplomatie, die einem Zehnjährigen eigen sein kann, zwischen den beiden Schwestern zu vermitteln. Noch schwankte er in seiner Neigung, obwohl er sich mehr zu Frances hingezogen fühlte.
Mit einem Knicks verließ Dorothee den Raum. Sie lief die Treppe hinauf, die zu den Kinderzimmern führte. Auch Fanny ging. Sie nickte Mrs. Cole zu und wandte sich der dunkel getäfelten Tür zu, die in die Bibliothek führte. Im Vorbeigehen warf sie einen Blick auf die vergoldete Rokoko-Uhr auf dem Kaminsims. Charles hatte sie ihr zum zehnjährigen Hochzeitstag aus Paris mitgebracht. Fünf Uhr! Wo Charles nur blieb? Er wollte längst zurück sein. Eine innere Unruhe erfaßte sie, die das gleichmäßig hin und her schwingende Pendel noch verstärkte.
Sie trat in den Salon. Schwere, dunkle Möbel gaben dem Raum etwas Düsteres. Die dunkelgrüne Seidentapete, mit goldenen Mustern durchwirkt, die dicken Portieren vor dem Alkoven, in dem ein kleiner Tisch mit zwei hochlehnigen, geschnitzten Stühlen stand, verstärkten den Eindruck des Beklemmenden. Fanny hielt sich nur ungern hier auf — hier fühlte sie sich unfrei und gehemmt. So zündete sie, obwohl der helle Tag durch die Fenster drang, die hohen, gelben Kerzen auf den bronzenen Leuchtern an.
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür von der Halle zum Salon und Charles trat ein.
„Liebster, Du kommst spät!“ Fanny sah ihren Mann an. In ihrem Blick war mehr Sorge als Vorwurf.
„Entschuldige bitte! Ich war noch bei Lord Douglas, der große Pläne hat und mich dafür gewinnen möchte, meine Beziehungen nach Montreal weiter auszudehnen und dort auch in seinem Namen Verhandlungen zu führen.“ „Montreal??? Wo ist denn das?“ — Geographie war Fannys schwache Seite.
„In Canada, Liebling!“ Charles mußte lächeln. Eine Weile schwiegen beide. Dann erst bemerkte der Hausherr in Fannys Gesicht die Spuren einer Verärgerung und fragte: „Was hast Du, mein Liebes?“
„Oh — nichts!“ Doch dann platzte sie heraus: „Dorothee hat an Frances immer etwas auszusetzen!“
Charles kannte das Thema zur Genüge. „Was hat sie denn wieder angestellt?“
„Eigentlich gar nichts. Sie hielt das „Cabinet“ über Gebühr lange besetzt. Und als ich sie zur Rede stellte, war ihre Antwort, ob sie mir darüber Rechenschaft schuldig sei. Dann aber stand plötzlich Dorothee neben uns und behauptete frech, daß Frances ein ,Cochonc sei. Schon dieses Wort!“ Charles grinste. Es amüsierte ihn, wenn Fanny ihr Lieblingskind in Schutz nahm und sich über jede unbotmäßige Äußerung Dorothees erregte.
Frances war für Fanny wirklich das Kind der Liebe. Der Anblick des Mädchens weckte in ihr alle Erinnerungen an die Wiedersehens-Nacht mit Charles. An die Nacht, die für sie zum Schicksal wurde. Alles, was sie an Liebe, an Sinn für das Schöne und Gute, an Willen und Kraft in sich fühlte, hatte sie diesem Kind mitgegeben.
Sie wußte, daß Charles bisweilen ungehalten war, weil sie Frances offensichtlich bevorzugte. Mitunter warf er ihr vor, daß sie das Mädchen nicht nur den beiden anderen, sondern auch ihm vorzöge. Derartige Anwürfe ärgerten Fanny; sie revanchierte sich dann prompt mit der Behauptung, daß er seinerseits den kleinen Edward verhätschelte. Lediglich Mrs. Cole verteile ihre Gunst auf alle drei Kinder gleichmäßig.
Zu diesem stereotypen, halb ernsten, halb scherzhaften Wortwechsel kam es an diesem Abend nicht. Charles Blicke ruhten auf der Erscheinung seiner eifernden Frau, die zu einer reifen Schönheit erblüht war. Selbst nach vierzehnjähriger Ehe übermannte ihn immer wieder das Bild ihrer makellosen Weiblichkeit, ihrer Mütterlichkeit, einer stets geschmackvollen Robe, ihrer Freude an schönen Dingen und ihr verhaltener Zorn, der ein tiefes Rot auf ihr Pfirsichgesicht hauchte.
So stand sie vor ihm: Lässig in der Gebärde, doch straff in der Haltung. Eine Haltung, die ihr ein fester Körper verlieh, der des Mieders kaum bedurfte.
Charles ging auf sie zu. Langsam löste er das Brusttuch, barg sein Gesicht im festen, strotzenden Quell der Mütterlichkeit, küßte und liebkoste ihn zärtlich-liebevoll.
Dann zog er sie auf die Ottomane. Die Wogen des Verlangens und der Lust schlugen zusammen und trugen sie fort in das Land, das Erfüllung verheißt. Stilles Kerzenlicht umspielte die orgiastische Szene.
Als Fanny und Charles ihre Kleider geordnet und den Salon verlassen hatten, huschte hinter der Portiere vor dem Alkoven ein ungebetener Zeuge elterlicher Intimitäten hervor. Mit bleichem Gesicht, die Hände zu Fäusten geballt, stahl sie sich aus dem Salon — Frances. „Cochons”, murmelte sie, „Cochons!“
„Sie sehen wie immer reizend aus, meine Liebe!“ Lächelnd beugte sich Lord Douglas über Fannys Hand. Dabei streifte sein Blick das tiefe Dekollete, dessen freizügiger Ausschnitt von einem Kragen aus feinster Brüsseler Spitze eingefaßt war und weitgehend zarte Rundungen sehen ließ. Die entblößten Schultern wölbten sich in weichem Schwung zu einem schmalen Nacken, über dem sich dichte, dunkelbraune Locken kräuselten. Ein Paar kostbare, diamantene Ohrgehänge unterstrichen Fannys schönes, ausdrucksvolles Gesicht.
In diesem Augenblick: trat Sir Anthony Hood, ein alter Freund des Hauses, auf die Gruppe zu, um die Gastgeber der Soiree zu begrüßen.
Lebhaft wandte Fanny sich dem Ankömmling zu. Lord Douglas genoß auf diese Weise den nicht minder reizvollen Anblick des freigebig entblößten Rückens, dessen zarte, weiße Haut im Licht der vielen Kerzen, die die Halle festlich erleuchteten, matt schimmerte. Wären sie allein gewesen, er hätte der Versuchung, diesen köstlichen, glatten Samt mit den Lippen zu berühren, kaum widerstehen können.
Als Charles sich ihm zuwandte, gab sich der Lord jedoch den Anschein, als blicke er teilnahmslos in die Halle. Diese war mit Gästen jeden Alters, meist Kaufleuten mit ihren Damen, bekannten Künstlern und einigen Adligen gefüllt — ein buntes Gewimmel. Die Damen waren, bis auf wenige Ausnahmen, stark dekolletiert — die Herren steckten durchweg in reichlich mit Gold bestickten Jacken. Außer zwei Malern und einem Dichter, die mit einer Schauspielerin vom Königlichen Theater in heftigen Disput geraten waren, trugen alle Herren Perücken.
Jeder in diesem Kreis kannte sich; so war allenthalben eine lebhafte Unterhaltung im Gang. In einer Ecke hatte Mrs. Whiteman, die Gattin eines Juweliers, das Gespräch an sich gerissen. Mit Schmuck überladen, wirkte sie hier deplaciert. Sie verkündete mit durchdringender Stimme, daß ihr Mann aufgehalten sei, weil er einem hochgestellten Kunden noch einen kostbaren Diamanten anzubieten habe.
Lord Douglas liebte das Milieu dieses Hauses. Es war gediegen, zeugte von erlesenem Geschmack und nicht unbeträchtlichem Reichtum. Mit Charles verstand er sich ausgezeichnet. Fanny, die er für die Seele des Hauses hielt, verehrte er mehr, als seine Erziehung ihm eigentlich erlaubt hätte. Erziehung, dachte er — die Gedanken sind frei! Charles ging auf einen jungen Mann, den Sohn eines Handelsfreundes zu, der an einer Säule lehnte, die Fannys Portrait-Büste trug. Es war eine Meisterarbeit John Flaxmans, der es verstanden hatte, Fannys fein geschnittenem Gesicht wahrhaft klassische Züge zu verleihen.
Fannys Blick folgte dem geliebten Mann. Ihr erschien er als der eleganteste des Abends. Die schwarze Samtjacke mit der schmalen Brokatborte und dem großen, weißen Kragen, eng anliegende Beinkleider, die in blendenweiße Strümpfe übergingen, und die mit silbernen Schnallen besetzten Schuhe verliehen ihm das Aussehen eines gediegen gekleideten Mannes von Stand und Rang.
Charles nahm seinen jungen Freund am Ärmel des Jacketts und zog ihn zum Buffet, das an der Querwand der Halle aufgebaut war. Kostbares Geschirr barg die kulinarischen Genüsse einer extravaganten Küche. In silbernen Kannen leuchtete goldgelber Wein; schwerer Muskateller glutete tiefrot in geschliffenen Kristallkaraffen.
Während Charles seinem Gast einschenkte, fuhr draußen eine Kutsche vor. Das Getrappel der Pferdehufe war kaum zu überhören. Die Gesichter der Anwesenden wandten sich der Eingangstür zu.
Schon von hier aus hatte der Diener das Wappen am Wagenschlag erkannt, den er eilfertig öffnete. Der Ankömmling nahm eiligen Schritts die wenigen Stufen bis zum Portal und ließ dem Butler kaum Zeit, ihn anzumelden. Er trat bereits auf Fanny zu, die neben Lord Douglas stand und ihm erwartungsvoll entgegensah, als der Butler verkündete: „Seine Gnaden, der Herzog von D * * *!“ Der Lord übernahm die persönliche Vorstellung; Fanny zelebrierte einen tiefen Knicks.
Lord Douglas, mit dem Herzog von D * * * eng befreundet, hatte oftmals von Fanny geschwärmt. Dennoch war der Herzog überrascht, in Madame eine wahrhaft ungewöhnliche Schönheit zu finden. Er huldigte ihr mit einer Verbeugung, die länger dauerte, als für seinen Stand notwendig gewesen wäre. Einige unverhohlene Komplimente folgten — dann kam die Frage nach dem Hausherrn.
Mit einem Lächeln in den Grübchen wies Fanny ihn zum Buffet, wo Charles, ohne den neuen Gast bemerkt zu haben, in angeregtem Gespräch mit seinem jungen Freund stand und gerade genußvoll in das Schwanzstück einer Languste biß. Mit einem Kopfnicken wandte sich der Herzog zu dieser Seite der Halle.
„Ich glaube, liebe Mrs. Burton,“ sagte Lord Douglas zu Fanny, „daß D * * * Ihrem Mann auf Grund seiner Beziehungen sehr behilflich sein kann.“
„Ich würde mich freuen, Mylord, wenn Charles Erfolg in Canada haben würde. Nicht wahr, darum geht es doch?!“ „Sie wissen? . . ., aber lassen Sie sich Einzelheiten von Charles selbst erzählen.“
Lord Douglas stand gänzlich unter dem Einfluß seines Freundes und Gönners, des Herzogs von D * * *. Beide hatten aus politischen Ambitionen und persönlichen Gründen Englands Ziele, die nordamerikanischen Kolonien ganz für sich zu gewinnen, unterstützt und erhebliche Gelder investiert, aber auch verdient.
Der Streit um die nordamerikanischen Kolonien war immer wieder Anlaß zu Kriegen zwischen England und Frankreich gewesen; der letzte dauerte sieben Jahre, bis 1763 der Friede von Paris geschlossen und unterzeichnet werden konnte. Canada war damit endgültig dem britischen Empire zugefallen.
Zwei Jahre zuvor, 1761, hatte König Georg III. den Staatssekretär William Pitt zu Gunsten seines unfähigen Günstlings Bute ausgeschaltet und versucht, den Einfluß des Parlaments zurückzudrängen. Die Whigs, Regierungspartei der alten Parlaments-Aristokratie, hatten nach Pitt’s Sturz sämtliche Zahlungen eingestellt, die der ehemalige Staatssekretär Friedrich II. von Preußen zur Unterstützung im Krieg gegen Österreich, das mit Frankreich verbündet war, aus der Staatskasse gezahlt hatte. Durch Pitt’s Manipulation waren die französischen Streitkräfte weitgehend in Europa gebunden worden. England hatte dadurch in Nordamerika freiere Hand gehabt.
In der Folgezeit beschwor jedoch die Kronpolitik den Abfall des nordamerikanischen Staatenbundes herauf. Pitt sah diese Entwicklung voraus und versuchte, sie mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterbinden. Er bediente sich hierbei einflußreicher Adels- und Finanzkreise, zu denen der Herzog von D * * * gehörte. Auch Lord Douglas hatte sich an den bisherigen Aktionen beteiligt, war jedoch mit seinem Engagement bis an die Grenze des Tragbaren gegangen.
König Georg III. galt als vorbildlicher Familienvater. Beim Volk war er deswegen recht beliebt. Und als der Prince of Wales, der spätere König Georg IV., zwei Jahre nach dem Regierungsantritt seines Vaters geboren wurde, gab es kaum jemanden im Lande, der sich nicht mit dem Herrscherhaus verbunden fühlte.
Politisch hatte der König eine wenig glückliche Hand. Zwar fühlte er sich als Engländer, auch wenn er dem hannoveranischen Herrscherhaus entstammte. Seine konservative Haltung beschwor indessen unüberbrückbare inner- und außenpolitische Konflikte herauf. Dazu kam eine Augenkrankheit, die ihn oft unbeherrscht machte oder unter melancholischen Anfällen leiden ließ. Gehässige Hofschranzen nannten ihn mehr oder weniger offen „geisteskrank.
So konnte der König nicht verhindern, daß sich das Schwergewicht der Regierungsgeschäfte wieder auf das Parlament verlagerte. Pitt wußte das zu nutzen. Er machte seinen Einfluß geltend, und es gelang ihm, für den Augenblick die drohende Gefahr in Nordamerika zu bannen.
Aber, was man brauchte, war Geld — Geld — und nochmals Geld!
Charles hatte schon kurz nach Friedensschluß Beziehungen zu Canada geknüpft. Er stand im Begriff, in Montreal eine Niederlassung zu gründen, deren Leitung er dem jungen Mann anvertrauen wollte, mit dem er am Buffet stand, als der Herzog auf ihn zutrat.
Lord Douglas hatte D * * * oft von Charles berichtet, ihn als einen besonders rührigen und offensichtlich auch erfolgreichen Kaufmann geschildert. Was der Herzog hier sah, entsprach durchaus dieser Auffassung.
Beide brauchten sie Geld — für sich, für Pitt, für England. Sie konnten es nur vom Handel bekommen. Hier sollte Charles eingeschaltet werden. So wollte es der Herzog — so wollte es England. Wenn es nottat, auch über Umwege. Es sei nicht verschwiegen, daß der Herzog auch Fanny in sein Kalkül einbezog.
Mrs. Cole, die mit wachsamen Augen vom Treppenabsatz aus in das bunte Gewimmel unter sich blickte und einsprang, wo eine ordnende Hand vonnöten war, hatte die Ankunft des Herzogs mit gemischten Gefühlen beobachtet. Sie kannte ihn von früher her, als er noch häufiger Gast in ihrem Hause war. Übrigens zu einem Zeitpunkt, als sie Fanny noch nicht unter ihre Fittiche genommen hatte. Das Aufblitzen in seinen Augen war verräterisch. Sie ahnte Konflikte und beschloß, ihren Schützling zur Vorsicht zu mahnen, und selbst Augen und Ohren weit offenzuhalten. D * * * ging auf Charles zu und begrüßte ihn wie einen alten Freund. Ohne von dem jungen Mann an dessen Seite Notiz zu nehmen, zog er den Hausherrn mit sich fort. Die Vertraulichkeit der Geste zwischen den Arm in Arm quer durch die Halle schreitenden Männern erregte Aufsehen. An diesem Abend stieg das Prestige der Burtons in der Londoner Gesellschaft um einige Grade.
Als ob er mit den Räumlichkeiten des Hauses längst vertraut sei, steuerte der Herzog die Tür zum Salon an, öffnete sie und setzte sich ohne Umschweife in den Kaminsessel, die langen, schlanken Beine gegen das prasselnde Feuer gestreckt. Er war von hohem Wuchs — eine gute, ja faszinierende Erscheinung. Regelmäßige Gesichtszüge wurden von leuchtend-blauen Augen beherrscht. Seine stark gebogene Nase unterstrich den Adel des in den mittleren Jahren stehenden Aristokraten. Schmale, ein wenig verkniffene Lippen und das vorspringende Kinn ließen auf Gefühlskälte, Energie bis zur Rücksichtslosigkeit und einen starken, unbeugsamen Willen schließen. Sein Lächeln war gewinnend; es verwischte den Zug von Boshaftigkeit in seinen Mundwinkeln.
„Wie ich hörte, lieber Burton,“ begann er die Unterredung ohne Umschweife, „wollen Sie in Kürze Verreisen.“
„Ja, Euer Gnaden, ich habe vor, eine Niederlassung in Montreal zu gründen. Dazu bedarf es wohl eines Trips über den Ozean.“
„Nun, mit einem schnellen Segler ist das heute keine Affaire mehr.“ D * * * machte eine Pause und fuhr dann fort: „Ich habe vor, Ihnen bei der Gründung behilflich zu sein. Genauer gesagt: ich will mich beteiligen.”
Dann entwickelte der Herzog seinen Plan, von dem Charles durchaus nicht begeistert war. Er wußte um die Hintergründe dieser Ideen und fürchtete, sich mit seiner Zustimmung politisch festzulegen. Seinem Freund, Lord Douglas, fühlte er sich jedoch verpflichtet. Dessen Bitte um Unterstützung, die anläßlich eines vertraulichen Gesprächs an ihn herangetragen worden war, konnte er schlechthin nicht abschlagen. Der Lord hatte ihm von seiner finanziellen Misere berichtet, in die er durch seine Transaktionen geraten war.
Das Gespräch beendete Charles mit gemischten Gefühlen.
Durch die Mall jagte eine Kutsche. Lady Douglas, Hofdame der Königin, war auf dem Wege zu Herzog D * * *, dem Gatten ihrer Cousine. Sie hatte sich reichlich verspätet, da die Wünsche der Königin kein Ende nahmen. Seine Majestät wollte heute abend mit seiner Gemahlin das Nachtmahl einnehmen. Kein Kleid, kein Schmuck waren recht, dieses in letzter Zeit so seltene Ereignis gebührend zu unterstreichen — für den König schön zu sein.
Lady Douglas wußte, daß der Herzog höchst ungehalten sein konnte, wenn man sich verspätete — zumal ohnehin nur wenige Minuten Zeit zur Verfügung standen. Mit gerafften Röcken eilte sie die schmale Stiege des Wirtshauses hinauf, dem geheimen Treffpunkt ihrer Rendezvous’ mit dem Herzog. Zaghaft, aber hastig, klopfte sie an die Tür, hinter der D * * * ungeduldig auf und ab schritt.
Ein barsches „Herein!“ war die Antwort. Statt einer Begrüßung herrschte er die keuchende Lady an, wo sie so lange geblieben sei.
Lady Douglas knickste und begann mit: „Euer Gnaden Mit einer Handbewegung unterbrach er sie: „Lassen Sie die albernen Höflichkeitsflauseln — sagen Sie mir lieber, ob Pitt beim König angekommen ist!“
Lady Douglas berichtete, daß Seine Majestät anscheinend von den außenpolitischen Plänen des Herzogs „Wind bekommen“ habe. Jedenfalls habe die Königin so etwas verlauten lassen, ohne zu ahnen, daß Lady Douglas in das Spiel eingeweiht war.
Der Herzog fuhr auf: „Verdammt! Madame, Sie werden alles aufbieten, um herauszubekommen, wie weit der König informiert ist, und welche Maßnahmen Seine Majestät zu treffen gedenkt. Sie werden mir umgehend in meiner Stadtwohnung berichten. Dort halte ich mich die nächsten Tage auf. Jede Zeit, jede Stunde ist recht!“
Des Herzogs harte Züge entspannten sich. Das Boshafte aus den Mundwinkeln verschwand. Ein Lächeln wandelte das Gesicht zu jener Faszination, die der Damen Knie bei Hofe und in der Gesellschaft weich werden ließen.
Lady Douglas über kam ein Zittern — „Euer Gnaden . . .“ „Blödsinn, Madame, wir sind hier unter uns! Sie sind echauffiert. Das macht Sie umso anziehender!“ „Der Lord ...“ begann sie zögernd ein Gegenargument — „. . . ist mein Vetter. Unsere Heimlichkeiten bleiben sozusagen in der Familie!“ D * * * war auf die Lady zugegangen. Er nahm ihre willenlos herabhängende, rechte Hand und führte sie an seine Lippen. „Es wäre nicht das erste Mal, wenn ich Sie in meine Arme schließen — Ihnen die Reverenz eines Verehrers erweisen würde!“ Und ganz nahe der zierlichen Ohrmuschel Lady Douglas’ flüsterte er: „Sie waren hinreisend, Madame — es war bezaubernd! Dieses, unser Geheimnis in politischen und persönlichen Dingen ist zwar eine seltsame aber recht glückliche Mischung — meine ich. Auf beiden Ebenen werden wir uns wohl noch häufiger begegnen. Unser Schicksal! Adieu, ma chere — in meiner Stadtwohnung . . . heute sind Sie pressiert!“ D * * * streichelte ihre glühenden Wangen, küßte mit spitzelnder Zunge die zarten, schmalen Hände der Lady, geleitete sie zur Tür bis auf den Treppenabsatz hinaus und verabschiedete sie: „Auf Wiedersehen, meine Liebe!“
Schwankend und zitternd tastete sich Lady Douglas die Treppe hinunter — verwirrt, beunruhigt, beschämt und doch glücklich ob der Huldigung dieses mit Zärtlichkeiten so sparsamen Mannes, dessen Wandlungsfähigkeit verblüffend und beglückend zugleich sein konnte. Sie wäre erschrocken gewesen, hätte sie den steinernen Gesichtsausdruck und die wegwerfende Handbewegung des Herzogs nach ihrem Weggang gesehen. Erschrocken über die „Moral“ eines politischen Ehrgeizlings, der sie vor den Wagen seiner Interessen spannte und ihr das Geschirr einer prachtvoll glänzenden, trabenden Stute umhängte — solange sie traben würde.
Bald nach Lady Douglas verließ auch D * * * das Haus. An der nächsten Ecke hielt er eine Mietkutsche an. Sie brachte ihn in die Wohnung Lord Douglas’. Noch ehe der Wagen hielt, sprang er heraus, warf dem Kutscher ein paar Münzen zu und setzte ungeduldig den Türklopfer in Bewegung. Mit einem Leuchter in der Hand öffnete ihm der Butler. „Melden Sie mich Seiner Lordschaft!“
„Sehr wohl, Euer Gnaden!“ verbeugte sich der alte Diener, dem der Gast bekannt war. Er stellte den Leuchter auf ein Side-Board und ging dem Herzog zur Bibliothek voraus, in der sich Lord Douglas um diese Zeit aufzuhalten pflegte. „Warum wohl Seine Gnaden es in den letzten Tagen immer so eilig hat?“ dachte er, „Na ja, diese hohen Herren . . .“ Er schüttelte den Kopf und öffnete die Tür zur Bibliothek.
Ehe er noch den Raum betreten konnte, drängte sich der Herzog an ihm vorbei. Er lief auf seinen Freund zu, der sich verdutzt aus dem Sessel am Kamin erhob, indessen der Butler, ob solcher Ungehörigkeit gekränkt, die Tür hinter sich ins Schloß fallen ließ.
„Nanu — Sie, Herzog?? Ist etwas passiert?“
„Wir müssen handeln, Douglas, — sofort! Der König weiß oder ahnt zumindest was . . .“
Lord Douglas griff nach einer silbernen Karaffe und schenkte Portwein in zwei Gläser. Der Herzog nippte an dem unvermeidlichen Drink, der Lord nahm einen tiefen Schluck.
„Sie müssen sofort zu Burton! Er soll morgen abend segeln. Eines meiner beiden Kaperschiffe steht ihm zur Verfügung. Ich veranlasse noch heute, daß sie gleichzeitig in See gehen. Das für Burton wird unmittelbar Canada ansteuern.“
Lord Douglas klingelte nach dem Butler und befahl seinen Wagen. Der Herzog wollte eine Mietkutsche nehmen. Im Augenblick war es klüger, nicht zusammen gesehen zu werden. Londons Straßen hatten allenthalben Augen und Ohren ...
„Wo waren Sie denn?! Ich hätte Sie dringend gebraucht!“ Vorwurfsvoll sah die Königin zu ihrer Hofdame auf. „Eine momentane Unpäßlichkeit, Euer Majestät!“ antwortete Lady Douglas.
„So, so! Hm — unpäßlich!“ Die Königin fixierte ihre Hofdame, deren Gesicht gerötet war und eher Gesundheit als „Unpäßlichkeit“ spiegelte. Wenngleich Ihre Majestät auch nichts weiter sagte, verriet ihr Gesicht doch blanke Zweifel. Kurz darauf ließ sich der König melden. Die Königin entließ ihre Damen, ordnete ihr Haar und zupfte noch an ihrer Robe, als Georg eintrat.
„Wie schön Sie heute wieder sind, Madame! Ich hoffe, Sie nicht zu stören!“
„Nicht im geringsten!“ lächelte die Königin, „ich freue mich, Sie zu sehen, Sire! Anscheinend sind Sie guter Stimmung!?“ Sie bot ihrem Gemahl einen bequemen Sessel an. „Durchaus, durchaus, meine Liebe!“
Sie plauderten ein wenig über Belanglosigkeiten, ehe der König auf seinen Gesundheitszustand hinwies, der ihm viel Sorge bereitete. Mitunter war er selbst bei wichtigen Staatsgeschäften geistig abwesend. Oder er wußte nicht, wo er sich befand. Manchmal träumte er in solchen Augenblicken, daß er ein Vogel sei, der sich in die Lüfte erhob — bisweilen sah er sich in Ketten als Gefangener tief unten im Tower. Er wehrte sich mit allen Kräften gegen solche Zustände, ahnte aber oder wußte gar, daß der allmähliche Verfall nicht aufzuhalten war.
Die Königin teilte die Sorge um die Gesundheit des Herrschers. Sie war rührend um ihn bemüht. Seine Anfälle von Jähzorn versuchte sie, dem Hofstaat gegenüber zu entschuldigen, zu bagatellisieren oder gar zu vertuschen. Als aber dem Hofmarschall ein Tintenfaß an den Kopf flog und Seine Majestät einem Pagen unvermittelt einen Tritt ins Hinterteil versetzte, war jeder Verteidigung die Grundlage entzogen.
Auch jetzt schien Georg trotz aller Liebenswürdigkeit erregt — Vorbote eines Anfalls. So geleitete die Königin ihren Gatten in das Schlafgemach. Absolute Ruhe half zuweilen. Mit dem gemeinsamen Essen war es wieder einmal nichts.
Ihre Sorge um Georg wuchs angesichts verfehlter politischer Aktionen. Außenpolitisch hatte er zweifellos versagt. Daß er wegen seiner familiären Einstellung überaus volkstümlich war, nutzte nichts mehr. Die Schwäche und die offensichtlich unheilbare Krankheit riefen politische Kreise auf den Plan. Seine glückliche Hand im nordamerikanischen Krieg gegen die Franzosen wogen die Fehlschläge der letzten Zeit nicht mehr auf. Auch wenn Canada für England gesichert war und Georg einige politische Trümpfe in der Fi and hielt. Die Freundschaft und sein bedingungsloses Vertrauen zu Bute boten seinen Gegenspielern, allen voran William Pitt, Handhabe genug, gegen sein Regime zu konspirieren. Seine Majestät war nicht mehr stark genug, sich durchzusetzen, seine Berater Dummköpfe oder Intriganten. Der Königin war jegliche Politik verhaßt. Sie verfügte weder über das Wissen noch über Mittel, mit denen sie Georg hätte beraten und ihren Einfluß geltend machen können.
Es war später Abend, als Lord Douglas an die Tür des Hauses Burton pochte. Eine Magd öffnete und bot den Besuch in den Salon. Dann lief sie, Charles von dem unerwarteten Gast zu benachrichtigen.
Im seidenen Hausrock begrüßte der Hausherr seinen Freund: „ So spät noch, Lord Douglas? Ich freue mich, Sie zu sehen!“
„Es ist keine Zeit zu verlieren!“ antwortete der Lord, „Sie müssen schon morgen abend segeln! Im Hafen liegen zwei Schiffe des Herzogs D * * *. Eines davon wird Sie nach Canada bringen. Wählen Sie, und geben Sie mir Bescheid, damit die Ordres ausgegeben werden können.“ Er reichte Charles zwei versiegelte Briefe. Einen, der an Mr. Harrison in Montreal gerichtet war, einen zweiten für Mr. Alliant in Quebec. „Übergeben Sie bitte Mr. Harrison beide Schreiben. Aber nur ihm persönlich! Was weiter geschehen soll, wird er veranlassen. Wir sehen uns noch! Bitte empfehlen Sie mich Madame!“
Lord Douglas ließ Charles in ziemlicher Verwirrung zurück. Verwirrt wegen der sich überstürzenden Ereignisse und des kategorischen: „Sie müssen . . .!“ Zum ersten Mal wurde ihm voll bewußt, daß er in eine Situation manövriert worden war, deren Risiken die „Herren“ zu einem guten Teil ihm auf gebürdet hatten. Wenngleich ihn auch das Vertrauen des nach Umsturz und Macht strebenden Adels schmeichelte und das Abenteuer lockte, so sah er doch sein und Fannys Vermögen aufs Spiel gesetzt. Charles hatte keine politischen Ambitionen. Aber der Appell des Herzogs an den Engländer Burton, sich bewußt zu sein, daß die Vormachtstellung Britanniens in der Welt auf dem Spiel stünde, hatte schon während des Gesprächs mit D * * * den Ausschlag gegeben. „So sei es denn!“, schloß Charles die Kette seiner Gedanken.
Fanny fügte sich in das Unvermeidliche. Sie konnte nur noch hausfraulich um Charles’ Gepäck und eine zweckmäßige Ausrüstung des Reisenden mit Kleidungsstücken für ein Land besorgt sein, von dem sie nichts wußte. Für sie lag Montreal irgendwo am Ende der Welt, jenseits des Ozeans, den sie nur fürchten konnte. Eine so lange Seereise hätte sie nicht lebend überstanden, wie sie Mrs. Cole versicherte.
Schließlich standen zwei mächtige Truhen mit Kleidung, Geschäftspapieren und zwei großen Lederbeuteln mit Goldmünzen abholbereit. Sie wurden von Bediensteten zur „Old Bottle“ geschafft; für dieses Schiff hatte sich Charles entschieden.
Er nahm Abschied von seinen Kindern. Die Herzlichkeit tat dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Familie Burton alle Ehre an. Audi Mrs. Cole gab dem Scheidenden alle guten Wünsche mit auf den Weg. Fanny begleitete ihn zum Hafen.
Ein Wald von Masten über dunklen Schiffsrümpfen — auf den Quais schreiende, gestikulierende, hastende Menschen: Seeleute, Hafenarbeiter, herumlungerndes Volk und Neugierige. Dazwischen leichte Mädchen, die den Männern auffordernde Blicke zuwarfen. Ballen und Lasten schwebten an kreischenden Ladegeschirren durch die Luft. Schauerleute buckelten des Landes Reichtum über schwankende Laufplanken. Englands Herz, sein kommerzielles Leben, pulsierte hier am stärksten.
Auf den Schiffen, die von langer Seereise zurückgekehrt waren oder zu neuer Fahrt rüsteten, scheuerten Matrosen und Schiffsjungen die Decks. An Bordwänden hingen Arbeiter in Strickleitern und teerten die Schiffsrümpfe. Über allem Lärm und aller hektischen Geschäftigkeit lag ein durchdringender Gestank von Fisch, Teer, Wasser und fauligen Abfällen. Fanny hielt sich die Nase zu, als sie die Kutsche verließ. Wie gräßlich! Wie konnte man nur in diesem Milieu atmen und leben?!
Dann aber gingen ihre Gedanken siebzehn Jahre zurück. Hätte es das Schicksal nicht gut mit ihr gemeint, was wäre aus der mittellosen Fanny Hill von damals geworden?! Eine Dirne, die sie ohnehin — wenn auch auf einer anderen Ebene — gewesen war. Ein Straßenmädchen vielleicht, wie diese armseligen, aufgeputzten Geschöpfe hier am Hafen. Es schauderte sie.
Die „Old Bottle“ war ein schönes, ungewöhnlich schnelles Schiff. Ein Viermastschoner, dessen weit vorgebauter Bug verriet, daß es zu den Schnell-Seglern zählte. Man wartete nur noch auf Charles. Der Kapitän auf der Kommandobrücke erteilte seine Befehle — die Matrosen kletterten in die Wanten.
Es war an der Zeit, Abschied zu nehmen. Fanny preßte Charles’ Arm, drängte sich an ihn, bot ihren Mund zum Kuß. Erst der Ruf des Steuermanns: „Mr. Burton, wir warten auf Sie!“ brachte beide zur Besinnung. Eine letzte Zärtlichkeit — Charles löste sich aus den Armen seiner Frau. Dann ging er schweren Schrittes an Bord.
Die Ankerketten rasselten — rauschend entfalteten sich die Segel. Das schwere Schiff legte vom Quai ab. Hastige, törichte Worte des Abschieds, bis das Schiff außer Rufweite war. Seidene Tüchlein hüben wie drüben — Zeugen flatternder Gedanken, die nichts mehr fassen konnten, als den Schmerz des Abschieds. Auf wie lange?
Bedrückt bestieg Fanny die Kutsche.
II.
„Liebe Mrs. Cole, ich langweile mich zu Tode!“ Fanny hatte trotz der vielen Jahre, die ihre mütterliche Freundin nun schon bei ihr war, trotz der weiten Kluft, die gesellschaftlich zwischen ihnen lag, nicht daran gedacht, sie wie eine Angestellte zu behandeln. Und für Mrs. Cole war Fanny immer noch das kleine, bezaubernde Mädchen, das sie einst in ihr „Haus“ genommen und am reichlich fließenden Quell getränkt hatte, den weiberlustige, finanzkräftige Kavaliere nie versiegen ließen.
„Hmm,“ nickte die Cole, „Charles ist jetzt über ein halbes Jahr fort, und sein letzter Brief erreichte uns vor zwei Monaten. Aber — Sie haben doch die Kinder!“
„Wer hat die Kinder?!“ Fanny brauste auf. „Sie haben sie doch! Dorothee und Edward hängen mehr an Ihnen als an mir!“
„Nur Frances nicht!“ maulte die Cole. „Für die haben Sie immer Zeit.“
„Na und??“ Kam die Rede auf Frances, kehrte Fanny ihre Stacheln wie ein Igel heraus. Ihre Augen begannen zu flackern, die Unterlippe schob sich vor. Mrs. Cole kannte diese Sturmzeichen. Sie lenkte ein. Wegen Frances hatte es schon genug Streit gegeben. „Sie haben recht! Charles fehlt an allen Ecken und Enden. Aber gewiß wird er bald zurückkehren.“
Fanny war davon nicht überzeugt: „Es kann unter Umständen noch Monate dauern, bis die Geschäfte in Montreal abgewickelt sind. Und die Rückreise nimmt auch einige Wochen in Anspruch.“
Wirtschaftliche Not litt sie nicht. Charles hatte das Vermögen, das sie in die Ehe eingebracht hatte, gut verwaltet und um über die Hälfte vermehrt. Aber es ärgerte sie, während der Abwesenheit ihres Mannes von der Substanz zehren zu müssen, da laufende Einnahmen ausblieben. Fanny war überdies eine Frau, die sich gern bewundern ließ, die bestätigt wissen wollte, daß sie schön, begehrenswert, reich und glücklich sei. Charles hatte mit dererlei Vorstellungen nie gegeizt.
Mrs. Cole kannte den Grund der Unzufriedenheit. So beschloß sie eines Tages, Fanny vorzuschlagen, eine Gesellschaft zu geben. Auch ihr ging die Zurückgezogenheit auf die Nerven. Außer Lord Douglas und dem Juwelier Mr. Whitman, der das Vermögen der Burtons verwaltete, empfing Fanny kaum Besuch.
„Fannykind,“ flötete die Cole anderntags am Frühstückstisch, „Sie sollten etwas für Ihre Gesundheit tun!“
Fanny blickte auf. Da war etwas im Unterton der Cole, das sie an längst vergangene Zeiten erinnerte.
„Wenn ich so bedenke, was Sie früher für ein lebenslustiges, unbekümmertes Weibsbild . . . — sie sagte mit voller Absicht „Weibsbild“ — „waren, dann erscheint mir Ihr jetziger Zustand beklagenswert!“ Sie machte eine Pause und fuhr fort: „Sie sollten wieder einmal Menschen um sich sammeln!“
Fanny verschluckte sich und hustete, bis die Tränen kamen, die von einem Lachen abgelöst wurden. Konnte die Cole Gedanken lesen?
Mrs. Cole lief um den Tisch herum und klopfte der Hausherrin den Rücken. Als der Anfall vorüber war, protestierte Fanny zum Schein gegen einen solchen „unmöglichen“ Vorschlag.
Die Cole gab diesem „Protest“ die richtige Deutung.
Beim Tee stellten beide Frauen bereits Überlegungen an, wie diese Soiree zu gestalten sei und unter welchem Vorwand. „Ist es notwendig, sich durch irgendeinen äußeren Anlaß für eine Einladung zu rechtfertigen, die in Abwesenheit des Hausherrn gegeben wird? Ich glaube nicht!“, beschwichtigte die Cole ihre jüngere Freundin.
„Und wenn,“ trumpfte Fanny auf, „dann sollen sie sich die Mäuler zerreißen; ich pfeife darauf!“ So war die Soiree beschlossene Sache.
Lohndiener wurden engagiert, Essen und Getränke bestellt. Einladungen gingen hinaus. Am wichtigsten aber war die Frage, was Fanny anziehen sollte. Nichts unter zahlreichen Roben schien ihr geeignet. Also mußte innerhalb von zehn Tagen ein neues Kleid geschneidert werden. Selbstverständlich vom ersten Taylor Londons.
Das war zur Zeit Monsieur Legrand, der sich seit kurzem in London niedergelassen hatte, um, wie er sagte, den Damen der Gesellschaft Pariser Eleganz zu bringen. Er war überbeschäftigt und sündhaft teuer. Zudem war es schwer, ihn zur Einhaltung eines Termins zu bewegen. Er brauche Zeit zur Inspiration — begründete er.
Fanny blieb es ein Rätsel, wie Mrs. Cole es zuwege brachte, den Meister zu überreden, sie aufzusuchen und zu versprechen, das Kleid in der kurzen Frist anzufertigen. Jedenfalls — Monsieur Legrand erschien!
Er machte seinem Ruf alle Ehre: er stolzierte einher wie ein gespreizter Pfau. Zum vollendeten Stutzer fehlte ihm lediglich der Degen. Mit Grandezza verbeugte er sich vor Fanny, brach in entzückte Rufe über ihre Schönheit, ihren Charme und — „mon Dieu“ — über ihre bezaubernde Figur aus. „Magnifique!“.
Mit spitzen Fingern wühlte er in Stoffballen, die überall auf Stühlen, Tischen und Kommoden ausgebreitet lagen. Stoffe, die Fanny bevorzugte, und aus denen Monsieur seine Wahl für das Kleid treffen sollte. Er entschloß sich für einen königsblauen Samt. Dazu kamen Bordüren aus geflochtenem Silber und hochhackige Schuhe aus silberdurchwirkter Seide.
Als Clou dieser „robe magnifique“ wollte er auf den üblichen Kragen aus Brüsseler Spitze verzichten und stattdessen etwas Einmaliges, Besonderes und Aufregendes applizieren: einen Kragen aus Leopard! Er sollte rundherum laufen und Schultern und Busen — „tres magnifique!“ — weitgehend entblößt lassen. Madame könne es sich leisten. Dann hörte man nichts mehr von Monsieur Legrand. Der Tag, an dem Fanny das Kleid tragen wollte, rückte näher. Zweimal schon war Mrs. Cole in der Werkstatt des Meisters gewesen, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Monsieur sei angestrengt bei der Arbeit und dürfe auf keinen Fall gestört werden, wies man sie ab.
Am Tage der Soiree erschien Monsieur Legrand gegen elf Uhr. Affektiert und gespreizt wie ein Lustknabe. Langsam und betont sorgfältig breitete er seine Schöpfung aus, streifte sie der Trägerin über. Das Kleid saß wie angegossen. Zwar schien Fanny das Leopardenfell recht ungewöhnlich — aber Monsieur Legrand diktierte die Mode. Seine Creationen, mochten sie noch so ausgefallen sein, machten Furore. Nicht weniger aber auch die Damen der Gesellschaft, die dieser allzu weibische Mann kleidete. Diese Robe zeichnete Fannys Kurven raffiniert nach, betonte sie und verriet mit der Andeutung interessanter Details einen vollendeten, begehrenswerten Körper. Sie betrachtete wohlgefällig ihr Spiegelbild, strich über den Samt, der den Busen gerade noch bedeckte, fühlte und sah die Spitzen der sanften, festen Rundungen wachsen — eine Regung, die sie verschüttet glaubte. Sie war’s zufrieden.
Lord Douglas war einer der ersten Gäste. Er brachte einen Freund mit, der seit einiger Zeit von sich reden gemacht hatte: den Maler Thomas Gainsborough. Galante Portraits, die er von den Damen des Hofes und der Gesellschaft malte, hatten ihm seinen Ruf eingetragen. Man buhlte um seine Gunst — galt es doch als besondere Ehre, von Gainsborough gemalt zu werden. Auch Fanny hatte von ihm gehört.
Allmählich füllte sich die Halle. Prominentester Gast war der Herzog D * * *. Mrs. Cole blieb es nicht verborgen, daß der Herzog Feuer fing, als er der schönen Gastgeberin gegenüberstand. Kann das ein Vorteil für Fanny sein oder das Gegenteil? fragte sie sich.
Es wurde ein reizender Abend. Für Fanny umso mehr, als sie wieder einmal die Gesellschaft genoß. Und die Gäste genossen sie — ihre Schönheit, ihr Kleid, ihre Liebenswürdigkeit. Unbestritten war sie der Mittelpunkt. So viele Komplimente hatte sie lange nicht mehr gehört, so glitzernde Augenpaare seit Monaten nicht mehr auf sich ruhen lassen. Es war ein Vergnügen, begehrt zu werden. Fanny blühte sichtlich auf und schwärmte noch tagelang von dem Glanz, der sie wieder umgeben hatte.
Nicht lange, und Fannys Gesellschaften bildeten das Stadtgespräch. Die Gäste mehrten sich — Adel, Künstler, Müßiggänger, Söhne reicher Eltern und Opportunisten jeglicher Art bevölkerten das Haus. Allmählich entwickelten sich diese Besuche zu einer ständigen Einrichtung an bestimmten Tagen. Nach dem „en vogue“ befindlichen Vorbild Frankreichs nannte sie die Empfänge ihre „Jours“.
Es war ein zwangloses Kommen und Gehen innerhalb der ebenfalls nach französischem Vorbild festgesetzten Zeit.
Einmal in der Woche, donnerstags, empfing Fanny in ihrem Boudoir, wobei sie darauf achtete, daß die Zofe Nancy anwesend war.
Lebhafte Diskussionen über Tagesthemata wechselten mit künstlerischen Vorträgen. Und manche politische Intrige wurde hier gesponnen.
Der Herzog von D*** fand sich regelmäßig ein und machte Fanny den Hof. Mrs. Cole empfand eine Aversion gegen den eleganten, allzu glatten und, wie ihr schien, berechnenden Vertreter des Hochadels. Sie witterte Schwierigkeiten, die sich aus den häufigen Besuchen des Herzogs ergeben könnten.
„Lady Douglas, Sie sind gänzlich zerstreut!“ Die Königin, äußerst ungehalten, rügte die Hofdame, die ihr schon zum zweiten Male den falschen Schmuck reichte.
Ihre Majestät war aufbrausender und mürrischer denn je. Des Königs Gesundheitszustand und die Intrigen, die um Georg gesponnen wurden, ohne daß sie helfend einspringen konnte, zerrten an ihren Nerven.