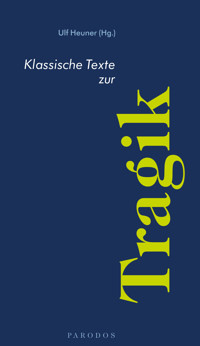
Klassische Texte zur Tragik E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Anhand der Bände dieser Reihe soll sich der Leser einen Überblick über die historische Diskussion und Entwicklung von Themen und Begriffen verschaffen, die in den philosophischen und kulturwissenschaftlichen Debatten unserer Zeit von großer Aktualität sind. Die einzelnen Bände werden von den Herausgebern eingeleitet und mit einer Bibliographie versehen. Dieser Band enthält Texte der klassisch zu nennenden Denker der Tragik vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts (zusätzlich ein Auszug der Poetik des Aristoteles), an denen man nachvollziehen kann, wie sich die Philosophie der Tragik aus der Tragödientheorie heraus entwickelte. Mit Texten von Aristoteles, Schelling, Hegel, Hölderlin, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Scheler und Simmel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klassische Texte zur Tragik
Herausgegeben und eingeleitet von Ulf Heuner
Klassische Texte Parodos – Band 1 (KTP 1)
Impressum
© Parodos Verlag Berlin 2024
https://parodos.de
Alle Rechte vorbehalten
Die Printausgabe ist 2006 erschienen unter der ISBN-13: 978-3-96824-019-0.
ISBN der E-Book-Version: 978-3-938880-03-6.
Ulf Heuner Einleitung: Von der Theorie der Tragödie zur Philosophie der Tragik
Zur Tragik gehören immer mindestens zwei. Zwei Menschen. Der Einsiedler in der Wüste kennt keine Tragik, allenfalls als vergangene Erfahrung. Erst wenn er wieder in Kontakt mit Menschen kommt, wenn z.B. ein einsamer Wanderer um Gastfreundschaft bittet, kommt die Tragik erneut ins Spiel. Das heißt, Tragik spielt sich immer zwischen Menschen ab, im zwischenmenschlichen Handeln. Begegnungen mit Tieren enden niemals tragisch, es sei denn, das Verhalten des Hundes, der uns gerade anfällt, hat seinen Grund in einer menschlichen Handlung. Der unmittelbare Kontakt mit – um es ganz allgemein zu sagen – Nicht-Menschlichem ist zunächst ganz und gar untragisch, solange sich nicht menschliche Handlungen in diesem Kontakt mittelbar bemerkbar machen. Wird jemand vom Blitz erschlagen, ist dies kein tragisches Ereignis, auch wenn man es heute landläufig so nennen würde, sondern zunächst höchstens ein Zeichen der Dummheit des Erschlagenen, da man doch wissen muss, dass man bei Gewitter keine Spaziergänge auf dem freien Feld machen sollte. War der Grund für den Aufenthalt im Freien bei Gewitter jedoch das Verhalten eines anderen Menschen, z.B. eines Kindes, das sich verlaufen hat, kann man durchaus von einem tragischen Tod sprechen. Damit gerät man sogleich in die Diskussion, welche menschlichen Konstellationen tragisch sind: ob alle unglücklichen Ereignisse, die sich aus menschlichen Interaktionen ergeben, tragisch zu nennen sind, oder ob nur bestimmte Handlungskonstellationen diese Bezeichnung verdienen. Ist die Begegnung des Einsiedlers und des Wanderers per se eine tragische Begegnung oder kann man von Tragik erst sprechen, wenn sich bestimmte Handlungskonstellationen zwischen den beiden ergeben, bestimmte Konflikte.
Vor der Frage, ob es spezifisch tragische Handlungskonstellationen gibt, steht jedoch die Frage, ob es überhaupt so etwas wie Tragik gibt. Das ist nämlich keineswegs ausgemacht. Die Idee der Tragik oder des Tragischen ist eine historisch kontingente Idee. Nicht zu jeder Zeit haben Menschen die Welt tragisch erfahren. Zum ersten Mal trat die „tragische Weltbetrachtung“ (Nietzsche) in der griechischen Antike auf, verkörpert in der griechischen Tragödie. Zusammen mit bzw. als Widerpart der Philosophie stellte sie die überkommene mythische Weltordnung in Frage. So standen sich in der klassischen Antike mythische bzw. religiöse, rationalistische und tragische Weltbetrachtung gegenüber. Diese Trias ergab sich erneut in der Neuzeit, als das religiöse Weltbild des Mittelalters ins Wanken geraten war, und zwar in der Form: Religion, Aufklärung, Tragik. Dieses sehr verkürzte Modell weitergedacht, lassen sich die Unterschiede der drei Weltbetrachtungen folgendermaßen skizzieren: Während die (christliche) Religion ein jenseitiges Paradies verspricht und das Diesseits mit all seinen Widrigkeiten in göttlicher Harmonie aufgehen lässt, verspricht die Aufklärung ein Paradies auf Erden. Die Tragik opponiert beiden Perspektiven. Gegenüber der Religion macht sie die menschliche Perspektive geltend, drängt auf eine säkulare Betrachtung der Lage. Das Jenseits interessiert die tragische Weltbetrachtung nicht. Und in Opposition zur Aufklärung weiß der Tragiker, dass das Paradies auf Erden nicht zu haben ist.
Das eigentlich Neue an der neuzeitlichen Tragik ist zunächst, dass hier die tragische Weltbetrachtung nicht mehr allein in Tragödien ihren Ausdruck fand, sondern dass sich eine eigene Philosophie der Tragik herausbildete. In der Antike hatte man sich bereits theoretisch mit der Tragödie auseinander gesetzt und dabei den Fokus auf die besonderen Wirkungen der Tragödienaufführungen in den antiken griechischen Theatern gerichtet. Am wirkmächtigsten für spätere Generationen erwies sich die Poetik des Aristoteles mit ihrer berühmten Katharsis-Formel im Kapitel VI, dass „[d]ie Tragödie [...] demnach die nachahmende Darstellung einer sittlich ernsten, in sich abgeschlossenen, umfangreichen Handlung [ist], [...], durch die Erregung von Mitleid [Eleos] und Furcht [Phobos] die Reinigung (Katharsis) von derartigen Gemütsstimmungen bewirkend“ (vgl. S. 13 in diesem Band). Insbesondere im 18. Jahrhundert n. Chr. setzte bei Aufklärern wie Lessing eine intensive Diskussion über diese Stelle ein. Die Aufklärer verfolgten das Ziel der moralischen Besserung des Theaterzuschauers, wollten mittels des Theaters eine bessere Welt erschaffen. Sie beschäftigten sich zwar theoretisch mit der Tragödie, waren aber selbst keine tragischen Denker.
Die Theorie bzw. Philosophie der Tragik setzte laut Peter Szondi erst mit dem Philosophen Schelling Ende des 18. Jahrhunderts ein. In seinem Versuch über das Tragische schreibt Szondi im Anschluss an ein Zitat des jungen Schelling aus dessen Philosophischen Briefen über Dogmatismus und Kritizismus: „Mit dieser Deutung des König Ödipus und der griechischen Tragödie im allgemeinen beginnt die Geschichte der Theorie des Tragischen, die ihr Augenmerk nicht mehr auf dessen Wirkung, sondern auf das Phänomen selber richtet.“1 Das Phänomen Tragik wurde nun nicht mehr allein in der Tragödie als ästhetisches Phänomen verortet, sondern es wurde gefragt, inwieweit unsere reale, nicht-ästhetische Welt tragisch verfasst ist. Wenn Schelling in seiner Philosophie der Kunst vom „einzig wahrhaft Tragische[n] in der Tragödie“ (S. 34 in diesem Band) spricht, zeigt dies die Scheidung von Tragödien- und Tragiktheorie. Jetzt wird die griechische Tragödie anachronistisch am Begriff einer nicht-dramatischen Tragik gemessen und die Rede von einer tragischen Tragödie ist nun mehr als eine Tautologie.
Dieser Band enthält Texte der klassisch zu nennenden Denker der Tragik vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, an denen man die Entwicklung der Philosophie der Tragik nachvollziehen kann: von Schelling bis Simmel. Es wird deutlich, dass die Theorie der Tragik sich nicht einfach von der Theorie der Tragödie in einem Sprung emanzipierte, sondern zunächst stark auf sie bezogen blieb. So wurden zunächst in die Überlegungen zur Tragödie Ideen zu einer Tragik jenseits der Tragödie eingeflochten, wie z.B. bei Hegel oder Hölderlin. Dagegen grenzt sich am Ende der Entwicklung Max Scheler explizit von der Tragödientheorie ab und illustriert seine Überlegungen zum Phänomen des Tragischen nur noch mit Beispielen u.a. aus der griechischen Tragödie. Bei den abgedruckten Texten Schopenhauers kann man diesen Perspektivenwechsel am Denken eines Philosophen beobachten. Während sich im Paragraphen 51 des ersten Bandes und im Kapitel 37 des zweiten Bandes seines Werks Die Welt als Wille und Vorstellung zunächst in der Theorie der Tragödie eine Theorie der Tragik nur abzeichnet, blickt er im Kapitel 49 in der Bestimmung des menschlichen Daseins und Lebens, dessen „Verlauf [...] im Grunde immer tragisch [ist]“ (vgl. S. 75 in diesem Band), nur noch einmal auf die Tragödie zurück.
Dennoch kommt es nie ganz zu einer Trennung von Tragik- und Tragödientheorie. Dies kann seinen Grund darin haben, dass im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht streng zwischen dramatischer Fiktion und nicht-dramatischer bzw. realer Welt, zwischen dramatischen Figuren und realen Menschen unterschieden wurde.2 Die Welt der Tragödien ist in dieser Sichtweise „Welt im verringerten Maßstab“, wie Hölderlin schreibt (S. 59 in diesem Band), der als Tragödienschreiber allerdings noch am ehesten um die besondere künstliche Form der fiktionalen, dramatischen Welt weiß. Dass die dramatische Welt als reale Welt im Kleinen betrachtet wurde bzw. an den raum-zeitlich kausalen Bedingungen dieser gemessen wurde, lag nicht zuletzt an der falschen Rezeption der aristotelischen Einheit von Raum, Zeit und Handlung seit Beginn der Neuzeit. Für das Verständnis der griechischen Tragödie erwies sich diese „documentary fallacy“ zwar lange als äußerst hinderlich, für die Theorie der Tragik jedoch als äußerst produktiv. Denn für den Theoretiker der Tragik ist es letztendlich unerheblich, woher er seine Anregungen nimmt und wie er mit seinen Inspirationsquellen umgeht.
Die Texte zeigen die vielfältigen Bestimmungen des tragischen Phänomens und den unterschiedlichen Umgang mit ihm: von der (eigentlich untragischen) dialektischen Auflösung der tragischen „Kollisionen“ in Versöhnung bei Hegel über die „Resignation“ als einzig angemessener Reaktion auf die tragische Verfasstheit der Welt bei Schopenhauer bis zu der Bejahung einer tragischen Lebensform bei Nietzsche.
Die Kapitel VI-XIII der Poetik des Aristoteles sind einerseits in den Band mit aufgenommen worden, weil die aristotelische Tragödientheorie auch für viele Philosophen der Tragik ein wichtiger Bezugspunkt ist, von dem sie sich allerdings häufig kritisch absetzen. Andererseits kann man die Frage stellen, ob nicht schon Aristoteles als ein Denker der nicht-ästhetischen Tragik zu betrachten ist, wenn er die Tragödie als „nachahmende Darstellung [Mimesis] nicht der Menschen, sondern ihrer Handlungen und des Lebens“ (S. 14 in diesem Band) bestimmt und fragt, welche nicht-dramatischen Handlungskonstellationen sich am besten für die Nachahmung eignen, d.h., anachronistisch gesprochen, am „tragischsten“ sind.
Die aphoristischen Gedanken zur Tragik aus dem Nachlass Georg Simmels sollen den Band abrunden und zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema anregen, das heute, nach dem weitgehenden Niedergang gesellschaftlicher Utopien, wieder von großer Aktualität ist. Die knappe Bibliographie versammelt daher einige Schriften aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die nach den klassischen Denkern der Tragik neue Denkanstöße zum Thema gegeben haben.
Die Texte sind moderat in die neue Rechtschreibung transformiert worden, was gegenüber einer Transformationen in die „alte“ Rechtschreibung, insbesondere bei den Textquellen des 19. Jahrhunderts, weniger Änderungen bedeutete. Manche Begriffe und Ausdrücke, die heute veraltet erscheinen, sind beibehalten worden, wenn sie Kennzeichen des jeweils spezifischen Denkens und Schreibstils der Philosophen sind. Texte, die nicht als eigenständige Texte geschrieben wurden, sondern größeren Werken entnommen sind, wurden jeweils so ausgewählt, dass sie in sich verständlich sind und darüber hinaus ihre Kontexte deutlich werden.
1
Peter Szondi: Versuch über das Tragische [1961]. In: Schriften I. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1978. S. 157-158.
2
Zur Verschränkung von theatraler und realer Tragik in der Wahrnehmung der Zuschauer im griechischen Theater s. Ulf Heuner: Tragisches Handeln in Raum und Zeit. Raum-zeitliche Tragik und Ästhetik in der sophokleischen Tragödie und im griechischen Theater. Metzler: Stuttgart 2001. S. 120 ff.
Aristoteles Poetik: Kapitel VI-XIII
Kapitel VI
1. Über die in Hexametern nachahmende Darstellung wie über die Komödie werden wir später handeln. Jetzt wollen wir über die Tragödie reden, indem wir die Definition ihres Wesens dem bereits Gesagten entnehmen.
2. Die Tragödie ist demnach die nachahmende Darstellung einer sittlich ernsten, in sich abgeschlossenen, umfangreichen Handlung, in kunstvoll gewürzter Rede, deren einzelne Arten gesondert in (verschiedenen) Teilen verwandt werden, von handelnden Personen aufgeführt, nicht erzählt, durch die Erregung von Mitleid und Furcht die Reinigung (Katharsis) von derartigen Gemütsstimmungen bewirkend. Unter „kunstvoll gewürzter Rede“ verstehe ich eine solche, die Rhythmus wie Harmonie, d.h. Gesang enthält, und unter dem „gesondert in seinen verschiedenen Arten,“ dass einiges rein metrisch, anderes dagegen musikalisch ausgeführt wird.
3. Da es nun handelnde Personen sind, die die nachahmende Darstellung vollziehen, so ergibt sich erstens mit Notwendigkeit, dass der Schmuck, der in der szenischen Ausstattung liegt, gewissermaßen ein Bestandteil der Tragödie ist, ferner die Gesangskomposition und der sprachliche Ausdruck, denn mit diesen Mitteln wird die nachahmende Darstellung erreicht. Unter sprachlichem Ausdruck verstehe ich hier die bloße Verbindung der Verse, unter Gesangskomposition aber das, was seinem Wesen nach allem offenkundig ist.
4. Da wir es nun mit der nachahmenden Darstellung einer Handlung zu tun haben, diese aber durch gewisse handelnde Personen erfolgt, die in Hinblick auf ihren Charakter und ihre Gedanken von einer bestimmten Beschaffenheit sein müssen, denn eben daraufhin legen wir ja den Handlungen eine gewisse Beschaffenheit bei, so ergeben sich naturgemäß zwei Ursachen für eine Handlung, eben der Charakter und die Gedanken, denen gemäß alle ihr Ziel erreichen oder verfehlen.
5. Nun ist aber die nachahmende Darstellung einer Handlung die Fabel. Unter Fabel verstehe ich nämlich die Verknüpfung der Begebenheiten, unter Charakter aber, wonach wir den handelnden Personen eine bestimmte Beschaffenheit zuweisen, unter Gedanken endlich das, womit die Redenden etwas beweisen oder einer allgemeinen Wahrheit Ausdruck verleihen.
6. Somit gibt es also sechs Bestandteile einer jeden Tragödie, nach welchen sie eine bestimmte Beschaffenheit hat. Es sind diese: die Fabel, die Charaktere, der sprachliche Ausdruck, die Gedanken, die szenische Ausstattung und die musikalische Komposition. Zwei von diesen Teilen gehören zu den Mitteln, eine zu der Art und Weise und drei zu den Gegenständen der nachahmenden Darstellung. Weitere gibt es nicht. Von diesen Formen hat man auch in der Regel Gebrauch gemacht, denn szenische Ausstattung hat ein jedes Drama, ebenso wie Charakterzeichnung, eine Fabel, sprachlichen Ausdruck, Gesang und Gedankeninhalt.
7. Der bedeutsamste dieser Bestandteile ist aber die Verknüpfung der Begebenheiten, denn die Tragödie ist eine nachahmende Darstellung nicht der Menschen, sondern ihrer Handlungen und des Lebens. Glück und Unglück beruhen auf Handlung und ihr Endzweck ist eine Art Tätigkeit, nicht eine Beschaffenheit. Dem Charakter nach sind wir so oder so beschaffen, unseren Handlungen nach aber glücklich oder das Gegenteil. Daher handeln die Nachahmenden nicht um die Charaktere nachahmend darzustellen, sondern der Handlung zuliebe werden die Charaktere in ihre Darstellung mitaufgenommen. So sind die Handlungen, will sagen die Fabel, das Endziel der Tragödie, das Endziel ist aber von allen Dingen die Hauptsache.
8. Ferner, ohne Handlung könnte es keine Tragödie geben, ohne Charaktere aber wäre dies wohl möglich, weisen doch die Tragödien der meisten Neueren keine (individuelle) Charakterzeichnung auf und überhaupt gilt dies von vielen Dichtern. Ähnlich verhält sich unter den Malern Zeuxis zu Polygnot. Dieser ist ein vortrefflicher Charaktermaler, die Malerei des Zeuxis hingegen entbehrt der Charakterisierung.
9. Wiederum, sollte jemand charakterzeichnende Tiraden wohlgelungen im sprachlichen Ausdruck wie in den Gedanken hintereinander aufreihen, so würde er damit noch keineswegs die von uns der Tragödie zugewiesene Aufgabe erfüllen, um vieles eher würde dies eine Tragödie tun, die von jenen Dingen einen mangelhafteren Gebrauch macht, dagegen aber eine Fabel d.h. eine Verknüpfung der Begebenheiten aufweist.
10. Dazu kommt, dass gerade diejenigen Mittel, mit denen die Tragödie ihren Hauptreiz ausübt, ich meine die Peripetien (Schicksalswendungen) und Wiedererkennungen, Bestandteile der Fabeln sind.
11. Ein weiterer Beweis (für die obige Behauptung) liegt darin, dass Anfänger in der Dichtkunst eher im sprachlichen Ausdruck und in der Zeichnung der Charaktere strengen Anforderungen der Kunst zu genügen imstande sind, als die Begebenheiten gehörig zu verknüpfen, und dasselbe trifft auf fast alle Dichter der ältesten Zeit zu. Grundlage und gleichsam die Seele ist also die Fabel.
12. An zweiter Stelle kommen die Charaktere. Eine Parallele bietet uns auch hier die Malerei. Wollte nämlich jemand eine Tafel mit den herrlichsten Farben aufs geratewohl bestreichen, so würde er nicht ein gleiches Wohlgefallen hervorrufen, als wenn er nur eine (monochrome) Zeichnung grau in grau geben würde. Wir haben es eben mit der nachahmenden Darstellung einer Handlung zu tun und vermittelst dieser vorzugsweise einer solchen von handelnden Personen.
13. Die dritte Stelle nehmen die Gedanken ein. Ich verstehe darunter das Vermögen, das von den Umständen Gebotene und Angemessene zu sagen, genau dasselbe, was in der Beredsamkeit die Aufgabe politischer Einsicht und rhetorischer Schulung ist. Die alten Dichter ließen nämlich ihre Personen nach ethisch-politischen Gesichtspunkten reden, bei den neueren aber treten sie als Redekünstler auf.
14. Die Charakterzeichnung ist derart, dass sie die Beschaffenheit der Willensrichtung offenbart und deshalb haben diejenigen Tragödien keine Charakterzeichnung in den Dialogpartien, in denen sich gar nichts findet, was der Redende begehrt oder meidet, Gedanken sind aber das, womit man beweist, dass etwas ist oder nicht ist, oder was einen allgemeinen Satz ausspricht.
15. Der vierte der (literarischen) Bestandteile ist der sprachliche Ausdruck. Ich verstehe darunter, wie bereits früher bemerkt wurde, die Fähigkeit, sich in Worten auszudrücken, was übrigens bei gebundener wie ungebundener Rede im Wesentlichen auf dasselbe hinausläuft.
16. Was die noch übrigbleibenden Bestandteile anbelangt, so ist die musikalische Komposition das wichtigste der Verschönerungsmittel, die szenische Ausstattung dagegen ist zwar reizvoll, liegt aber der Dichtkunst ganz fern und ist ihr am wenigsten angemessen. Die Wirkung der Tragödie wird nämlich auch ohne öffentliche Aufführung und ohne Schauspieler erreicht. Außerdem gehört die Herstellung der szenischen Ausstattung mehr der Kunst des Theatermeisters an als der der Dichter.
Kapitel VII
1. Nach diesen Bestimmungen wollen wir zunächst darüber reden, wie etwa die Verknüpfung der Begebenheiten beschaffen sein muss, da dies in der Tragödie sowohl zuerst in Betracht kommt als auch das wichtigste ist. Es stand uns also fest, dass die Tragödie die nachahmende Darstellung einer in sich abgeschlossenen und ganzen Handlung ist, die eine ganz bestimmte Größe hat, denn es gibt auch ein Ganzes, das keine (eigentliche) Größe hat. Ein Ganzes ist nämlich das, was Anfang wie Mitte und Ende hat. Anfang ist das, was selbst nicht notwendigerweise auf ein anderes folgt, nach dem aber naturgemäß etwas ist, Ende dagegen ist das, was selbst naturgemäß nach einem anderen ist, sei es notwendigerweise oder in der Regel, nach dem aber nichts folgt, Mitte endlich das, was auch selbst nach einem anderen und nach dem ein anderes folgt. Gutgebaute Fabeln müssen daher weder aufs geratewohl von irgend woher anfangen noch aufs geratewohl irgendwo enden, sondern sich nach den erwähnten Begriffsbestimmungen richten.
2. Ferner, das Schöne, sei es ein lebendes Wesen, sei es irgend ein Gegenstand, der aus bestimmten Teilen zusammengesetzt ist, bedarf dieser Teile nicht nur in wohlgegliederter Folge, sondern muss auch eine nicht dem Zufall unterworfene Größe haben, denn das Schöne beruht auf Ordnung und Größe. Deshalb könnte weder irgend ein winzig kleines Wesen schön sein, denn dessen Betrachtung, die sich hart an der Grenze eines unwahrnehmbaren Zeitpunkts vollzieht, würde verworren zusammenfließen, noch ein übermäßig großes, denn die Wahrnehmung könnte nicht auf einmal zustande kommen, sondern das Eine und Ganze würde den Betrachtenden aus dem Gesichtsfeld entschwinden, wie z.B. wenn das Geschöpf 10000 Stadien lang wäre. Wie daher bei körperlichen Gegenständen und bei lebenden Wesen (um schön zu sein) Größe vorhanden, diese aber leicht zu übersehen sein muss, so ist auch bei den Fabeln ein bestimmter Umfang erforderlich, der seinerseits leicht im Gedächtnis behalten werden kann.
3. Was nun aber diesen Umfang selbst anbelangt, so ist dessen Umgrenzung in Rücksicht auf die öffentliche Aufführung und das Wahrnehmungsvermögen (der Zuschauer) nicht Sache der Dichtkunst. Denn wenn man (d.i. ist der Schauspieler) hundert Tragödien aufzuführen hätte, so würde man sie nach der Wasseruhr (Klepsydra) aufführen, wie wir bei anderer Gelegenheit uns auszudrücken pflegen. Die aus der Natur der Sache selbst sich ergebende Umgrenzung ist aber diese: Stets wird die ausgedehntere Fabel, insofern sie übersichtlich ist, auch im Hinblick auf ihren Umfang die vorzüglichere sein. Um aber eine einfachere Bestimmung zu treffen, so ist es eine genügende Umgrenzung des Umfangs, wenn man (d . i. der Held) innerhalb der aufeinander folgenden Ereignisse nach Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit einen Umschwung aus Unglück in Glück oder aus Glück in Unglück durchmacht.
Kapitel VIII
1. Die Fabel ist aber nicht schon eine einheitliche, wie einige meinen, wenn sie sich um eine einzelne Person dreht, denn unendlich viele Dinge begegnen einer einzelnen Person, von denen manche gar keine Einheit darstellen und so gibt es auch viele Handlungen einer einzelnen Person, aus denen keine einzige einheitliche Handlung sich entwickelt.
2. Daher scheinen mir alle jene Dichter im Irrtum zu sein, die eine Herakleis und eine Theseis und ähnliche Werke gedichtet haben. Denn sie glauben, weil Herakles eine einzelne Person sei, komme auch der Fabel ein einheitlicher Charakter zu.
3. Homer dagegen, wie er ja auch in allem anderen hervorragt, scheint auch hier einen künstlerischen Blick gehabt zu haben, sei es infolge erworbener oder angeborener Tüchtigkeit. Denn bei der Abfassung seiner Odyssee hat er nicht alles, was Odysseus selbst widerfuhr, behandelt, wie z.B. die Verwundung auf dem Parnass und dem vorgeschützten Wahnsinn bei dem Aufgebot, da von diesen Begebnissen keins, falls das eine eintrat, auch das andere mit Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit eintreten musste. Er hat vielmehr die Odyssee um eine einheitliche Handlung, wie wir sie bestimmt haben, aufgebaut und desgleichen auch die Ilias.
4. Es muss daher, wie auch in den anderen nachahmenden Darstellungen die einzelne Nachahmung Darstellung eines einzelnen Gegenstandes ist, so auch die Fabel, da sie die Nachahmung einer Handlung ist, Nachahmung einer einheitlichen und zwar einer vollständigen sein. Und es müssen die Teile der Begebenheiten so zusammenhängen, dass, wenn auch nur einer dieser Teile versetzt oder weggenommen wird, das Ganze zerstört wird und auseinander fällt. Denn dasjenige, was ohne einen in die Augen springenden Eindruck zu machen, vorhanden oder nicht vorhanden sein kann, ist kein (wesentlicher) Teil des Ganzen mehr.
Kapitel IX
1. Aus dem Gesagten erhellt, dass es nicht die Aufgabe des Dichters ist das, was sich wirklich zugetragen, zu erzählen, sondern das, was sich hätte zutragen können und was nach Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit möglich ist.
2. Der Geschichtsschreiber und der Dichter unterscheiden sich nämlich nicht durch die gebundene oder ungebundene Rede, denn man könnte das Werk des Herodot in Verse setzen und es würde nach wie vor eine Art Geschichtsdarstellung sein, mit Versmaß oder ohne Verse. Der Unterschied ist vielmehr der, dass jener, was sich zugetragen darstellt, dieser, was sich hätte zutragen können.
3. Deshalb ist auch die Poesie philosophischer und höher einzuschätzen als die Geschichtsschreibung, denn die Poesie stellt mehr das Allgemeine, die Geschichtsschreibung das Einzelne dar. Das Allgemeine besteht darin, dass dem so oder so Beschaffenen es zukommt, so oder so nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit zu reden oder zu handeln und darauf richtet die Dichtkunst bei der Namengebung ihr Augenmerk, das Einzelne ist aber, was ein Alkibiades getan oder erlitten hat.
4. Bei der Komödie ist nun dies bereits augenfällig geworden. Indem die Dichter nämlich ihren Stoff auf Grund wahrscheinlicher oder notwendiger Begebenheiten gestalteten, haben sie ihren Personen dementsprechend beliebige Namen beigegeben und nicht wie die Jambendichter sich mit einer historischen Persönlichkeit befasst.
5. In der Tragödie dagegen hält man sich an die überlieferten Namen. Der Grund dafür ist, dass das Mögliche auch glaublich ist. Was sich aber noch nicht zugetragen hat, an dessen Möglichkeit glauben wir nicht ohne weiteres, dagegen ist offenbar das möglich, was sich bereits zugetragen hat, denn es hätte sich ja gar nicht zutragen können, wenn es unmöglich gewesen wäre. Indessen verhält es sich in den Tragödien nicht anders, in einigen gehört nur der eine oder zwei zu den bekannten Namen, während die übrigen erdichtet sind, in anderen findet sich überhaupt kein einziger bekannter Name, wie in der Anthē des Agathon, in welchem Drama die Begebenheiten ebenso wie die Namen erfunden sind, und dennoch gewährt es eine nicht geringere Freude.
6. Deshalb soll man auch nicht um jeden Preis darnach trachten sich an die überlieferten Sagenstoffe, die den Tragödien zugrunde liegen, zu binden, denn es wäre lächerlich darnach zu trachten, ist doch auch das Bekannte nur wenigen bekannt und trotzdem erfreut es alle.
7. Es ist demnach klar, dass der Dichter vielmehr ein Dichter von Sagenstoffen als von Versmaßen sein muss, insofern er ein Dichter auf Grund der nachahmenden Darstellung ist und zwar Handlungen nachahmt. Und sollte es sich einmal treffen, dass er das, was sich wirklich zugetragen hat, darstellt, so ist er nichtsdestoweniger ein Dichter. Denn nichts hindert, dass von dem, was sich tatsächlich zugetragen hat, manches der Wahrscheinlichkeit entsprechend sich zugetragen hat und in Bezug auf diesen Punkt erweist er sich eben als ein Dichter jener Begebenheiten.
8. Von mangelhaften Fabeln, d.h. Handlungen sind die episodischen die schlechtesten. Ich verstehe unter einer episodischen Fabel eine solche, in der die episodischen Teile ohne Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit aufeinander folgen. Solche werden von minderwertigen Dichtern infolge ihres eigenen Unvermögens verfasst, von guten dagegen aus Rücksicht auf die Schauspieler. Da sie nämlich Dramen aufführen und einmal die Fabel über Gebühr ausgedehnt haben, kommen sie oft in die Zwangslage, die (natürliche) Abfolge (der Begebenheiten) in Unordnung zu bringen.
9. Da wir es nun mit der nachahmenden Darstellung einer Handlung zu tun haben, die nicht nur in sich abgeschlossen ist, sondern auch furcht- und mitleiderregende Vorgänge enthält, diese aber ganz besonders dann entstehen, wenn sie sich wider Erwarten aus dem (inneren) Zusammenhange ergeben, (so ist das Wunderbare ein wirkungsvolles Element der Tragödie). Und es wird das Wunderbare eine noch größere Wirkung ausüben, als wenn es nur von Ungefähr oder durch Zufall eintritt, da selbst bei rein zufälligen Ereignissen diejenigen den größten Eindruck des Wunderbaren machen, deren Vorkommen gleichsam den Schein der Absichtlichkeit erwecken, wie z.B. die Bildsäule des Mitys in Argos den, der an dem Tode des Mitys schuld war, erschlug, indem sie, gerade als er sie betrachtete, auf ihn niederfiel. So etwas scheint nämlich nicht auf Zufall zu beruhen. Es sind also derartig beschaffene Stoffe notwendigerweise die kunstgerechteren (schöneren).
Kapitel X
1. Von Fabeln sind die einen einfach, die anderen verflochten, denn derart sind auch ihrer Natur nach die Handlungen, deren nachahmende Darstellungen ja die Fabeln sind. Unter einer einfachen Fabel verstehe ich eine solche, in deren ununterbrochenem und einheitlichem Verlauf unserer Bestimmung gemäß der Umschwung ohne Peripetie oder Erkennung herbeigeführt wird, eine verflochtene dagegen, bei der der Umschwung mit Erkennung oder Peripetie oder mit beiden zugleich zustande kommt.
2. Diese beiden müssen aber aus dem Aufbau der Fabel selbst sich ergeben und zwar so, dass sie aus den jeweilig vorhergegangenen Begebenheiten, sei es mit Notwendigkeit, sei es mit Wahrscheinlichkeit sich entwickeln. Denn es macht einen erheblichen Unterschied, ob etwas „propter hoc“ oder „post hoc“ erfolgt.
Kapitel XI
1. Peripetie ist der Umschwung dessen, was man tut, in sein Gegenteil und zwar unserer Ansicht entsprechend auf Grund der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit. So kommt z.B. einer im Oidipus, um den Oidipus zu erfreuen und ihn von seiner Furcht in Betreff seiner Mutter zu befreien; indem er aber dadurch dessen Herkunft offenbart, bewirkt er das gerade Gegenteil und im Lynkeus wird der eine zum Tode geführt, ein anderer [Danaos] folgt ihm, um ihn zu töten, es ergibt sich aber aus dem, was sie taten, dass dieser den Tod erleidet, jener aber gerettet wird.
2. Erkennung (Anagnorisis) ist, wie ja auch schon der Name besagt, die Umwandlung aus Unkenntnis in Kenntnis, die entweder zur Freundschaft oder Feindschaft der zu Glück oder Unglück ausersehenen Personen führt. Am kunstvollsten ist die Erkennung, wenn zugleich damit eine Peripetie eintritt, wofür die Erkennung im Oidipus ein Beispiel bietet.
3. Es gibt nun freilich auch andere Arten der Erkennung, denn in Bezug sowohl auf leblose wie auf ganz beliebige Dinge kann sie in der erwähnten Weise eintreten, und man kann erkennen, ob jemand etwas getan oder ob er es nicht getan hat. Aber die wichtigste für die Fabel, d.h. die wichtigste für die Handlung ist die erstgenannte. Denn eine derartige Erkennung und Peripetie werden entweder Mitleid erwecken oder auch Furcht und als nachahmende Darstellung solcher Handlungen gilt uns ja die Tragödie. Ferner werden ja auch Glück und Unglück durch solche Erkennungen bedingt sein.
4. Da nun die Erkennung (vorzugsweise) eine Erkennung von gewissen Personen ist, so gibt es einerseits Erkennungen, die nur von einer einzelnen Person in Bezug auf die andere stattfinden, falls es nämlich bekannt ist, wer die andere Person ist; andrerseits müssen beide Parteien sich erkennen, wie z.B. Iphigeneia von Orestes vermittelst der Absendung ihres Briefes erkannt wurde, dieser aber von Seiten der Iphigeneia noch einer anderen Erkennungsart bedurfte.
5. Dieses wären also zwei Bestandteile der Fabel, nämlich Peripetie und Erkennung; die dritte ist die leidvolle Tat. Eine leidvolle Tat aber ist eine verderbenbringende und schmerzverursachende Handlung, als da sind Tötungen vor den Augen der Zuschauer, Fälle von übermäßigen Qualen, Verwundungen und sonstiges dieser Art.
Kapitel XII
1. Die (qualitativen) Teile der Tragödie, welche man als Arten verwenden muss, haben wir vorhin besprochen; was die quantitativen anbelangt, d.h. die gesonderten Teile, in die sie geschieden werden, so sind es folgende: Prolog, Epeisodion, Exodos, Chorlied, das seinerseits in die Parodos und das Stasimon zerfällt. Diese Bestandteile sind allen Dramen gemeinsam, der Tragödie eigentümlich die Gesänge von der Bühne und die Kommoi.





























