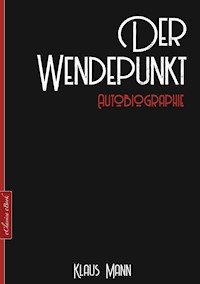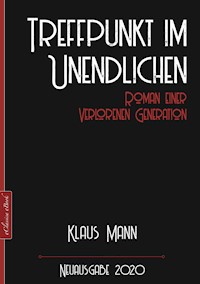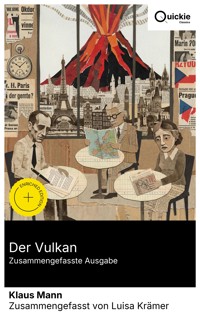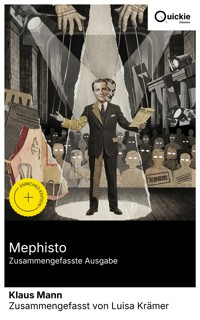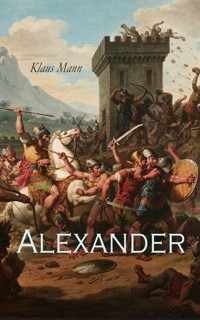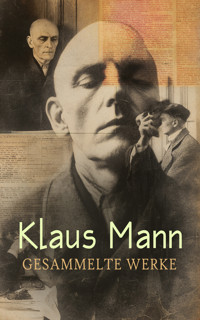Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EClassica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klaus Mann: Der fromme Tanz - Roman einer Jugend | Neu editierte Ausgabe 2020 |Erzählt wird die Geschichte des homosexuellen Nachwuchs-Künstlers Andreas Magnus, der seinem großbürgerlichen Elternhaus entflieht, um sich in Berlin unter die Bohème zu mischen. Er durchstreift Nachtclubs, Cabarets und zwielichtige Etablissements - suchend nach dem eigenen Lebensweg. Er begegnet Niels, der seine erste große Liebe wird - doch das Verhältnis ist schwierig ... | Diesen stark autobiographischen Coming Out-Roman schrieb Klaus Mann bereits im Alter von 19 Jahren. Von den zeitgenössischen Kritikern wurde die offene Schilderung gleichgeschlechtlicher Liebe als geschmackloser sexueller Exhibitionismus gegeißelt. Heute aber gilt "Der fromme Tanz" als erster bedeutender Homosexuellen-Roman im deutschsprachigen Raum. © Redaktion eClassica, 2020
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
— INHALT —
Innentitel
Über das Buch
Über den Autor
Motto
Vorwort
Prolog
Erster Abschnitt
1
2
3
4
5
6
7
Zweiter Abschnitt
8
9
10
11
12
13
14
Dritter Abschnitt
15
16
17
18
19
20
21
Vierter Abschnitt
22
23
24
25
26
27
28
Fünfter Abschnitt
29
30
31
32
33
34
35
Impressum
Über das Buch
Erzählt wird die Geschichte des homosexuellen Nachwuchs-Künstlers Andreas Magnus, der seinem großbürgerlichen Elternhaus entflieht, um sich in Berlin unter die Bohème zu mischen. Er durchstreift Nachtclubs, Cabarets und zwielichtige Etablissements – auf der Suche nach dem eigenen Lebensweg. Er begegnet Niels, der seine erste große Liebe wird – doch das Verhältnis ist schwierig. Der junge Mann verlässt Berlin, Andreas folgt ihm nach Paris, um ihn doch noch für sich zu gewinnen.
Diesen stark autobiographischen Coming Out-Roman schrieb Klaus Mann bereits im Alter 19 Jahren. Ein mutiges Unterfangen, denn Homosexualität stand in der Weimarer Republik unter Strafe. Von den zeitgenössischen Kritikern wurde die offene Schilderung gleichgeschlechtlicher Liebe als geschmackloser sexueller Exhibitionismus gegeißelt. Heute aber gilt ›Der fromme Tanz‹ als erster bedeutender Homosexuellen-Roman im deutschsprachigen Raum. @ Redaktion eClassica, 2020
Über den Autor
Klaus Mann war der älteste Sohn des Schriftstellers Thomas Mann, geboren als dessen zweites Kind nach Schwester Erika, am 18. November 1906 in München. Von einem leichtfertigen, selbstbezogenen und bohéme-artigen Nachwuchsschriftsteller, der im Schatten seines berühmten Vaters stand, entwickelt er sich im Lauf der Jahre zu einem der wichtigsten Kritiker der Nazi-Diktatur im Exil. Er arbeitet für im Ausland publizierte Widerstandsblätter und geht in den USA auf Vortragsreisen, um das Bild eines ›anderen‹, humanen Deutschland zu vermitteln. Drogensucht, oft unglücklich gelebte Homosexualität und ein schwieriges Verhältnis zum ›Übervater‹ Thomas Mann ließen ihn häufig am Leben zweifeln und mit Selbstmordgedanken spielen. Am 21. Mai 1949 starb er in Cannes nach einer Überdosis Schlaftabletten.
Anna Pamela Wedekindgewidmet
Motto
Du kannst nicht sein, Du kannst Dich nur verschwenden,Kannst bleiben nicht, die Erde wandert aller Enden,Du kannst nicht sammeln, jedes Gold wird Blei,Und nichts wissen, denn es wird schon Trug –Du kannst nur lieben. Lieben ist genug.
Ernst Bertram
Einer von uns muss das Lied singen, unser Lied. Wie wird es sein?
›Anja und Esther‹
Vorwort
Einem Buche ein »Vorwort« voranzusetzen, bedeutet ein Buch erklären wollen. Wer sein Werk und seine Bemühung zu erklären nötig hat, der gesteht damit auch die Notwendigkeit ein, seine Bemühung entschuldigen zu müssen.
Kein Buch vielleicht hat es nötiger, am Anfang gleich um Entschuldigung zu bitten, um seiner Wirrnis willen, als eines, das aus unserer Jugend kommt, von unserer Jugend handelt, und nichts sein, nichts bedeuten möchte, als Ausdruck, Darstellung und Geständnis dieser Jugend, ihrer Not, ihrer Verwirrung – und ihrer hohen Hoffnung vielleicht.
»Ich werde mich zahlreichen Vorwürfen aussetzen«, heißt der erste Satz eines erschütternden Romans, den ein Siebzehnjähriger drüben in Frankreich schrieb: »Aber was kann ich dafür? Ist es meine Schuld, dass ich einige Monate vor der Kriegserklärung zwölf Jahre alt war? Zweifellos waren die Verwirrungen, die diese außergewöhnliche Zeit für mich mit sich brachte, so, wie man sie sonst niemals in diesem Alter empfindet. Ich bin nicht der einzige.« – Das schrieb Raymond Radiguet, dem es bestimmt war, mit zwanzig Jahren zu sterben.
Wir haben uns vor denen nicht zu verteidigen, die gehässig sind und uns übel wollen. An ihnen ist nichts mehr gelegen, obgleich sie so sehr in der Überzahl sind. Nichts auf der Welt könnte unwichtiger für uns sein, als die »zahlreichen Vorwürfe« abzuwehren, oder sie gar zu widerlegen, denen wir uns »aussetzen«. Aber die, die mitzudenken, mitzufühlen willens sind, dürfen wir bitten, Nachsicht zu haben mit unserer Bemühung, die sich immer bewusst ist, kein Werk sein zu können, weil die Klarheit, nach der sie so tastet, nie ganz voll erschaut und nie ganz gestaltet ist. Ich bin sicher, dass die meisten Mängel dieses Buches im Künstlerischen und Artistischen damit eben zusammenhängen: wie oft wurde geredet, angeklagt, diskutiert, wo nur Bild, nur Gestalt hätten stehen dürfen. Und wie jener Radiguet in Frankreich führe ich die große, historische Erklärung alles dieses an. Dass mein Held Andreas und seine Altersgenossen dreizehn Jahre alt waren, als die Revolution begann, der andere, zweite verhängnisvolle Aufstand: kann ich dafür?!
Zuweilen will es mir beinahe vorkommen, als sei es an sich und von vornherein schon ein Zeichen von Rückständigkeit und Melancholie, als junger Mensch heute überhaupt noch Bücher zu schreiben. Das Interesse für Literatur bei der Jugend darf länger nicht überschätzt werden. Ich glaube, dass sich nur bei Vereinzelten noch Enthusiasmus für die Wichtigkeit und die Notwendigkeit des Buches findet. Andere Dinge sind es, die im Vordergrund stehen.
Ich habe Zweifel, ob es möglich sein kann, diesen »anderen« buchfeindlichen Dingen in einem Buche auf den Grund zu kommen und sie, gereinigt, darzustellen. Unter Zweifeln habe ich das Wagnis unternommen. Vielleicht soll das Pathos und das Problem dieser fragwürdigsten und hoffnungsseligsten »Nach-Kriegs-Jugend« überhaupt nicht gestaltet, nicht geformt und durch das Werk verewigt werden. Vielleicht hat diese Generation kein für sie eigentlich charakteristisches Werk bis heute hervorgebracht aus dem einfachen Grunde, weil, allem Anschein zum Trotz, kein Bedürfnis in ihr ist nach einem solchen Werk.
All dieser Fragestellungen, all dieser Gedanken ist mein »Abenteuerbuch« voll, viel zu unmittelbar sind sie oft ausgesprochen, viel zu direkt und geständnishaft. Für das »Werk« dieser Jugend, für ihre »Gestaltung« darf ich also auch dieses Buch nicht halten. Als ein Dokument kann es vielleicht bestehen, finden doch die »Verwirrungen, die diese außerordentliche Zeit für uns mit sich brachte«, einen nur zu deutlichen Spiegel in ihm.
Darf ich aber auch hoffen, dass das, wofür ich kein Wort weiß und was ich dann die neue Unschuld, den neuen Glauben, die neue Frömmigkeit benenne, ein wenig durch diese Verwirrungen schimmert?
Wer in meinem »Dokument« von diesem Leuchten und von dieser Klarheit nur einen Schein und Hauch verspüren kann – dem sollte ich dankbar sein, als wenn er mein Bestes erraten hätte.
München, im Juli 1925
Klaus Mann
Prolog
Ich sehe ein Hotelzimmer in irgendeiner fremden südländischen kleinen Stadt und in diesem Hotelzimmer sitzt ein junger Mensch und schreibt einen Brief – ich weiß aber noch nicht an wen. Er hat seinen Schreibtisch nahe ans Fenster gerückt, es ist gegen Abend. Das letzte Licht des Tages benutzt der Schreibende, das letzte gläserne Licht.
Vor dem Fenster liegt noch ein kleiner Balkon und dann kommen Bäume. Aber hinter und zwischen den Wipfeln, die schon ganz schwarz gegen das durchsichtige Silber des Himmels stehen, schimmert das Meer und ist weiß. Man kann es beinahe nicht sehn, aber man fühlt seine Nähe, sein Atmen, sein rührend gewaltiges Eingeschlafensein.
Vor dem strengen Silber des beinahe abendlichen Himmels zeichnet fast schwarz sich das Gesicht des schreibenden jungen Menschen ab, wie eine geschnittene Silhouette. Die Nase springt etwas stark vor, das Haar fällt ihm dunkel und weich in die Stirn. Sein Blick ist über den Briefbogen, der weiß vor ihm ausgebreitet liegt, hinaus und in einer wie abwesenden tiefverschleierten Sanftheit, auf ein paar Photographien gerichtet, die im schlichten Rahmen sonderbar gleichmäßig aufgestellt sind im Hintergrunde des Schreibtischs.
Es lässt sich nicht genau unterscheiden, was diese Photographien darstellen, dazu ist es zu dunkel.
Aber der junge Mensch wendet sich um auf seinem Hotelstuhl und sieht hinter sich ins Zimmer hinein. Gleich neben dem Bett, auf dem Nachttisch, steht nämlich noch eine vierte Photographie, aber auch diese lässt sich in der Dämmerung fast nicht erkennen. Ist es ein Kind oder ist es ein Knabe oder ist es einjunger Mann? Rührend ernst und gesammelt schaut sie in den verschwimmenden Raum, wie Kinder schauen, denen man Großes erzählt. Aber um die Photographie, soviel kann man noch sehen, ist eine schwarze Rosenkranzkette gelegt. Sonst ist es jetzt schon so dunkel im Zimmer, dass sich nicht einmal mehr sagen lässt, ob der am Schreibtisch, zu dem Bild mit dem Rosenkranz selbst hinübersieht, oder nur zum großen Bett, das weißlich, schweigsam und hoch getürmt, stattlich und voll Geheimnis auf etwas zu warten scheint. – Man kann seinem Blick nicht mehr folgen, er verliert sich im Zimmer.
Aber bald wendet er sich dem Briefbogen wieder zu und beginnt wieder zu schreiben. Vor längerer Zeit hat er augenscheinlich diesen Brief schon begonnen, mit anderer Tinte, vielleicht auch in einer anderen Stadt. Aber jetzt fährt er fort. Eifrig, eilig und doch ein wenig schwerfällig geht seine Hand übers Papier. Knabenhaft groß und gläubig reihen sich seine Worte. Und darüber ist sein Gesicht geneigt, ernst und voll Andacht, aber doch mit einem kleinen lächelnden Zug irgendwo um den Mund – so wie Kinder sich über ein Spiel beugen, das ihnen wohl wichtig ist, aber eben doch nur ein Spiel bleibt. – Einmal gleitet sogar sein Blick fort vom Papier und zu einer der Photographien hinüber, die vor ihm stehen. Dann ist es, als redete eine leise Stimme ihn an, deutlich, sanft und doch streng: »Was schreiben Sie denn da, mein Lieber, für hochgespanntes Gerede? Pathetisch und wirr?« – Und der Knabe, mit der Jugend selbstverständlichem Hochmut, antwortet mit seinem geheimnisvollen, verschlagen-lustigen Kinderspielblick: »Wundere Dich nur – die, der ich schreibe, wird’s schon verstehen. Heute bin ich ihr näher, als Du. Das Wort ist stets wirr, das Wort ist verwirrend. Aber unter dem Wort wird es klar, aber hinter dem guten Wort steht die Klarheit.« – Damit neigt er die helle Stirn und schreibt andächtig weiter.
Aber plötzlich springt er dann auf, er läuft ein paar Schritte vom Schreibtisch weg und steht mitten im Zimmer. Er breitet die Arme aus, beinahe wie einer, der etwas umfangen will. Aber dann ist es nur, weil er sich dehnt, als sei er jetzt erst vom Schlaf erwacht. Da war also ein Zimmer um ihn, ein kleines dämmeriges Hotelzimmer – und an der Wand hing im hellen Holzrahmen ein kleines Gemälde, darstellend eine Dame, sowie ein sich bäumendes Pferd. Und ein Bett also stand schweigsam und hoch getürmt – was alles hatte es schon erlebt? – Und draußen, im fremden Gang, standen plaudernd die Stubenmädchen. Und ein kleiner, fremder Geruch wehte durchs Fenster – was im Süden nicht alles für Blumen gediehn! – Und Gesichter schauten verschwimmend vom Schreibtisch. Und einer, der abseits am Bette stand, blickte so rührend ernst und gesammelt – war es ein Kind, ein Knabe oder ein junger Mann? Aber man hatte ihn mit der schwarzen Kette geschmückt. Und ein Brief lag angefangen da, ein weißer Brief, auf dem die Worte sich groß und gläubig aneinander reihten.
Und draußen lag eine fremde südliche Stadt ganz warm im Abend und rauschte mit ihren Brunnen. Und dann kam das Meer.
Er ließ die Arme sinken, er stand schmal, die Arme angelegt, schmal und geordnet. So sah er aus, wie ein frommer junger Kriegsmann, das Antlitz weiß im Dämmern über dem Schwarz des Anzugs – der Schildwacht hält für etwas Heiliges, Schildwacht in diesem fremden Zimmer, durch diese fremden Meere, durch diese fremde Welt.
Erster Abschnitt
1
Als Andreas Magnus noch im Hause seines Vaters lebte, hatte er eines Nachts einen Traum. Aber dieser Traum schmerzte so, tat so ungemein weh, dass Andreas, aus ihm erwachend, sein Kopfkissen in Tränen gebadet fand. Der Traum begann in einer kleinen, halbdunklen Bude, die von oben bis unten angefüllt war mit Kreuzen und Kerzen, mit allerlei frommem Gerät aus Silber und Wachs. Zwischen all diesem stand, ganz undeutlich zwischen den vielen Schatten, die Verkäuferin hinter dem Ladentisch, seltsam frisiert das Haar —durch hellblaue Schleifchen gleichsam eingeteilt oder gerafft zu einzelnen Bündeln – und mit einem sonderbar wassergrünen Blick von unten schauend. Andreas aber erhandelte bei ihr für sein letztes Geld eine schwarze Rosenkranzkette. Sie sollte viel kosten – unverhältnismäßig viel, wie ihm schien – und seine Taschen waren ganz leer. Wahrhaftig, nicht leicht fiel es ihm, die letzte Barschaft über den Ladentisch dieser Dame da zuzuschieben. Aber sie, heiliginnenhaft lächelnd, nahm das Geld leis in Empfang. Behänd verbarg sie es im schwarzledernen Täschchen, verwandte es vermutlich zu wohltätigem Zweck. – Er schickte sich also an, das Geschäft zu verlassen, und sie sagte ihm still zum Abschied ein »Behüte Sie Gott« – wie man es Kindern gibt, die zu langen Wegen ausziehen.
Es musste drinnen nach Weihrauch und Enge gerochen haben, er merkte es jetzt erst. Hier draußen war die Luft so klar und so rein. – Augenscheinlich befand er sich auf einem Hügel oberhalb einer großen Stadt. Aber er kannte die Stadt nicht, auch verschwamm sie formlos wie Wasser zu seinen Füßen im Dunkel. Hinter ihm, ein wenig höher gelegen, schimmerte eine Kirche, weiß und groß gewölbt in der Nacht. – Andreas ging ein Stück weiter, den Rosenkranz in der Hand. Wie ein fließender Bach rann der weiße Weg vor ihm her, er führte bergab, der Stadt zu, die aus der Ferne summte und rauschte. Im Gehen hatte er die Gebetkette sich zweifach um die Hand gewunden – wie kühl die Perlen über das Fleisch rannen. Nicht mit Unrecht war sie so teuer gewesen. – Er legte sich plötzlich die Frage vor, ob die Verkäuferin mit den Schleifen im Haar nicht etwa ein Engel gewesen sein könnte, ein Engel mit leerem, frommem und geheimnisvollem Blick, wie sie manchmal zu Seiten der Madonnen musizieren. Andreas hielt es für gar nicht unmöglich, dass ein Engel sein Geld eingestrichen und heiter im schwarzen Täschchen verwahrt habe. Denn was konnte nicht alles sein und geschehen, in der Nähe so weißer Kirchen? Welches Wunder war ausgeschlossen – fragte der Wandernde sich – über der Stadt?
Eine Frau saß am Wegsaum, Andreas sah sie von fern. Sie saß wie eine, die sich müde an einem Wasser gelagert hat und nun still, ohne Gedanken, den Wellen zusieht, die fließen. – Als er dann aber bei ihr stehenblieb, erkannte er gleich, wer sie war. Zwischen dem starr und doch lieblich geordneten Falten ihres dunklen Mantels saß sie wie zwischen lauter Gold und Edelstein. Und doch war sie so, grau und schlicht – unscheinbar, wie ein Weibchen am Wege. Zwischen dem schwärzlichen Stoff ihres Kleides hingen ihre Hände so müde, als hätten sie den ganzen Tag Mildes getan und viel angefasst.
Andreas erkannte sie wohl. Aber er wagte es nicht, ihr, auch im stillen nur, einen Namen zu geben. Alle Worte, die sie bezeichnen sollten und die andere Beter sich für sie ausgedacht hatten, kamen ihm zu gering und auch wieder zu pomphaft vor, für ihre zarteste Lieblichkeit. Da wollte er einen neuen Namen für sie erfinden, eine neue Formel für ihre Heiligkeit, den frommsten Laut. – Aber es fiel ihm nichts ein.
So stand er vor ihr, und da er kein Wort für sie wusste, mit dem er ihr hätte huldigen können, streckte er ihr seine Rosenkranzkette hin, die er sich doch fürs letzte Geld gekauft hatte. Er hielt sie ihr hin – aber da schüttelte die Mutter Gottes den Kopf. Und gleich begreift es Andreas: Sie wollte die Gabe nicht. Er begriff es, wie sie den Kopf schüttelte: Sie wollte kein Opfer von ihm.
Er ließ die Kette zu Boden fallen – leise klirrend, wie ein beleidigtes Schlänglein, ringelte sie sich auf dem weißen Weg. »Warum wollt Ihr sie nicht?« fragte er leise. Und die Stimme der Mutter – klein und silbern, wie die Stimme von Andreas Schwester Marie Therèse – antwortete ihm: »Noch nicht. Du hast dir’s noch nicht verdient. Du hast dir’s noch nicht erlitten. Du hast mich noch niemals begriffen. Du bist noch jung und voll Hochmut. Du musst erst das Große erlebt haben, dass ich mich deiner Huldigung neige. Hast du mich jemals begriffen? – Noch nicht …«
Während sie aber noch sprach, war sie seinem Blicke immer weiter entschwunden. In eine weite Ferne entglitt ihr schmaler Körper im Mantel. Nur ihre letzten Worte hingen so sonderbar nach, wie eine silberne Wolke in der dunklen Luft:
»Noch nicht …«
Andreas wollte sich bücken um die Rosenkranzkette wieder aufzuheben, aber dann fehlte ihm dazu der Mut und er blieb aufrecht stehen.
Die weiße Kirche läutete ihre Glockenlieder über die unbekannte Stadt hin. Ihr gewaltiges Tönen vermischte sich mit den kleinen, entweichenden, letzten Worten der Maria, die wie ein fremder, gekräuselter Rauch davonzogen. Einen schweren, prunkenden Hintergrund bildete das Glockenlied gleichsam für dieses wehe Weinen: »Noch nicht – noch nicht …«
Andreas hob den Blick, um nach den Sternen zu suchen. Doch waren keine zu sehen, die Nacht war verhüllt und glanzlos. Nur die Stadt rauschte, mahnend, befehlshaberisch fast, wie ein Wasser, das steigt und immer näher kommt.
Da erwachte Andreas und hatte im Schlafe geweint. Er richtete sich halb im Bette auf und schmeckte salzig die Tränen. Er wollte nach seinem Rosenkranz greifen, er dachte, dass er neben ihm auf dem Nachttisch liegen müsste. Aber er fand ihn nicht. Er faltete nur die Hände und legte sich, ohne die kühlen Perlen gefühlt zu haben, in die Kissen zurück.
2
Erst spät am Morgen wachte er auf. Er hob den Kopf, er stützte ihn in die Hand und blickte um sich. Das war sein Zimmer, hier war er aufgewachsen. War er hier nicht zu Haus? – Das waren doch Möbel, waren doch Wände, welche er kannte, seit Jahren schon. Er blickte, den Kopf aufgestützt, im Zimmer umher und sah es sich an – so wie man sich etwas, was man lange Zeit gesehen hat, aber niemals verstanden, plötzlich, mit einem Male genau und beinahe erschreckt besieht. So war es um ihn – so deutlich, so wunderlich fremd und vertraut.
Da aber lag er, lag inmitten allen dieses, lag zu Hause und sann. Da waren Bücher, welche er liebte – waren zu kleinen Stößen gestapelt, standen in langen Reihen. Nordische Bücher und französische Bücher und deutsche Bücher. Alle Form gewordenes Leid, Melodie gewordene Sehnsucht, Rhythmus gewordene Lebensbewegung, Klang gewordene Lebenstrauer. – Und Bilder standen da, auch Photographien und Reproduktionen von den großen Gemälden Frank Bischofs, der der Freund seines Vaters war. Sie blickten so streng und heiter aus ihren dunklen Hintergründen. – Und da drüben, da vor dem Schranke lagen die eigenen Skizzen, in wirren Haufen und ganz durcheinander geworfen. Er mochte nicht hinsehen, er wandte den Kopf ab. Tanzende Leiber und spitzige Landschaften und widerliche Karikaturen – ein zum Krassen, Grotesken gesteigerter Naturalismus neben einer gläsernen, scheuen Romantik. Lauter Dokumente, Bleibsel, Gestaltungsversuche seiner unsicheren, immer tastenden, immer sehnsüchtig experimentierenden Jugend – rührend und peinlich für den, der sie selber gebildet hatte schon ganz kurze Zeit nach ihrer Entstehung. Aber diesem Bündel von Zeichnungen und Anfängen ganz nahe, stand schlicht und gerahmt die Photographie einer spätgotischen Madonna, halb abgewandt im heilig-künstlichen Faltenwurf ihrer Gewänder und gleichsam als sei ihr dies alles zu Füßen gelegt. Die Geste aber, mit der sie den Mantel raffte, der Ausdruck, mit dem sie den gebenedeiten Kopf beiseite wandte, war nicht der des Empfangens, sondern der des Ablehnens beinahe.
Da fiel Andreas sein Traum wieder ein. Wie ein Schmerz oder wie eine Krankheit stieg Nachdenklichkeit in ihm auf. Er legte den Kopf wieder zurück und schloss die Augen. – Sie hatte das Opfer nicht annehmen mögen, in lieblicher Ungnädigkeit hatte sie es zurückgewiesen, was er sich ihr darzubringen sehnte. Die anderen alle, die hatten ihr gedient, die, deren Bücher und Bilder da standen, hatten ihr gedient, jeder auf seine Art. Der eine weltlich, der andere geistlich, der eine in Hohn und Qual, der andere in Demut und Stille. Jeder hatte ihr sein Lied zu Füßen gelegt – sein Lebenslied. Er aber hatte noch keines. Überall waren Ansätze dazu, überall Bemühungen, überall Auftakte. Aber er hatte die Melodie noch nicht gefunden – er und seine Generation.
Aufgereckt plötzlich im Bette, emporgerichtet, wie einer der eine Vision hat, und die Brauen verzerrt im Nachdenken, sah er es vor sich, wie es um ihn stand. Mit einer beinahe erschreckend plötzlichen Eindringlichkeit und zusammenfassenden Deutlichkeit überschaute er seine Situation. So stand es – so war es um ihn bestellt. Wie in einer gewaltigen und heftigen Vereinfachung wurde ihm alles klar.
Die Generation der Väter, die hatte also ihr Teil getan und würde es weiterhin tun und weiter vollenden. In Würdigkeit und Haltung oder in Qual und Not war sie groß geworden – aber sie war groß geworden, war sie selbst geworden, hatte ihren Ausdruck gefunden. – Und dann kam der grässliche Schlussstrich, der blutige Brand, das flammende Abreißen, dann kam der Krieg und die große, verzehrende Unruhe. In diesen Krieg hineingeboren war er – er, Andreas Magnus, der Einzelfall, der ihm in seiner einmaligen Verwirrung vor Augen stand, obwohl er zuinnerst begriff, dass diese Verwirrung die einer Generation sein musste, die eines ganzen Geschlechtes, nicht die eines einzelnen, einen. Seine dumpfe, träumevolle Kindheit war also in die Aufbruchtage von 1914 gefallen, deren Größe, deren gewaltiges Pathos er aber noch nicht hatte verstehen können, sondern die eben nur als irgendeine große Erhebung, als ein klirrender dröhnender Lärm, als eine unerklärliche Stunde, nach der alles anders werden musste wie vorher, seiner Seele sich eingeprägt und diese umgebildet hatten – und den Hintergrund, die Umgebung für die Jahre seines ersten Erwachens, seines ersten Sehens – Lernens – für die Jahre also zwischen elf und dreizehn – war der andere zweifelhaftere, noch gefährlichere Aufbruch gewesen, jene verzweifelte Unruhe, die wohl ein Altes, Mürbes zerstören konnte, aber nicht fähig war, aus ihrer Zerrissenheit ein Neues zu gebären – der Aufbruch also von 1918.
Die Generation vor ihm – das hatte er damals wohl schon gefühlt – das Geschlecht, das vom Tage des Kriegsbeginnes etwa vierzigjährig angetroffen wurde, es erfuhr wohl auch Erregung und ungewohnte Verwirrung durch diese Katastrophe. Die große Unruhe warf sich auch über sie, und mancher, der sich schon fertig und reif geglaubt hatte, musste in Nöten umlernen, nach innen und außen. Aber diese mussten doch eben nur umlernen, aus etwas, was sie schon waren, sich, soweit es noch anging, hinüberverwandeln zu etwas anderem, was die Zeit forderte in ihrer hohen Unerbittlichkeit. – Wie viel schlimmer jedoch, ja, wie viel verzweifelter stand es für die, die aus dem Chaos heraus überhaupt erst irgend etwas zu werden hatten, die ihren Ton erst finden mussten aus diesem entzügelten Gerausch von Tönen, ihren Weg suchen, vorbei an allen Extremen, zwischen die sie gestellt waren.
Ganz starr saß Andreas im Bett, minutenlang. Noch niemals hatte er so deutlich – so überdeutlich dies alles gewusst: Dass er noch ohne Weg war, dass er noch ohne Melodie war – und an wie vielen Ecken waren ihm Wegweiser aufgestellt und verlockten, die Richtung zu wählen, nach der ihr seligmachendes Dogma wies.
Sein Vater aber saß drunten im Arbeitszimmer, sein guter Vater. Er war kein bevorzugter Mann, ein redlicher, kluger Bürger, Arzt gewesen vor Jahren, aber ziemlich vermögend und schon lange im Ruhestand. Der wusste doch, was er wollte. Auch ihn hatte die Erregung einstmals betroffen, aber er hatte sich aus ihr gefunden und war, verwandelt ein wenig, weitergegangen die Bahn, die ihm angemessen erschien. Seine wissenschaftliche Arbeit gedieh, gedieh stattlich sogar, wie es schien. Und seine Freundschaft mit dem großen Maler Frank Bischof gab seinem Leben höheren Inhalt, machte sicher sein vornehmstes Gut aus. Vielleicht war »Freundschaft« ja ein zu schwerwiegendes Wort für dieses Verhältnis. Der Vater und Frank Bischof kannten sich schon von Jugend an. Und öfter schenkte dieser ihm die Ehre seines Besuches.
Aber der Sohn musste, nach bitterlich traurigen Träumen, bei seinem Erwachen sich plötzlich aufrecken und, wie im Entsetzen, die Brauen verzerren, als hätte er ein schlimmes Gesicht – nur weil in erschreckender Überdeutlichkeit sich seine Lage ihm zeigte. – So war seine Jugend gewesen, die Jugend, die im Lärm des Aufstandes begann: vielfarbig und ungeordnet, befleckt und unrein, unschuldig doch, weil sie sich dauernd nach Reine, nach Klarheit und Licht sehnte. Umschwenkend von einer Orientierung zur anderen oder allen auf einmal in Wirrnis hingegeben – amüsant und peinigend zugleich. – So war sie gewesen: Weglos und in ihrer hilflosen Sucht nach Richtung kindisch – verderbt abenteuerlich auf allen Gassen. Ausschweifend in Lustigkeit und in Pein. Der revolutionären Geste hatte man sich skeptisch enthalten, der Abgrund war ja an sich schon tief genug gezogen zwischen dem vorigen, man verzichtete lieber auf die schöne umstürzlerische Allüre oder man gebrauchte sie nur selten, wie als Maske und letzte Zuflucht. Eher war man schon froh, wenn sich irgendwo ein Halt einem bot, eine Richtlinie, an die man sich klammern konnte. Oft allerdings war man scherzhaft gewesen, sonderbar witzig gestimmt, als sei vorher nie das Geringste auf Erden geschehen, als werde nachher vermutlich auch nichts recht Wesentliches mehr vorkommen – scherzhaft auf eine radikale maßlose Art, die gleichsam jeglichen Ernst verleugnete, das Würdigste noch verzerrte, mit dem Sachlichsten Fangball spielte. – Aber öfter noch hatte man sich einer Trauer hingegeben, einer schweren Hoffnungslosigkeit, gegen die es kein Sich-Wehren mehr gab, und die nichts mehr meinte, nichts mehr empfand, als dass alles vorüber sei und dass jetzt nichts etwas nützen könne und dass das Ende nun da sei und diese ganze fragwürdige Nach-Kriegs-Generation nur geboren, nur von Gott erdacht um den klaffenden Schlund dieses Untergangs zu umrahmen – ein nutzloser Zierrat des großen Ruins, ein nicht mehr zum Leben bestimmtes Geschlecht.
Er trug keine Schuld und sein Vater trug keine Schuld. Schuld gab es nicht. Aber so war alles gewesen. – Sein Vater hatte wohl helfen wollen und hatte gesagt: »Siehst du, mein Sohn, das haben wir alle mal mitgemacht – das ist die Pubertät – das sind die Nöte der Jugend …« Und dann hatte der Sohn den Blick wohl gesenkt und nichts geantwortet und nichts gesagt, dass das etwas anderes sei, nicht die psychisch-physische Krisis der Übergangsjahre, sondern eine Gefährdung, eine Entgleisung tieferer, einschneidenderer schicksalshafterer Art. – Er hatte neben diesem Vater gelebt und hatte ihm nichts gesagt. Seine liebe Mutter war tot. Sorgenvoll und in Güte sah ihr Bildnis prüfend, mahnend, beobachtend von allen Kommoden. »Die Eltern sind gut«, dachte Andreas plötzlich, »Sie sind so gut zu uns gewesen. – Aber sie können nicht helfen. Sie schauen sorgenvoll, wie auf Bildern, aber ihr Blick kommt niemals ganz bis zu uns.«
Er legte sich in die Kissen zurück. Seine Hände strichen immerfort über die Kissen – als wollten sie etwas glatt streichen. Aber er dachte bei dieser Bewegung nur: Und nun hat die Mutter Gottes die Kette nicht angenommen – das kleine Opfer nicht angenommen – mich nicht würdig befunden, nach allem, was ich gelitten. – Oder hatte er das Eigentliche noch gar nicht erlitten? Stand das Eigentliche ihm noch bevor? – Und das Bild, um das er sich jetzt bemühte, seit Wochen schon? War auch das noch nichts – Eigentliches? Das große Bild, von dem er so sehr, so ungemein gehofft hatte, es möge endlich Gestaltung, Formwerdung, Gebetwerdung all dieser letzten Jahre sein? Würde sie denn auch dieses Opfer mit der unnahbaren, unabänderlichen Zierlichkeit ihrer abwehrenden Geste zurückweisen?
Er schloss die Augen, mit aller Innigkeit beschwor er das Bild vor sich, ließ seine hellen, wie gläsernen Farben, seine leidenschaftlichen, verzogenen Konturen vor sich aufsteigen. Da stand es im Nebenzimmer, halb fertig auf seiner Holztafel: Der liebe Gott um den die Kinder tanzten. Wie hellrot das Mäuerlein war, vor dem ihre Gruppe sich abhob. Und wie hinter dem Mäuerlein golden und blau, schimmernd und übergossen vom heiligen Abendlicht in kuriosen Zacken das Gebirge sich hinzog. Das Mäuerlein war wie mit Blut bespritzt, mit hellrotem Kinderblut. – Seltsam behindert allerdings war die Bewegung der Kinder, ihr Tanz war steif und verkrampft, als tanzten sie gleichsam in Schmerzen. Marie Therèse tanzte leichter. – Seine Kinder hatten ein ernstes Gesicht über den grellen Kitteln, ernst und verzückt. Diese Gesichter atmeten nicht, beinahe lebten sie nicht. Sie waren wie fromme und doch witzige Masken, bunt bemalte Masken aus Glas. – Das Antlitz Gottes selbst war noch nicht ganz aus dem Dunklen erstanden, da galt es nun noch zu arbeiten, die nächste Zeit. Aber schon begann es Form und Blick zu gewinnen, aus all dem Nebel heraus, das große Antlitz des alten Mannes mit grauschwarzem Bart, mit unnatürlich erweiterten, starren, leeren und doch ganz mit Wissen angefüllten Augen. So sollte es werden, so musste Gottes Antlitz wohl sein: Starr und leer und doch ganz voll Wissen, so wie ein Brunnen voll Dunkelheit ist. Grausam und unberührbar umrauscht vom schwarzen Bart, zwischen dessen Gestrüpp der Mund blutete, aber doch Wissen um alle Qual in den Nachtaugen – und Mitwissen ist ja schon Mitleid und Gnade.
Der junge Maler Andreas lächelte wie in geheimer Freude in seinem Bett. So sollte das Bild werden: Vorm blutbespritzten Mäuerlein tanzten verzückt und ungelenk die Kinder. In der Mitte erwuchs aus dem Dunkel Gottes Gesicht: starr, leer und doch gnädig. Und weit hinten waren die Berge vom blauen Gold begossen. Das sollte sein Gebild und das »Eigentliche« sein.
Dann dachte er, dass er aufstehen müsse, er habe reichlich genug gelegen, und im raschen Entschluss sprang er schon aus dem Bett. – Gleich aber, nachdem er das Bett nun verlassen, ging er, ernüchtert plötzlich durch die Kälte des Tags, barfuß und mit verwirrtem Haare durchs Zimmer. Er hatte den Spiegel als Ziel ins Auge gefasst. Ein weiter Weg. – Barfuß ging er über den roten Fußboden hin, als wäre er heißer Sand. Sonderbar hob er die nackten Füße, wie ein mühselig Wandernder. Barfuß stand er vom Glas. Lange sah er sich an – todernst am Anfang. Er zog die Brauen zusammen, unter ernsten Vorwürfen verhandelte er gleichsam mit dem schlaftrunkenen Pilger da vor ihm im weißen Gewand. »Ja, ja«, sagte er streng und drohte dem demütig Lauschenden gleichsam mit dem Finger, »heut nacht hast du’s schon erfahren, wie weit du’s gebracht hast mit all deiner Verwirrung. Jetzt willst du ja einen verwunschenen Gott malen, ließ ich mir sagen, und Kindermasken, die tanzen. Nun, wollen mal zusehen …«
Aber plötzlich stieg ein Lächeln in ihm auf – und er wusste es nicht, woher. Es ergriff ganz Besitz von ihm, legte sich um ihn. »Das also bin ich …« dachte er lächelnd. »So jung, so vierzehnjährig jung. So wirr das Haar, so kurz das Hemd, so nackt die Füße.« – War die Kindheit unruhig und befleckt gewesen? – Ach, aber er fand sich ja heute so rein im Glas. Galt es noch viel zu bestehen? Und war auch dieses also das »Eigentliche« noch nicht, das da angefangen im Nebenraum stand? Stand ihm noch alles bevor? – So würde sich’s schon noch wenden.
Und, lachend plötzlich im Übermut, streifte er sich das Hemd ab und reckte sich nackt. Er schlang sich das Badetuch um, lachend in Eitelkeit, dekorativ als sei es ein seiden Gewand. So sah er wie ein griechischer Gymnasionknabe drin aus – und wenn er es so schlang, fast wie ein junger Mönch.
Lachend rannte er den Korridor hinunter, hinüber zum Badezimmer. »So jung«, dachte er immerfort im Laufen, »so jung also.«
3
Es war ziemlich spät geworden, als er zum Frühstück hinunterkam – etwas nach elf Uhr. Marie Therèse war schon von der Schule zurück – ja, von neun bis elf hatte sie Unterricht. Sie lief ihm gleich zwitschernd und plaudernd bis zum Fuße der Treppe entgegen, und er musste sie bis ins Esszimmer tragen. Ihr Freund Peter sei da, berichtete sie geschwind – und das Wort »Freund« war rührend und viel zu groß für ihre helle, kleine Stimme. Wie klein sie überhaupt war, wie überraschend, ja märchenhaft klein auf Andreas Arm. Ihr Gesichtchen, um das fein, wie gesponnene Seide, ganz glatt das hellbraune Haar hing, war nah an dem seinen, und sie hatte ihm auch die Arme um den Hals geschlungen, damit sie nicht hinunterfallen könne. Und ihr Gesichtchen war süß und witzig. Ihr Mund war ein bisschen zu groß und außerdem war er zahnlückig – fast alle Zähne waren ihr ausgefallen, das gab ihr ein so rührendes und zugleich scherzhaftes Ansehen. Aber die bräunlich schimmernden Augen redeten, während der Mund von allerlei Abenteuern auf dem Schulweg erzählte, ihre so kluge und unschuldige Sprache.
Im Esszimmer saß auch schon Peterchen und stand artig auf, um den großen Bruder seiner Freundin zu begrüßen. »Guten Tag«, sagte er und dienerte, und er reichte ihm seine kleine, etwas feuchte Hand. Er hatte einen gestreiften Matrosenanzug an und sein Haar, das er wie Marie Therèse geschnitten trug, war immer ein bisschen verwirrt und verklebt. Klein war er auch, kaum größer als seine Dame – auch er hatte nicht viele Zähne: ein kleiner, zahnloser Kavalier. Aber ein Kavalier eben doch, keck, artig und mit hellen Augen. »Guten Tag«, sagte er und dienerte. – Marie Therèse stand schelmisch in ihrem Schürzchen beiseite.
Andreas trank Tee, während die Kinder in beiden Händen viel zu große Butterbrote hatten, in die es Mühe machte hineinzubeißen. Dazwischen sprachen sie, den Mund noch voll, von Fräulein Amtmann, ihrer Lehrerin, und dass sie ihnen Malzbonbons geschenkt hätte, wozu Andreas versonnen nickte. Und ob er’s auch nicht vergessen habe, fragte Marie Therèse und blinzelte schelmisch, dass ihr Herr Papa heute Geburtstag feiere – den einundfünfzigsten. – Da blickte Andreas auf. Doch – ja – das hatte er wirklich vergessen.
Sie nahmen rasch Abschied und liefen, über die Terrasse, in den Garten hinunter. Sie waren ein kleines Paar auf der Wiese – ein kleines, süßes, laufendes Paar. Marie Therèse wandte noch einmal den Kopf und lachte zu ihrem Bruder zurück, der allein am Tisch aß und ihnen nachsah. Sie wandte, schon weit draußen im Grün, ihr Gesichtchen nach ihm, aus dem schimmernd die Augen sprachen. »Willst du nicht kommen?« rief ihr hohes, feines, verlockendes Stimmchen. – Aber der Bruder schüttelte nur den Kopf.
Er stand langsam auf. Jetzt musste er arbeiten.
Auf der Diele begegnete er seinem Vater. Er kam im Kamelhaarschlafrock aus seinem Arbeitszimmer, wo er bis um diese Stunde ein wenig zu schreiben pflegte, ein paar Zeilen jeden Tag am spezial-wissenschaftlichen Werk, das langsam – langsam fortschritt, es näherte sich schon seinem Ende. Oben zog er sich um und auch ein älterer Friseurgehilfe erwartete ihn, der ihn täglich rasierte. Dann ging er spazieren.