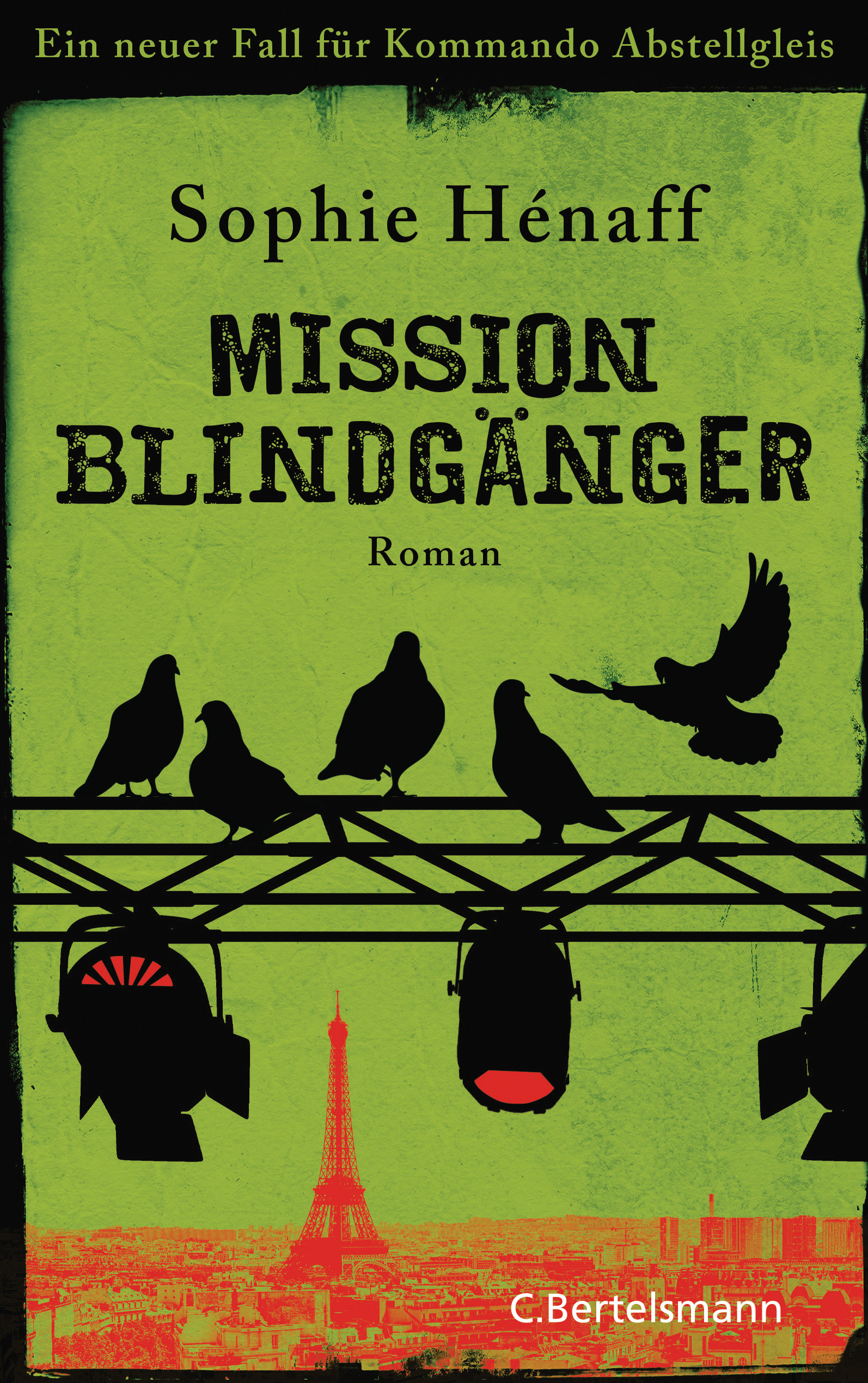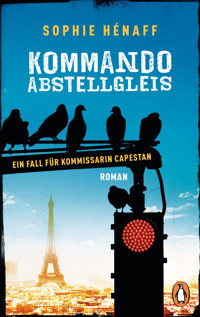
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommando Abstellgleis ermittelt
- Sprache: Deutsch
Im Pariser Hauptkommissariat wird aufgeräumt. Das ist der Startschuss für eine neue Brigade, in der alle Faulenzer, Schläger und Alkoholiker unschädlich gemacht werden sollen. Die Leitung erhält Anne Capestan, einst hoffnungsvolle Polizistin, die wegen eines fatalen Fehlers vom Dienst suspendiert wurde. Doch Capestan denkt gar nicht daran, sich aufs Abstellgleis schieben zu lassen! In einem schäbigen Büro macht sie sich mit ihrer Loser-Truppe an die Aufklärung alter Fälle, die die Abgründe in der neuen Chefetage zutage bringen ...
„Das ist ein Krimi, der so richtig Spaß macht!“ Wiener Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Pariser Hauptkommissariat, 36 quai des Orfèfres hat eine neue Leitung. Ihr Ziel heißt: die Aufklärungsraten und Statistiken polieren und alle problematischen Mitarbeiter loswerden.
Deshalb ruft die Führungsriege eine neue Brigade ins Leben, in der alle Alkoholiker, Faulenzer, Schläger, Depressive und Polizisten, die sich für etwas anderes berufen fühlen - wie z.B. Eva Rozière, die Krimis schreibt, anstatt zu ermitteln –, zusammengefasst werden sollen. Die Leitung übergibt sie Anne Capestan, einer einst hoffnungsvollen jungen Polizistin, die wegen eines fatalen Fehlers vom Dienst suspendiert wurde. Was man von ihr erwartet: stillhalten. Anne hasst aber nichts mehr, als einfach zu gehorchen. Deshalb lässt sie nichts unversucht und baut mit ihrer Truppe der verkrachten Existenzen in einem schäbigen Büro ein Kommissariat der unkonventionellen Methoden auf und löst - zum Schrecken der neuen Chefs – auch noch alte Fälle, die die neue Führungsriege in gar keinem schönen Licht erscheinen lassen …
Ein origineller, schwungvoller, intelligenter Krimi – zum Schießen komisch!
Sophie Hénaff
KOMMANDO
Abstellgleis
Ein Fall für Kommissarin Capestan
Aus dem Französischen von Katrin Segerer
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Poulets Grillés bei Éditions Albin Michel, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2015 by Éditions Albin Michel, Paris
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 bei carl’s books, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: bürosüd nach einem Entwurf von Semper Smile Covermotive: Arcangel Images/Ayal Ardon; plainpicture/Fogstock/Francois Jacquemin
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18062-1V004
www.penguin.de
Für meine kleine Meuteund für meine Eltern
1.
Paris, 9. August 2012
Anne Capestan stand vor ihrem Küchenfenster und wartete darauf, dass der Tag anbrach. Mit einem Schluck leerte sie ihre Tasse und stellte sie auf das grüne Wachstuch mit Vichy-Muster. Wahrscheinlich hatte sie gerade ihren letzten Kaffee als Polizistin getrunken.
Commissaire Capestan, der schillernde Star ihrer Generation, die kometenhafte Aufsteigerin, hatte eine Kugel zu viel abgefeuert. Sie war vor dem Disziplinarausschuss gelandet, wo man ihr diverse Verwarnungen und sechs Monate Suspendierung aufgebrummt hatte. Danach Funkstille, bis zu Burons Anruf. Ihr Mentor, mittlerweile Leiter am Quai des Orfèvres 36, war endlich aus der Deckung gekommen und hatte sie einbestellt. Für den 9. August. Das sah ihm ähnlich. Ein subtiler Wink, dass sie nicht im Urlaub, sondern ohne Beschäftigung war. Nach dieser Unterredung wäre sie entweder arbeitslos oder wieder Polizistin, in Paris oder der Provinz, aber wenigstens würde sie es dann wissen. Alles war besser als dieses ewige In-der-Luft-Hängen, dieser Schwebezustand, der jedes Vorankommen verhinderte. Anne Capestan ließ Wasser in ihre Tasse laufen und nahm sich fest vor, sie später in die Spülmaschine zu stellen. Es wurde Zeit.
Sie durchquerte das Wohnzimmer, das, wie so oft, von Brassens und seinen poetisch-beschwingten Melodien beschallt wurde. Die Wohnung war groß und gemütlich. Capestan hatte weder an Tagesdecken noch an indirekter Beleuchtung gespart. Der zufrieden vor sich hin schnarchenden Katze schien ihr Stil zu gefallen. Doch die Behaglichkeit wurde von Spuren der Leere durchbrochen, wie eine Frühlingswiese mit Eisflecken. Am Tag nach ihrer Suspendierung hatte ihr Mann sie verlassen und die Hälfte der Möbel mitgenommen. Das war einer dieser Momente gewesen, in denen das Leben einem rechts und links eine schallende Ohrfeige verpasst. Anne Capestan versank jedoch nicht in Selbstmitleid: Das alles geschah ihr recht.
Staubsauger, Fernseher, Couch, Bett, keine drei Tage später hatte sie das Wichtigste ersetzt. Doch die Abdrücke auf dem Teppich ließen die alten Sessel nicht in Vergessenheit geraten. Helle Stellen auf der Tapete zeugten von früher: hier der Schatten eines Bildes, der Geist eines Bücherregals, eine schmerzlich vermisste Kommode. Anne Capestan wäre am liebsten umgezogen, aber durch ihr berufliches Zwischen-den-Stühlen saß sie fest. Nach dem Termin würde sie endlich wissen, in welches Leben sie sich von jetzt an stürzen konnte.
Capestan zog das Haargummi von ihrem Handgelenk und band sich einen Zopf. Wie in jedem Sommer war ihre Mähne heller geworden. Bald würde sich wieder ein dunkleres Braun durchsetzen. Sie strich mechanisch ihr Kleid glatt und schlüpfte in ihre Sandalen. Die Katze auf der Armlehne der Couch hob nicht einmal den Kopf. Nur die flauschigen Ohrmuscheln drehten sich in Richtung Tür und verfolgten ihren Aufbruch. Sie schob sich den Griff ihrer großen ledernen Handtasche auf die Schulter und steckte Fegefeuer der Eitelkeiten ein, den Roman von Tom Wolfe, den Buron ihr ausgeliehen hatte. Neunhundertachtundzwanzig Seiten. »Damit sind Sie beschäftigt, bis ich Sie anrufe«, hatte er ihr versichert. Bis ich Sie anrufe. Die Zeit hatte noch locker für die dreizehn Bände von Merles Fortune de France und das Gesamtwerk von Marie-Ange Guillaume gereicht, die unzähligen Krimis nicht mitgerechnet. Buron und seine Floskeln ohne feste Daten oder Versprechen. Sie schloss die Tür hinter sich, drehte den Schlüssel zweimal um und nahm die Treppe.
Die Rue de la Verrerie lag verwaist in der noch milden Sonne. Zu dieser frühen Stunde schien Paris in einen Naturzustand versetzt: Die Stadt war befreit von ihren Bewohnern, wie die einzige Überlebende einer Neutronenbombe. In der Ferne zuckte das orangefarbene Licht eines Reinigungsfahrzeugs. Anne Capestan lief an den Schaufenstern des BHV-Kaufhauses vorbei und überquerte die Place de l’Hôtel-de-Ville, danach die Seine und die Île de la Cité, bevor sie den Quai des Orfèvres erreichte.
Sie trat durch das gewaltige Eingangstor in den gepflasterten Hof und bog dann nach rechts. Vor dem verblichenen blauen Schild »Aufgang A, Direktion der Kriminalpolizei« hielt sie kurz inne. Zusammen mit seinem neuen Posten hatte Buron ein Büro im dritten Stock besetzt, auf der gediegenen Etage der Entscheidungsträger, in der selbst die Cowboys nicht mehr mit ihrer Knarre herumspazierten.
Sie schob die zweiflügelige Tür auf. Beim Gedanken an eine Entlassung zog sich ihr Magen zusammen. Anne Capestan war schon immer Polizistin gewesen und weigerte sich strikt, andere Optionen in Betracht zu ziehen. Mit siebenunddreißig drückt man nicht noch mal die Schulbank. Diese sechs Monate Untätigkeit hatten ihr schon schwer zu schaffen gemacht. Sie war viel spazieren gegangen. Sie hatte die Strecken aller Metrolinien abgelaufen, methodisch von der 1 bis zur 14, von Endhaltestelle zu Endhaltestelle. Sie hoffte, wieder im Dienst zu sein, bevor sie die Vorortbahnen in Angriff nehmen musste. Manchmal sah sie sich sogar die TGV-Gleise entlangmarschieren, bloß um eine Aufgabe, ein Ziel zu haben.
Vor dem funkelnagelneuen Kupferschild mit dem Namen des Regionaldirektors blieb sie stehen, straffte die Schultern und klopfte dreimal. Burons tiefe, klangvolle Stimme bat sie hinein.
2.
Buron war aufgestanden, um sie zu begrüßen. Haar und Bart waren grau, im Militärschnitt, und rahmten das Gesicht eines Bassets ein, der die Welt um sich herum mit einem stets freundlichen, aber traurigen Blick bedachte. Er war noch einen guten Kopf größer als Capestan, die selbst schon groß war. Und einen guten Bauch dicker. Trotz seiner gutmütigen Erscheinung strahlte Buron eine Autorität aus, mit der sich niemand anlegte. Anne Capestan reichte ihm das Buch von Tom Wolfe. Sie hatte einen Knick in den Einband gemacht, und eine verärgerte Falte erschien auf der Stirn des Directeur. Sofort entschuldigte sie sich, obwohl sie nicht verstand, wie man so viel Wert auf Gegenstände legen konnte. Er antwortete, nicht doch, das sei überhaupt nicht schlimm, meinte aber kein Wort davon ernst.
Auf den breiten Sesseln hinter Buron erkannte sie Fomenko, den früheren Leiter der Drogenfahndung, der mittlerweile stellvertretender Regionaldirektor war, und Valincourt, der vom Direktor der Kriminalbrigade zum Direktor aller Zentralbrigaden aufgestiegen war. Sie fragte sich, was diese hohen Tiere hier wollten. Mit Blick auf ihre letzten Diensthandlungen war eine Beförderung mehr als unwahrscheinlich. Mit einem liebenswürdigen Lächeln ließ sie sich dem Triumvirat gegenüber nieder und wartete auf das Urteil.
»Gute Neuigkeiten«, fing Buron an. »Die Untersuchung der Dienstaufsicht ist abgeschlossen. Ihre Freistellung ist vorbei, Sie werden wiedereingegliedert. Der Vorfall kommt nicht in Ihre Akte.«
Eine gewaltige Last fiel von ihr ab. Freude durchströmte ihre Adern und drängte sie, rauszugehen und zu feiern. Trotzdem zwang sie sich, konzentriert zu bleiben.
»Ihre neue Verwendung beginnt im September. Ihnen wird die Leitung einer Brigade anvertraut.«
Jetzt wurde sie misstrauisch. Dass man sie wiedereingliederte, kam unerwartet, dass man sie beförderte, war verdächtig. Burons Rede klang wie das Knöchelknacken vor einer Ohrfeige.
»Mir? Eine Brigade?«
»Es handelt sich um ein besonderes Programm«, erklärte Buron und schaute durch sie hindurch. »Im Zuge einer Umstrukturierung der Polizei zur Optimierung der Arbeitsleistung ist eine zusätzliche Brigade geschaffen worden. Sie ist mir direkt unterstellt und umfasst nur die unorthodoxesten Beamten.«
Während Buron seine Ansprache herunterbetete, langweilten sich seine Komplizen zu Tode. Fomenko studierte desinteressiert die Sammlung alter Orden in Burons Vitrine. Dann und wann strich er sich durch das weiße Haar, rückte seine Anzugweste zurecht oder betrachtete die Sohle seiner Cowboystiefel. Die kräftigen behaarten Unterarme, die aus den hochgekrempelten Hemdsärmeln ragten, erinnerten daran, dass er einem mit einem Schlag die Kauleiste brechen konnte. Valincourt, ein hagerer Typ mit kantigen Zügen und dunkler Haut, fummelte an seiner silbernen Uhr herum, als würde er am liebsten die Zeit vordrehen. Hinter seinem Häuptlingsprofil schien eine tausendfach wiedergeborene Seele zu wohnen. Er lächelte nie, sondern trug ständig eine abweisende Miene zur Schau, als belästige man Seine Majestät. Sicherlich war all seine Aufmerksamkeit höheren Überlegungen, einem reineren Leben gewidmet. Gewöhnliche Sterbliche wagten nur selten, ihn zu stören. Anne Capestan beschloss, ihrer aller Leiden zu verkürzen.
»Soll heißen?«
Der lockere Ton missfiel Valincourt. Ruckartig fuhr seine spitze Hakennase herum, wie bei einem Raubvogel. Er warf Buron einen fragenden Blick zu. Es brauchte allerdings mehr, um den Directeur zu erschüttern. Buron ließ sich sogar zu einem Lächeln herab, als er sich in den Tiefen seines Sessels aufrichtete.
»Na schön, Capestan, dann noch mal zum Mitschreiben: Wir säubern die Behörde, um die Statistiken aufzupolieren. Wir stecken alle Alkoholiker, Schläger, Depressiven, Faulpelze und so weiter, alle, die unsere Abteilungen behindern, aber nicht gefeuert werden können, zusammen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Unter Ihrem Kommando. Ab September.«
Anne Capestan hütete sich davor, irgendeine Reaktion zu zeigen. Sie wandte ihr Gesicht zum Fenster und verfolgte das Spiel der blauen Spiegelungen auf der Scheibe. Dann richtete sie ihren Blick auf die winzigen schimmernden Wellen der Seine unter dem klaren Himmel, während ihr Gehirn arbeitete.
Eine Abstellkammer. Ganz einfach. Das war die Essenz von Burons Rede. Oder eher ein Abfalleimer. Ein sehr großes Modell. Eine Einheit der Verstoßenen, die Schandbullen des ganzen Departements vereint in einem Müllcontainer. Und sie war das Sahnehäubchen auf dem Müllhaufen.
»Warum ich?«
»Sie haben als Einzige den Dienstgrad eines Commissaire«, erwiderte Buron. »Im Normalfall kündigen sich die Pathologien anscheinend schon vor dem Auswahlverfahren an.«
Sie hätte wetten können, dass diese ganze Sache auf seinem Mist gewachsen war. Weder Valincourt noch Fomenko wirkten, als würden sie das Programm gutheißen, der eine aus Verachtung, der andere aus Desinteresse. Beide hatten Wichtigeres zu tun, diese Geschichte hielt sie bloß auf.
»Wen kriege ich?«, fragte Capestan.
Buron bückte sich, um die unterste Schublade seines Schreibtisches zu öffnen. Er zog eine dicke Mappe heraus und warf sie auf die Schreibtischunterlage aus flaschengrünem Maroquin. Die Mappe war unbeschriftet. Eine Brigade ohne Namen. Der Directeur suchte von den verschiedenen Brillen, die unter seiner Schreibtischlampe aufgereiht waren, eine mit Horngestell aus. Seine Nasenquetscher wählte er je nachdem, ob er einen beruhigenden, modernen oder strengen Eindruck vermitteln wollte. Er schlug die Mappe auf und fing an zu lesen.
»Agent Santi, seit vier Jahren krankgeschrieben, Capitaine Merlot, Alkoholiker – «
»Alkoholiker? Dann dürfte es ziemlich voll bei uns werden …«
Buron klappte die Mappe zu und reichte sie ihr.
»Nehmen Sie sie mit, und gehen Sie sie in Ruhe durch.«
Capestan wog die Mappe in der Hand. Sie war so schwer wie das Pariser Telefonbuch.
»Wie viele sind wir nach Ihrer ›Säuberung‹? Das halbe Departement?«
Der Directeur lümmelte sich wieder in seinen Sessel, und unter seinem Gewicht knarzte das Leder herzzerreißend.
»Offiziell ungefähr vierzig.«
»Von wegen Brigade, das ist ja fast eine Hundertschaft«, bemerkte Fomenko spöttisch.
Vierzig. Polizisten, die Kugeln, stundenlange Observationen, zu viele Kilos und Scheidungen im Namen des Gesetzes auf sich genommen hatten, nur um jetzt auf dem Abstellgleis zu landen, dem Ort, an den man sie verfrachtete, damit sie endlich ihre Entlassung beantragten. Anne Capestan fühlte mit ihnen. Seltsamerweise zählte sie sich nicht dazu. Buron seufzte und setzte die Brille ab.
»Capestan, die meisten sind seit Jahren raus aus dem System. Sie werden sie nie zu Gesicht bekommen, geschweige denn zum Arbeiten bewegen. Das sind nichts weiter als Namen, die existieren für uns praktisch nicht mehr. Und falls doch mal ein paar aufkreuzen, dann bloß, um Kugelschreiber zu klauen. Machen Sie sich keine Illusionen.«
»Welche aus dem Gehobenen dabei?«
»Ja. Die Lieutenants Dax und Évrard und die Capitaines Merlot und Orsini.«
Buron machte eine Pause und betrachtete eingehend den Bügel seiner Brille, mit dem er herumspielte.
»José Torrez ist ebenfalls Lieutenant.«
José Torrez. Alias Schlemihl. Der Unglücksbringer, der schwarze Kater. Also hatten sie endlich einen Platz für ihn gefunden. Es hatte nicht gereicht, ihn zu isolieren, nein, man musste ihn noch weiter wegschieben. Capestan kannte Torrez vom Hörensagen. Jeder Bulle in ganz Frankreich kannte Torrez vom Hörensagen und bekreuzigte sich, wenn er vorbeiging.
Angefangen hatte alles mit einem einfachen Unfall: Sein Partner hatte bei einer Verhaftung einen Messerstich abgekriegt. Alltag. Während er sich erholte, war seine Vertretung ebenfalls verletzt worden. Berufsrisiko. Der Nächste hatte sich eine Kugel und drei Tage Koma eingefangen. Der Letzte war von einem Haus gestürzt und gestorben. Alle vier Mal war jeglicher Verdacht gegen José Torrez ausgeräumt worden. Er hatte sich in keinster Weise schuldig gemacht, nicht einmal der Fahrlässigkeit. Aber seitdem klebte sein Ruf wie Pech an ihm. Er brachte Unglück. Niemand wollte mehr mit ihm zusammenarbeiten, niemand wollte ihn berühren, und kaum einer schaute ihm noch in die Augen. Außer Anne Capestan, die sich nicht um irgendwelche Flüche scherte.
»Ich bin nicht abergläubisch.«
»Warten Sie ein paar Wochen«, verkündete Valincourt mit Grabesstimme.
Fomenko nickte und unterdrückte ein Schaudern. Der tätowierte Drache an seinem Hals – ein Andenken an seine Anfänge beim Militär – zitterte. Heute trug Fomenko einen breiten weißen Schnauzer, der sich fächerartig unter seiner Nase ausbreitete wie ein struppiger Schmetterling. Komischerweise passte er sogar ganz gut zum Drachen.
Wie immer, wenn Torrez’ Name gefallen war, senkte sich Schweigen über das Zimmer. Buron brach es als Erster.
»Und dann ist da noch Commandant Lebreton.«
Dieses Mal setzte Capestan sich auf.
»Der von der obersten Dienstaufsicht?«
»Genau der«, sagte Buron und hob schicksalsergeben die Hände. »Der hat es Ihnen nicht leicht gemacht, ich weiß.«
»Ja, der Kritiker der noblen Sache war nicht gerade entgegenkommend. Aber wie ist er bei dieser Truppe gelandet? Der IGS gehört nicht zur Kriminalpolizei.«
»Es hat eine Beschwerde gegeben, irgendwas wegen persönlicher Differenzen, auf jeden Fall eine interne Geschichte, IGS gegen IGS, dafür brauchen sie nicht einmal mehr uns.«
»Eine Beschwerde worüber?«
Dieser Lebreton war zwar ein unglaublicher Starrhals, aber er würde nie gegen eine Regel verstoßen. Buron legte den Kopf schief und zog in geheuchelter Unwissenheit die Schultern hoch. Die beiden anderen untersuchten eingehend die Zierleisten an der Decke und grinsten hämisch. Mehr würde Capestan nicht aus ihnen herausbekommen.
»Im Übrigen sind Sie nicht in der Position, den ersten Stein auf Querulanten zu werfen«, fügte Valincourt kühl hinzu.
Anne Capestan schluckte die Bemerkung, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie war nicht länger in der Position, auch nur den kleinsten Kiesel auf irgendjemanden zu werfen, und das wusste sie sehr gut. Ein Sonnenstrahl fiel durch das Fenster, begleitet vom entfernten Klang eines Presslufthammers. Eine neue Brigade. Ein neues Team. Blieb nur noch die Frage, was ihre Aufgabe sein würde.
»Gibt es auch Fälle, die wir bearbeiten sollen?«
»Mehr als genug.«
Allmählich fand Buron offenbar richtig Gefallen an der Sache. Das war sein kleiner Willkommensscherz, ein Spielchen zum Einstand. Im Grunde genommen ließ er sie noch einmal den Initiationsritus durchlaufen, nach fünfzehn Jahren Polizeidienst.
»Mit der Zustimmung der Präfektur, der örtlichen Direktion SRPJ und der Zentralbrigaden übernehmen Sie die ungeklärten Fälle aller Kommissariate und Brigaden des Dienstbezirks. Wir haben die Archive um alle festgefahrenen Untersuchungen, alle ad acta gelegten Fälle erleichtert. Die werden direkt zu Ihnen geschickt.«
Buron warf seinen Kollegen einen zufriedenen Blick zu, bevor er fortfuhr: »Grob gesagt liegt damit die Aufklärungsrate der Polizei der Île-de-France bei annähernd hundert Prozent und Ihre bei null. Eindämmung ist das Zauberwort. Eine einzige unfähige Brigade in der ganzen Region.«
»Verstehe.«
»Die Kartons aus den Archiven bekommen Sie im Laufe Ihres Einzugs«, sagte Fomenko und kratzte seinen Drachen. »Im September, wenn man Ihnen Ihre Räumlichkeiten zugewiesen hat. Der Quai des Orfèvres ist voll wie eine Familiengruft, Sie kriegen irgendwo anders ein schönes Plätzchen.«
Valincourt, der reglos wie immer dasaß, warnte: »Sollten Sie den Eindruck haben, glimpflich davonzukommen, täuschen Sie sich. Aber trösten Sie sich mit der Tatsache, dass keiner Resultate von Ihnen erwartet.«
Mit einer beredten Geste wies Buron ihr die Tür. Anne Capestan verließ das Büro. Trotz der letzten wenig ermutigenden Worte lächelte sie. Zumindest hatte sie jetzt ein Ziel, und ein Datum.
Valincourt und Fomenko tranken ein Bier auf der Terrasse des Café des Deux Palais. Fomenko nahm sich eine Handvoll Erdnüsse und schaufelte sie sich entschlossen in den Mund. Knackend zermalmte er sie, bevor er fragte: »Und, wie findest du Burons Schützling?«
Valincourt schob eine einzelne Erdnuss mit dem Zeigefinger am Rand seines Bierdeckels entlang.
»Ich weiß nicht. Hübsch, vermutlich.«
Fomenko lachte hell auf und strich über seinen Schnauzer.
»Ja, das ist nicht zu übersehen! Nein, professionell, meine ich. Ganz ehrlich, was hältst du von der Brigadensache?«
»Augenwischerei«, antwortete Valincourt, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern.
3.
Paris, 3. September 2012
Jeans, Ballerinas, dünner Pulli und Trenchcoat. Anne Capestan hatte ihre Uniform angelegt und umklammerte den Schlüsselbund für ihr neues Kommissariat. Zwanzig von vierzig Polizisten, das war ihr Ziel. Wenn auch nur jeder Zweite irgendeinen Sinn in dieser Brigade sah, lohnte es sich, dafür zu sorgen, dass sie funktionierte.
Ungeduldig und insgesamt eher optimistisch überquerte Capestan im Laufschritt den Platz, auf dem die Fontaine des Innocents gluckerte. Ein Verkäufer öffnete gerade den mit Graffiti besprühten Metallrollladen eines Geschäfts für Sportbekleidung. Der Geruch nach Frittierfett aus den Fast-Food-Restaurants waberte durch die noch frische Luft. Vor der Rue des Innocents Nummer 3 blieb Capestan stehen. Das war weder ein Kommissariat noch eine Wache. Das war ein ganz normales Wohnhaus. Und sie kannte den Zugangscode nicht. Seufzend betrat sie das Café nebenan, um den Wirt zu fragen. B8498. Sie baute sich die Eselsbrücke Brunnen-Vaucluse-Weltmeister.
Eine hastig hingekritzelte 5 auf dem zerknitterten Schlüsselanhängerschild verriet das Stockwerk. Anne Capestan holte den Aufzug und fuhr in die letzte Etage. Man hatte ihnen kein offizielles Erdgeschossbüro mit Schaufenster, Neonröhren und Laufkundschaft zugestanden. Man hatte sie ganz oben versteckt, ohne Schild oder Gegensprechanlage. Hinter der Etagentür fand sich eine in die Jahre gekommene, aber helle Wohnung, die, wenn schon nicht besonders repräsentativ, so doch wenigstens gemütlich war.
Die Umzugsfirma hatte gestern alles aufgebaut, nachdem die Elektriker und die Leute von der Telefongesellschaft da gewesen waren. Buron hatte ihr versichert, sie brauche sich keine Sorgen zu machen, man würde sich um alles kümmern.
Von der Eingangstür aus sah Anne Capestan einen Schreibtisch aus Zink, der mit Rostwunden bedeckt war. Direkt gegenüber neigte sich ein graugrüner Resopaltisch gefährlich zur Seite, trotz der Bierdeckel, die unter das abgebrochene Bein geschoben worden waren. Die übrigen beiden Schreibtische bestanden aus einer schwarzen Melaminplatte auf einem wackeligen Bock. Wenn man sich der Bullen entledigte, konnte man auch gleich die Möbel loswerden. Das Programm war wirklich gut durchdacht.
Das Parkett war mit Löchern unterschiedlicher Größe übersät, und die Wände waren fleckiger als eine Raucherlunge, aber das Zimmer war geräumig und hatte große Fenster, die auf den Platz hinausgingen und einen freien Blick bis zur Saint-Eustache-Kirche boten, über den Stadtpark, ehemals Jardin des Halles, und die Baukräne, die dort wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit stehen würden.
Als Capestan um einen kaputten Bürostuhl herumlief, bemerkte sie einen Kamin, der nicht zugemauert war und funktionstüchtig schien. Ein Pluspunkt. Sie wollte ihre Besichtigung gerade fortsetzen, da hörte sie, wie sich der Aufzug öffnete. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Punkt acht.
Ein Mann klopfte an die halb offene Tür, während er sich die Wanderschuhe auf der Fußmatte abtrat. Sein dichtes schwarzes Haar gehorchte einer ganz eigenen Ordnung, und trotz der frühen Uhrzeit überzogen grau melierte Bartstoppeln seine Wangen. Er kam herein und stellte sich vor: »Lieutenant Torrez, guten Morgen.«
José Torrez. Also kreuzte das Pech als Erstes auf. Er machte keine Anstalten, die Hand aus der Tasche seiner Lammfelljacke zu nehmen, und Capestan fragte sich, ob er Angst hatte, sie würde sie nicht schütteln, oder ob er einfach nur unhöflich war. Um das Problem zu umgehen, beschloss sie, ihm auch die ihre nicht hinzustrecken, sondern setzte ein Lächeln voll friedlicher Absicht auf, den Zahnschmelz zur Schau gestellt wie eine weiße Flagge.
»Guten Morgen, Lieutenant. Commissaire Anne Capestan, ich leite diese Brigade.«
»Ja. Hallo. Wo ist mein Büro?«, fragte Torrez, als wäre der Höflichkeit jetzt Genüge getan.
»Wo Sie möchten. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst …«
»Kann ich mich erst umschauen?«
»Nur zu.«
Sie beobachtete, wie er direkt auf die hinteren Zimmer zusteuerte.
José Torrez war ungefähr eins siebzig groß, pure Muskelmasse. Als schwarzer Kater fiel er eher in die Kategorie Puma, kräftig und kompakt. Bevor er hier gelandet war, hatte er bei der Gendarmerie im 2. Distrikt gearbeitet. Vielleicht kannte er ein paar gute Restaurants in der Gegend. Er öffnete die letzte Tür ganz am Ende des Flurs, nickte, drehte sich zu Capestan um und erhob die Stimme, um seine Absicht kundzutun: »Ich nehme das hier.«
Ohne Umschweife betrat er sein neues Büro und schloss die Tür hinter sich.
So viel dazu.
Sie waren schon zu zweit.
Eins der vielen Telefone, die genauso wenig zusammenpassten wie das Mobiliar, klingelte. Nach längerer Suche fand Anne Capestan ein graues Modell, das gleich neben dem Fenster auf dem Boden stand. Am anderen Ende der Leitung begrüßte sie Burons Stimme: »Guten Morgen, Capestan. Ich wollte nur Bescheid geben, dass Sie noch eine neue Rekrutin bekommen. Sie kennen sie, lassen Sie sich überraschen.«
Der Directeur wirkte sehr zufrieden mit sich. Wenigstens einer, der Spaß an der Sache hatte. Nachdem Capestan aufgelegt hatte, tauschte sie den grauen Apparat gegen eine Antiquität aus Bakelit, die sie auf den Zinkschreibtisch stellte. Einmal feucht abwischen, und er würde seinen Zweck erfüllen. Dann nahm sie sich eine große Lampe mit einem cremefarbenen Schirm und einem Fuß aus zerkratztem Kirschbaumholz, die neben einem Kopierer herumstand, und holte Feuchttücher und einen fünfzehn Zentimeter großen vergoldeten Eiffelturm aus ihrer Handtasche. Den hatte sie sich an ihrem ersten Tag in der Hauptstadt bei einem Souvenirhändler am Quai gekauft. Sie legte ihren großen roten Lederkalender und einen schwarzen Kugelschreiber daneben, und fertig war ihr Arbeitsplatz, schräg zwischen Fenster und Kamin. Mit vierzig Leuten würde es hier drin vielleicht ein bisschen eng werden, aber es würde schon passen.
Anne Capestan ging in die Küche, um sich ein Glas Wasser zu holen. Der Raum war großzügig geschnitten und mit einem wackeligen Kühlschrank, einem alten Gasherd, einer Spüle und einem Unterschrank aus Kiefernholz im Stil einer Ferienhauskochnische ausgestattet. Der Schrank war leer, es gab keine Gläser. Wahrscheinlich gab es nicht einmal Wasser. Eine Glastür führte auf die Dachterrasse. An einem Plastikspalier kletterte Efeu hinauf, der allmählich gelb wurde, und grub Risse in die Hauswand. In einer Ecke stand ein gewaltiger Terrakottatopf, der einen Haufen trockene Erde ohne Pflanzen beherbergte. Aber man sah den blauen Himmel, und Capestan hielt eine Weile inne und lauschte dem geschäftigen Paris weit unter sich.
Als sie in die Wohnung zurückkehrte, war Commandant Lebreton, ehemals IGS, eingetroffen und hatte sich bereits an einem der schwarzen Melaminschreibtische eingerichtet. Seine große Gestalt war über einen Aktenkarton gebeugt, den er mit dem Taschenmesser zu öffnen versuchte. Wie gewöhnlich ließ er sich nicht stören. Weder seine Gelassenheit noch seine Ansichten konnte irgendetwas erschüttern. Anne Capestan erinnerte sich noch lebhaft an seine unerbittlich strengen Vernehmungen. Wäre der Disziplinarausschuss seiner Empfehlung gefolgt, wäre sie nie rehabilitiert worden. Louis-Baptiste Lebreton hielt sie für schießwütig. Sie hielt ihn für starrköpfig. Dementsprechend überschwänglich verlief ihre Begrüßung. Er hob kaum den Kopf.
»Guten Morgen, Commissaire«, sagte er, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder der Schachtel zuwandte.
»Guten Morgen, Commandant«, antwortete Anne Capestan.
Dann fiel bleierne Stille über das Zimmer.
Sie waren zu dritt.
Capestan nahm sich ebenfalls einen Karton vor.
*
Hinter ihren Schutzschilden aus Pappe blätterten Anne Capestan und Louis-Baptiste Lebreton seit gut zwei Stunden Akten durch. Haufenweise Einbrüche, Trickbetrüger, aufgebrochene Geldautomaten und Autos: In diesen Schachteln waren keine Überraschungen versteckt, und allmählich begann Capestan, den Sinn ihrer Mission zu hinterfragen.
Eine laute, energische Stimme riss sie aus ihrer Lektüre. Sie erstarrten, die Stifte im Anschlag. Eine rundliche Frau um die fünfzig trat durch die Tür. Ihr strassbesetztes Handy bekam ein wahres Donnerwetter ab.
»Ach, leck mich doch, du Arsch!«, brüllte sie. »Ich schreibe, was ich will. Und soll ich dir erklären, warum? Weil ich mir von einem kleinen Pimmel mit Schlips nicht sagen lasse, wo ich hinpissen darf.«
Capestan und Lebreton starrten sie mit offenem Mund an.
Die Furie schenkte ihnen ein freundliches Lächeln und vollführte eine Vierteldrehung, bevor sie ausstieß: »Staatsanwalt oder nicht, das ist mir scheißegal. Ihr wollt mich loswerden? Bitte schön! Ich habe nichts mehr zu verlieren, und falls es euch interessiert, meiner Meinung nach ist das nicht eure beste Aktion. Wenn ich will, dass euer dämlicher Robenträger in der nächsten Folge Hämorriden kriegt, verpasse ich ihm Hämorriden. Er kann schon mal die Salbe rausholen!«
Mit einem wütenden Schnauben legte sie auf.
»Capitaine Eva Rosière, guten Morgen«, sagte sie.
»Commissaire Anne Capestan, freut mich«, erwiderte Anne Capestan und schüttelte ihr die Hand, die Augen immer noch weit aufgerissen.
Eva Rosière. Sie war sicher Burons Überraschung. Sie hatte jahrelang in der Chefetage des Quai des Orfèvres gearbeitet, bevor sie ihre Berufung als Schriftstellerin entdeckt hatte. Zur allgemeinen Verblüffung hatten sich ihre Krimis weniger als fünf Jahre später millionenfach verkauft und waren in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden. Wie jeder Polizist, der diese Bezeichnung verdiente, brachte sie der Staatsanwaltschaft eher mäßigen Respekt entgegen und zog sie oft durch den Kakao, indem sie ihre Figuren ungeniert aus dem Topf der Pariser Justiz schöpfte. Dabei gab sie sich nicht allzu viel Mühe, die Identität ihrer Opfer zu verschleiern, und machte diejenigen lächerlich, die ihr Missfallen erregten. Anfangs hatten die Staatsanwälte ihren Ärger noch stillschweigend hinuntergeschluckt: Sich angegriffen zu fühlen wäre einem Schuldeingeständnis gleichgekommen, und den Kopf einzuziehen war besser als ein Skandal. Als schließlich eine Produktionsfirma auf Eva Rosière zugekommen war, hatte sie sich vom Polizeidienst beurlauben lassen, um sich in das große Abenteuer einer Fernsehserie zur Hauptsendezeit zu stürzen. Seitdem bescherte Kriminalpolizistin Laura Flammes dem Ersten und dreißig anderen Kanälen rund um den Globus einen goldenen Donnerstagabend.
Am Quai des Orfèvres hatte dieser plötzliche Ruhm eine gewisse Belustigung hervorgerufen. Dass Olivier Marchal oder Franck Mancuso sich einen Namen machten, bitte schön. Aber dass eine Frau, noch dazu eine aus Saint-Étienne, über einen scharfen Verstand und einen spitzen Kuli verfügen sollte, das konnte der Pariser nur schwer akzeptieren. Aber genau das war der Fall. Eigenartigerweise hatte Eva Rosière dann auf der Höhe ihres Erfolgs darum gebeten, in den Polizeidienst zurückkehren zu dürfen, ohne jedoch ihre Beschäftigung als Drehbuchautorin aufzugeben. Besagte Polizei konnte ihr das natürlich nicht verweigern.
Doch was in den Romanen noch erträglich gewesen war, war auf dem Fernsehschirm und mit größerem Publikum zunehmend schwer auszuhalten. Zumal Eva Rosière selbst innerhalb der PJ, der Kriminalpolizei, am Ende ihre Vorgesetzten vergrätzte, weil sie mit Millionen protzte, die überhaupt keinen interessierten. Die Spötteleien, die anfangs noch als Kinderscherze durchgingen, kratzten allmählich am Stolz: Leuten, die man beneidet, verzeiht man nicht so leicht.
Und so hatte der gepfefferte Start der neuen Staffel ein wahres Komplott losgetreten, und die Führungsriege hatte alles darangesetzt, die Künstlerin mundtot zu machen. Da Rosière heute hier gestrandet war, hatte sie diese Schlacht wohl verloren. Capestan selbst verpasste keine Folge der Serie, die sie richtig lustig und, trotz allem, harmlos fand.
Eva Rosière warf Anne Capestan ein Lächeln und Louis-Baptiste Lebreton einen Feinschmeckerblick zu. Sportliche Figur, helle Augen, feine, aber markante Gesichtszüge: Was das Äußere anging, war er ganz gut gelungen, das musste man zugeben. Eine tiefe Falte, die wie ein Kopfkissenabdruck senkrecht über seine rechte Wange verlief, war der einzige Makel an seinem Hollywoodgesicht. Lebreton, der an derlei Inspektionen gewöhnt war, verneigte sich liebenswürdig und erwiderte Rosières Händedruck. Die wandte sich an Capestan: »Unten stehen zwei Möbelpacker mit einem Empireschreibtisch. Wo kann ich den hinstellen?«
»Also …«
Eva Rosière drehte sich einmal um die eigene Achse, um sich ein Bild von den Räumlichkeiten zu machen.
»Da drüben vielleicht, wo der Haufen Sperrmüll steht?«, fragte sie und deutete auf die andere Platte mit Bock in der Ecke.
»Bitte.«
*
Um achtzehn Uhr stand Anne Capestan im Eingang, wie eine Hausherrin, der niemand seine Aufwartung gemacht hat. Sie hatte vierzig Lebensläufe auswendig gelernt und fand sich jetzt mit drei Leuten wieder, die morgen womöglich nicht einmal mehr auftauchen würden. Zumindest hatte sie nicht vor, sie dazu zu zwingen. Diese Brigade bedeutete für sie alle eine Strafe, wahrscheinlich das Ende ihrer Karriere.
Wie die Verkörperung dieses Desasters kam José Torrez aus seinem Büro geschlurft und durchquerte das Wohnzimmer, ohne seine Kollegen anzusehen. Als er an ihnen vorbeiging, fuhren Rosière und Lebreton mit einer Mischung aus Überraschung und Angst hoch. Die Schaffelljacke über der Schulter und die Hände in den Taschen seiner Cordhose, marschierte Torrez auf die Tür zu. Capestan zögerte erst, beschloss dann aber, mit offenen Karten zu spielen.
»Ich werde morgen da sein, aber fühlen Sie sich nicht verpflichtet, auch zu erscheinen«, sagte sie.
Bei einem derart kleinen Team machte das sowieso keinen Unterschied.
Torrez schüttelte unbeirrt den Dickschädel: »Ich werde von acht bis zwölf und von zwei bis sechs bezahlt.«
Er klopfte mit dem Zeigefinger auf seine Armbanduhr und sagte: »Bis morgen.«
Damit zog er die Tür hinter sich zu. Anne Capestan drehte sich zu Eva Rosière und Louis-Baptiste Lebreton und wartete auf ihre Reaktion.
»Das Ganze hier ist eine Sache von ein paar Monaten«, fing Rosière an. »Da riskier ich doch nicht meinen Kopf wegen Arbeitsverweigerung.«
Sie strich mit den Fingerspitzen über ihre Kette und tastete die zahlreichen Anhänger – hauptsächlich Heiligenbilder – ab, die auf ihren vollen Brüsten ruhten.
»Torrez hat ja sein eigenes Büro, oder?«
Capestan nickte und wandte sich an Lebreton. Bevor er wieder in seinen Aktenkarton abtauchte, ließ er sie knapp wissen, was er zu tun gedachte: »Hier drin gibt es zwangsläufig einen Fall, der es wert ist, bearbeitet zu werden. Ich finde ihn.«
Für den Anfang waren sie also zu viert. Statt der zwanzig, auf die sie gehofft hatte. Alles in allem gar nicht so schlecht. Anne Capestan war zufrieden.
4.
Am nächsten Tag suchten sie stundenlang weiter. Sie pickten sich aus den Kartons, die die gesamte Flurwand bedeckten, zufällig welche heraus und durchstöberten die Akten, in der Hoffnung, einen Fall zu finden, der eine gründlichere Untersuchung verdiente. Eva Rosière sprach als Erste ihren Überdruss aus: »Mal im Ernst, Commissaire, sollen wir uns jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit beknackten Handydiebstählen rumschlagen?«
»Wahrscheinlich, Capitaine. Die haben uns nicht hierhergeschickt, damit wir Mesrine jagen. Aber na ja, man weiß nie. Nicht aufgeben!«
Wenig überzeugt baute sich Rosière vor den Kartons auf.
»Na wunderbar. Ene, mene, miste … ach Scheiß drauf, ich geh einkaufen.«
Mit einer theatralischen Geste griff sie nach ihrer Jacke. Eva Rosière war generell keine Frau, die Angst vor Aufmerksamkeit hatte: Ihr Haar war flammend rot, die Lippen glänzend pink und ihre Jacke metallicblau. Nicht ein Fädchen Beige oder Grau wagte sich in den Kleiderschrank dieser schillernden Polizistin.
»Augenblick«, warf Lebreton leise ein.
Er hatte gerade eine Akte aufgeschlagen. Capestan und Rosière traten an seinen Schreibtisch.
»Ein Mord. Lag ganz oben in der hier«, sagte er und deutete auf eine Schachtel mit dem Stempel »Orfèvres«. »Der Fall ist von 1993 und betrifft einen Mann namens Yann Guénan. Erschossen. Die Jungs von der Flussbrigade haben ihn aus der Seine gefischt, er hatte sich in einer Schiffsschraube verfangen.«
Die drei Polizisten betrachteten ungläubig ihre Entdeckung. Ein Lächeln umspielte ihre Lippen, während sie ein paar Sekunden ehrfürchtig schwiegen. Der Schatz stand seinem Finder zu.
»Wollen Sie den Fall übernehmen?«, schlug Capestan Lebreton vor.
»Gern.«
Es würde sich zeigen, ob der Ritter der internen Ermittlungen auch so kompetent war, wenn es darum ging, in den trüben Wassern der Seine und ihren Leichen herumzuwaten. Anne Capestan hatte die Zusammenstellung der Teams für den Fall, dass sich eine Ermittlung auftat, schon geplant: Sie wollte nicht mit Lebreton arbeiten, und niemand wollte mit Torrez arbeiten. Bei vier Leuten war die Rechnung schnell gemacht. Sie wandte sich an Rosière: »Capitaine, Sie unterstützen ihn.«
»Perfekt!« Eva Rosière rieb sich die drallen, mit bunten Ringen besetzten Hände. »Also, was hat uns unser Wassermann denn zu erzählen?«
5.
»Bitte heirate mich.«
Obwohl Gabriel leise sprach und versuchte, keine Aufmerksamkeit zu erregen, konnte er nicht verhindern, dass seine Worte durch das Pariser Schwimmbad Piscine de Pontoise hallten. Sein Antrag wurde vom Wasser weitergetragen, prallte von den dunkelblauen Fliesen ab und kam als Echo zurück, gespannt auf Manons Antwort.
Jetzt, mitten am Nachmittag, war das Becken praktisch leer. Nur ein paar Stammgäste zogen ihre Bahnen und verfolgten ein unbekanntes Ziel. Und solange Gabriel und Manon ihnen nicht in die Quere kamen, scherten sie sich nicht um das Geplauder und Gespritze. Manon schwamm mit einer perfekt fließenden Brusttechnik, ganz anders als Gabriel, der unkoordinierte Bewegungen vollführte, um neben ihr zu bleiben. Sie lächelte ihn durch den Wasserfilm auf ihrem Gesicht an.
»Wir sind viel zu jung, Gab…«
Gabriel passte genau den Moment ab, in dem Manon den Kopf aus dem Wasser hob, um seine Sätze zu beginnen.
»Wir sind immerhin volljährig.«
»In deinem Fall noch nicht besonders lange.«
»Soll ich dir zeigen, wie erwachsen ich bin?«, fragte Gabriel, noch immer stolz auf seine Leistungen ihrer letzten Liebesnacht.
Er ging fast unter und musste heftig mit den Beinen schlagen, um an der Oberfläche zu bleiben. Manon hatte zwei Meter Vorsprung gewonnen. Er holte sie wieder ein.
»Wenn du mich nicht heiraten willst, wie wär’s dann mit einem Gelübde? Einer eingetragenen Partnerschaft? Blutsbrüderschaft mit einem rostigen Messer?«
»Du gibst nie auf, oder? Wir haben das doch schon tausendmal besprochen …«
Sie kamen an einer alten Frau vorbei, die eine über und über mit Gummiblumen besetzte Bademütze trug. Sie würdigte sie keines Blickes, sondern konzentrierte sich voll und ganz auf ihr Ziel. Auch Gabriel hatte ein Ziel, und er würde sich nicht davon abbringen lassen.
»Ich kann auch auf die Knie gehen. Das würde ich machen, sogar hier, mitten im Schwimmbecken. Dann schlucke ich zwar eine Menge Wasser, aber du hättest deinen romantischen Antrag. Ist es das, was du willst? Einen großen, romantischen Antrag? Einen Ring in einem Kuchen? Erdbeeren im Champagner?«
»Hör schon auf! Wenn du weiter so rumspinnst, geh ich noch unter.«
Manon war wunderschön. Selbst in literweise Chlor getaucht, roch sie großartig. Gabriel war verrückt nach ihr. Er neckte sie, bespritzte sie mit Wasser, mimte den Romantiker aus den amerikanischen Liebeskomödien, den Schüchternen mit dem empfindsamen Gemüt. In Wirklichkeit jedoch sehnte sich jede Zelle seines Körpers nach Manons Antwort, und ihm war überhaupt nicht zum Lachen zumute. Sie musste ihn einfach heiraten. Sie durfte nicht weggehen, davonfliegen, verschwinden, weiterziehen. Sie sollte für immer bei ihm bleiben, ihm nie fehlen. Wenn ein Blatt Papier die Macht hatte, auch nur ein Jota Einfluss darauf zu nehmen, dann wollte Gabriel es unterzeichnen.
»Komm schon, Manon. Ich liebe dich. Und das habe ich auch die nächsten fünfzig Jahre vor.«
»Aber wir haben doch noch so viel Zeit …«
Er schüttelte sich, und seine Haare flogen wie das Fell eines Hundes. Rotbraune Strähnen klebten an seiner Stirn.
»Ja. Fünfzig Jahre. Und die fangen an, wann du willst.«
Manon hielt sich am Rand des Beckens fest, um kurz zu verschnaufen, und musterte ihn. Ihre Augen, deren kleinste Veränderung er kannte, verrieten ihm, dass sie Ja sagen würde. Er nahm all seine Sinne zusammen und setzte sein Erinnerungsvermögen in Gang. Er musste diese Minute festhalten. Er hatte schon so viele Minuten seines Lebens vergessen, bedeutende Minuten, die hoffnungslos und für alle Zeit verloren waren. Diese hier musste er bis in die unterste Schicht seines Gehirns prägen.
»Okay. Wir tun’s.«
Sie ließ sich Zeit, bevor sie hinzufügte: »Ja.«
*
Gabriel sprang förmlich nach Hause. Er wollte seinem Vater die Neuigkeit verkünden. Er war schon auf dem Boulevard Beaumarchais, noch ein paar Meter, dann war er da. Er sprang noch immer, aber bei jedem Satz spürte er, wie eine kleine Bleikugel gegen seine Magenwand schlug. Je näher er kam, desto schwerer wurde sie. Bloß ein Unwohlsein, ein Schluckauf, das würde gleich weggehen, er wusste nicht, woher es überhaupt kam, also war es bestimmt gleich wieder verschwunden.
Das Kügelchen wurde zu einer Boulekugel. Gabriel klingelte kurz, bevor er die Tür mit seinem Schlüssel öffnete. Sein Vater saß bequem in seinem Armsessel. Als er ihn hörte, drehte er den Kopf und stand auf, um ihn zu begrüßen. Groß, stark, erhaben. Sein Vater war eine Kathedrale. Gerade nahm er die Brille ab und öffnete den Mund, um ihn, wie jeden Abend, nach seinem Tag zu fragen.
Ohne Vorrede platzte Gabriel heraus: »Papa! Manon hat eingewilligt, meine Frau zu werden.«
Sein Vater sah aus, als wolle er lächeln, sonst zeigte er keine Reaktion. Gabriel spürte, dass er leicht überrumpelt war, überrascht von der Neuigkeit. Wahrscheinlich fand er, Gabriel sei zu jung, noch nicht bereit.
»Wir wollen im Frühjahr heiraten, wenn es klappt. Ich brauche das Familienstammbuch.«
Sein Vater zuckte beinahe unmerklich zurück, versteifte sich plötzlich. Ein Schatten trat in seine Augen und ging nicht mehr weg.
6.
Als Anne Capestan am nächsten Morgen die heruntergekommene Wohnung im fünften Stock betrat, die man wohl oder übel ihr Kommissariat nennen musste, begegnete sie einem glatzköpfigen Mann in einem blauen Anzug von der Statur eines Kubikmeters. Bei seiner morgendlichen Rasur hatte er eine Stelle unter dem Kinn vergessen, und auf seiner Krawatte waren Flecken; mehrere Flecken, die weder von derselben Mahlzeit noch vom selben Tag stammten. Auf dem Revers seines Jacketts trug er ein Abzeichen des Lions Club, von dem er wohl hoffte, dass man es für eine Ehrenlegion hielt. In der Hand hatte er einen Plastikbecher. Er neigte höflich den Kopf.
»Capitaine Merlot, zu Ihren Diensten. Mit wem habe ich die Ehre?«
Ein überwältigender Geruch nach Rotwein verpestete die Luft, und Capestan versuchte, so wenig wie möglich zu atmen, während sie antwortete: »Commissaire Capestan, guten Morgen, Capitaine.«
Fröhlich und in keinster Weise verlegen durch die Erinnerung an ihren Rangunterschied erwiderte Merlot: »Hocherfreut, werte Freundin. Leider wird meine Anwesenheit bei einer Verabredung verlangt, zu der ich mich nicht verspäten darf, aber ich hoffe, wir können unsere Bekanntschaft bald vertiefen, denn …«
Merlot salbaderte noch ein paar Minuten über die Wichtigkeit seiner Verabredung und die Bedeutung seiner Freunde, bevor er den leeren Becher auf einen Kartonstapel im Eingangsbereich stellte und versprach zurückzukommen, sobald seine Verpflichtungen es erlaubten. Anne Capestan nickte lächelnd, als sei dieses Gleitzeitsystem völlig selbstverständlich, dann ging sie hinein und riss sofort das Fenster auf. Sie durchsuchte ihren geistigen Aktenschrank nach Merlot. Er war Capitaine, ein »Schreibtisch-Opa«, wie man die alternden Vollzugsbeamten bezeichnete, die sich um den Papierkram kümmerten. Nach dreißig Jahren bei der Sitte sah er jetzt nur noch von der Seitenlinie aus zu. Als notorischer Alkoholiker und unverbesserlicher Schwätzer arbeitete er die meiste Zeit überhaupt nicht, aber er verfügte über viel Geschick im Umgang mit Menschen. Capestan hoffte, er würde wirklich zurückkommen und die Reihen verstärken – nach seiner glorreichen Verabredung und ein paar Aspirin. In der Zwischenzeit musste sie erst einmal ihr Viererteam bei Laune halten. Und José Torrez dazu überreden, mit ihr zusammen zu ermitteln.
Gestern hatte sie in einem Karton der Kriminalbrigade, zwischen einem Selbstmord und einem Verkehrsunfall, eine interessante Akte entdeckt. Eine alte Frau war bei einem Einbruch erdrosselt worden. Den Täter hatte man nie gefunden. Der Fall lag bereits sieben Jahre zurück, verdiente jedoch eine Neuaufnahme.
Bevor sie nach Hause gegangen war, hatte sie eine Kopie der Akte auf Torrez’ Schreibtisch platziert, um schon einmal die Weichen zu stellen. Wenn er sich, wie erwartet, seit Punkt acht Uhr am Ende des Flurs verbarrikadierte, war er jetzt gerade dabei, sie zu lesen. Damit war die Schlacht allerdings noch lange nicht gewonnen.
Anne Capestan begrüßte kurz Louis-Baptiste Lebreton, der einen Computer mitgebracht hatte und mit einem Haufen Kabel kämpfte, um ihn ans Internet anzuschließen. Sie legte Handtasche und Mantel auf einen Stuhl neben ihrem Schreibtisch, und ihre Hände wanderten automatisch an den Gürtel, um die Smith & Wesson Bodyguard aus dem Halfter zu holen. Diese kompakte und leichte Waffe mit fünf Schuss, die .38 Spezialpatronen abfeuerte, hatte ihr Buron, damals Leiter der Spezialeinheit BRI, an ihrem ersten Tag in seiner Abteilung geschenkt. Doch der Revolver war nicht an seinem angestammten Platz. Anne Capestan war nicht länger berechtigt, eine Waffe zu führen. Um ihre Bewegung zu begründen und sich nicht allzu lächerlich zu machen, tat sie so, als wolle sie ihren Gürtel zurechtrücken, und schaltete die Schreibtischlampe ein.
Danach nahm sie die große rote Einkaufstasche, mit der sie gekommen war, und ging in Richtung Küche. Sie beförderte eine Kaffeemaschine, eine Schachtel mit sechs Tassen und Untertassen, vier große Kaffeebecher, Gläser, Teelöffel, drei Pakete gemahlenen Kaffee, Zucker, Spülmittel, einen Schwamm und ein Geschirrtuch mit dem Aufdruck »Fromages de France« zutage und bot Louis-Baptiste Lebreton widerwillig eine Tasse Kaffee an. Der lehnte ab. Das nächste Mal würde sie sich die Frage schenken.
Mit einem dampfenden Kaffeebecher in der Hand kehrte sie schließlich an ihren Schreibtisch zurück und sah sich die Akte zu ihrem Mordfall genauer an: Marie Sauzelle, sechsundsiebzig, tot aufgefunden im Juni 2005 in ihrem Einfamilienhaus in der Rue Marceau 30 in Issy-les-Moulineaux. Das erste Foto genügte, und Capestan bekam nichts mehr von ihrer Umgebung mit.
*
Die alte Dame saß würdevoll auf dem Sofa. Ihre Haut war blau verfärbt. In den Augen und auf den Wangen waren rote Flecken zu erkennen, die Zungenspitze schaute zwischen den Lippen hervor und ein panischer Ausdruck lag auf dem gedunsenen Gesicht. Aber ihre Hände waren sittsam gefaltet, und sie war ordentlich frisiert. Die Schildpattspange, die ihr Haar zurückhielt, war verkehrt herum befestigt.
Das Wohnzimmer rund um das untadelige Opfer allerdings sah aus, als sei buchstäblich eine Bombe explodiert. Alle Nippsachen waren aus den Regalen geschleudert worden. Der Boden war übersät mit den Überresten von Porzellantieren. Ein Barometer in Pudelform aus rosafarbenem Quarz ganz vorne im Bild sagte milde Temperaturen voraus. Ein Strauß Holztulpen war auf dem Teppich verstreut. Wie um ihn zu verhöhnen, stand auf dem Couchtisch ein zweiter Strauß, dieses Mal echte Blumen, in seiner auf wundersame Weise heil gebliebenen Vase.
Das nächste Foto zeigte das Wohnzimmer aus einem anderen Winkel. CDs und Bücher in allen Größen ruhten vor einem Schrank aus Eichenholz. Auf dem Fernseher gegenüber dem Sofa – einem Röhrenmodell – lief Planète. Ein Detail machte Capestan stutzig, und sie suchte in ihrer Tasche nach ihrer Klapplupe. Sie holte das Instrument mit dem Rahmen aus poliertem Stahl aus seiner Hülle und richtete es auf den Fernsehschirm. In der rechten unteren Ecke war ein Symbol. Ein durchgestrichener Lautsprecher. Der Fernseher war stumm geschaltet.
Anne Capestan legte die Lupe beiseite und breitete verschiedene Fotos auf ihrem Schreibtisch aus, um sich ein Gesamtbild zu verschaffen. Nur Wohn- und Schlafzimmer waren verwüstet worden. Bad, Küche und Gästezimmer waren unversehrt. Sie überflog den Tatortbefundbericht: Das Schloss der Haustür war aufgebrochen worden. Capestan trank einen Schluck Kaffee und dachte nach.
Ein Einbruch. Der Fernseher ist stumm geschaltet, also hat Marie Sauzelle zum Tatzeitpunkt ferngesehen. Man lässt den Apparat nicht an, wenn man ins Bett geht. Sie hört ein Geräusch und schaltet den Ton aus. Das Wohnzimmer befindet sich direkt gegenüber der Haustür, deswegen überrascht sie den Einbrecher, als er hereinkommt. Doch anstatt zu fliehen wie jeder andere Einbrecher, tötet er sie. Dann setzt er sie wieder hin und bringt, dem gepflegten Haar und der verdrehten Spange nach zu urteilen, ihre Frisur in Ordnung. Anschließend stellt er das Wohnzimmer auf den Kopf, auf der Suche nach Bargeld vermutlich, und das Schlafzimmer, aus dem der Schmuck verschwunden ist.
Anne Capestan drehte die Lupe in den Händen. Der Einbrecher wirkte auf sie labil und unlogisch, irgendwie nervlich angeschlagen. Ein Drogensüchtiger vielleicht oder ein Anfänger, was die Ermittlungen immer ungemein erschwerte. Sie nahm sich den Obduktionsbericht und die Vernehmungsprotokolle vor.
Marie Sauzelle war durch Erdrosselung gestorben. Die Leiche war nicht unmittelbar entdeckt worden, sondern erst ungefähr zwei Wochen nach ihrem Tod. Der Gerichtsmediziner hatte weder Zeitpunkt noch Tag des Todes genau bestimmen können. Er hatte einen blauen Fleck am rechten Unterarm vermerkt, der wahrscheinlich von einem Kampf herrührte, aber keine Haut des Angreifers unter den Fingernägeln gefunden.
Die Spurensicherung hatte weder DNA