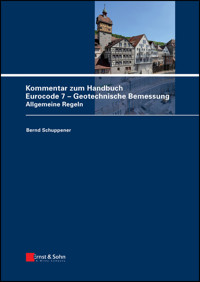
Kommentar zum Handbuch Eurocode 7 - Geotechnische Bemessung E-Book
88,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
The commentary provides detailed foundations and explanations for a better understanding of the new terminology, regulations and definitions. The examples show how the new definitions can be put into practice in concrete situations. The book illustrates how the standard stability analyses in soil engineering, e.g. for flat footings, pile foundations, retaining structures, construction pit supports, anchorages or slopes, as well as checks against uplift and hydraulic ground failure can be performed based on Eurocode?s partial safety concept.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
HerausgeberBernd SchuppenerPforzheimer Str.76344 Leopoldshafen
Titelbild: Kocherquartier Schwäbisch Hall, Bauer Aktiengesellschaft Schrobenhausen
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2012 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstr. 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publisher.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie als solche nicht eigens markiert sind.
1. AuflagePrint ISBN: 978-3-433-01528-5ePDF ISBN: 978-3-433-60153-2ePub ISBN: 978-3-433-60152-5Mobi ISBN: 978-3-433-60151-8o-Book ISBN: 978-3-433-60108-2
Vorwort
Nach einer Entwicklungsarbeit von über 30 Jahren konnten im Jahr 2011 die Normen- Handbücher der Eurocodes für den konstruktiven Ingenieurbau vorgelegt werden, in denen die für Europa gemeinsam geltenden Eurocodes und die ergänzenden deutschen Regelungen für den Anwender zusammengefasst sind. Vor allem in den letzten Jahren vollzog sich diese Entwicklungsarbeit immer auf zwei Ebenen:
− Auf der europäischen Ebene wurden die Eurocodes erarbeitet, für die Geotechnik der Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik, mit Teil 1: Allgemeine Regeln (EC 7-1 bzw. DIN EN 1997-1) und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds (EC 7-2 bzw. DIN EN 1997-2). Der EC 7-1 ist eine sogenannte Regenschirmnorm; hier werden Begriffe definiert, die zu führenden Grenzzustandsnachweise beschrieben und festgelegt, drei Nachweisverfahren mit dem Teilsicherheitskonzept geregelt und Mindestanforderungen formuliert. Mit dem EC 7-1 allein ist eine Bemessung in der Geotechnik nicht möglich. Vielmehr müssen freie Parameter der europäischen Norm festgelegt werden, was die beteiligten Mitgliedsstaaten in nationaler Verantwortung vornehmen können.
− Auf der nationalen Ebene mussten daher in einem nationalen Anhang zum EC 7-1 die nationalen Parameter festgelegt, die vorhandenen Normen überarbeitet und dem neuen Teilsicherheitskonzept angepasst werden, zumal die Verpflichtung der Mitgliedstaaten besteht, keine konkurrierenden Normen bestehen zu belassen. Das betraf vor allem DIN 1054:1976 „Zulässige Belastung des Baugrunds“, die in mehreren Schritten überarbeitet wurde und nun in der Fassung von 2010 mit dem Titel „Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1“ den EC 7-1 ergänzt. Aber auch die Berechnungsnormen, z. B. DIN 4017 „Grundbruchberechnungen“ und DIN 4084 „Gelände- und Böschungsbruchberechnungen“ sowie die EAU und die EAB mussten dem Teilsicherheitskonzept angepasst und veröffentlicht werden. Dies geschah auch, um eine breite Fachöffentlichkeit an der Diskussion über die Einführung des Teilsicherheitskonzepts zu beteiligen und die Anwender frühzeitig damit vertraut zu machen. DIN 1054 „Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau“ von 2005 wurde darüber hinaus für eine Übergangszeit bauaufsichtlich eingeführt.
Die jetzt fertig gestellte erste Generation der Eurocodes besteht aus 58 Normen, mit insgesamt über 5.200 Seiten, hinzu kommen die nationalen Ergänzungsnormen. Allein die Zahl der Seiten ist geeignet, den Anwender abzuschrecken. Daher erscheinen Hinweise, Anwendungsbeispiele und Interpretationshilfen sinnvoll, die dazu beitragen, einen Überblick zu gewinnen und sich im umfangreichen Normenwerk zurechtzufinden.
Es fragt sich, wie es zu einer solchen Papierflut überhaupt kommen konnte. Dafür gibt es drei wesentliche Gründe:
− Es war unvermeidlich, dass die Eurocodes eine Art „Stoffsammlung“ der Normen und Erfahrungen aus den 27 Ländern der Europäischen Union und den drei EFTA-Staaten wurden, denn jedes Land hielt seine Traditionen für unverzichtbar.
− Bearbeiter und Einsprecher der Eurocodes waren vielfach bemüht, über den anerkannten Stand hinaus den neuesten Stand der Technik einzubringen.
− Es waren keine strengen Regelungen vorgegeben, was in einem Eurocode stehen soll und was nicht.
Infolgedessen enthält der Eurocode 7-1 neben klaren normativen Forderungen auch sehr viele Erläuterungen, die eigentlich in Kommentare oder Lehrbücher gehören. Dies wird als Schwäche von allen Beteiligten anerkannt.
In Zukunft sollte es Ziel sein, dem Anwender eine stark gestraffte Norm und einen umfassenden verständlichen Kommentar zur Verfügung zu stellen. Daher hat sich auch die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) der Initiative PraxisRegelnBau angeschlossen, die im Einvernehmen mit dem Normenausschuss Bauwesen (NABau), beginnend auf nationaler Ebene, die Eurocodes straffen will.
Bernd Schuppener
November 2011
Normen, Richtlinien und Empfehlungen
DIN 1054:1976-10: Baugrund – Zulässige Belastungen des Baugrunds;
DIN 1054:2005-01: Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau;
DIN 1054:2010-12: Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1:2009-9, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln;
DIN 1055-2:2010-09: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Bodenkenngrößen;
DIN EN 1537:2001-01: Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Verpressanker;
DIN EN 1990:2010-12: Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010;
DIN EN 1990/NA:2010-12: Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung;
DIN EN 1992-1-1:2001-01 – Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau, Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004 + AC:2010;
DIN EN 1993-1-1:2010-12: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1: Allgemeine Regeln;
DIN EN 1993-5:2010-12: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 5: Pfähle und Spundwände;
DIN EN 1998-5:2010-12: Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben, Teil 5: Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte;
DIN EN 1998-5/NA:2009-9 (Entwurf): Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – Teil 5: Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte;
DIN 4017:2006-3: Baugrund – Berechnung des Grundbruchwiderstands von Flachgründungen;
DIN 4020:2010-12: Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke;
DIN 4024-1:1988-04: Maschinenfundamente; Elastische Stützkonstruktionen für Maschinen mit rotierenden Massen;
DIN 4084:2009-1: Baugrund – Geländebruchberechnungen;
DIN 4084:1981-7: Baugrund – Gelände- und Böschungsbruchberechnung;
DIN 4085-100:1996-4: Baugrund – Berechnung des Erddrucks, Teil 100: Berechnung nach dem Konzept mit Teilsicherheitsbeiwerten;
DIN 4085:2007-10: Baugrund – Berechnung des Erddrucks;
DIN 4124:2002-10: Baugruben und Gräben – Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau;
DIN 4125:1990-11: Verpressanker – Kurzzeitanker und Daueranker, Bemessung, Ausführung und Prüfung;
DIN EN 12715:2000-10: Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Injektionen
DIN 19702:2010-6: Massivbauwerke im Wasserbau;
DIN 21521 – Teil 2:1993-02: Gebirgsanker für den Bergbau und den Tunnelbau Allgemeine Anforderungen für Gebirgsanker aus Stahl Prüfungen, Prüfverfahren;
EBGEO Empfehlungen für Bewehrungen aus Geokunststoffen, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT), Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2010;
EAB Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT), 4. Auflage, 2006;
EA-Pfähle (2007): Empfehlungen des Arbeitskreises „Pfähle“, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT), Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2007;
EAU 2004 Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen, Häfen und Wasserstraßen“, herausgegeben von der Hafenbautechnischen Gesellschaft e. V. (HTG) und der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e. V. (DGGT), 10. Auflage, Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2005;
Handbuch Eurocode 7 – Geotechnische Bemessung, Band 2: Erkundung und Untersuchung. Herausgeber: Deutsches Institut für Normung (DIN), Beuth Verlag, Berlin 2011;
MAG Merkblatt für die Anwendung von geotextilen Filtern an Wasserstraßen. Herausgegeben von der Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe 1993;
MAK Merkblatt für die Anwendung von Kornfiltern. Herausgegeben von der Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe 1989;
MSD Merkblatt: Standsicherheit von Dämmen an Bundeswasserstraßen. Herausgegeben von der Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe 2011.
Die Autoren in alphabetischer Reihenfolge:
BORin Eva Dornecker, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe, [email protected]
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hans-Georg Kempfert, Hamburg, [email protected]
Dr.-Ing. Franz-Reinhard Ruppert, Braunschweig, [email protected]
LBDir a.D. Dr.-Ing. Bernd Schuppener, Eggenstein-Leopoldshafen, [email protected]
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Norbert Vogt, Zentrum Geotechnik, TU München, [email protected]
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Anton Weißenbach, Norderstedt, [email protected]
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl Josef Witt, Bauhaus-Universität Weimar, [email protected]
Prof. Dr.-Ing. Peter-Andreas v. Wolffersdorff, Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH, [email protected]
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler, RWTH Aachen, Geotechnik im Bauwesen, [email protected]
Teil A Einführung
A 1
Die Entwicklung der Eurocodes und des EC 7-1
Dr.-Ing. B. Schuppener
1.1 Die Eurocodes
Erste Initiativen für die Erarbeitung europäischer Normen im Bauwesen gingen 1975 von einer Reihe von Hochschullehrern und Vertretern der Bauindustrie aus. Sie wurden bald darauf von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft unterstützt, die europäische Normen als einen wesentlichen Bestandteil für die Entwicklung eines gemeinsamen Marktes betrachtete und eine Möglichkeit sah, den freien Markt zu fördern und technische Handelshemmnisse durch Normen abzubauen. Im Jahre 1989 entschieden sich die Kommission und die Mitgliedsländer der Europäischen Union und der EFTA (European Free Trade Association), die Entwicklung und Veröffentlichung der Eurocodes an das CEN (Comité Européen de Normalisation), das Europäische Normungsinstitut, zu übertragen, damit diese den Status von Europäischen Normen (EN) erhielten (Orr, 2008). Die Koordination der Arbeit an den Eurocodes wurde dem Technischen Komitee (TC) 250 „Eurocodes für den konstruktiven Ingenieurbau“ übertragen. Jeder der Eurocodes wird von einem Subkomitee (SC) betreut, in dem jedes Mitgliedsland des CEN vertreten ist. Das sind zum einen die Staaten der Europäischen Union und zusätzlich drei Mitglieder der EFTA, d. h. Island, Norwegen und die Schweiz sowie gegebenenfalls andere Staaten als Beobachter.
Das derzeitige Eurocode-Programm umfasst die folgenden Normen, die in der Regel aus mehreren Teilen bestehen:
– DIN EN 1990 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung,
– DIN EN 1991 Eurocode 1: Einwirkung auf Tragwerke,
– DIN EN 1992 Eurocode 2: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbetonbauten,
– DIN EN 1993 Eurocode 3: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbauten,
– DIN EN 1994 Eurocode 4: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahl-Beton-Verbund-Bauten,
– DIN EN 1995 Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten,
– DIN EN 1996 Eurocode 6: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Mauerwerksbauten,
– DIN EN 1997 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik,
– DIN EN 1998 Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben,
– DIN EN 1999 Eurocode 9: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Aluminiumkonstruktionen.
Die bis 2006 fertiggestellte erste Generation der Eurocodes besteht aus 58 Normen, mit insgesamt über 5.200 Seiten. In der Planung sind weitere Eurocodes, z. B für Glaskonstruktionen und Konstruktionen mit einer Bewehrung aus Fiberglas.
DIN EN 1990 ist die Grundlagen-Norm für die Eurocodes DIN EN 1991 bis DIN EN 1999. In ihr werden die in allen Eurocodes verwendeten Begriffe definiert und die Prinzipien und Anforderungen zur Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit von Tragwerken und damit die Bemessungsphilosophie im Bauwesen festgelegt. Wesentlicher Bestandteil der Bemessungsphilosophie ist das Bemessungskonzept der Grenzzustände mit Teilsicherheitsbeiwerten. Darüber hinaus lifert sie Hinweise zu Fragen der Zuverlässigkeit in Verbindung mit der Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit.
Grenzzustände werden in DIN EN 1990 sehr allgemein als Zustände definiert, „bei deren Überschreitung das Tragwerk die Entwurfsanforderungen nicht mehr erfüllt.“ (Abschnitt 1.5.2.12). Für die Geotechnik sind maßgebend:
– Grenzzustände der Tragfähigkeit, die im Zusammenhang mit Einsturz oder anderen Formen des Tragwerksversagens stehen, und
– Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit, bei deren Überschreitung die festgelegten Bedingungen für die Gebrauchstauglichkeit eines Tragwerks oder Bauteils nicht mehr erfüllt sind.
Die in DIN EN 1990 und den anderen Eurocodes angegebenen Zahlenwerte für die Teilsicherheitsbeiwerte und andere Zuverlässigkeitsparameter gelten als Empfehlungen zur Erreichung eines akzeptablen Zuverlässigkeitsniveaus. Es steht jedem Mitgliedsland des CEN frei, sie zu übernehmen oder eigene Werte festzulegen.
Die Bemessung nach den Eurocodes konzentriert sich darauf nachzuweisen, dass eine Überschreitung von Grenzzuständen vermieden wird, wobei die Grenzzustände „baupraktisch“ definiert sind als Versagensmöglichkeiten, unsichere Zustände und fehlende oder ungenügende Funktionsfähigkeit. Während frühere Bemessungsphilosophien vorhandene Spannungen mit zulässigen Spannungen verglichen, konzentriert sich die Bemessung auf Grundlage von Grenzzuständen auf die Überprüfung, was versagen könnte und was vermieden werden muss.
Die Überprüfung der Grenzzustände wird mit Bemessungswerten der Einwirkungen bzw. der Beanspruchungen, Bemessungswerten der Materialfestigkeit bzw. von Bauteilwiderständen und der geometrischen Randbedingungen durchgeführt, wobei die Bemessungswerte bewusst vorsichtig angesetzt werden. Bemessungswerte werden sowohl bei Grenzzuständen der Tragfähigkeit als auch bei Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit angesetzt. Da aber ein Zusammenbruch oder Einsturz einer Konstruktion ein ungleich schwerwiegenderer Schaden ist als Risse oder eine Schiefstellung eines Bauwerks, sind die Bemessungswerte für die beiden Grenzzustände nicht identisch.
In allen Eurocodes wird, abhängig vom Charakter der einzelnen Absätze, nach Prinzipien und Anwendungsregeln unterschieden.
Die Prinzipien enthalten:
– allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen, die immer gelten, sowie
– Anforderungen und Rechenmodelle, die immer gültig sind, soweit auf die Möglichkeit von Alternativen nicht ausdrücklich hingewiesen wird.
Die Prinzipien werden durch den Buchstaben P nach der in Klammern gesetzten Absatznummer gekennzeichnet.
Die Anwendungsregeln sind allgemein anerkannte Regeln, die den Prinzipien folgen und deren Anforderungen erfüllen. Abweichende Anwendungsregeln sind zulässig, wenn vom Aufsteller nachgewiesen werden kann, dass sie mit den maßgebenden Prinzipien übereinstimmen und in Hinblick auf die Bemessungsergebnisse bezüglich der Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit, die bei Anwendung der Eurocodes erwartet werden, mindestens gleichwertig sind.
Die Mitgliedsländer der EU und der EFTA betrachten die Eurocodes als Normen:
– zum Nachweis der Übereinstimmung der Hoch- und Ingenieurbauten mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 89/106/EWG, besonders mit der wesentlichen Anforderung Nr. 1: „Mechanischer Widerstand und Stabilität“ und der wesentlichen Anforderung Nr. 2: „Brandschutz“,
– als Grundlage von Verträgen für die Ausführung von Bauwerken und der dazu erforderlichen Ingenieurleistungen und
– als Grundlage für die Herstellung harmonisierter, technischer Bestimmungen für Bauprodukte.
Die Eurocodes liefern damit Regelungen für den Entwurf, die Berechnung und Bemessung von kompletten Tragwerken und Baukomponenten, die sich für die tägliche Anwendung eignen. Sie gehen auf traditionelle Bauweisen und Aspekte innovativer Anwendungen ein, liefern aber keine vollständigen Regelungen für ungewöhnliche Baulösungen und Entwurfsbedingungen, wofür Spezialistenbeiträge erforderlich sein können.
Die Bestimmungen der Eurocodes beruhen auf nachstehenden Voraussetzungen (Abschnitt 1.3 (2) in DIN EN 1990):
– Die Wahl des Tragsystems und die Tragwerksplanung werden von dafür entsprechend qualifizierten und erfahrenen Personen durchgeführt.
– Die Bauausführung erfolgt durch geschultes und erfahrenes Personal.
– Sachgerechte Aufsicht und Güteüberwachung werden während der Bauausführung sichergestellt, z. B. bei der Tragwerksplanung, der Fertigung und auf der Baustelle.
– Die Verwendung von Baustoffen und Erzeugnissen erfolgt entsprechend den Angaben in EN 1990 oder EN 1991 bis EN 1999 oder den maßgebenden Ausführungsnormen, Werkstoff- oder Produktnormen.
– Das Tragwerk wird sachgemäß instand gehalten.
– Das Tragwerk wird entsprechend den Planungsannahmen genutzt.
EC 7-1 weist in Abschnitt 1.3 (3) besonders darauf hin, dass sich Planverfasser und Auftraggeber dieser Voraussetzungen bewusst sein müssen. Zur Vermeidung von Unklarheiten sollten diese Voraussetzungen aktenkundig gemacht werden, z. B. im Geotechnischen Entwurfsbericht.
1.2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
Das Subkomitee SC 7 bearbeitet den Eurocode 7 „Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik“ seit 1980 und verabschiedete 1993 die ENV 1997-1 als Vornorm „Geotechnische Bemessung – Teil 1: Allgemeine Regeln“. Schon damals wurde deutlich, dass noch eine Vielzahl von Fragen diskutiert und einvernehmlich geklärt werden musste, bevor eine für alle Mitglieder des CEN akzeptable Europäische Norm (EN) zur Abstimmung gestellt werden konnte. Im Januar 1997 begann eine Arbeitsgruppe (WG 1) mit Vertretern aus insgesamt 19 Mitgliedsländern mit der Überarbeitung der ENV zu einer EN. Dem erarbeiteten Entwurf, der im November 2004 veröffentlicht wurde, stimmten 26 von 28 Ländern zu. Er wird im Folgenden kurz als „EC 7-1“ bezeichnet.
Das positive Votum war nur möglich, weil EC 7-1 weit mehr als die anderen Eurocodes nationale Sonderregeln erlaubte. Die geotechnischen Berechnungsmodelle variieren von Land zu Land und können nicht einfach vereinheitlicht werden, auch weil die Geologie von Land zu Land unterschiedlich ist und sich daraus regionale Traditionen der Bemessung entwickelt haben. Dies wurde durch eine Resolution des TC 250 bestätigt, in der anerkannt wird, dass der EC 7-1 sich im Gegensatz zu den anderen Eurocodes ausschließlich auf die fundamentalen Regeln der geotechnischen Bemessung konzentriert und durch nationale Normen ergänzt wird.
EC 7 bestand ursprünglich aus zwei weiteren Teilen:
– Teil 2, der sich der geotechnischen Bemessung aufgrund von Laborversuchen widmete, und
– Teil 3, der die geotechnische Bemessung aufgrund von Feldversuchen beinhaltete.
Bei der Überarbeitung der beiden Vornormen entschloss man sich, sie zu einem einzigen Dokument mit dem Titel „Eurocode 7: Geotechnische Bemessung – Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds“ (EC 7-2) zusammenzufassen. Im Frühjahr 2006 wurde der Entwurf von EC 7-2 einstimmig angenommen und im März 2007 durch das CEN veröffentlicht. Auf den Inhalt von EC 7-2 wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, sondern auf Kapitel B 3 „Geotechnische Unterlagen“ in Teil B verwiesen.
1.3 Die Einführung der Eurocodes in Deutschland
Die Richtlinien der EU über das öffentliche Beschaffungswesen sehen vor, dass im Bauwesen in ganz Europa in allen öffentlichen Ausschreibungen und Verträgen die Eurocodes zugrunde gelegt werden. Damit werden die Eurocodes zur technischen Ausschreibungsgrundlage für Bauverträge der öffentlichen Hand. Das bedeutet allerdings nicht, dass grundsätzlich nur die Eurocodes angewendet werden müssen, denn Angebote sind „auch anzunehmen, wenn deren Gleichwertigkeit zu den EN Eurocodes vom Unternehmer nachgewiesen werden“ (Europäische Kommission, 2002).
Bei der praktischen Umsetzung der Harmonisierung der nationalen und europäischen Normen gelten folgende Grundsätze:
– Die Eurocodes sind vollständig mit allen informativen Anhängen von allen Mitgliedsstaaten einzuführen.
– Nationale Normen sind weiterhin zulässig, sie dürfen aber weder europäischen Normen widersprechen noch mit ihnen konkurrieren.
– Nationale Normen mit Regelungen, für die es europäische Normen gibt, sind nach einer Übergangsfrist zurückzuziehen.
Um die Eurocodes anwendbar zu machen und sie mit den nationalen Normen zu verbinden, sind in den Europäischen Staaten sogenannte „Nationale Anhänge“ zu erstellen. Wegen ihrer besonderen Bedeutung hat die Europäische Kommission im „Leitpapier L – Anwendung der Eurocodes“ (Europäische Kommission, 2002) Vorschriften darüber erlassen, was in den Nationalen Anhang aufzunehmen und wie er aufzubauen ist. Auch wenn nach 2.1.1 des Leitpapiers gilt:
„Die Bestimmung von Sicherheitsniveaus für Hoch- und Ingenieurbauwerke und für Teile davon, einschließlich der Aspekte der Dauerhaftigkeit und der Wirtschaftlichkeit, ist und bleibt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.“,
werden jedoch in 2.3.4 dem nationalen Entscheidungsspielraum Grenzen gesetzt:
„Ein nationaler Anhang kann den Inhalt eines EN Eurocodes in keiner Weise ändern, außer wo angegeben wird, dass eine nationale Wahl mittels national festzulegender Parameter vorgenommen werden kann“.
Nach Abschnitt 2.3.3 des Leitpapiers L darf ein nationaler Anhang (NA) die national zu bestimmenden Parameter (Nationally Determined Parameter, NDP) enthalten. Das sind:
– die Zahlenwerte der Teilsicherheitsbeiwerte, Streuungsfaktoren, Kombinationsbeiwerte und andere sicherheitsrelevante Beiwerte,
– die Entscheidung über die anzuwendenden Nachweisverfahren, wenn mehrere zur Wahl gestellt werden und
– die Entscheidung bezüglich der Anwendung informativer Anhänge.
Darüber hinaus darf der NA Verweise auf nicht widersprechende zusätzliche Angaben (Non-controdictory Complementary Information, NCI) enthalten, die dem Anwender beim Umgang mit dem Eurocode helfen. Der Nationale Anhang soll also keinerlei zusätzliche nationale normative Regelungen enthalten. Spezifische nationale Regelungen sollen in nationale Normen aufgenommen werden, auf die im Nationalen Anhang verwiesen wird. In Deutschland ist dies DIN 1054:2010-12.
Die Hierarchie europäischer und deutscher Normen ist in Bild A 1.1 für den Bereich des Verkehrswasserbaus dargestellt. An der Spitze der europäischen Baunormen stehen der Eurocode „Grundlagen der Tragwerksplanung“ und Eurocode 1 „Einwirkungen auf Tragwerke“. Sie sind Grundlage für die Bemessung im gesamten Bauwesen Europas. Auf diese beiden Grundnormen beziehen sich alle anderen acht Eurocodes.
Bild A 1.1 Hierarchie der Normen für den Bereich Verkehrswasserbau
Mit den Eurocodes allein ist in keinem der Fachgebiete des Bauingenieurwesens eine Bemessung bzw. ein Nachweis möglich, weil die anzuwendenden Teilsicherheitsbeiwerte und in vielen Fällen auch die zur Wahl gestellten Nachweisverfahren von den nationalen Normungsinstitutionen festgelegt werden müssen. Diese Festlegungen sind als national zu bestimmende Parameter in den Mitgliedsstaaten in Nationalen Anhängen (NA) festzulegen, die darüber hinaus nicht widersprechende zusätzliche Angaben (NCI) enthalten, die dem Anwender beim Umgang mit dem Eurocode helfen. Die Nationalen Anhänge stellen somit die Verbindung zwischen den Eurocodes und den weiterhin zusätzlich geltenden nationalen Normen her.
1.4 Pflege und Weiterentwicklung der Eurocodes
Die Pflege und Weiterentwicklung der Eurocodes dient nicht nur dazu, Fehler zu beseitigen und Missverständnisse auszuräumen. Es muss darüber hinaus sichergestellt werden, dass durch die Aktualisierung der Eurocodes ihre Akzeptanz, ihre Vollständigkeit und damit auch ihre Bedeutung erhalten und ausgebaut wird. Aus diesem Grund wurde in den meistens Subkomitees eine Maintenance Group, eine Arbeitsgruppe zur Pflege und Weiterentwicklung der Eurocodes, eingerichtet. Insbesondere nach der Einführung und den ersten Anwendungen ergaben sich in den Mitgliedsländern zahlreiche technische und juristische Fragen, die geklärt werden mussten. Für Eurocode 7 wurden 2009 bzw. 2010 in einem ersten Schritt die Fehler der ersten Fassung beider Teile durch Berichtigungen korrigiert.
Ergänzungsvorschläge sowie alle Fragen und Einsprüche zur Anwendung der Eurocodes, die sich in den Mitgliedsstaaten ergeben, sind zunächst den nationalen Normungsinstitutionen zuzuleiten (Bild A 1.2). Soweit wie möglich sollten die Fragen und Einsprüche durch die nationalen Normungsinstitutionen in den Mitgliedsstaaten behandelt werden. Nur Einsprüche und Fragen, die eine Auswirkung in Hinblick auf Korrekturen oder Ergänzungen haben, werden an die Maintenance Group zur Pflege und Aktualisierung des Eurocodes weitergegeben.
Bild A 1.2 Pflege und Aktualisierung der Eurocodes
Die Arbeit dieser Arbeitsgruppe wird unterstützt durch die Entwicklung und Pflege einer Datenbank für die Eurocodes durch das Joint Research Center (JRC) der Europäischen Kommission in Ispra, Italien, das eine Internetplattform für Informationen zu den Eurocodes entwickelt hat (http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/login.php).
Europäische Normen sollten spätestens vier Jahre nach ihrer Ratifizierung erneut in den Mitgliedsländern zur Diskussion gestellt und gegebenenfalls vom zuständigen technischen Komitee überarbeitet werden. Da die Einführung der Eurocodes in den Mitgliedsländern erhebliche Zeit in Anspruch nahm und deshalb auch noch keine ausreichende Erfahrung mit ihrer praktischen Anwendung gewonnen werden konnte, entschloss man sich, diese Frist bis 2013 zu verlängern. Zur Überarbeitung empfiehlt die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten, „… die national zu bestimmenden Parameter zu vergleichen … und die Auswirkungen in Hinblick auf die technischen Unterschiede beim Bauen abzuschätzen. Die Mitgliedsländer sollten auf Aufforderung der Kommission ihre national bestimmten Parameter ändern, um die Unterschiede von den empfohlenen Werten zu reduzieren“ (CEN, 2003). In diesem Zusammenhang sind auch die zur Wahl gestellten Nachweisverfahren zu reduzieren. Auf lange Sicht können auch neue Themen entwickelt werden, z. B. die Standardisierung der Auswertung von Versuchsergebnissen in Hinblick auf die Wahl charakteristischer Werte für geotechnische Kenngrößen für die geotechnische Bemessung oder die Entwicklung von Grundsätzen für die Anwendung von numerischen Methoden, die in EC 7-1 nur in einer sehr allgemeinen Form geregelt sind.
EC 7-1 und z. T. auch andere Eurocodes sind „Regenschirm-Normen“ und geben den Ländern die Möglichkeit, ihre speziellen nationalen geotechnischen Erfahrungen weiter zu nutzen. Zum Beispiel enthält EC 7-1 nur empfohlene Zahlenwerte für die Teilsicherheitsbeiwerte und die Option drei verschiedener Nachweisverfahren für die Grenzzustände, über welche die nationalen Normungsorganisationen entscheiden können. Diese Unbestimmtheit ist zwar einerseits ein erheblicher Nachteil für den Eurocode, andererseits bedeutet dies aber eine Offenheit, die eine Übernahme und Einführung einer solchen Norm nicht nur in Europa, sondern auch weltweit attraktiv macht. Allerdings ist eine weitere Harmonisierung in Europa in der Zukunft unbedingt erforderlich, um die Konkurrenzfähigkeit der Bauindustrie zu verbessern.
Literatur
CEN (2003): Commission recommendation of 11 December 2003 on the implementation and use of Eurocodes for construction works and structural construction products (2003/887/EC). Official Journal of the European Union, 19.12.2003, EN, L 332/62 & 63;
Europäische Kommission (2002): Leitpapier L – Anwendung der Eurocodes. Schriften des Deutschen Instituts für Bautechnik, Reihe LP, Heft L;
Orr, T. L. L. (2008): The Story of Eurocode 7. Mitteilung 61 des Instituts für Geotechnik: Von der Forschung zur Praxis. Stuttgart 2008.





























