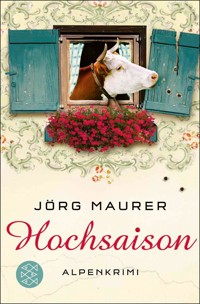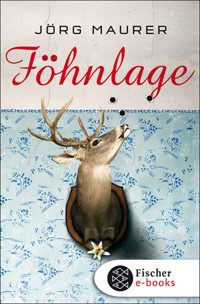17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Jennerwein ermittelt
- Sprache: Deutsch
Literarisch morden mit Kommissar Jennerwein:Der neue Roman von Nr.1-Bestseller-Autor Jörg Maurer Die Mitglieder des virtuellen Lesezirkels ›Salomes Lesekränzchen‹ sind Literatur-Enthusiasten. Dass sich ausgerechnet ein Kultusminister abschätzig über das Lesen der Klassiker und die korrekte Rechtschreibung äußert, macht sie wütend. Aus Protest inszenieren sie Verbrechen der Weltliteratur. Ob eine Puppe, auf deren Kopf ein Apfel von einem Pfeil durchbohrt wird, oder eine gestohlene Leiche, kopfüber im Kamin der Rue Morgue in Paris – die Aktionen werden von Mal zu Mal spektakulärer. Was kommt als Nächstes – Dostojewski, Shakespeare, Kafka? Dann geschieht wirklich ein Mord, das Opfer trägt ein mit Blut geschriebenes Hölderlin-Zitat auf der Brust. Alles deutet auf die Mitglieder des Lesezirkels hin. Kommissar Jennerwein soll den Fall übernehmen. Denn nur er kann mit seinem berühmten Blick für das Besondere den Tatort wirklich lesen – und nur er kann verhindern, dass der Täter das letzte Wort hat. Der 16. Fall für Jennerwein: Literatur, Mord und Humor unnachahmlich kombiniert
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jörg Maurer
Kommissar Jennerwein und der tintendunkle Verdacht
Roman
Über dieses Buch
Der sechzehnte Fall für Kommissar Jennerwein
Die Dichterfürsten Goethe und Schiller lassen sich vom Maler Tischbein am Ufer der Ilm portraitieren, bevor sie einen Spaziergang durch Weimar machen. Ihr Ziel ist das erste Treffen von „Salomes Lesekränzchen“. Dort haben sich zahlreiche Literaten versammelt, darunter auch ein etwas ungehobelter Mann mit Lederjacke und ein unscheinbarer Herr im Straßenanzug, die sich nach der Begrüßung der eleganten Salonnière Salome als Bertolt Brecht und Franz Kafka vorstellen. Moment mal – was geht hier vor?
Svenja Weber weiß es: sie und andere Literaturbegeisterte sind Mitglieder eines sehr besonderen Lesezirkels, dessen Teilnehmer sich nur als die Dichter kennen, die sie in einer virtuellen Weimarer Klassikwelt verkörpern. Sie alle lieben die Welt der Geschichten und gehen ungewöhnliche Wege: mit spektakulären Aktionen wollen sie die Bedeutung der Klassiker deutlich machen. Dabei fragt sich Svenja Weber, wie weit manche von ihnen wohl bereit sind zu gehen. War es ein Fehler, dass sie Kommissar Jennerwein, den sie bei einem Vortrag kennengelernt hat, vom virtuellen Lesezirkel erzählt hat?
Weitere Romane von Jörg Maurer:
›Föhnlage‹, ›Hochsaison‹, ›Niedertracht‹, ›Oberwasser‹, ›Unterholz‹, ›Felsenfest‹, ›Der Tod greift nicht daneben‹, ›Schwindelfrei ist nur der Tod‹, ›Im Grab schaust du nach oben‹, ›Stille Nacht allerseits‹, ›Am Abgrund lässt man gern den Vortritt‹, ›Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt‹, ›Am Tatort bleibt man ungern liegen‹, ›Den letzten Gang serviert der Tod‹, ›Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel‹, ›Kommissar Jennerwein darf nicht sterben‹, ›Shorty‹ und ›Leergut‹.
Die Webseite des Autors: www.joergmaurer.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jörg Maurer liebt es, seine Leserinnen und Leser zu überraschen. Er führt sie auf anspielungsreiche Entdeckungsreisen und verstößt dabei genussvoll gegen die üblichen erzählerischen Regeln. In seinen Romanen machen hintergründiger Witz und unerwartete Wendungen die Musik zur Spannungshandlung.
All dies hat Jörg Maurer auch schon auf der Bühne unter Beweis gestellt. Als Kabarettist feierte er mit seinen musikalisch-parodistischen Programmen große Erfolge und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Seine inzwischen sechzehn Jennerwein-Romane sind allesamt Bestseller. Seine Romane »Shorty« und »Leergut« waren ebenfalls erfolgreich.
Jörg Maurer lebt zwischen Buchdeckeln, auf Kinositzen und in Theaterrängen, überwiegend in Süddeutschland.
Impressum
Zu diesem Buch ist bei Argon ein Hörbuch erschienen.
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie, Zürich
Coverabbildung: Shutterstock
ISBN 978-3-10-492016-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Nachwort
Schlussworte
[Newsletter-Anmeldung]
1
Goethe war einen Kopf kleiner als Schiller. Der Maler Tischbein, der die beiden portraitierte, blickte von seinen Skizzenblättern auf und fragte wie nebenbei:
»Sollen wir diese Tatsache eher verbergen oder hervorheben?«
Der laue Frühsommermorgen des Jahres 1806 hatte die Landschaft in ein verheißungsvolles, unwirkliches Licht getaucht, die Ilm floss träge und unbestimmt glitzernd dahin, drei Ruderboote glitten lautlos hintereinander her und verschwanden in Richtung Norden. Weimar flackerte.
»Er ist Maler und Er hat Augen, Tischbein«, erwiderte Goethe mit dem Nachdruck eines Menschen, der es gewohnt war, eher in druckbaren Sentenzen als in gewöhnlichen Sätzen zu sprechen. »Male Er also einfach das, was Er sieht.«
»Nein, keineswegs!«, widersprach Schiller. »Tischbein, liebster Freund! Auch Ihnen schlägt ein fühlendes Herz in der Brust. Malen Sie also das, was Sie empfinden!«
»Ich werde den einen auf diese, den anderen auf jene Weise portraitieren«, versetzte Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Spross einer weitverzweigten Malerfamilie, diplomatisch.
Er hatte das Flussbett der Ilm als Hintergrund gewählt und den beiden vorgeschlagen, sich am begrünten Uferstreifen einander gegenüberzustellen. Sie fassten sich an den Händen, drückten diese fest, so, als ob sie sich nach langer Zeit endlich wieder überraschend begegnet wären. Diese Überraschung eine geschlagene Stunde beharrlich durchzuhalten, war für die großen Dichter allerdings anstrengender als gedacht. Der Händedruck war Schillers Idee gewesen, die lange Trennung der Freunde die von Goethe. Tischbein arbeitete sorgfältig, aber schnell. Er skizzierte die Umrisse der Figuren mit Kohle und mischte dazwischen immer wieder die Farben an, die für Details wie Kleidung, Landschaft und Gelüft notwendig waren. In einer Pause durften die beiden hochrangigen Modelle einen Blick auf die Leinwand werfen. Sie konnten eigentlich nur Striche, geschwungene Linien und hingeworfene Farbkleckse ausmachen.
»Aber einfach und stumm schläft in der Skizze die Kraft«, zitierte der Geheimrat sich selbst.
»Man hat gewissermaßen den Urgoethe und den Urschiller vor sich«, fügte Schiller hinzu, indem er auf zwei besonders kindlich anmutende Strichmännchen deutete.
Eine weitere halbe Stunde mussten sie noch überrascht und hocherfreut posieren, dann wollte Tischbein alleine weiterarbeiten. Schiller und Goethe traten in der Aufmachung, in der sie sich befanden (prächtiger Putz, gebürstete Perücke, gewienerte Schuhe, leicht geschminkte Gesichter), den Rückweg Richtung Stadtkern an. Sie kletterten die Uferböschung empor, philosophierten über die Kunst im Allgemeinen, über die Literatur im Speziellen und über die deutsche Literatur im ganz Besonderen, gelangten so, vorbei an der Hofschmiede des Fürstenhauses und über den Frauenplan auf die Esplanade, auf der schon einige fein herausgeputzte Morgenspaziergänger mit silberbeschlagenen Spazierstöcken und seidenbespannten Sonnenschirmchen zu sehen waren. Es gab kaum einen Flaneur, der die beiden Hochkaräter nicht ehrerbietig grüßte, manche verneigten sich vor so viel geballter Klassik, doch niemand machte einen Versuch, die großen Söhne der Stadt anzusprechen.
Sie schritten nebeneinander her, wobei Goethe der Größenunterschied weniger auszumachen schien als seinem Freund. Wohl um das ständige Aufschauen und einseitige Kopfdrehen während des Gesprächs zu vermeiden, richtete Goethe seine Worte nach vorne und leicht nach unten, wie wenn er zu den frisch verlegten Pflastersteinen oder zu einem vorauseilenden Pudel sprechen würde. Durchaus, edler Freund, ja, ich begreife. Ich fühle mit Ihnen. Da bin ich mit Ihnen ganz d’accord. Schiller schien seine Statur mehr Schwierigkeiten zu bereiten. Wie viele Menschen seiner Größe nahm er bisweilen eine leicht gekrümmte Haltung ein, was gleichzeitig linkisch und herablassend wirkte. Der eine oder andere der Passanten machte hinter vorgehaltener Hand gar eine diesbezügliche Bemerkung über das Dichterpaar. Auch sie selbst hatten vor Monaten herzlich gelacht über die spaßigen Clowns des Königlich Privilegierten Wander-Circus Renz, der etwas außerhalb von Weimar gastierte. Harlekin und Bajazzo hatten eine respektable Parodie der beiden Ehrenbürger aufgeführt. Der Manegengoethe Harlekin führte einen leibhaftigen Pudel spazieren, der Stelzenschiller Bajazzo zielte mit der Armbrust auf einen Apfel, der auf dem Kopf des anderen befestigt war. Damals hatte es viel Applaus für das schrille Intermezzo gegeben, und auch jetzt auf der Esplanade verhalfen ihnen die unangemessen stattlichen Kleider, die ja eigentlich für das Tischbein’sche Doppelportrait ausgesucht worden waren, zu einem komödiantischen Effekt. Goethe steckte in türkisch anmutenden schwarzen Pluderhosen, die mit silbernen Streifen durchwirkt waren, das pfefferminzgrüne Wams blitzte aus dem dicken blauen Wollmantel heraus, eine imposante, reich verzierte Gürtelschnalle umfing seine Leibesmitte, auf dem Kopf saß ein verwegener Landsknechthut mit lederner Krempe und wehender Feder. Schiller trug eine sandfarbene Jacke mit einem aufgeschlagenen, riesigen rostroten Kragen, dazu eng geschnittene, wässrig blaue Kniebundhosen nach französischer Art. Es war, als hätten beide unbestimmte märchenhafte Paradeuniformen angelegt. Ein kleines Mädchen kam angelaufen und reichte Goethe ein Blumensträußchen, Knicks inbegriffen.
»Selbstgepflückt!«, rief der stolze Vater, Hofrat Nesenius, aus dem Hintergrund. »Es ist uns eine Ehre, dass diese Blumen den Weg aus unserem bescheidenen Gärtchen zu Dero hochmögender Brust gefunden haben.«
Schiller konnte sich eines Schmunzelns nicht enthalten. Der so Angesprochene steckte sich das Sträußchen ans Revers, das Mädchen rezitierte nach einem dezenten Wink der Mutter: Über allen Wipfeln ist Ruh …, jedoch schon bei spürest du blieb sie stecken, auch ein Soufflieren seitens Goethe persönlich kaum … einen … was? … half nichts. So bedankten und verabschiedeten sie sich von der Familie Nesenius und spazierten weiter, die angenehm schattige Lindenallee entlang, an einem opulenten Springbrunnen in der Nähe des Stadttheaters vorbei, immer Richtung Stadtkern. Die Sonne ruckelte durch die Frühsommerwolken, dazu roch es jetzt eklatant nach Bratfisch, der von einem der vielen Marktleute aus einer Bretterbude heraus angeboten wurde. Sie verließen die Esplanade, die Gassen wurden enger und das Treiben der Menge munterer. Die Damen knicksten, die Herren lüpften die Hüte und setzten sie sorgfältig wieder auf, darauf achtend, dass die mit Pomade fixierten Scheitel oder die mühsam angeklebten Toupets nicht Schaden litten. Durch das ständige Auf und Ab der Kopfbedeckungen glich die Rittergasse einem unruhigen Wasserlauf, aus dem schwarzglänzende Unken sprangen, um sofort wieder lautlos einzutauchen. Der Topfmarkt kam in Sicht. Hier tummelten sich die emsigen Vertreter der arbeitenden Bevölkerung. Der Schneider Wiesmayer, zu Reichtum gekommen durch Verkäufe an die Kleiderkammer des preußischen Heeres, gesellte sich zu ihnen. Wiesmayer hatte Goethe schon ein paar Röcke geschneidert, er konnte es wie immer nicht lassen, ihn nach seinem neuesten Wirken zu befragen.
»Vielleicht schreiben Sie mal wieder was wie den Werther?« Er schnitt ein verschmitztes Gesicht und boxte spielerisch in die Luft. »Wie wär’s? Ab und zu ein Skandälchen kann doch nicht schaden, finden Sie nicht auch?«
Goethe und Schiller verabschiedeten sich so höflich wie möglich und gingen seufzend weiter. Auch Schiller fürchtete nichts so sehr wie die Frage, wann er denn die Fortsetzung der Räuber schreiben würde. Je näher sie dem Topfmarkt kamen, desto größer wurde der Lärm. Schiller hielt sich die Ohren zu. Er war ausgesprochen geräuschempfindlich. Marktschreier brüllten ihre Angebote von den Holzwagen herab, jeder versuchte den anderen an Lautstärke und ungehobelter Wortwahl zu übertrumpfen. Lieferanten, Bettler, Schausteller, versprengte Militärs, auch Märchenerzähler und allerlei fahrendes Volk, laut betende Nonnen, die aus der Stadtkirche quollen, und Wanderlieder singende Ausflügler ließen ein ohrenbetäubendes Inferno entstehen. Ein großes Pferdefuhrwerk schlingerte um die Ecke, das morsche Holzgeländer des Anhängers brach, alle Fässer gerieten ins Rutschen und fielen polternd aufs Kopfsteinpflaster. Man schimpfte und lachte. Aus allen Richtungen, in gleichbleibend schmerzhafter Lautstärke, war das Stakkato des Peitschenknallens zu vernehmen. Gleich vier Equipagen fuhren auf den Platz, es waren strahlende Kutschen mit anmutigen englischen Pferden, die Kutscher standen auf den Böcken und ließen ihre Siebenschwänzigen so geräuschvoll durch die Luft flattern, dass sich die allgegenwärtigen Ratten erschrocken in die Getreidekeller verzogen.
»Feinste Bratwürste! Echt Thüringer Roster! Frisch vom offenen Feuer!«
Auf dem Dach einer aufgeschlagenen Bratwurstbude stand breitbeinig und barfuß ein wirrhaariger Geselle und pries seine Waren mit Hilfe eines blechernen Trichters an, durch den er sein Innerstes nach außen kehrte. Nachdem er sich heiser geschrien hatte, schwärmten einige seiner Helfer aus und mischten sich unter das gaffende Publikum. Sie liefen brüllend zwischen den Passanten hin und her und hielten ihnen die dampfenden Erzeugnisse Altthüringer Metzgerskunst vor die Nase. Einer der Schreihälse trat auch zu den beiden Dichterfürsten, ließ die heißen, fetttriefenden Bratwürste über seinem Kopf tanzen und pries den Inhalt:
»Schweinebacke ohne Schwarte von Thüringer Keilern, geschlegeltes Kalbsbrät, Majoran, würziger Kümmel, dazu einige geheime orientalische Zutaten!«
Schiller hüstelte. Er glaubte, ordinären Branntwein durch den Bratwurstdampf hindurch zu riechen. Er war nicht nur geräuschempfindlich, sondern auch geruchs-, geschmacks-, licht- und berührungsempfindlich. Es waren ideale Voraussetzungen für einen klassischen, fünfhebigen Dramatiker, doch auf der Straße schien der Olympier Spuren von Überforderung zu zeigen. Goethe vollführte eine herrische, abweisende Handbewegung, der rohe Geselle trollte sich brav und suchte nach neuen Opfern.
»Mein lieber Freund«, begann Friedrich Schiller, als sich der Lärm wieder etwas beruhigt hatte, »was halten Sie von der Idee des großen Napoleon, jedem Menschen das Lesen und Schreiben beizubringen, ohngeachtet seines Standes, seiner Herkunft, seines Geschlechts, seines Glaubens, seines Charakters, seiner Nationalität, seiner Religion und seiner sonstigen Wesenszüge? Alle sollen lesen können.«
»Wirklich alle?«, unterbrach Goethe mit einem spöttischen Unterton. »Nun ja, im Grunde ist das eine menschenfreundliche Idee, der ich nicht abgeneigt bin zuzustimmen. Es könnte aber doch sein, dass eine allgemeine Schulpflicht über das Ziel hinausschießt. Nicht jeder wird einen Vorteil darin sehen, wenn alle, vom Bauern bis zum Lohnknecht, vom Waldarbeiter bis zur Kellnerin, des Lesens kundig sind. Vom Schreiben ganz abgesehen!« Goethe hob die Hand und wies auf die Menge, die den Marktplatz füllte. »Der Großteil des Volkes ist nun einmal illiterat. Und wird es immer bleiben. Bedenken Sie: Eine allgemeine, Tröpfe und Narren gleichermaßen erfassende Schulpflicht haben bekanntlich schon die alten Römer eingeführt. Bis in die entlegensten Provinzen und durch alle Stände hindurch war halb Europa des Schreibens und Lesens kundig. Und was, mein lieber Freund, ist aus dem römischen Reich geworden? Es ist zerbrochen wie ein alter Nachttopf. Doch ein Großteil der Menschen ist seitdem fast zweitausend Jahre ohne Grammatik und Rechtschreibung ausgekommen.« Goethe blickte hoch zu Schiller. »Aber lieber Freund, mon cher ami – was hat Sie gerade zu diesem Thema geführt?«
Schiller wies auf die Bretterbude mit den Thüringer Würsten, vor der sich schon eine kleine Schlange gebildet hatte. Das Geplärre hatte gewirkt.
»Stellen Sie sich vor, dort oben an der Bude hinge ein einfaches, weithin lesbares Schild: 1A THÜRINGER BRATWÜRSTE, 3 STÜCK 2 GROSCHEN. Alle könnten dieses Schild lesen und niemand bräuchte herumzuschreien.«
Goethe nickte lächelnd. Schiller wies mit einer halbkreisförmigen Armbewegung quer über den Topfmarkt. Zu den Kutscherständen, an denen lauthals um Fahrpreise gefeilscht wurde. Zu der kleinen Apotheke, dessen Inhaber mit quäkender Stimme Salben und Tinkturen anpries, als ginge es um Leben und Tod. Zum gegenüberliegenden Blumenladen, vor dem sich eine Schar aufgeregter und wild durcheinanderrufender Menschen versammelt hatte.
»Das geschriebene Wort würde den Lärm auf der Welt verringern, glauben Sie es mir, edler Geistesbruder. Dieser Marktplatz hier wäre zum Beispiel so still wie eine Zisterzienserbibliothek.«
Wie um Schillers These zu bestätigen, ließ das Getöse etwas nach, als ob sich alle Marktschreier zu einem effektvollen Decrescendo verabredet hätten. Doch in die relative Stille hinein ließen die Kutscher bald wieder die Ochsenziemer sprechen und zogen dadurch die anderen Lärmquellen mit empor.
»Das Peitschenknallen werden Sie auch mit einer allgemeinen Schulpflicht nicht abschaffen können«, sagte Goethe. »Das Peitschenknallen kann nicht schriftlich formuliert werden. Das wird es auch in zweihundert Jahren noch geben.«
Der Himmel hatte sich bewölkt. Über der fernen Ilm schien sich etwas zusammenzubrauen. Ein Blitz zuckte quer durch den Himmel über Weimar, heftig, aber lautlos, als wollte das Gewitter nicht auch noch zum allgemeinen Getöse beitragen. Trotzdem sah es so aus, als ob der Marktplatz erzitterte. Schiller blieb stehen und reckte den Kopf.
»Ich träume von einem geräuschlosen, wattigen Elysium«, sagte er. »Ohne Militärkapellen, Trommelwirbel, schallendes Gelächter, Kanonendonner, Streitgespräche – und Peitschenknallen.«
»Es ist ein idealer Traum, den Sie da träumen.«
Schiller lächelte versonnen. Sie duzten sich auch nach so langer Zeit der Bekanntschaft nicht, beide blieben beim distanziert-freundschaftlichen Sie. Und das sollte auch so bleiben. Doch jetzt stieß Schiller einen leisen, überraschten Pfiff aus. Sein Blick war auf den übermannshohen Boxring gefallen, der wohl erst in den Morgenstunden in der Mitte des Marktplatzes aufgebaut worden war. Goethe wandte sich seufzend ab. Er wusste, dass sein Freund dieser Leidenschaft frönte, sei es passiv als begeisterter Zuschauer, sei es aktiv im Rahmen der Leibesertüchtigung. Schiller hatte in der württembergischen Militärakademie Boxen gelernt und er ließ keine Gelegenheit aus, diesem Vergnügen nachzugehen. Goethe selbst war der Sport zu roh. Doch Schiller war schon auf dem Weg zum Ring. Da gab es für ihn kein Halten mehr. Im Gehen nahm er die Perücke ab, warf die Jacke von sich, zog sich das wallende Satinhemd über den Kopf und entledigte sich seiner Schmuckstücke und der Uhr. Einige der Umstehenden klatschten und johlten dem Herausforderer zu.
»Neuer Kampf, neues Glück!«, ließ sich der Impresario vernehmen.
So kahlköpfig und muskulös wie Schiller jetzt dastand, wurde er von den Umstehenden allerdings nicht als der Verfasser von landauf, landab gespielten Dramen erkannt. Ein paar der Menschen, die nahe am Ring standen, musterten Schiller und seine leptosome Statur sogar abschätzig und wetteten. Kaum einer setzte auf ihn. Der Schöpfer von Maria Stuart stieß ein paar Mal mit den bloßen Fäusten spielerisch in die Luft, wie um sich seiner Finten aus dem Dienst beim Heer von Herzog Karl Eugen zu erinnern. Im Boxring selbst waren zwei Männer zu sehen, der Jahrmarktboxer, der in der Ecke saß und seine Hände mit einem grausam wirkenden Lächeln knetete, und der Impresario, der den Zuschauern die Regeln erklärte. Der Herausforderer war dann Sieger, wenn er den großen Boldoni innerhalb von zehn Runden zu Boden schickte oder auf eine andere Weise zum Aufgeben zwang. Schaffte er das in der vorgegebenen Zeit nicht, hatte er verloren. Diese Art der sportlichen Auseinandersetzung kam angeblich aus England (so ähnlich wie das Wasserbett, die Streckbank, das Reisebüro, die Spinnmaschine, der Logarithmus, der Radiergummi, die Eisenbahn, das Mieder, die gothic novel …), das Spektakel wurde bare-knuckle fighting genannt. Schiller griff in seinen Lederbeutel und holte einen glänzenden Taler heraus. Der Impresario versprach, ihn im Falle seines Gewinns zu verfünffachen. Im anderen Fall wäre der Taler verloren. Der große Boldoni erhob sich und schlurfte in die Mitte des Rings. Auch sein Schlurfen hatte etwas Grausames. Goethe befand sich in einigem Abstand, aber mit guter Sicht auf das Gerüst, den Kampf selbst wollte er sich allerdings nicht ansehen. Einem plötzlichen Einfall folgend, zog er einen Notizzettel aus der Tasche und warf Skizzen aufs Papier, die Physiognomie des Jahrmarktboxers betreffend. Dessen Gesicht war – ja, wie nannte man diesen Blick? Unzufrieden? Distanziert? Missbilligend? Stumpfsinnig? Was hätte der große Gotthold Ephraim Lessing jetzt gesagt? Goethe notierte sich einige Ausdrücke. Nervös. Geistesabwesend. Verblüfft. Uninteressiert.
»Trostlos«, sagte ein kleiner, jungenhaft wirkender Mann mit kurz geschorenen, pechschwarzen Haaren, großen, abstehenden Ohren und dunklen, traurigen Augen.
Er trug einen mausgrauen Straßenanzug und war plötzlich neben ihm aufgetaucht.
»Wie meinen?«, murmelte Goethe, ohne aufzusehen.
»Trostlos trifft es am ehesten«, versetzte der Fremde. »Und Sie wissen ja besser als ich: Jedes einzelne Wort muss sitzen. Ein Faustschlag kann danebengehen. Das Wort muss treffen. Und wenn es trifft, trifft es wirkungsvoller als ein Faustschlag.«
Goethe blickte auf. Er kannte den sonderbar gekleideten Fremden nicht, er war sich sicher, ihn noch nie gesehen zu haben. Goethe nickte zerstreut und notierte weiter. Besonnen. Nachdenklich. Überrascht. Hochmütig.
»Entschuldigen Sie«, sagte Goethe, während er noch einige weitere Möglichkeiten, dem Boxer adjektivisch beizukommen, aufschrieb, »aber ich befinde mich in der Verlegenheit, Ihren Namen nicht zu kennen.«
Als er wieder aufsah, war der Mann verschwunden. Goethe schrieb weiter. Die Feder tanzte über das Papier. Ein Begriff jagte den anderen. Er hatte immer etwas Schreibzeug in der Rocktasche. Wenn er einmal am Schreiben war, konnte er kaum mehr aufhören. Abwesend. Automatenhaft. Nicht von dieser Welt. Unambitioniert. Absent. Gedankenverloren. Zerfahren. Entrückt. Versunken. Teilnahmslos. Ungerührt. Imbezill … Der jungenhafte Mann hatte vielleicht recht gehabt: Trostlos traf es am ehesten.
Der Impresario zog an der Glockenschnur. Schiller stieg in den Ring und tänzelte dort spielerisch und in leicht gebückter Haltung vor und zurück, nach rechts und nach links. Der Jahrmarktboxer blinzelte ihn spöttisch an und schüttelte den Kopf. Die Glocke erklang drei Mal kurz hintereinander. Über den Marktplatz senkte sich jetzt spannungsgeladene, atemlose Stille. Schiller selbst, Friedrich von Schiller, der gestern noch seinen Aufsatz Über das Erhabene bei Hofe vorgetragen hatte, bemerkte es schon nach den ersten tastenden Schlagversuchen. Sein Gegner war lediglich auf Verteidigung aus. Der große Boldoni war ohne jeden Zweifel dazu fähig, jederzeit hart und humorlos zuzuschlagen. Aber das wäre schlecht fürs Geschäft gewesen. Allzu viel Blut, Knochensplitter und ausgeschlagene Zähne hätten weitere zahlende Bewerber abgehalten. Also verzichtete er darauf. Schiller versuchte eine erste Kombination links, halbrechts, links. Der andere wich geschickt aus und telegraphierte eine lange Gerade, aber so, dass sie nicht völlig überraschend kam. Goethe notierte weiter in sein Büchlein. Gelangweilt. Pikiert. Träge. Entgeistert.
»Na, Herr Geheimrat, immer auf Motivsuche, wie?«, ließ sich eine Stimme aus der Menge vernehmen.
Das war Zwickenpflug, der Weinhändler. »Wird’s diesmal ein Schauspiel? Sie haben so etwas Dramatisches in Ihrer Miene, Herr von Goethe. Jeder Blick ein Auftritt, jeder Wimpernschlag ein Aktschluss!«
Goethe nickte nur und schrieb weiter. Er war jetzt nicht auf schmeichlerische Konversation aus. Er musste Begriffe finden. Um Schillern machte er sich keine Sorgen. Schiller stand solche Kämpfe durch.
Goethe lag mit seiner Annahme völlig richtig. Schiller hielt sich prächtig. Das anfangs skeptische Publikum war jetzt auf seiner Seite und spendete ihm sogar reichlich Beifall. Mit gefährlich aussehenden, aber im Grunde harmlosen Finten hielt sich der große Boldoni seinen Gegner vom Leib. Er wusste auf jeden Hieb, jeden Haken und jeden Schwinger eine Antwort. Das ärgerte den Olympier. Seine Schläge wurden jetzt von Wut angetrieben. Das war nicht gut. Und der andere schien sich darüber zu amüsieren.
»Ist das nicht Schiller?«, sagte ein Zuschauer zu einem anderen. »Wenn man sich die Glatze wegdenkt und eine Perücke hinzu, wäre es möglich.«
»Nein, das kann nicht sein«, erwiderte der andere. »Schiller ist letztes Jahr gestorben.«
»Tatsächlich?«
»Ja, im Jahre 1805. Ich war bei der Beerdigung mit dabei. Auf dem Jacobsfriedhof.«
Rechtsausleger, kurzer Schrittwechsel, linke Gerade, Finte, Counterpunch – und plötzlich wurde Schiller getroffen. Es war kein schwerer Treffer, eher ein Streifschlag am linken Ohr. Das war entwürdigend. Schiller kochte vor Wut. Dieser Gegner machte mit ihm, was er wollte. Schiller wich ein paar Schritte zurück. Er brauchte einen Plan.
Goethe blickte wieder auf. Nicht, dass er sich Sorgen um seinen Freund gemacht hätte. Er wusste, dass alles nur Kulisse und Show war. Der Boxer schlug nicht zu, sein Geschrei war unecht. Schiller würde nichts geschehen, aber er hatte auch keine Chance zu gewinnen. Der Taler war verloren. Goethe blickte auf die Turmuhr. Er musste sich beeilen, wenn er zu seiner Verabredung nicht zu spät kommen wollte. Es handelte sich um einen neu gegründeten literarischen Zirkel. Man hatte ihn und Schiller gebeten, sich in der Jacobsgasse einzufinden. Dort veranstaltete eine gewisse Salome, vermutlich eine Dame höheren Standes, einen Jour fixe mit ausgesprochen interessanten, literarisch hochgebildeten Menschen. Goethe liebte Salons. Deshalb hatte er diese Einladung angenommen. Erstaunlich wendig für sein vorgerücktes Alter drängte er sich durch die Menge, konnte eine Wahrsagerin abschütteln, die ihn an der Hand fasste und darin lesen wollte, schob einige Bettler beiseite, wich einem Spielmannszug aus und hatte das Haus der Salonnière bald gefunden. Ein großes Schild in einer matt leuchtenden Schrift prangte über der Eingangstür: SALOMES LESEKRÄNZCHEN. Auf der Schwelle wäre er fast mit einem frech dreinblickenden Gesellen in viel zu großer Lederjacke zusammengestoßen, der eine starke Brille trug. Er rauchte eine Zigarre, blies Kringel in die Luft und machte keine Anstalten, sich zu entschuldigen. Stattdessen sagte er:
»Hallo, Wolfi!« Als ihm Goethe die Antwort schuldig blieb, setzte er hinzu: »Schön, dass du auch da bist.«
Goethe zuckte irritiert zusammen. Wer wagte, ihn in solch unpassender Weise anzusprechen? Er reagierte jedoch nicht auf den Affront und wandte sich ab. Bevor er das Haus endgültig betrat, blickte er sich nochmals um. Der Himmel über Weimar war von einem strahlenden, unechten Blau gefärbt. In südöstlicher Richtung stiegen einige Wolken über der Ilm auf. Über den Horizont zogen sich die sanft begrünten Hügel des Thüringer Waldes. Im Vordergrund, ganz rechts unten im Blickfeld, war in großen und säuberlichen Lettern eine Signatur zu lesen:
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Juni 1806
2
Erwartungsvoll schritt Goethe die breite Wendeltreppe hinauf, die in den vierten Stock führte. Ihm fiel auf, dass die Stufen aus edlem Holz gearbeitet waren, die Trittbretter waren in solch großzügigen Abständen verlegt, dass man durch sie hindurch in die Tiefe schauen konnte – von Stockwerk zu Stockwerk ein erhabenerer Anblick, wie er fand. Als er den Salon betrat, verstummten die Unterhaltungen. Seine Augen mussten sich erst an das schummrige Kerzenlicht gewöhnen, doch er schätzte, dass sich vielleicht fünfzehn oder zwanzig Personen in dem kleinen Raum befanden. Vereinzelt wurde getuschelt. Ist er das? Ist das wirklich Goethe? Sie wissen schon, der mit dem Werther. Ich habe ihn mir älter vorgestellt! Nein, jünger! Und wo ist Schiller? Auch der livrierte Geiger, der in einer Ecke mit Inbrunst getragene Weisen spielte – das Lied vom Lindenbaum hatte man bis auf die Straße gehört –, ließ sein Instrument sinken und gaffte Goethe mit offenem Mund an. In der Mitte des Salons standen bequeme Sessel, sie waren auf ein kleines Podest mit Stehpult ausgerichtet, das aus feinstem, mit edlen Intarsien verzierten Nussbaumholz gearbeitet war. Überhaupt ließ die Ausstattung des Raumes nichts zu wünschen übrig. An den Wänden waren Kupferstiche mit Portraits einflussreich dreinblickender Menschen zu sehen, von der Decke hing ein prächtiger Lüster aus Kristallglas, das Flackern der Kerzen wurde durch die geschliffenen Muranosteine vervielfacht. Die meisten der Anwesenden standen unschlüssig herum, einige hatten schon Platz genommen. Instinktiv stellte sich Goethe, gewohnt, überall den gesellschaftlichen Mittelpunkt zu bilden, an den hellsten Platz des Raumes, nämlich unter den Lüster. Dort verharrte er in einer höfisch wirkenden Pose. Ein dienstbarer Geist näherte sich und verbeugte sich tief.
»Wünschen der Herr Geheimrat eine Erfrischung?«, flüsterte er, mehr zu einem verschlungenen Ornament im Teppich als zu Goethe. »Etwas Mandelmilch vielleicht? Oder am Ende gar schon ein Glas Wein?«
»Danke«, antwortete Goethe und setzte in einer Anwandlung von Leutseligkeit hinzu: »Ich verspüre im Augenblicke keine besonderen Bedürfnisse, weder in die eine noch in die andere Richtung.«
Verwirrt zog sich der Diener zurück. Goethe sah sich nach einem freien Platz um und musterte dabei die Anwesenden genauer. Es war eine bunte Schar von Gästen in allen Lebensaltern, das Auffällige daran war, dass jeder von ihnen in einer vollkommen anderen Mode gekleidet war. Es wirkte fast so, als ob es hier in erster Linie darum ginge, eine möglichst originelle und breite Stilvielfalt an Gewandungen und Kopfbedeckungen zu bieten. Das bunte Gemisch aus Allongeperücken, Reithosen, mausgrauen Straßenanzügen, Lederjacken und grellfarbenen Stoffüberwürfen begann, den feinen Geschmack Goethes aufs peinlichste zu bedrängen. Im Salon schien so etwas wie eine Modenschau stattzufinden. Auch war Goethe geneigt zu glauben, dass sich viele Ausländer unter den Besuchern befanden, so fremdartig war die Kleidung mitunter, von den oft undefinierbaren Accessoires ganz zu schweigen. Einem baumelte ein Zierdegen an der Seite, andere wedelten mit Fächern, wieder andere hielten Lorgnons vors Auge, um den Neuling zu mustern. Einer der Herren trug eine seltsam geformte Kappe mit langem Schirm und der Aufschrift Miami Beach. Goethe war froh, in der abenteuerlichen Garderobe erschienen zu sein, in der ihn Tischbein gemalt hatte. Derart herausgeputzt ging er unter normalen Umständen nicht aus dem Haus. Doch bei dieser Matinée schien er angemessen ausstaffiert zu sein. Der Einladungszettel hatte keine Kleiderordnung enthalten. Dort stand auch nicht geschrieben, wer genau ihn hier erwartete. Er hatte nur so viel erfahren, dass eine weitgereiste und hocherfahrene Salonnière namens Salome (die sich als Dame von edlem Geblüt mit tief empfindsamem Hintergrund bezeichnet hatte) die Veranstaltung von zarter Hand leiten sollte. Von zarter Hand – das waren ihre eigenen Worte gewesen. Goethe hoffte, dass keine reine Vorlesestunde geplant war, bei der auch er unweigerlich gebeten werden würde, etwas aus seinen eigenen Werken zum Besten zu geben, womöglich aus dem Gedächtnis und am Ende den Erlkönig.
Dass keiner der Anwesenden Anstalten machte, ihn anzusprechen, führte er darauf zurück, dass sie alle in Ehrfurcht erstarrt waren angesichts des großen Geistes, der ihnen plötzlich so nahe war. Goethe setzte eine versöhnliche, großväterliche Miene auf. Damit wollte er die kleine Schar der Verängstigten beruhigen und ihnen zeigen, dass auch er, trotz Zauberlehrling und Prometheus, ein ganz normaler Sterblicher war, der – wie hatte sich Humboldt neulich so treffend ausgedrückt? – auch nur mit Wasser kochte. Ein herrliches Idiom. In der Nähe der Tür stand ein spindeldürrer Mann mit faltigem Gesicht, schmalen Lippen und Knollennase, die hervortretenden Froschaugen spähten listig umher. Sein eigenartiger schwarzer Hut in Halbkugelform glich eher der Kopfbedeckung eines Viehhändlers oder Großbauern als der eines Besuchers literarischer Salons. Neben ihm, an den Türrahmen gelehnt, ein Knie hochgezogen, Rauchkringel an die Decke paffend, erblickte Goethe zu seiner Verwunderung den Zigarrenrüpel in der viel zu großen Lederjacke, mit dem er vorher am Hauseingang schon zusammengetroffen war und der ihn unschicklicherweise mit seinem Vornamen angesprochen hatte. Wolfi – so hatte ihn schon vierzig Jahre niemand mehr genannt. Jetzt rief der ungehobelte Lümmel mit quäkender Stimme in den Saal:
»Verdammte Unzucht! Was ist denn das für eine fade Gesellschaft! Jetzt bin ich doch fast im Stehen eingeschlafen.«
Der Mann mit dem Viehhändlerhut entgegnete:
»Ich weiß ja nicht, in welchen Gesellschaften Sie sonst verkehren, Herr Brecht, aber ich für meinen Teil habe mich bisher gut amüsiert. Lieber eine fade Gesellschaft, mit der man eine Gaudi hat, als eine lustige Gesellschaft, bei der einem fad ist.«
»Dialektisch gedacht, Herr Valentin!«
»Im Dialekt gedacht, Herr Brecht.«
Einige der Anwesenden zischten, ein paar drehten sich um und bedeuteten beiden, stille zu schweigen. Darunter war auch eine Dame, die nichts als ein Unterkleid zu tragen schien. Vielleicht war es auch ein Nachthemd. Jedenfalls konnte man einen Blick auf ihre nackten Knie erhaschen. Die Augen vieler waren an dieser unziemlichen Tatsache eine Sekunde lang hängengeblieben, doch jeder der Herren hatte den Blick sofort wieder diskret oder peinlich berührt abgewandt. Es war jedenfalls nicht die Garderobe, die einem Salon angemessen war. Goethe bemerkte, dass der jungenhafte Mann mit den großen, abstehenden Ohren und dem traurigen Blick ebenfalls anwesend war. Er hatte bisher mit dem Rücken zu den anderen gestanden, um die Kupferstiche und Radierungen an der Wand zu studieren. Als er sich umdrehte und Goethe erblickte, kam er mit einem kleinen, wehmütigen Anflug von Lächeln auf ihn zu.
»Es freut mich, Sie hier zu sehen, Herr von Goethe«, sagte er mit sanfter Stimme. Verschwörerisch fügte er hinzu: »Ich habe mein Leben lang auf dieses Zusammentreffen gewartet. Ich gehe jetzt und verlasse Sie.«
Damit wandte er sich ab.
»Halt, warten Sie!«, rief ihm Goethe nach und hob die Hände zu einer entschuldigenden Geste. »Bitte helfen Sie mir aus der Verlegenheit, Ihren Namen nicht zu kennen.«
Der Fremde kehrte um.
»Ich heiße Kafka«, entgegnete er leise und schüchtern, als ob es sonst niemand hören sollte. »Franz Kafka. Wohnhaft in Prag.«
»Hatte ich schon die Ehre, nähere Bekanntschaft mit Ihnen gemacht zu haben?«
»Ja, natürlich, vor einer halben Stunde, Sie erinnern sich vielleicht. Ich war es, der Ihnen vorgeschlagen hat, den Begriff trostlos für die Physiognomie des Jahrmarktboxers zu verwenden. Nicht unzufrieden, distanziert, missbilligend oder stumpfsinnig, schon gar nicht imbezill, sondern trostlos.«
»Das nennen Sie nähere Bekanntschaft?«
»Ich finde, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, sich kennenzulernen, als gemeinsam nach präzisen Begriffen zu suchen. Auch Eheleute sollten dies beherzigen.«
Goethe schüttelte verwirrt den Kopf. War er in eine Art Kostümfest geraten? Oder in eine Versammlung von Verrückten? Wieso waren Brecht, Valentin und Kafka anwesend? Als er darüber nachdachte, stieg eine leise Ahnung in ihm auf.
»Weiß jemand von den Herrschaften, wie sich die Matinée im Einzelnen gestalten wird?«, fragte er misstrauisch in die Runde. »Wird vorgelesen? Oder auswendig vorgetragen?«
»Hoffentlich nicht«, sagte Brecht. »Ich kann kein einziges meiner Gedichte auswendig.«
»Die sind auch wirklich schwer zu merken«, sagte Karl Valentin. »Da tut sich der Herr Kafka leichter. Kein Mensch verlangt, dass er einen seiner Romane auswendig vorträgt.«
»Romane?«, hohnlachte Brecht mit gellender Stimme. »Das sind keine Romane, das sind Bewerbungen um einen Therapieplatz.«
»Und Ihre Stücke, Herr Brecht«, hielt Valentin entgegen, »das sind keine Stücke, sondern Unterrichtsstunden, und zwar sechste Unterrichtsstunden mit einem schweren Stoff an einem sehr heißen Sommertag, wenn man eigentlich lieber zum Baden gehen will.«
»Mäßigen Sie Ihren Ton, meine Herren!«
Der Zwischenruf kam von einem Mann, der die ganze Zeit am Fenster gestanden hatte und immer wieder nervös hinausblickte. Er stand schief und ungesund, seine Körperhaltung hatte etwas Lauerndes. Sein Backenbart war zerzaust, sein langer, dunkler Mantel war mit einem Pelzkragen besetzt, der schon bessere Zeiten gesehen hatte. Goethe reckte sich. Ragte da aus seiner Manteltasche nicht ein Pistolenknauf? Und aus der anderen Tasche ein Perlencollier? Der grimmige Mann am Fenster wandte sich an Brecht.
»Sind Sie überhaupt eingeladen?«, fragte er ihn. »Dies ist schließlich eine literarische Gesellschaft.«
Bevor dieser antworten konnte, schaltete sich Karl Valentin ein. Sein Ton war gutmütig und verbindlich.
»Ja, so einer wird überall eingeladen, Fjodor Michailowitsch. Einen wie den Brecht braucht jede Gesellschaft. Um sich zu ärgern. Ohne Ärger kein Gaudium.«
Der angesprochene Fjodor Michailowitsch reagierte nicht darauf. Fjodor Michailowitsch?, dachte Goethe. Doch nicht etwa Fjodor Michailowitsch Dostojewski? Und es war tatsächlich ein Pistolenknauf, da war sich Goethe sicher. Und ein Perlencollier.
»Ich bin das Salz in der Suppe jeder faden Gesellschaft.«
Brecht nuckelte wie ein Säugling an seiner Zigarre und spuckte als Bestätigung seines Bonmots Tabakkrümel auf den Boden. Er schien sich in der Rolle des Enfant terrible ausgesprochen wohlzufühlen. Goethe drehte sich pikiert hüstelnd zur Seite. Mit einem Seidentuch tupfte er sich den Schweiß von der Stirn. Sein Gesicht zeigte Missmut und Gereiztheit. In was für einen Kreis war er hier nur geraten? Schalk und Neckerei ja, durchaus, immer wieder gerne, aber doch bitte in maßvollen Dosierungen. Er hatte sich den Nachmittag jedenfalls nicht gar so gewöhnlich vorgestellt. Unter anderen Umständen hätte er diese Veranstaltung verlassen. Doch die Neugier hielt ihn. Er sah sich um. Ein Mann mit keckem Schnauzbärtchen, auffälligen runden Augengläsern, einen Strohhut auf dem Schoss, den Irish Independent unter den Arm geklemmt, deutete auf einen leeren Stuhl neben sich. Goethe setzte sich auf den freien Platz, darauf achtend, dass er viel Beinfreiheit und überhaupt großen Abstand zu den übrigen Salonbesuchern hatte.
Auf dem Marktplatz war der Boxring von Hunderten johlenden Zuschauern umlagert. Der schlaksige Mann mit nacktem Oberkörper hatte sich inzwischen sieben Runden auf den Beinen gehalten. Das hatte man noch nie erlebt. Das war sensationell. Einen zwingenden Schlag hatte Schiller freilich noch nicht erzielen können. Aber der große Boldoni eben auch nicht. Doch während dieser gar nicht willens zu sein schien zuzuschlagen, wollte jener durchaus einen Treffer landen. Links, links, Halbgerade rechts, Flatterhand, Ausfallschritt, Gerade links. Es musste doch eine Möglichkeit geben, diesem einfallslosen Kerl, der routiniert, aber ohne jegliche Leidenschaft verteidigte, beizukommen. Schiller hatte es mit allen Finten versucht, die er kannte, doch der Mann war eine Maschine. Er musste der Maschine auf andere Weise begegnen. Er musste diesem Kerl das Seine geben. Moment mal: Er músste díesem Kérl das Séine gében. Das war ein lupenreiner fünfhebiger Jambus. Durch díese hóhle Gásse múss er kómmen. Das war vielleicht eine Möglichkeit. Er konnte ihn mit dem Rhythmus einlullen. Ihn mit dem Jambus in den Schlaf wiegen. Oder zumindest unaufmerksam werden lassen. Und dann plötzlich den Rhythmus ändern. Ohne jeden erkennbaren Grund aus dem Takt ausbrechen. Schiller atmete tief durch. Dass er da nicht früher darauf gekommen war! Links, links, kurz, links, links, kurz … Fünf Mal hintereinander. Boldoni behielt sein starres, unmenschlich wirkendes Lächeln. Und beim sechsten Mal schlug Schiller mit rechts zu. Er war selbst überrascht darüber, wie einfach es ging. Es war eigentlich wider die boxerische Logik, aber es funktionierte, obwohl der Schlag gar nicht so fest geführt war. Das hatte der große Boldoni nicht erwartet. Er sah Schiller verblüfft an. Nicht gedankenverloren, zerfahren, entrückt, versunken, teilnahmslos, ungerührt, entgeistert, unkonzentriert, schon gar nicht imbezill, sondern einfach verblüfft. Der große Boldoni taumelte. Ein derber Fluch entrang sich seinem Mund. Es gab keinen Zweifel. Er war angeschlagen. Schiller hatte ins Schwarze getroffen.
»Wann wird denn unsere geheimnisvolle Salome erscheinen?«, fragte Brecht.
»Salome eilt der Ruf voraus«, antwortete Kafka, »dass sie immer zu spät kommt.«
»Dann ist also der Ruf, dass sie zu spät kommt, eher da als sie selbst«, fügte Valentin hinzu.
»Oder ist sie gar schon unter uns und wir erkennen sie bloß nicht?«, fuhr Brecht fort. Er zeigte mit der Zigarre auf die Dame mit den nackten Knien. »Sind Sie unsere Salonnière, Madame Unbekannt? Lüften Sie doch Ihr Inkognito!«
»Nein, ich bin durchaus nicht Ihre Salonnière«, gab diese gereizt zurück. »Und ich werde auch mein Inkognito nicht lüften.« Sie zog ihr undefinierbares, leicht glitzerndes Kleidungsstück nach unten, so dass wenigstens ihre Oberschenkel bedeckt waren, dann wandte sie sich an alle. »Wer ich bin, das müssen Sie schon selbst herausbekommen.«
»Ich bin kein Freund von Rätseln und ähnlichen Kindereien«, versetzte Brecht.
Die Stimmung blieb angespannt und wäre es auch geblieben, wäre nicht der dienstbare Geist mit einem Silbertablett erschienen, auf dem allerlei Häppchen aufgetürmt waren. Das hob die Laune wieder, denn es schien für jeden etwas dabei zu sein. Karl Valentin nahm eine Breze, Brecht griff sich ein Stück Augsburger Zwetschgenkuchen, Dostojewski eine Pirogge und ein elegant gekleideter Herr mit großen Rehaugen, die Haare zu einem Fast-Mittelscheitel gekämmt, den breiten Oberlippenbart sanft nach unten geschwungen, griff mit den Worten »Quelle surprise!« zu den Madeleines, von denen er eines in den Tee tauchte und die Augen dazu schloss. Passend dazu hatte der Geiger wieder zu seinem Instrument gegriffen und spielte Opernmelodien, die mit Speis und Trank zu tun hatten. Eben gerade war Mozarts Champagnerarie aus dem Don Giovanni zu hören. Langsam kam Bewegung in die Gesellschaft. Goethe fiel auf, dass sich einige der Anwesenden lebendig und angeregt miteinander unterhielten, andere saßen nach wie vor starr da, man hätte sie für Puppen halten können, wenn sie nicht manchmal kleine, zitternde Bewegungen vollführt hätten. Dazu zählte auch ein Herr in sehr altertümlicher Kleidung, der sich bisher noch nicht am Gespräch beteiligt hatte. Seine Haare waren straff zurückgekämmt, so dass die außerordentlich hohe Stirn noch deutlicher zur Geltung kam. Die Halskrause war groß wie ein Schaufelblatt. Seine Augen gingen ins Leere, dazu bewegte er die Lippen leicht, als würde er etwas murmeln. Goethe wandte sich von ihm ab, nahm sich ein hart gekochtes Ei vom Silbertablett, das er in ein Schälchen mit birkenlaubgrünem Brei tauchte. Karl Valentin beobachtete ihn dabei.
»Darf ich fragen, Herr Geheimrat, was das ist? Das Grüne da! Ist das Götterspeise? Oder Pfefferminzkompott?«
»Nein, durchaus nicht. Es handelt sich um Frankfurter Grüne Soße. Es ist meine Leibspeise und wird in den gewöhnlichen Tavernen Grie Soß genannt. Ich gebe zu, dass ich ihr unwiderstehlich verfallen bin.«
»Grie Soß? Beherrschen Sie denn den hessischen Dialekt noch, Herr Goethe?«
»Ei sischer, isch könnt schon hessisch babbele«, versetzte Goethe wohlwollend und aus einer leutseligen Laune heraus, die ihn von Zeit zu Zeit anwandelte. »Abba wenn isch so schwätz, versteht misch halt kaaner.«
»Was haben Sie gesagt?«
»Isch hab gsacht, dass isch für de Grie Soß a Verbresche begehn könnt.«
»Und was ist da drin?«
»Jetz pass uff, sibbe Kräuter: Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch.«
Alle schienen die Szene aufmerksam verfolgt zu haben. Viele lachten. Das kleine Stimmungstief war offensichtlich überwunden. Doch Goethe selbst hatte der Dialekt sehr verändert. Der Dialekt riss ihn ins Triviale. Der Dialekt machte ihn fast zum Holzknecht, er erschrak über sich selbst. Doch er hatte sich sofort wieder im Griff. Elegant schlug er die Beine übereinander.
»Aber ich gebrauche diese Sprachfärbung selten«, kehrte er wieder zur Hochsprache des druckreifen Dichters zurück. »Ich befleißige mich der Hannoverschen Zunge. Damit drückt sich’s dann doch am besten aus. Vor allem in einem Literaturzirkel.«
»Sagen Sie mir nichts gegen Dialekte!«, polterte Brecht mit vollem Zwetschgendatschi-Mund. »Wie könnte man Grobheiten besser ausdrücken. Und Grobheiten sind die Metaphern des Volkes.«
»Vielleicht ist auch das Volk eine Metapher für die Grobheit«, entgegnete Karl Valentin.
Goethe wandte sich kopfschüttelnd von den beiden ab und unterhielt sich angeregt und leise mit dem Herrn im Strohhut, der sich ihm als James Joyce vorgestellt hatte. Jetzt plötzlich richtete sich der Mann mit der Halskrause auf und begann mit geradeaus gerichteten Augen zu sprechen, zu niemand Bestimmtem, einfach so in die Luft, aber mit dramatischer, für die letzte Theaterreihe gedachter Betonung:
»Schurken seid ihr, Halunken und Tellerlecker; niederträcht’ge, eitle, hohle, bettelhafte, dreiröckige, hundertpfündige, schmutzige, grobstrümpfige Gauner –«
»Wenn ich mich nicht irre, ist das aus König Lear, 2. Aufzug, 2. Szene!«, sagte Brecht. »Ich müsste das Stück einmal bearbeiten. Und ein bisschen epischen Schwung hineinbringen. Auch ein paar schmissige Lieder würden nicht schaden.«
»– lüderliche, spiegelgaffende, überdienstfertige geschniegelte Taugenichtse –«
Und mitten in der sonderbaren, an niemand Speziellen gerichteten Schimpftirade von William Shakespeare, denn um ihn und keinen anderen musste es sich handeln, erschien sie endlich. Die Salonnière. Salome persönlich. Sie trug ein dunkles, dezent gemustertes Kleid mit einem weiten, tief gefalteten Rock, dessen Saum den Fußboden berührte. Auch im Übrigen sah sie ganz so aus, wie man sich eine Salonnière vorstellte: mit kleinen, geschmackvollen Puffärmeln und der modischen Andeutung einer Wespentaille. Salome schwebte gleichsam herein und verneigte sich nach allen Seiten. Brecht hielt mit dem Rauchen, Shakespeare mit dem Fluchen inne, Dostojewski steckte die kleine versilberte Pistole, die er am Fenster gereinigt hatte, wieder in die Tasche seines abgeschabten Mantels. Salome war eine junge Frau von angenehmem, freundlichen Gesicht, sie trug eine Schute, aus der seitlich goldene Korkenzieherlocken hervorquollen. Auf die Frontseite ihres Kleides hatte sie sich ein kleines Blumenbukett gesteckt. Einige klatschten, Luftküsse flogen, Bravo-Rufe erschallten. Sogar der proletarische Rüpel Brecht ergriff ihre zarten Finger und deutete einen Handkuss an.
»Zu viel der Ehre«, rief Salome und errötete für jeden sichtbar. »Sie beschämen mich ja.«
Sie raffte ihr Kleid eine Handbreit hoch und bestieg das kleine Podest aus Nussbaumholz, wobei es fast so aussah, als schwebte sie hinauf. Dann bedeutete sie dem Geiger, mit dem Spiel innezuhalten. Jetzt erstarb auch das leiseste Geflüster und alle blickten erwartungsvoll zu ihr. Salome räusperte sich, holte ein kleines, silberfarbenes Stück Blech aus ihrem kunstvoll bestickten Beutel und legte es auf das Pult. Sie musterte das Viereck lange, als ob es dort etwas zu lesen gäbe. Niemand sagte etwas. Man glaubte, jede einzelne Falte ihres gestärkten Rocks knistern zu hören. Goethe bemerkte, dass kleine Schweißperlen ihre Stirn benetzten. Trotz all ihrer Erfahrung, die man ihr nachsagte, war sie nervös?
»Ich heiße Sie willkommen in unserem exklusiven Literatur-Forum, in Salomes Lesekränzchen, programmiert von der Firma Otherland. Salome, tja, Sie werden es schon erraten haben, das bin ich. Ich bin erfreut, dass sich die Crème de la Crème der Weltliteratur hier versammelt hat.« Sie vollführte einen tiefen Knicks, stilgerecht mit Hohlkreuz, gesenktem Kopf und leichtem Anheben des Rocksaums. »Ich hoffe, Sie hatten ein paar schöne Stunden in unserem prächtig reproduzierten Weimar. Besonders stolz sind wir natürlich auf unsere Esplanade und auf den historischen Marktplatz mit dem Topfmarkt. Es hat viel Mühe bereitet, das alles im Maßstab 1:1 mit Farbe und Leben zu füllen, das kann ich Ihnen sagen. Ein Dank an das Designerteam. Ich freue mich, dass sich einige von Ihnen schon miteinander bekannt gemacht haben.« Sie hob das Stück Blech hoch und klopfte darauf. »Die Anwesenheitsliste gehen wir später durch, wenn auch die letzten Nachzügler eingetroffen sind. Doch ich darf Ihnen jetzt schon den Ehrengast der heutigen Matinée vorstellen –«
Goethe erhob sich von seinem Stuhl.
»– Franz Kafka«, fuhr Salome fort.
Applaus brandete auf, alle waren sich wohl einig, dass das der Ehrengast sein musste. (Oder fast alle.) Kafka selbst wehrte peinlich berührt mit den Händen ab, glich jetzt einem kleinen, überaus bescheidenen Schuljungen, der mit der Eins plus im Aufsatz lediglich einen Zufallstreffer gelandet hatte, nicht mehr. Der Applaus verebbte, Salome starrte wieder auf das Blech, wischte mit dem Finger darüber, als ob sie ein Stäubchen wegschnipsen wollte.
»Sie alle, die Sie hier versammelt sind, leben weit verstreut«, fuhr Salome fort. »In den entferntesten Regionen Deutschlands, Europas, ja, wer weiß, vielleicht sogar der Welt.« Mädchenhaft kichernd fügte sie hinzu: »Ich will dieses Geheimnis Ihrer Verortungen gar nicht lüften. Und damit sind wir schon bei der wichtigsten Grundregel unseres digitalen Forums. Oberstes Prinzip ist strikteste Anonymität. Wer Sie wirklich sind, wo und wie Sie leben, ob Mann oder Frau, alt oder jung, arm oder reich, das alles soll hier kein Thema sein. Jeder von Ihnen hat sich eine animierte Figur aus der Literatur ausgewählt, jeder von Ihnen existiert hier im virtuellen Pixel-Weimar nur unter diesem Namen, und so soll es auch bleiben. Ich erinnere Sie daran, dass Sie sich dazu verpflichtet haben.«
»Wer sich outet, fliegt raus?«, grätschte Brecht dazwischen.
»Nun, es ist in Ihrem eigenen Interesse, sich nicht zu outen«, versetzte Salome mit leicht hochgezogenen Augenbrauen. »Im Übrigen hoffe ich, dass Sie mit der Ausgestaltung Ihrer Figur, die Sie gewählt haben, zufrieden sind.«
»Sehr zufrieden.«
»Überaus zufrieden.«
»Ich hätte keine bessere finden können.«
»Geht so.«
Das kam von Brecht. Goethe vermutete, dass der User dahinter genauso rüpelhaft war. Dass er zu Hause vor dem Computer auch Zigarre rauchte.
»Freut mich, freut mich, meine Lieben. Wir, beziehungsweise unsere Designer, haben ihr Bestes getan. So viel kann ich allerdings verraten: Es handelt sich bei den Menschen, die hinter Goethe, Schiller und Dostojewski stecken, samt und sonders um literaturbegeisterte Zeitgenossen, die sich, das kann ich vielleicht auch noch preisgeben, Sorgen um die derzeitige Lesekultur machen.«
Dostojewski meldete sich vom Fenster aus zu Wort.
»Es ist also alles dort unten auf dem Marktplatz animiert?«
»Ja, so ist es.«
»Auch der Boxkampf?«
Schiller boxte also immer noch. Goethe erhob sich, eilte zum Fenster und sah hinaus. Schiller hielt sich gut. Er trieb den anderen tatsächlich in die Ecke. Der andere hielt die Fäuste vors Gesicht und machte nur noch schwache Abwehrbewegungen. Bravo, Schiller, dachte Goethe. Die verhasste Militärakademie war also doch nicht ganz umsonst gewesen.
»Und wir können uns überall frei bewegen, in der ganzen Stadt?«, fuhr Dostojewski fort.
»In ganz Weimar und Umland, Fjodor Michailowitsch.«
Dostojewski sah wieder aus dem Fenster und nickte zufrieden.
»Der Michi hält wahrscheinlich Ausschau nach einer Spielhölle«, flüsterte Valentin Brecht zu. »Ich weiß nicht, ob das Roulette schon erfunden worden ist –«
»Alle Figuren in der Stadt sind computergeneriert«, unterbrach Salome mit einem strafenden Blick hin zu den beiden Schwätzern.
»Ungesalz’ne Glattbacken und Hanswurstgesichter, Schwindelhirne und Hagelkocher –«
»Mister Shakespeare, was ist denn los? Geht es Ihnen gut?«, fragte Salome, eilte zu dem Mann mit dem zurückgekämmten Haar und der schaufelförmigen Halskrause und berührte ihn leicht am Rücken, an einer Stelle zwischen den Schulterblättern.
Shakespeare reagierte nicht darauf, murmelte nur weiter Schimpfwörter und Beleidigungen. Da er sie jedoch an niemand Bestimmten richtete, fühlte sich auch niemand getroffen. Salome klappte einen Teil ihres Blumenschmuckes hoch und flüsterte etwas in ein verstecktes Mikro.
»Support! Shakespeare spinnt schon wieder.«
Sie sah aus wie eine Geheimagentin im Einsatz. Dann richtete sie sich wieder auf, klappte den Blumenschmuck zurück, glättete ihr Kleid und wandte sich, ganz Grande Dame eines Salons der Goethe-Zeit, an die Anwesenden:
»Sie sehen, wir sind vor kleinen Pannen nicht gefeit. Unser Support arbeitet aber daran. Sie können solche Störungen jederzeit bei mir melden.«
»Batzenschmelzer! Bettelpack! Hufeisenfresser!«
»Ich kann bei Ihnen allen von einer gewissen literarischen Bildung ausgehen«, fuhr Salome fort. »Und Sie wissen, dass sich Goethe und Dostojewski nicht getroffen haben können.«
Goethe fragte sich, ob er auf den groben Schnitzer hinweisen sollte, dass Friedrich Schiller 1806 schon ein ganzes Jahr tot war, er schwieg jedoch, um nicht pedantisch zu erscheinen.
»Aber das ist ja gerade das Spannende an Computersimulationen, Friedrich von Schiller einfach weiterleben zu lassen oder zu sehen, wie sich Johann Wolfgang von Goethe und Fjodor Michailowitsch unterhalten haben könnten. Was wäre, wenn Franz Kafka nicht mit vierzig Jahren gestorben wäre, sondern das hohe Alter von fünfundneunzig erreicht hätte –«
Kafka schien diese Vorstellung zu gefallen.
»Ich wäre nach Amerika ausgewandert, hätte dort Romane ohne Ende geschrieben –«
»Also alle unvollendet«, warf Valentin ein.
»– hätte mich beim Nobelpreis gegen Thomas Mann durchgesetzt –«