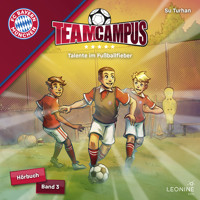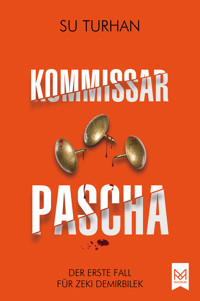
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kommissar Pascha-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Tote vom Eisbach Verdeckt durch die dichte Brustbehaarung glänzten in den Körper eng an eng hineingetriebene Reißnägel mit goldenen Köpfen. Gut zu erkennen war, dass die Anordnung ein in schnörkeligem Schriftzug geformtes Wort darstellte. Wirkliche Lust hat Zeki Demirbilek auf seine Aufgabe nicht. Ausgerechnet er, der bayerisch-türkische, teamresistente und streitsüchtige "Kommissar Pascha" – wie er von allen genannt wird – soll die neue Abteilung Migra führen, die sich schweren Fällen mit Migrationshintergrund annimmt. Eigentlich hatte er ja schon mit München und allem dort abgeschlossen, doch sein innerer Ehrgeiz lässt ihn das Angebot annehmen. Kurz darauf wird eine grausam zugerichtete Leiche aus dem Eisbach gezogen – vermutlich ein Türke. In der Brust des Toten stecken hunderte Reißnägel und formen auf Arabisch eine unmissverständliche Botschaft: »Teufel«! Der erste Fall für Kommissar Pascha und sein bayerisch-türkisches Team! »Und am Ende hofft man nur eins: dass Demirbilek möglichst bald seinen nächsten Fall löst.« Münchner Merkur
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Su Turhan
Kommissar Pascha
Band 1
Krimi
Über das Buch
Der Tote vom Eisbach
»Verdeckt durch die dichte Brustbehaarung glänzten in den Körper eng an eng hineingetriebene Reißnägel mit goldenen Köpfen. Gut zu erkennen war, dass die Anordnung ein in schnörkeligem Schriftzug geformtes Wort darstellte.«
Wirkliche Lust hat Zeki Demirbilek auf seine Aufgabe nicht. Ausgerechnet er, der bayerisch-türkische, teamresistente und streitsüchtige „Kommissar Pascha“ – wie er von allen genannt wird – soll die neue Abteilung Migra führen, die sich schweren Fällen mit Migrationshintergrund annimmt.
Eigentlich hatte er ja schon mit München und allem dort abgeschlossen, doch sein innerer Ehrgeiz lässt ihn das Angebot annehmen.
Kurz darauf wird eine grausam zugerichtete Leiche aus dem Eisbach gezogen – vermutlich ein Türke. In der Brust des Toten stecken hunderte Reißnägel und formen auf Arabisch eine unmissverständliche Botschaft: »Teufel«!
Der erste Fall für Kommissar Pascha und sein bayerisch-türkisches Team!
Impressum
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright der Originalausgabe © 2013 by Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München
Copyright © 2024 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2024
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: © Oleksandr Kostiuchenko/ Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Made in Germany
ISBN: 978-3-98679-047-9
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Inhalt
Widmung
PROLOG
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17 KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
43. KAPITEL
44. KAPITEL
45. KAPITEL
46. KAPITEL
47. KAPITEL
48. KAPITEL
49. KAPITEL
50. KAPITEL
51. KAPITEL
52. KAPITEL
53. KAPITEL
54. KAPITEL
55. KAPITEL
56. KAPITEL
57. KAPITEL
58. KAPITEL
59. KAPITEL
60. KAPITEL
61. KAPITEL
62. KAPITEL
Anhang
Leseprobe: Bierleichen
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
Der Autor Su Turhan
BAND 2
BAND 3
BAND 4
BAND 5
BAND 6
BAND 7
BAND 8
Widmung
Für Dagny, Lyn und Floyd
PROLOG
Ziemlich genau vor einem Jahr fasste Kommissar Zeki Demirbilek einen Entschluss: Er wollte statt jeden Sonntag nur jeden zweiten Sonntag Schweinebraten essen. Zum einen wegen der Kalorien, zum anderen hatte er ein schlechtes Gewissen. Dem Münchner türkischer Abstammung war sehr wohl bewusst, mit den Essgewohnheiten gegen die Regeln seines Glaubens zu verstoßen.
Nur, er konnte nicht anders.
Obwohl seine Eltern Fatma und Zülfü ihrer Pflicht nachgekommen waren und ihren einzigen Sohn in die Koranschule schickten, wie es die Tradition verlangte. Bis zum zwölften Lebensjahr lernte Zeki, den Koran zu lesen, und wurde in religiösen Fragen unterrichtet. Das war ein selbstverständlicher Bestandteil seines Alltags. Bis zu dem Tag, an dem seine Eltern sein Leben auf den Kopf stellten.
Zeki kam nach Hause in die Karadeniz Caddesi, war unterwegs gewesen mit einem Plastikball und einer Horde kurzgeschorener Freunde. Seine Eltern erwarteten ihn in der Küche. Während er aus dem Kühlschrank eine eiskalte Flasche Leitungswasser holte, rückten sie mit der Neuigkeit heraus, dass sie nach Almanya gehen würden, um dort zu arbeiten. Er wollte nicht. Etwas Besseres als seine Heimatstadt Istanbul und sein Stadtviertel Fatih konnte er sich nicht vorstellen. Er war glücklich, war in der Schule einer der Besten, hatte gute Freunde, liebte seine Großeltern babaanne und dede, und natürlich die gleichaltrige Selma, seine ultraheimliche Freundin. Trotz Weinkrämpfen und Protesten erreichten die Demirbileks drei Wochen später mit dem Nachtzug Augsburg, wo seine Eltern eine Anstellung als Lehrkräfte für türkischen Heimatunterricht antraten. Zwei Jahre Auslandserfahrung, die deutsche Sprache perfektionieren, Deutschmark sparen, wieder zurück nach Istanbul, so die Lebensplanung. Zeki hatte heute noch das Tuscheln und hämische Kichern seiner damals neuen Mitschüler im Ohr, als er sich in gebrochenem Deutsch der Klasse vorstellte. Nach zwei Jahren im beschaulichen Augsburg folgte der Umzug nach München. Dort bezogen die Demirbileks in einer Hochhaussiedlung in Neuperlach eine Zweizimmerwohnung. Zeki dachte gerne an jene Zeit zurück. Dort fanden sich Kinder in seinem Alter, die ausländisch wie er aussahen und Türkisch sprachen; die Jungs konnten mit den Spielernamen seines Vereins Fenerbahçe etwas anfangen. Es war ein bisschen wie in Istanbul, auch wenn ihm Selma sehr fehlte und natürlich seine Großeltern, mit denen er von Geburt an unter einem Dach gelebt hatte. Nach bereits einem Jahr erfolgreicher Assimilation an die deutschen Verhältnisse wechselten sie in das schicke Viertel Haidhausen. Der soziale Aufstieg erlaubte der Familie eine schöne Wohnung mit drei Zimmern und Balkon. »Bak oğlum, noch ein Jahr, dann haben wir genug gespart …« Dieser Satz seines Vaters hatte sich für alle Zeiten in Zekis Kopf festgesetzt. Jahr für Jahr bekam er ihn zu hören. Im fünften Jahr zog er sich wortlos in sein Zimmer zurück. Ihm war klar, dass seine Eltern nicht zurückkehren würden. Fieberhaft tüftelte er zu jener Zeit an einem Handschriften-Analysesystem, um einen Übeltäter auf dem Gymnasium zu überführen. Der Unbekannte hatte an die Wand im Pausenhof eine Preisliste gekritzelt, um sexuelle Dienste einer Mitschülerin zu bewerben. Nachdem er den Schmierfink tatsächlich ausfindig gemacht hatte, die Bestrafung jedoch ausblieb, weil er der Sohn des Direktors war, holte Zeki aus dem Keller den orangefarbenen Autolack, den sein Vater für den Opel Kadett gekauft hatte. Es waren noch vier Wochen bis zu den Abiturprüfungen. Zekis Leistungen in Chemie, Physik und Wirtschaft waren nicht überzeugend. Er war renitent. Hatte eine ungezügelte Streitlust, immer dann, wenn es gegen seine türkische Heimat ging oder Ungerechtigkeiten als Selbstverständlichkeit hingenommen wurden. So sprayte er an die Wand die orange leuchtende Mitteilung: »Dirk Kauzner bläst Schwänze. Unkostenbeitrag 5DM.« Dirk Kauzner war der Sohn des Direktors. Und nach alter Familientradition trug Dirk denselben Vornamen wie sein Vater.
Nach dem Vorfall stellte der vor Wut schäumende Vater seinen Sohn Zeki zur Rede: »Hast du dich anständig auf das Abitur vorbereitet?«
Als keine Antwort kam, holte der Vater tief Luft.
»Nein! Hast du nicht! Du hast die letzten Wochen damit verbracht, den schamlosen Jungen zu überführen.«
Zeki nickte.
»Hat dir das Freude gemacht?«
Zeki nickte erneut.
»Gut, dann nehme ich dich vom Gymnasium. Du bewirbst dich an der Polizeischule, mittlerer Dienst«, entschied sein Vater.
Am Abend nach der erfolgversprechenden Abschlussprüfung an der Polizeischule ging Zeki mit seinen Schulkollegen das erste Mal in seinem Leben Schweinebraten essen. Erst damit, so wurde ihm viele Jahre später bei der Beförderung zum Kommissar klar, hatte er die Prüfung wirklich bestanden und fühlte sich als Absolvent der bayerischen Polizeischule – wenngleich er bei aller Liebe zu München seine türkischen Wurzeln nie leugnete.
1. KAPITEL
Süleyman Güzeloğlu, soeben von München in Istanbul gelandet, hatte den Ort für das Treffen vorgeschlagen: ein privat geführter Hamam auf dem Dach eines Wolkenkratzers mit Blick über die atemberaubende Skyline der Metropole. Für zwei Stunden gehörte an diesem späten Nachmittag das türkische Luxusbad im Medien- und Finanzviertel Levent ihm und seinem Geschäftsfreund. Die zwei älteren Herren galten als unangefochtene Patriarchen ihrer Familienunternehmen und waren auf dem Papier reich wie Aladin zu seinen besten Zeiten. Für den grauhaarigen Güzeloğlu war Istanbul kein Ort alter Gemäuer, für ihn war seine Heimatstadt aufstrebendes Wirtschaftszentrum, das als Brücke zwischen Okzident und Orient einer blühenden Zukunft entgegensah. Ganz anders als er selbst. Süleyman Güzeloğlu hatte Darmkrebs. Er litt unter schrecklichen Schmerzen und spürte, dass sein Tod nahte. Er konnte auf ein erfolgreiches Leben zurückblicken. Mit dem Verkauf von Döner in Deutschland und Österreich war er reich geworden. Da Allah trotz seiner Güte und Barmherzigkeit ihm nur eine Tochter und keinen Sohn geschenkt hatte, wollte der kranke Güzeloğlu mit einer strategischen Allianz sein Imperium Döner Delüks über seinen Tod hinaus in guten Händen wissen.
Sein dafür vorgesehener Geschäftspartner und betagter Freund Furat Firinci wurde gerade auf einem steinernen Bett von einem dickleibigen Mann durchgeknetet. Nun bedeutete er dem Masseur jedoch, aufzuhören, setzte sich auf und sah ihn an.
»Süleyman, mein Freund, wenn mein ältester Sohn Uğur deine Tochter Gül heiratet, dann ist das zum Wohle beider Unternehmen. Ich will in Europa mit meiner Firma Fuß fassen. Du willst die Leitung von Döner Delüks einem fähigen, modern denkenden Manager übertragen.«
Süleyman Güzeloğlu schwitzte in dem dampfigen Raum. Eigentlich hatten sie alles besprochen, was es im Vorfeld zu klären gab. Die Anwälte von Firincis Good Döner Food und seine Anwaltskanzlei hatten das umfangreiche Vertragswerk, was sowohl die Belange der Firma als auch die Bedingungen der geplanten Ehe betraf, hinlänglich diskutiert und zur Unterschriftsreife formuliert. Er hörte weiter zu, ohne seine Irritation zu zeigen.
»Was über deine wunderschöne und kluge Tochter Gül geredet wird, interessiert mich nicht. Die Zeitungen füllen Seite um Seite mit Schmutz und Widerwärtigkeiten. Ich gebe darauf nichts, das weißt du. Auch wenn mir klar ist, dass die Skandale für dein Geschäft in Deutschland von Vorteil sind.«
Süleyman Güzeloğlu griff zu einer Mandarine und begann, sie langsam zu schälen. Er kannte Furat Firinci lange genug. Er wusste, dass sein alter Freund genau das Gegenteil von dem meinte, was er sagte. Er schwieg.
»Seit zwei Nächten schlafe ich nicht gut, Süleyman. Ich träume wirr.« Furat sah zur Decke, in Gedanken bei den Träumen, die ihn plagten. »Hilf mir, meine Sorgen zu vertreiben.«
Süleyman schluckte das saftige Fruchtfleisch herunter und fixierte seinen Freund.
»Bevor wir unsere Kinder verheiraten und mit Allahs Hilfe ein gemeinsames Freudenfest feiern, muss mit den Skandalen deiner Tochter Schluss sein. Erlaube mir, einen Vorschlag zu machen.«
»Mit Allahs Hilfe … Ich höre, mein Freund«, erwiderte der alte Güzeloğlu mit Bedacht.
»Ich habe jemanden an der Hand, den ich nach München schicken möchte. Er soll – mit deinem Einverständnis – Gül beobachten. Ich will erfahren, was nicht in den Zeitungen steht. Ich will wissen, ob sie für die Ehe mit meinem Sohn bereit ist«, sagte Firinci mit fester Stimme und hielt einen Moment inne. »Kannst du meinen Wunsch nachvollziehen?«
Diese letzte Prüfung darf ich nicht ausschlagen, sagte sich der todkranke Güzeloğlu. Er war froh, endlich den Grund für das Treffen in Istanbul erfahren zu haben, und betete, dass Allah ihm so viel Zeit zugestand, seine Tochter auf den rechten Pfad zu bringen. Seine Antwort fiel so aus, wie von ihm erwartet wurde: »Natürlich verstehe ich dich, Furat, mein Freund. Die Ehre meiner Familie ist mir genau so heilig wie dir.«
»Gut, dann sind wir uns einig. Um den Rest brauchst du dich nicht zu kümmern. Die Auslagen für den Mann verrechnen wir in unseren Bilanzen«, entgegnete Furat, froh über das schnelle Einverständnis. Dann stand er auf und nahm im Sessel neben seinem müden Freund Platz.
»Wen willst du schicken?«, fragte Güzeloğlu nebenbei und bot ihm eine frische Feige an.
Furat lehnte dankend ab, trank dafür aber einen Schluck von seinem Gin Tonic.
»Was nützt es dir, wenn du weißt, wer er ist? Ich setze den Mann bei allen großen und wichtigen Geschäften ein. Er hat mich bisher nie enttäuscht. Das Komische ist, ich habe ihn selbst noch nie getroffen«, erklärte er und lachte vergnügt auf. »Er wird Alman genannt. Wegen seiner Tugenden. Seine Dienste verrichtet er ordentlich und gründlich. Das passt zu Deutschland, meinst du nicht auch?«
Güzeloğlu zuckte zusammen. In Furats Worten lag eine gewisse Drohung. Er nahm alle Kraft zusammen und antwortete unbekümmert: »Dein geheimnisvoller Mann wird dir nichts anderes berichten können, als dass Gül noch Jungfrau ist. Darum geht es dir doch, nicht wahr?«
»Du hast recht, Süleyman, genau darum geht es mir«, machte Furat deutlich. »Das Fundament meines Geschäfts ist die Tradition. Mein Sohn Uğur heiratet ein unversehrtes Mädchen oder gar nicht.«
»Aber natürlich, dein Sohn wird meine Tochter als Jungfrau zum Imam führen«, erwiderte Güzeloğlu voller Überzeugung und entschuldigte sich abrupt, um die Toilette aufzusuchen. Dort übergab er sich. Lautlos, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Das Morphin, das ihm sein Leibarzt Dr. Bower für die Reise mitgegeben hatte, vertrug er immer schlechter.
2. KAPITEL
Dampfschwaden strömten aus den Öffnungsschächten. Weißes, grelles Licht vermischte sich mit roten Spotlights, die wie Finger über den Körper der Frau auf der Bühne wanderten.
Das Speed in der Maximilianstraße – Prachtmeile und Luxusoase für Besserverdienende – übertraf den Ruf des legendären P1 am Haus der Kunst seit einigen Monaten. Wer dort hereinkam, war mehr als angesagt in der High Society Münchens. Ein knallharter Türsteher, der nach Gutdünken selektierte, gehörte der Vergangenheit an. Ein im Unterarm implantierter Minichip war die Eintrittskarte für den elitären Club.
Gül Güzeloğlu, die vierundzwanzigjährige Tochter des Dönerunternehmers Süleyman Güzeloğlu, hatte den Chip mit der Codenummer 003. Von Anfang an sorgte sie mit Auftritten und Skandalen aktiv für den guten schlechten Ruf des Clubs. Sie verlangte kein Geld dafür. Davon hatte sie genug. Nur die horrende Rechnung über die Unmengen Wasser, die sie in sich hineinschüttete, war sie nicht gewillt zu zahlen. Die normalen Gäste erledigten das leidige Begleichen der Rechnung durch einfaches Hochhalten des Chip-Arms. Der Scanner erledigte den Rest. PayPal oder Kreditkarte. Dem System war das egal.
Es war Donnerstag. Karaoke-Night. Güls Vater war auf Geschäftsreise in Istanbul. Sie nutzte die letzten Tage Freiheit vor ihrer Verheiratung und hatte sich von Metin Burak, dem alten Freund ihres Vaters und seit fünf Jahren ihr Chauffeur, in den Club fahren lassen. Für ihren Auftritt hatte sie sich Paparazzi von Lady Gaga ausgesucht. Der Popsong dröhnte über die versteckte Lautsprecheranlage durch den vollbesetzten Club. Fotografieren war verboten. Handys und sonstiger elektronischer Schnickschnack mussten an der Garderobe abgegeben werden. Wer sich nicht daran hielt und erwischt wurde, flog raus. Den Chip unter der Haut entfernte eine Ärztin im Krankenschwester-Look mit einer Saugpistole. Ein Pieks – und man war verbannt aus dem Szenelokal. Trotzdem drangen heimlich geschossene Fotos und Filmchen aus dem Club an die Öffentlichkeit. In der Regel zahlten Online-Portale ordentlich für Exklusivrechte an blanken Brüsten, besoffenen Stars oder vermeintlich kopulierenden Paaren in den blitzblank gereinigten Toilettenfluchten.
Gül Güzeloğlus Ruhepuls lag morgens um die achtzig Schläge pro Minute. Wenn sie wie jetzt mit dem fast durchsichtigen, weiß fluoreszierenden Ganzkörperanzug auf der Bühne tanzte, bewegte sich der Puls bei neunzig. Sie genoss es, im Mittelpunkt zu stehen. Sie genoss es, als Frau wahrgenommen zu werden. Ihre Reize auszuspielen. Empfand es als Privileg, als Frau auf die Welt gekommen zu sein, und hielt ihre Weiblichkeit für etwas Göttliches. Sie liebte erotische Spiele und damit Männer wie Frauen gleichermaßen zu provozieren. Für Gül kam es einer sportlichen Herausforderung gleich, in die erogenen Gehirnzonen ihrer Mitmenschen vorzudringen. Die Kunst des Betörens und des Begehrtwerdens hatte sie sich von orientalischen Bauchtänzerinnen abgeschaut. Für Gül waren die hüftschwingenden Frauen Künstlerinnen. Sie verströmten unnahbare Weiblichkeit mit jeder Geste, mit jedem Wimpernschlag, mit jeder Zuckung des verhüllten Körpers. Sex passierte im Kopf und endete für Gül auch dort. Sie war Jungfrau. Aus Überzeugung.
Die Menge tobte und klatschte. Lasziv ließ Gül das schnurlose, wie ein Dildo geformte Mikrofon über die sich abzeichnenden Brustwarzen kreisen. Am Ende des Lieds spreizte sie die Beine und stieß das Mikrofon zwischen ihnen hindurch. Unter der neonweißen Perücke erstrahlte ihr zufriedenes, verschwitztes Gesicht; ihre Augen glänzten im Scheinwerferlicht. Kaum jemand merkte beim Schlussapplaus, wie sie für eine Sekunde erschrak. Sie hatte jemanden im Publikum entdeckt, der niemals hätte Einlass in den exklusiven Club finden dürfen. Sie verbeugte sich und verließ hastig die Bühne.
Der Mann, der Gül derart aus der Fassung gebracht hatte, hörte auf den Namen Stefan Tavuk. Er war Mitte dreißig, der Körper gezeichnet von zwanzig Stunden Fitnessprogramm in der Woche. Das hellbraune Haar färbte er mit einer Spezialtönung naturblond. Stefan Tavuk beobachtete, wie Gül an der Schlange wartender Frauen vorbeiging und in die Toilette verschwand. Er lehnte sich an die Wand in der Nähe und nippte an seinem Whisky-Cola. Dreiundzwanzig Euro. Eine stolze Summe, fand er, aber schon bald würde er mit den irrsinnigen Preisen kein Problem mehr haben. Dann sah er nervös auf die Uhr. Er fragte sich, wo Bülent abgeblieben war, ob er überhaupt noch kommen würde? Pünktlichkeit war nicht die Stärke seines Partners.
Endlich trat Gül aus der Toilette und huschte an den gaffenden Frauen vorbei. Sie hatte die grelle Bühnenschminke gegen weniger auffälliges Make-up getauscht. Ein weißer Büstenhalter bedeckte ihre Brüste, Ärmel und Hosenbeine des Ganzkörperanzuges waren hochgekrempelt. Die Lady-Gaga-Perücke hielt sie zusammengeknüllt in der Hand, als Stefan Tavuk sich ihr in den Weg stellte.
»Gül hanım«, sprach Tavuk sie auf Türkisch an.
Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich mit einem Schlag. Mit hasserfüllten Augen spie sie dem Mann entgegen: »Sie haben bekommen, was Sie wollten. Lassen Sie mich in Ruhe!«
»Ich muss aber wissen, wo Bülent Karaboncuk ist. Er wollte mit Ihnen unsere Angelegenheit besprechen. Er hat sich nicht gemeldet, und ich erreiche ihn nicht«, entgegnete er kleinlaut.
»Sie meinen Ihren Scheißpartner? Das Schwein kann mir gestohlen bleiben, er ist nicht zur Verabredung gekommen«, zischte Gül zurück und fuchtelte mit der Perücke vor seinem Gesicht herum. Dann ließ sie ihn einfach stehen und bahnte sich ihren Weg zur Bar. Das Quellwasser aus den Pyrenäen trank sie in einem Zug direkt aus der Flasche. Als sie sich umdrehte, stellte sie erleichtert fest, dass der Mann verschwunden war.
Spät nach Mitternacht kauerte Gül auf dem Beifahrersitz der Mercedes-Limousine, statt wie üblich hinten auf dem komfortablen, lederbezogenen Rücksitz Platz zu nehmen. Der alte Chauffeur war wieder einmal betrunken und nicht in der Lage, selbst den Wagen zu fahren. Sie war froh, dass er Ahmet geschickt hatte, um sie abzuholen. Sie mochte den Mann mit dem jugendlich wirkenden Gesicht und den unschuldigen Augen. Es war der unbekümmerte, scheue Blick, der sie in den Bann gezogen und seit der ersten Begegnung nicht mehr losgelassen hatte. Ob sie verliebt war in den schüchternen, in sich gekehrten Mann, konnte sie nicht mit Gewissheit sagen. Erschöpft nahm sie Ahmets freie rechte Hand in die ihre. Die zärtliche Berührung half ihr, auf der Heimfahrt durch das nächtliche München einzuschlafen.
Ahmet stoppte den Wagen am Anwesen der Güzeloğlus, ohne seine Dienstherrin zu wecken. Leise holte er seine Mini-Polaroidkamera aus dem Handschuhfach und machte ein Foto von der schlafenden Frau, die zu lieben ihm verboten war.
3. KAPITEL
Am nächsten Tag verhieß die Morgensonne einen herrlichen Sommertag. Es war Freitag. Seit acht Uhr morgens saß Kommissar Zeki Demirbilek hinter seinem Schreibtisch im dritten Stock, wo für das neugegründete Sonderdezernat Migra Büroräume freigeräumt worden waren. Wie gewohnt war er um Viertel vor sieben aufgestanden, hatte çay gemacht, den Sportteil der Hürriyet und der Süddeutschen Zeitung überflogen, dazu einen Buttertoast gegessen und war anschließend zum Münchner Polizeipräsidium gefahren. Sein Arbeitsweg von seiner Wohnung in der Weilerstraße bis zum Marienplatz dauerte, dank der guten Verkehrsanbindung, zum Glück nur zwanzig Minuten.
Noch hatte er etwas mehr als zwei Stunden Zeit bis zum Termin mit dem Anwalt seiner Frau. Zeki schob den lästigen Gedanken beiseite und wunderte sich lieber darüber, es geschafft zu haben. Er war jetzt Chef. Auch wenn er das nie hatte werden wollen. Mit nicht einmal vierzig war er auserkoren worden, Leiter dieses Sonderdezernats zu werden. Er hatte zunächst nicht verstanden, was das Ganze sollte. Sein Chef, Kommissariatsleiter Franz Weniger, den Zeki gerne mit einem Pitbullterrier in Gestalt eines Dackels verglich, hatte ihm mit jovialem Lächeln erklärt, dass er Kapitalverbrechen aufklären solle, und zwar solche, bei denen Täter und Opfer mit Migrationshintergrund eine Rolle spielten. Zekis ausgeprägt pragmatischer, bisweilen aber auch etwas behäbiger Charakter ließ keinen anderen Entschluss zu, als den Posten anzunehmen. Das war genau vor einer Woche gewesen.
Nun saß er alleine vor einem Berg Fälle, die allesamt in irgendeiner Weise mit Migranten in Verbindung standen. Der Stapel auf seinem Schreibtisch hatte eine Höhe erreicht, die ihn dazu bewog, Allah zu ersuchen, dass seine beiden neuen Mitarbeiterinnen arbeitswillig waren. Die junge Deutschtürkin, die am Montag anfangen sollte, kannte er noch nicht, weil Weniger bei einer seiner Dienstfahrten nach Berlin das Bewerbungsgespräch geführt hatte. Kriminalmeisterin Isabel Vierkant kannte er zwar schon vom Sehen, doch er war später noch mit ihr zu einem Gespräch verabredet. Mal abwarten, wie sie sich macht, dachte er und griff widerwillig zur nächsten Akte, als es an der Tür klopfte.
»Ja, bitte«, rief er, ohne den Blick von den Ausführungen über einen Banker zu heben, der türkischstämmige Anleger mit fiktiven Anleihen prellte. Anleihen für ein neues Hotel in Antalya. Nicht gerade originell, fand Demirbilek, sicher aber ein einträgliches Geschäft. Schließlich sah er doch hoch, zwei Arbeiter in Blaumännern standen mit einem Schränkchen vor ihm.
»Wohin damit?«, fragte der Größere freundlich.
Zeki trat zu ihnen. Er öffnete und schloss die erste Schublade des Schränkchens, tat dasselbe mit der zweiten und schüttelte dann den Kopf. »Ich wollte eines mit drei Schubfächern.« Er nahm wieder Platz und stapelte den Anlagebetrüger auf den Haufen mit den abgewiesenen Fällen. »Und keines mit zweien. Nehmen Sie es bitte wieder mit.«
»Das ist nicht Ihr Ernst, oder?«, fragte der andere der beiden, während er sich eine Zigarette drehte.
»Doch. Und wenn Sie mein Büro nicht in zehn Sekunden verlassen haben, stehe ich noch mal auf«, drohte der Kommissar, ohne aufzublicken. Der Zigarettendreher feuchtete sein Papier an und nickte seinem Kollegen zu. Die beiden Männer nahmen das Möbel und verschwanden wieder. Zekis Ansprüche waren nicht hoch, aber das Schränkchen war ihm wichtig. Er hatte eine stattliche Sammlung Stofftaschentücher und sich zur Gewohnheit gemacht, täglich drei frische im Anzug bei sich zu tragen. Ganz gleich, ob er privat oder beruflich unterwegs war. Diese Angewohnheit erforderte einen gewissen Grundstock an Tüchern, die es zu waschen, pflegen und sortieren galt. Zu Hause hatte er einen einfachen, weißen Schrank mit drei Schubladen. Das half, den Überblick zu behalten, deshalb wollte er auch hier einen mit drei Fächern. Er vermutete, dass sein dede an dieser Marotte schuld war. Der alte Querkopf war stets mit seinem Stofftaschentuch zur Stelle gewesen, um damit erst sich und dann seinem kleinen Enkel die Nase zu putzen.
Seit er das neue Dezernat vor zwei Tagen offiziell übernommen hatte, wurde er mit Delikten überschwemmt. Der klassische Einbrecher aus Rumänien, die Bande polnischer Herkunft, die auf Beschaffung diebstahlsicherer Luxusautos spezialisiert war, Schweizer, die zum Prügeln nach München kamen. Natürlich Kurden und Türken, die sich mit Glücksspiel und häuslicher Gewalt hervortaten. Sogar einen Zechpreller mit italienischem Namen, der sich als ehemaliger hessischer Polizist entpuppte, wollten sie ihm unterjubeln. Zeki Demirbilek blieb gelassen. Er nahm jeden Hinweis ernst, studierte wie an diesem Morgen jeden Fall auf das genaueste, lehnte ab und leitete die Fälle an die zuständigen Kollegen weiter. Sehr zu deren Missmut, hofften sie doch auf Entlastung durch den Migrationsspezialisten. Demirbilek aber bestand auf die nötige Schwere des Verbrechens. Ihm war klar, dass bei der Ermittlungsarbeit Wissen und Kenntnis kultureller Denkweisen und Eigenheiten förderlich sein würden. Doch ob der überführte Täter einen deutschen Pass hatte oder nicht, war nicht von entscheidender Bedeutung. Wenn der politische Wille sich einen Luxus wie die Migra leisten wollte, dann wollte er den Luxus auch auskosten. Wenige Fälle, die aber lösen. Die Statistik musste stimmen, sein Sonderdezernat gute Polizeiarbeit leisten. Deshalb nahm er sich vor, es sich nicht zu heimisch im Büro zu machen. Yavaş, yavaş – immer schön langsam.
Der Kommissar sah auf seine Armbanduhr. Die Zeiger näherten sich halb elf. Es wurde Zeit, zu seinem Anwaltstermin aufzubrechen, dachte er. Schnell richtete er seine Krawatte und kontrollierte die drei Taschentücher. Eines rot-blau gestreift, das andere grün-gelb kariert und das dritte weiß mit Stickereien, ein Geschenk von seiner Tochter, glaubte er sich zu erinnern.
4. KAPITEL
Abermals strich Isabel Vierkant sich durch die langen Haare. Sie war angespannt, was sich darin äußerte, dass sie mit geschlossenen Augen den unüberschaubaren Inhalt ihrer Umhängetasche durchging. Eine dumme Angewohnheit, die sie nicht ablegen konnte. Sie wartete seit fünfzehn Minuten auf dem einzigen Stuhl im Flur vor Demirbileks Büro. Sie war zu früh. Viel zu früh. Sie hatte es mit der Angst zu tun bekommen, als sich der Friseur an ihren braunen, gewellten Haaren zu schaffen machen wollte, und Reißaus genommen. Um die Zeit bis zu ihrem Bewerbungstermin zu überbrücken, streunte sie ziellos über den Marienplatz, blieb vor nahezu jedem Schaufenster stehen, um sich zu vergewissern, dass wirklich keine einzige Haarsträhne fehlte.
Sie durfte es nicht vermasseln, beschwor sie sich. Sie wollte unbedingt in sein Team, weil sie den türkischen Kommissar seit der ersten Begegnung vor einem Jahr bewunderte. Sie erinnerte sich an den Tag, als wäre es der heutige. Ein Raubmörder hatte Kasse und Schmuck aus einem Juweliergeschäft im Olympia-Einkaufszentrum gestohlen und den Sicherheitsmann erschossen. Die Einsatzleitung mutmaßte, dass sich der Täter noch vor Ort befand. Isabel hatte in der Nacht zuvor den Heiratsantrag ihres Verlobten Peter ausgiebig gefeiert. Sie war verliebt und nicht ganz auf der Höhe ihrer geistigen Möglichkeiten, als ein sympathisch lächelnder Mann sie fragte, ob er durch die Absperrung dürfe, die sie bewachte. Da sie abseits vom Tatort lag, hatte sie keine Bedenken, den Mann passieren zu lassen. Kommissar Zeki Demirbilek beobachtete das Ganze zufälligerweise und folgte ihm. Später am Abend sah sie zu ihrem Entsetzen, wie dieser Mann in Handschellen zum Verhörraum geführt wurde. Als sie sich bei Demirbilek im Büro entschuldigen wollte, meinte er, sie habe klug gehandelt, der Raubmörder hätte sie sonst niedergeschossen. Dann wünschte er ihr aus tiefstem Herzen eine glückliche Ehe und viele Kinder.
Seit dem Tag verfolgte sie seine Laufbahn und hatte von einer Freundin aus dem Personalbüro erfahren, dass zwei Stellen, von denen eine bereits vergeben war, ausgeschrieben waren. Man suche jedoch eine türkischstämmige Kollegin, und damit konnte Vierkant nicht aufwarten. Seit vierunddreißig Jahren Kind niederbayerischer Eltern. Spätberufene im Polizeidienst, gnadenlos ehrlich zu sich und anderen, ein wenig unsicher manchmal im Auftreten, was sie mit ihrem besonnenen Charakter mehr als wettmachte. So erfuhr sie, dass man auf den Gängen tuschelte, dass Demirbilek wohl eine andere Auffassung von Personalpolitik hatte. Er wollte jemanden im Team haben, der Abläufe und Zuständigkeiten im Polizeiapparat kannte. Er soll lautstark geäußert haben, dass es ihm verdammt scheißegal sei, ob Deutscher oder Türke oder Kroate oder sonst etwas. Es folgte einer seiner Ausbrüche, die regelmäßig mit Flüchen in türkischer Sprache endeten. Im Personalbüro machte man sich daran, unabhängig von ethnischen Kriterien eine qualifizierte Person zu finden. Und diese Person wollte Isabel Vierkant sein.
Gerade entdeckte sie einen Kugelschreiber auf dem Boden und steckte ihn in ihre riesige dunkelbraune Umhängetasche, wo sie alles verwahrte, was man als Frau und Polizistin brauchte oder brauchen könnte. In dem Moment flog die Bürotür auf. Zeki Demirbilek stand plötzlich vor ihr. Vierkant war vollkommen durcheinander, ihn im Sakko zu sehen. Sie vergaß, aufzustehen und zu grüßen.
Demirbilek registrierte, dass sie nicht in Uniform war. Clever, fand er. Jeans, modern, vermutlich neu erworben, adrette Jacke, Kunstleder, beige, darunter trug sie eine helle Bluse, der weiße BH schimmerte leicht durch den Stoff. Sexy. Sie nahm die Bewerbung ernst. Gefällt mir, urteilte er.
»Gehen Sie ans Telefon, wenn es klingelt. Rufen Sie an, wenn es eine Leiche gibt. Sonst nicht. Jetzt suchen Sie sich einen Schreibtisch und warten auf mich. Der hintere Raum ist meiner.«
»Aber, aber …«, stotterte Vierkant. »Heißt das, ich habe die Stelle?«
»Das weiß ich noch nicht. Nur, wenn ich in zwei Stunden keinen kahve auf dem Schreibtisch habe, denke ich noch mal darüber nach, ob Sie als Bewerberin überhaupt in Frage kommen«, lächelte er und eilte den Gang entlang. Er würde ein Taxi nehmen müssen. Er war spät dran.
5. KAPITEL
An dem heißen Freitagvormittag herrschte im Englischen Garten Hochbetrieb. Joggende Hundebesitzer fluchten über rasende Fahrradfahrer, nackte Sonnenanbeter verscheuchten blutdürstige Mücken, und einheimische Gäste an den Biertischen am Chinesischen Turm beschwerten sich über schlecht eingeschenkte Maßkrüge.
Die Sonne strahlte auch auf etwa hundert Neugierige aus aller Welt, die in der Prinzregentenstraße die Stadtsurfer beobachteten. Der Eisbach schoss unter der vielbefahrenen Straßenbrücke hindurch. Das Wasser brach sich direkt unter dem Brückengeländer an Steinen und Erhebungen im Bachbett und sorgte für spektakuläre Wellen.
»Du musst direkt rein. Brett werfen, draufspringen. Nicht lange zögern! Pass auf, wie ich es mache, okay?«, schrie eine junge Blondine ihrem braungebrannten Begleiter zu.
Die Zuschauer warteten gebannt, sie ahnten, dass der Mann zum ersten Mal den Eisbach bezwingen wollte.
Die Frau nahm ihr Brett und legte es knapp vor sich ins Wasser. Sprang sofort darauf und hielt trotz des reißenden Wasserstroms geübt das Gleichgewicht. Ihre Bewegungen waren elegant, ihre Querfahrten über das etwa sechs Meter breite Bachbett mutig. Die Leute klatschten vor Begeisterung.
Über eine Minute surfte sie über die Wellen, lächelte glücklich hoch zu den Zuschauern und bemerkte nicht, wie der Kopf eines schnauzbärtigen Mannes mit entstellten Gesichtszügen ihr Surfbrett torpedierte. Der Aufprall hob die Surferin vom Brett. Sie landete im Eisbach, was früher oder später ohnehin immer der Fall war. Noch hörte sie die Schreie der Zuschauer nicht. Ein älterer Herr mit Strohhut sank zusammen, als er erkannte, dass nicht nur die Surferin, sondern auch ein toter Mann im Bachbett herumgewirbelt wurde. Eine Frau mit Fahrradhelm und schnittiger Sonnenbrille ließ ihr Handy vor Schreck in die Fluten fallen. Väter und Mütter rissen ihre Kinder an sich und rannten davon, um ihnen und sich den schrecklichen Anblick zu ersparen. Der braungebrannte, junge Mann gaffte regungslos auf die Wasserleiche. Die Surferin hatte sich ohnmächtig den Fluten ergeben. Zwei ihrer Freunde sprangen ins Wasser. Zu spät für die weitertreibende Leiche, rechtzeitig aber, um ihre Freundin aus dem Eisbach zu fischen.
6. KAPITEL
Auf dem Weg zur Anwaltskanzlei überlegte Zeki Demirbilek, warum er Schwabing nicht mochte. Natürlich gab es keinen Grund. Wie konnte er Groll gegen einen Stadtteil hegen? Nur weil die Anwaltskanzlei dort lag? Der Gedanke war schnell wieder verflogen, als er an einem kleinen Reisebüro vorbeikam. Er blieb stehen und studierte das Angebot auf den Schaufensterplakaten. Antalya, zwei Wochen. Sonne und Meer. Warum nicht?, dachte er. Wie vor zwei Jahren, als die Ehe mit Frederike schon einmal kriselte. Frag sie einfach. Zeig ihr, dass du ein echter Türke bist, mit Herz im Leib und schwerer Romantik im Blut. Zeki musste bei der Vorstellung über sich selbst lächeln – ihm war es als Ermittler nicht fremd, Unmögliches als eine Möglichkeit in Erwägung zu ziehen.
Es blieben ihm noch zehn Minuten bis zu dem Termin um elf Uhr. Frederike, so malte er sich aus, rauchte bestimmt noch eine Zigarette vor der Tür der Kanzlei. In etwa sechs Minuten würde sie sich des Atemsprays bedienen und mit genügend Nikotin im Blut mit dem Aufzug in den zweiten Stock zu Dr. Gerhard Vollrat hochfahren. Vollrat war ursprünglich die Idee ihres Paartherapeuten gewesen. Bei dem von ihm angeregten Scheidungsinformationsgespräch sollten Frederike und er erfahren, dass Scheidung ein schmutziges Geschäft war. Ein drastischer Griff in die psychotherapeutische Trickkiste, um die verkorkste Ehe zu retten. Zeki konnte den eingebildeten Schnellredner mit dem juristischen Duktus vom ersten Moment an nicht leiden und sagte es ihm auf den Kopf zu. Frederike dagegen hatte Gefallen an dem Experten gefunden und engagierte ihn. Die Scheidung von Frederike Schubert und Zeki Demirbilek war nach dem paartherapeutischen Termin beschlossene Sache.
Demirbilek blieb ein weiteres Mal stehen. Gerade rechtzeitig, um nicht in einen Hundehaufen mitten auf dem Bürgersteig zu treten. Das Innenfutter seines grauen Anzugs rieb an dem weißen Hemd, als er sich suchend umblickte. Kein Hund weit und breit. Kein Frauchen oder Herrchen. Der Geruch war frisch. Angeekelt passierte Demirbilek die Stelle und erblickte eine um die siebzig Jahre alte Frau mit altmodischem Kopftuch, das ihr verschrumpeltes Gesicht fast zur Gänze verdeckte. Sie hockte im Schneidersitz auf dem Bürgersteig. Mit wirrem Blick starrte sie ihren Dackel an, der mit dem Kopf in ihrem Schoß lag. Demirbilek registrierte aus den Augenwinkeln die neugierigen Blicke der Passanten auf der anderen Straßenseite, doch niemand machte Anstalten, der Frau beizustehen.
»Weg, sag ich! Lassen Sie mich in Ruhe!«, schrie sie den Kommissar an, der sich zu ihr beugte, um ihr aufzuhelfen. Der Dackel kläffte mit piepsigen Lauten, als wäre er dem Wahnsinn nahe. Demirbileks unerschütterlicher Glaube an die Richtigkeit seines Tuns ließ ihn weitermachen. Mit ruhigen Worten redete er auf die alte Frau ein, das dazwischengeschobene »Halt’s Maul« dem Dackel gegenüber ließ die Situation jedoch eskalieren. Das Hündchen bekam es mit der Angst zu tun und nahm mit der Leine, die an der Handtasche der alten Frau hing, Reißaus. Nun schrie die alte Frau erst recht aus vollem Halse. Schnappte nach Luft und fixierte in Todesangst den dunkelhaarigen Mann: »Polizei! Polizei! Der hat meine Handtasche gestohlen! Ein Räuber! Helft mir! Polizei!« Demirbilek hielt besänftigend seinen Dienstausweis vor ihre angsterfüllten Augen, woraufhin die Alte noch verwirrter als vorher in Demirbileks Gesicht sah und weiterkreischte.
Demirbilek steckte ratlos seinen Dienstausweis wieder ein und ließ die Frau sitzen. Warum passierte ihm das immer wieder? Warum nur?, fragte er sich wütend. Er kannte diese Wut, seit er nach Deutschland gekommen war. Immer wieder holte ihn seine Herkunft ein. Er hatte es aber satt, sich zu rechtfertigen und klarzustellen, dass es zwei Welten in ihm gab. Mal war es der Türke in ihm, der sein Recht forderte, mal gewann der Münchner die Oberhand.
Plötzlich klingelte sein Handy. Frederike. Natürlich wollte sie wissen, wo er blieb. In seiner Wut wollte er nicht mit ihr reden. Er lief los, gehetzt, als wäre er auf der Flucht. Er versuchte, seine Umwelt, die Menschen, die Straßen, die Läden, alles, was ihn an das Hier und Jetzt erinnerte, zu ignorieren. Nach zehn Minuten erreichte er einen kleinen Park mit einem Brunnen in der Mitte. Hier war es ruhig. Er setzte sich auf eine Bank und schaltete das Handy aus. Dann dachte er an das angstverzerrte Gesicht der alten Frau, rekapitulierte, dass sie echte Todesangst vor ihm gehabt hatte, als er helfen wollte. Wegen seines Aussehens. Dunkel und schwarzhaarig. Anders als die anderen und bestimmt kein Polizist. Sie konnte nicht glauben, dass er sich für Gesetz und Ordnung einsetzte, für die deutschen Gesetze und die deutsche Ordnung.
Sein Blick wanderte den Brunnen hoch. Er erkannte das Münchner Kindl, Münchens Wappenfigur. Die Stadt, die er als sein Zuhause empfand. Er sah genauer hin. Stutzte. Dann verstand er, was für eine Bewegung der Mönch in seiner schwarzen Kutte und den roten Schuhen machte. Er stieg mit einem großen Schritt aus dem Wappen heraus.
Sein Herz hämmerte wild. Es tat weh. Pochte und trommelte viele Augenblicke lang. Dann verflog der Schmerz genauso schnell, wie er gekommen war. Es ist Zeit, wurde Zeki auf einen Schlag bewusst. Scheiß auf Deutschland. Scheiß auf München. Mach mit all dem Rotz, der dich so nervt, Schluss. Wirf alles hin. Fang neu an. Geh weg. Geh zurück. Zurück?, fragte er sich verängstigt. Was bedeutet zurück? Nach Neuperlach? Nach Istanbul? Bei dem Gedanken an seine Geburtsstadt jagten Erinnerungen an seine Kindheit durch den Kopf. Die Straßen Istanbuls. Der Bosporus. Gestank und Schmutz. Düfte und Lärm des Basars mittwochs in der Karadeniz Caddesi. Sein Onkel Aydin, der ihm mit acht Jahren die erste Zigarette in den Mund steckte. Der Weg zur Moschee an der Hand seines Vaters. Wo er als Junge ein kleiner Mann sein durfte. Tränen schossen ihm in die Augen. Wehmut packte ihn ohne einen Funken Gnade. Mit zitternder Hand holte er ein Stofftaschentuch aus dem Sakko und wischte sein Gesicht trocken, seine dunklen Augen mit den wuchtigen Augenbrauen. Verschämt schaute er nach links und rechts, er wollte nicht, dass ihn jemand in dem jämmerlichen Zustand sah.
Dann plötzlich dachte er an Selma. Wie eine Injektion. Ein unvermittelter Stich durch den Anzug, sein Hemd, das Unterhemd, die behaarte Brust, durch die Haut, das Gewebe tief in sein Herz. Er spürte Selmas sanfte Zunge. Sie rieb sich an seiner in einer dunklen Gasse in Istanbuls Altstadt.
Er wusste mit den Gefühlen, die ihn wegen eines verachtenden Blickes einer alten Frau übermannten, nichts anzufangen. Er brauchte dringend ein Stück alte Heimat, etwas, um sich zugehörig zu fühlen, damit er auch München wieder sein Zuhause nennen konnte.
7. KAPITEL
Kommissar Pius Leipold stand neben dem dickleibigen Notarzt, der, etwa zweihundert Meter von der Surferbrücke entfernt, den Tod des nackten, schnauzbärtigen Mannes feststellte. Leipold spielte mit dem goldenen Ring in seinem rechten Ohr, ein untrügliches Zeichen dafür, dass er ein Problem witterte. Er mochte den Anblick von Leichen nicht sonderlich und war erfahren genug, um zu wissen, dass ein Mordfall wie der Eisbachtote viele Überstunden fordern würde. Und darauf war er nicht gerade versessen. Er zündete einen Zigarillo an und sah zu seinen beiden Freunden und Kollegen Herkamer und Stern. Sie führten die Befragungen mit den Surfern durch. Besser Surferin, dachte Leipold, die eine hatte lange blonde Haare, kein Wunder, dass sich Stern ins Zeug legte. Wahrscheinlich notierte er gerade ihre Telefonnummer, um sie am Abend anrufen zu können, falls er noch Fragen haben sollte. Stern war Junggeselle. Frauen zum Vögeln zu überreden war das einzige Hobby, das er ernsthaft betrieb. Pius Leipold holte sein uraltes Handy aus der Lederjacke und rief ihn an. Er beobachtete, wie Stern es drei Mal läuten ließ, bevor er den Anruf entgegennahm und sich nach ihm umdrehte.
»Komm mal wegen der Leiche vorbei, ich kann das nicht ansehen, ehrlich«, sagte Leipold, ohne eine Antwort abzuwarten.
Trotz weiträumiger Absperrung und Einsatz von zwanzig Beamten harrten die Schaulustigen aus, um wenigstens einen kurzen Blick auf die Wasserleiche zu ergattern. Der illegale Bierverkäufer hielt keine hundert Meter von der Leiche entfernt Bierkästen im Eisbach kühl – er machte das Geschäft seines Lebens. Eine Handvoll Polizeireporter und Lokaljournalisten verlangten freien Zugang zur Leiche. Sanitäter versorgten zwei Zeugen, die in Ohnmacht gefallen waren. Leipold beobachtete eine Weile das Treiben und setzte sich dann müde in seinen Dienstwagen, der am Haus der Kunst parkte. Er dachte darüber nach, wie er den unliebsamen Fall loswerden könnte. Da es sich dem Augenschein nach bei der Leiche um einen Ausländer handelte, hoffte er darauf, dass sein verdienter Kollege, Kommissar Zeki Demirbilek, den Fall übernehmen würde. Er kannte den Türken seit fünf Jahren. Er mochte ihn nicht, warum auch? Der Kerl war eingebildet wie ein osmanischer Sultan, hatte ständig ein Schneuztuch in der Hand und war für einen Kriminaler mit seinem Anzug eine zu elegante Erscheinung. Sie sind überall, die Ausländer, hatte er in letzter Zeit festgestellt. Wenn er morgens beim Bäcker den Milchkaffee holte, grinste ihn der erste freundlich an. Und wehe, es stand einer ihresgleichen an der Kasse. Dann wechselten sie die Sprache und faselten Belanglosigkeiten, die er nicht verstand. Einfach so die Sprache wechseln zu können, war Pius Leipold nicht geheuer. Er hatte nicht mal richtig Englisch gelernt, überlegte er und schnippte seinen halbgerauchten Zigarillo aus dem Autofenster. Kassierer beim Discount-Bäcker mochte ja für einen Türken eine angemessene Stellung sein, aber Kommissar mit eigenem Dezernat? Das war Pius Leipold zu viel an Integration. Natürlich wusste er, dass der türkische Kommissar ein guter, gewissenhafter Ermittler war, er hatte es über den mittleren Dienstweg weit gebracht. Außerdem soll er ein Kenner der bayerischen Küche sein, hatte ihm der Wirt der Augustiner Schwemme gesteckt. Schweinebraten soll er bei ihm bestellt haben, und das nicht nur einmal. Soll doch der Türke die Leiche übernehmen. Er selbst jedenfalls hatte keine Lust, aufklären zu müssen, wer den Schnauzbartträger umgebracht hat. Von weitem beobachtete er, wie Stern, über die Leiche gebeugt, Notizen in sein Diktiergerät sprach. Dann begann er, die Schläfen zu massieren. Sein Schädel brummte von den Gin Tonics, die er mit Stern und Herkamer nebenan im P1 getrunken hatte. Die drei hatten in der vergangenen Nacht in den Eisbach gepisst, betrunken wie sie waren.
Dann blinzelte er hoch in den weiß-blauen bayerischen Himmel und flehte den lieben Herrgott an, den Toten einen Türken sein zu lassen. Er wollte mit dem Gschwerl nichts zu tun haben.
8. KAPITEL
Eine Stunde später, kurz vor eins, drehte Kommissar Pius Leipold seinen ergonomisch optimierten Bürostuhl mit Lehne von links nach rechts und zurück. Das Dienstzimmer des Einundvierzigjährigen war heimelig eingerichtet, eine Reihe Familienfotos standen auf seinem Schreibtisch. Als Beweis für seine hervorragenden Leistungen als Eisstockschütze hingen Urkunden und Zinnteller an den Wänden. Seine beiden einige Jahre jüngeren Kollegen Ferdinand Stern und Helmut Herkamer saßen ihm auf einfachen Bürostühlen gegenüber. Der frisch gebrühte Filterkaffee dampfte aus den Jumbotassen. Sie waren mit dem bayerischen Polizeiwappen verziert, die Namen hatte Leipold als Weihnachtsgeschenk für seine beiden engsten Mitarbeiter eingravieren lassen.
»Könnte tatsächlich ein Türke sein, vielleicht Grieche, wer weiß, jedenfalls hat er eine ordentliche Brustbehaarung, auch am Rücken. Beschnitten ist er auch … Ach so, dann kann er ja kein Grieche sein, oder? Er hat eine helle Stelle am Ringfinger der linken Hand. Der Ehering fehlt aber«, berichtete Stern, dem ebenfalls die durchzechte Nacht anzusehen war. »Schätzungsweise ist er Mitte dreißig, definitiv ein unnatürlicher Tod. Sieht aus, als wäre er erdrosselt worden. Das Obduktionsergebnis kommt noch. Im Moment haben wir keinen Hinweis auf die Identität des Mannes.« Dann seufzte Stern und sagte noch: »Was aber richtig komisch ist, ist das da.«
Stern reichte Leipold eines der Fotos, die von der Leiche gemacht worden waren. Leipold bekam die Großaufnahme des Brustkorbes zu sehen. Verdeckt durch die dichte Brustbehaarung, glänzten in den Körper eng an eng hineingetriebene Reißnägel mit goldenen Köpfen. Gut zu erkennen war, dass die Anordnung ein in schnörkeligem Schriftzug geformtes Wort darstellte. Ein paar Reißnägel fehlten. Wahrscheinlich hatte sie sich der Eisbach einverleibt, mutmaßte Leipold und stieß angewidert hervor: »Ach geh, so was macht man doch nicht!« Dann nahm er einen Kugelschreiber zur Hand und begann, damit die Reißnägel zu zählen. Nach einer Weile gab er das Vorhaben auf. »Das müssen ja mindesten zweihundert sein, oder?«, fragte Leipold mit Blick zu seinen Kollegen.
»Keine Ahnung. Das sollen die von der Rechtsmedizin uns sagen.«
»Das ist doch ein Wort, richtig? Was es bedeutet, weißt du nicht, oder?«
»Keine Ahnung. Deutsch ist das jedenfalls nicht«, erwiderte Stern.
Leipold reichte Stern das Foto zurück.
»Na ja, das kriegen wir schon raus. Was haben wir sonst noch?«, wandte sich Leipold an Herkamer, der in seiner bayerischen Lodenmode trotz durchzechter Nacht ausgeschlafen und konzentriert wirkte. Als Nichtraucher vertrug er die Gin Tonics besser als Leipold und Stern. Herkamer sah in den Unterlagen nach und berichtete, dass die Befragung der Surfer und Zuschauer natürlich nichts ergeben habe. Der Schnauzbart war ja schon länger tot. Die Leiche muss ein ganzes Stück bachaufwärts entsorgt worden sein.
Leipold schüttelte den Kopf und dachte kurz nach. »Warum haben sie ihn in den Bach geworfen? Das verstehe ich nicht. Wollten der oder die Täter, dass wir die Leiche finden? Wenn ja, warum machen sie sich die Mühe und ziehen ihn aus und nehmen ihm den Ehering ab? Früher oder später finden wir doch heraus, wer er ist.« Leipold massierte sich die Schläfe. »Helmut, du gehst mal die Vermisstenanzeigen durch. Zum Ehering wird es ja wohl eine Ehefrau geben. Und du, Ferdinand, gibst ein anständiges Foto an die Presse raus, nichts so Furchterregendes, bitte. Mal schauen, ob jemand die arme Sau erkennt. Mehr können wir im Moment nicht tun. Macht dann weiter mit euren anhängigen Fällen. Ich versuche mal, ob wir den Eisbachtoten nicht jemand anderem aufs Auge drücken können. Wir haben genug anderes zu tun.«
»Stimmt. Das wäre was für den Demirbilek und sein Dezernat, oder?«, fragte Herkamer seinen Chef.
»Jetzt warten wir mal ab, ob wir es wirklich mit einem Ausländer zu tun haben … Ihr kennt den Türken doch. Der schickt uns den Toten sonst bloß wieder zurück! So, jetzt macht eure Arbeit, in einer Stunde fahren wir zur Muffathalle in den Biergarten. Ich brauche ein Bier.«
Die beiden Kollegen nahmen ihre Jumbotassen und verließen Leipolds Dienstzimmer. Leipold blieb auf seinem Sessel sitzen und wählte ein weiteres Mal Demirbileks Handynummer. Wieder nur die Mailbox. Er legte auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, und sagte laut zu sich: »Scheiße, Türke, wo bist du?« Dann stand er auf und schloss die angelehnte Tür. Er ging zurück zum Schreibtisch und wühlte in der vollgestopften Schublade, bis er einen Reißnagel mit blauem Plastikkopf fand.
Im Stehen zog er den Ausschnitt seines schwarzen T-Shirts ein Stück nach unten und drückte vorsichtig den Reißnagel in seinen Brustkorb. Mit dem geringen Druck, den er ausübte, passierte nichts. Er drückte fester zu. Fest genug, bis der Schmerz im Schädel aufhörte und sich wohltuend auf den Brustkorb verlagerte. Der Reißnagel steckte im Fleisch seiner rasierten Brust. Das herausquellende Blut war im Schwarz des T-Shirts nicht zu sehen.
Zwanzig Minuten später drehte Herkamer den Kopf, um das Foto, das aus dem Farblaserdrucker surrte, betrachten zu können. Er nahm das warme Papier und setzte sich im gemeinsamen Dienstzimmer Stern gegenüber. Dann begutachtete er das Foto aus der Vermisstenkartei ein weiteres Mal und hielt es hoch, damit sein Kollege es sehen konnte. »Na also«, sagte er mit einem erleichterten Unterton. »Das ist er. Türke. Bülent … den Nachnamen kann kein Mensch aussprechen.«
Stern nahm Herkamer den Ausdruck aus der Hand. Das Hochzeitsfoto neben den Angaben zu Person und Wohnort zeigte den Mann aus dem Eisbach in einem schwarzen Anzug, seine brünette Frau in weißem Hochzeitskleid trug ein enganliegendes Kopftuch. Beide hatten einen übertrieben glücklichen Gesichtsausdruck. Das erzwungene Lächeln wirkte leicht spastisch, fand Stern. Der Hintergrund des Studiofotos zeigte einen weichgezeichneten, roten Mond, was der Aufnahme eine gewisse kitschige Note verlieh.
»Vermisst?«, fragte Stern.
»Jetzt nicht mehr«, erwiderte Herkamer.
»Warum jagen die ihm bloß Reißnägel in die Brust?«, dachte Stern laut nach.
»Gott sei Dank müssen wir nicht zu seiner Witwe. Die spricht bestimmt kein Deutsch … Demirbilek ist der Richtige dafür«, entgegnete Herkamer.
»Komm, gehen wir zu Leipold, Zeit für den Biergarten«, meinte Stern. Die beiden Beamten standen auf, Herkamer nahm das Foto und legte es zu den anderen Unterlagen in die Akte.
9. KAPITEL
Zwei Stockwerke über Leipolds Büro hatte Isabel Vierkant genug vom Warten. Sie blickte sich um und beschloss, etwas gegen das Durcheinander zu unternehmen. Obwohl sie keine Ordnungsfanatikerin war, war es ihr lieber, wenn es in ihrer Umgebung nicht so aussah wie in ihrer chaotischen Umhängetasche. Offenbar, stellte sie kopfschüttelnd fest, war dem neuen Dezernatsleiter die Inneneinrichtung gleichgültig. Sie stand auf und verrückte einen der beiden Schreibtische ein Stück in die Mitte des Raumes, damit sie eine bessere Sicht durch das Bürofenster hatte. Die Wandschränke, Regale und Tische aus dem Möbellager machten ebenfalls keinen guten Eindruck. Nichts passte zusammen. Einen Garderobenständer gab es auch nicht. Sie setzte sich und hängte die Jacke über den Drehstuhl, genoss einen Seufzer lang den Blick über die Dächer von Münchens Altstadt und schaltete den Computer ein. Sie tippte im Zehnfingersystem. Eine Fähigkeit, die sie sich in einem VHS-Kurs angeeignet hatte. Überhaupt war sie auf die neue berufliche Herausforderung gut vorbereitet. Peter, ihr Ehemann, arbeitete freiberuflich als Programmierer zu Hause. Die Zweizimmerwohnung war für sie beide groß genug. Das Kind, nach dem er sich sehnte, musste warten. Auch sie wollte unbedingt eine Familie gründen. Nur nicht jetzt. Ein, vielleicht zwei Jahre später.
Es dauerte fünfzehn Minuten, bis Vierkant von Garderobenständer, Büroklammern, Locher, Ordner und Blumenvasen eine umfangreiche Liste erstellt hatte. Sie schickte das Dokument per Mail an die Kollegin vom zentralen Materiallager und rief gleich an, um sich mit ihr am Montag zum Mittagessen zu verabreden. Wäre gelacht, wenn sie nicht bis spätestens Mittwoch alles zusammenhätte, dachte sie und sah nervös auf die Uhr. Es war noch Zeit für den kahve. Sie würde in die Kantine gehen. Dort hielt der Küchenchef für den türkischen Mitarbeiter Kaffeekännchen und Tassen bereit. Sie wusste Bescheid im Präsidium. Deshalb wird er dich nehmen, peitschte sie sich in bescheidenem Maße auf. Doch der Druck ließ nicht nach. Im Gegenteil, sie spürte das Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen. Sie hängte sich ihre Tasche über die Schulter und verließ das Büro.