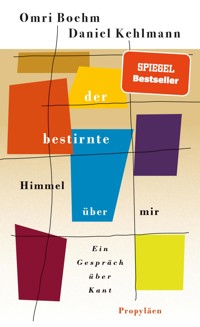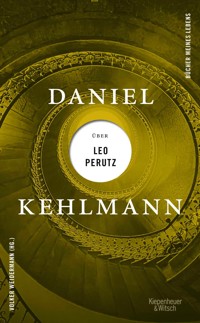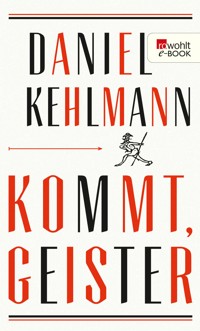
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wieso reichen neun Minuten Peter Alexander, um Günter Grass dankbar zu sein? Warum ist Vergessen eine anstrengende Übung, Verdrängung harte Arbeit? Entstehen Gespenster aus unserer Angst vor der Vergangenheit? Und könnte es sein, dass Daniel Kehlmann, den als Kind ein Buch nächtelang mit Albträumen geplagt hat, eben dadurch später zum Schriftsteller geworden ist? Um diese und andere Fragen kreisen seine fünf bestechend klaren und virtuos durchkomponierten Vorlesungen, die er als Inhaber des ältesten und renommiertesten deutschen Gastlehrstuhls für Poetik im Sommer 2014 an der Frankfurter Goethe-Universität gehalten hat. Mit einem Shakespeare-Zitat als Titel – «Kommt, Geister, die ihr lauscht auf Mordgedanken» – entführen sie in literarische Schattenwelten voller Zwielicht und Echos, Falltüren und Gespinste. Daniel Kehlmann zeigt auf, wie sehr die nachhallenden Schrecken der deutschen Vergangenheit sein Werk grundieren, schreibt über die Geister, Gespenster, Zombies, Narren, Halbmenschen in den Werken von Autoren wie Jeremias Gotthelf, J.R.R. Tolkien, Shakespeare, Grimmelshausen, Leo Perutz. Und gibt damit auch Auskunft über sich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Daniel Kehlmann
Kommt, Geister
Frankfurter Vorlesungen
Über dieses Buch
Wieso reichen neun Minuten Peter Alexander, um Günter Grass dankbar zu sein? Warum ist Vergessen eine anstrengende Übung, Verdrängung harte Arbeit? Erstehen Gespenster aus unserer Angst vor der Vergangenheit? Und könnte es sein, dass Daniel Kehlmann, den als Kind ein Buch nächtelang mit Albträumen geplagt hat, eben dadurch später zum Schriftsteller geworden ist?
Um diese und andere Fragen kreisen seine fünf bestechend klaren und virtuos durchkomponierten Vorlesungen, die er als Inhaber des ältesten und renommiertesten deutschen Gastlehrstuhls für Poetik im Sommer 2014 an der Frankfurter Goethe-Universität gehalten hat. Mit einem Shakespeare-Zitat als Titel – «Kommt, Geister, die ihr lauscht auf Mordgedanken» – entführen sie in literarische Schattenwelten voller Zwielicht und Echos, Falltüren und Gespinste. Daniel Kehlmann zeigt auf, wie sehr die nachhallenden Schrecken der deutschen Vergangenheit sein Werk grundieren, schreibt über die Geister, Gespenster, Zombies, Narren, Halbmenschen in den Werken von Autoren wie Jeremias Gotthelf, J.R.R. Tolkien, Shakespeare, Grimmelshausen, Leo Perutz. Und gibt damit auch Auskunft über sich.
Impressum
Die fünf Vorlesungen wurden zwischen dem 3. Juni und dem 1. Juli 2014 an der Frankfurter Goethe-Universität gehalten.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger/Wüschner/Rasp, München
Abbildung akg-images (Ausschnitt aus einer Zeichnung von Johannes de Witt, 1596)
ISBN 978-3-644-04591-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Motto
Illyrien
Elben, Spinnen, Schicksalsschwestern
Robin Goodfellows Reise um die Erde in vierzig Minuten
Teutsche Sorgen oder die Entdeckung der Stimme
Unvollständigkeit
Zitierte Literatur
Dank
Der tote Perutz an meinem Tisch, freundlich – im Kaffeehaus.
(Elias Canetti: Das Buch gegen den Tod)
Illyrien
In jedem Film mit Peter Alexander gibt es eine Musikeinlage für die jungen Leute. Von irgendwem wird etwas Flottes gefordert, etwas Modernes, und sogleich tanzt man mit wackelnden Knien und schwingenden Hüften, und dazu spielt eine Band – nein, natürlich nicht Rock ’n’ Roll oder Jazz, sondern deutsche Schlagermusik, aber der Sänger, manchmal Peter Alexander selbst, manchmal Gus Backus oder Bill Ramsey, trägt immerhin den deutschen Text mit amerikanischem Akzent vor und ruft zwischen den Strophen «Hey», «Oh» und «Yes». So sieht für die Zwecke der deutschen Komödie Wildheit und Jugend aus, so die große Welt, die man für vier Minuten hereinlässt. Und ist die gespenstische Einlage vorbei, geht der Film weiter, als wäre nichts geschehen.
Vor einiger Zeit, Günter Grass hatte gerade sein Gedicht über die israelische Außenpolitik veröffentlicht, geriet ich mit Amerikanern, die Deutsch können und das Land gut kennen, in eine Diskussion: Was für ein albernes Gedicht, wurde da gerufen, welch ein Wichtigtuer, und überhaupt, immer dieses Politikergehabe, das Moralisieren! Mir schien das alles nicht falsch, aber plötzlich aufsteigende Erinnerungen an die Samstagnachmittage meiner Kindheit in Wien, als es nur zwei Fernsehprogramme gab, von denen eines bloß ein buntes Ding namens Testbild zeigte, sodass man dankbar ansah, was immer auf dem anderen geboten wurde, ließen mich das iPad hervorholen.
«Ihr glaubt, ihr versteht Deutschland. Aber ihr wißt nichts, wenn ihr das nicht kennt.» Und ich tippte Peter Alexander und wählte den ersten Film, den YouTube mir anbot: Peter schießt den Vogel ab.
Nach fünf Minuten wurde ich leise gebeten abzuschalten, nach sieben Minuten wurde ich laut gebeten abzuschalten, nach neun Minuten wurde mir Gewalt angedroht, und ich schaltete ab. Müde sahen wir einander an.
«Und das haben Leute gesehen?»
«Das war der beliebteste Entertainer Deutschlands. In den fünfziger Jahren, in den sechziger Jahren, in den siebziger Jahren und auch noch in den Achtzigern.»
Und auf einmal hatte keiner von uns mehr Lust, über die Gruppe 47 zu spotten: Wir hatten ihrem Anderen ins Gesicht gesehen, der Film gewordenen Verdrängung. Auf einmal mochten wir Günter Grass wieder. Auf einmal waren wir ihm dankbar.
Unter dem kühlen Titel Probleme zeitgenössischer Dichtung eröffnet Ingeborg Bachmann 1959 die Reihe der Frankfurter Vorlesungen. Im selben Jahr erscheint Die Blechtrommel, und der Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer erreicht, dass der Bundesgerichtshof die «Untersuchung und Entscheidung der Strafverfolgung» in Sachen Auschwitz dem Landgericht Frankfurt am Main überträgt. Endlich kann Bauer beginnen, das vorzubereiten, was unter dem Namen «Auschwitz-Prozeß» in die Geschichte eingehen wird. Im Jahr 1959 bringt Peter Alexander drei Filme heraus: Schlag auf Schlag, Ich bin kein Casanova und Peter schießt den Vogel ab.
Ingeborg Bachmann ist dreiunddreißig, und ihre Vorlesungen sind ein Versuch, Anschluss zu finden an eine unerreichbar fern gewordene Weltliteratur. «[Es] bleibt uns allen lang verborgen, was an Neuem in anderen Ländern entsteht, meist mit der Verspätung von ein, zwei Generationen erfahren wir es.» Ihre Vorlesungen sind ein Spiel aus Andeutung, Verschlüsselung und Klarheit, und sie hält sie in einem seltsamen Land. Auf das Verbrechen folgt die Verdrängung, auf den Schrecken die Neurose, auf die Hölle die Farce. «Halten Sie mich nicht für allzu engstirnig, daß ich darauf beharre, auf Schuldfragen in der Kunst, und daß ich sie derart in den Vordergrund rücke.» Denn man arbeite ja nicht in irgendeiner Zeit, sondern habe sich daran zu erinnern, «auf welchem Grund wir bauen, auf wieviel Gräbern, Schandorten».
Das Bild vom Bauen auf schlechtem Grund verwendet auch der zurückgekehrte Emigrant Fritz Bauer, den eine glückliche Fügung zum rechten Mann am rechten Ort werden lässt.
Daß Deutschland in Trümmern liegt, hat auch sein Gutes, dachten wir. Da kommt der Schutt weg, da bauen wir Städte der Zukunft. Hell, weit und menschenfreundlich. Bauhaus. Gropius. Mies van der Rohe. So dachten wir damals. Alles sollte ganz neu und großzügig werden. Dann kamen die anderen, die sagten: Aber die Kanalisationsanlagen unter den Trümmern sind doch noch heil! Na, und so wurden die deutschen Städte wieder aufgebaut, wie die Kanalisation es verlangte.
Ende der fünfziger Jahre, so berichtet Ronen Steinke in seiner grandiosen Biographie Bauers, hat die Bundesrepublik keines der Nürnberger Urteile offiziell anerkannt, auch in Dokumenten des Bundesgerichtshofes ist im Zusammenhang mit den in Nürnberg Verurteilten immer von «mutmaßlichen» Kriegsverbrechern die Rede. Die Hamburger Dienststelle des Roten Kreuzes gibt das Periodikum Warndienst West heraus, in dem untergetauchte NS-Funktionäre lesen können, wann und wo sie gesucht werden. Als Fritz Bauer erste Hinweise auf den Aufenthaltsort Adolf Eichmanns bekommt, ist ihm sofort klar, dass keiner seiner Kollegen in der deutschen Justiz wissen darf, auf wessen Spur er ist; darum wendet er sich an den israelischen Geheimdienst. Bis zu seinem Tod wird er verheimlichen – als wäre es etwas Schändliches –, dass der entscheidende Anstoß zur Verhaftung Eichmanns von ihm kam. «Wenn ich mein Dienstzimmer verlasse», lautet sein berühmtester Ausspruch, «betrete ich feindliches Ausland.»
Unterhaltungsfilme der deutschen Nachkriegszeit haben einen starken Effekt auf Verstand, Gemüt und Seele. Zwingt man sich, einen von ihnen anzusehen, so ist einem nicht bloß langweilig, man fühlt sich schon nach kurzem regelrecht misshandelt. Das liegt nicht nur daran, dass diese Filme schlecht sind. Schlecht ist vieles; schlecht sind auch die Filme mit Doris Day und Rock Hudson, die zur gleichen Zeit entstehen, schlecht ist das meiste von Jerry Lewis, schlecht sind Komödien mit Jennifer Aniston oder von Jerry Bruckheimer produzierte Blockbuster. Die Erzeugnisse der deutschen Unterhaltungsindustrie aus den fünfziger Jahren aber vermögen etwas, das andere Filme nicht können: Sie machen einen verzweifelt. Sie sorgen dafür, dass man Migräne bekommt. Hat man es wirklich geschafft, einen von ihnen in voller Länge anzusehen, so ist die Gefahr groß, dass man den Rest des Tages in maroder Verwirrung zubringt.
Seltsamerweise haben die Filme der Nazizeit diese Eigenschaft nicht. Viele sind natürlich üble Propagandawerke, andere Ausdruck von harmlosem Eskapismus, wieder andere sind alles in allem wirklich nicht schlecht, sodass man ihnen außer ihrer Entstehungszeit nicht viel vorwerfen kann. Aber da arbeiten Schauspieler, die ihren Beruf verstehen, die Dialoge sind nicht abstrus und die Szenen richtig ausgeleuchtet. Die Kostüme sind nicht lächerlich, die Regie ist handwerklich versiert.
Erst nach dem Krieg ändert sich das. Zuvor haben deutsche Filme viel verschwiegen, jetzt werden sie selbst zum Vehikel des Verschweigens, das Verdrängen geht gewissermaßen als aktiver Vorgang in sie ein. Erst nach dem Krieg starrt einen aus dem deutschen Film die Fratze des Wahnsinns an.
Ingeborg Bachmanns Vater ist NSDAP-Mitglied, ein frühes und überzeugtes, dann ist er Wehrmachtsoffizier. Er ist auch ein guter, liebender Vater. Aus diesem Konflikt wird sie sich ihr Leben lang nicht befreien, er liegt in dunkel verzerrter Weise noch ihrem späten Roman Malina zugrunde. Hochbegabt, früh gefördert, früh aufgebrochen aus der österreichischen Provinz in eine Hauptstadt, die nur eine etwas urbanere Provinz ist und in der literarische Provinzkönige wie Hermann Hakel und Hans Weigel regieren, wird die junge Frau dort rasch aufgenommen und sofort unterschätzt. Schnell beweist sie, dass sie nicht in diese Lokalgrößenwelt gehört. Mit Umsicht und Geschick – denn weltfremde Künstler können unerhört praktisch sein, wenn es nötig ist zu entkommen – besorgt sie sich eine Einladung zu einer Zusammenkunft der Gruppe 47. Dort entdeckt man sie, und bald ist sie aus dem, was Thomas Bernhard später die «Wienfalle» nennen wird, befreit.
Die berühmten Kollegen sind fasziniert von ihrem Charisma – man merkt es daran, dass in den Beschreibungen regelmäßig gesagt wird, sie habe keines – und ihrem Talent. Wie fast alle jungen Schriftsteller ist sie entsetzt darüber, dass man denkt, sie meine sich selbst, wenn sie in ihren Gedichten «ich» sagt. Dieses Erschrecken ist alt, aus reiner Höflichkeit stimmt man dem klagenden Autor darin gemeinhin zu, sagt nickend: «Wirklich schlimm, die Leute können nicht lesen», und liest selbst weiterhin genau so, wie man es immer getan hat.
Denn natürlich meint der Schriftsteller immer sich selbst, wenn er «ich» sagt. Aber das Komplizierte am Sprechakt der Literatur ist eben, dass die Freiheit, so von sich zu sprechen, wie man es unter anderen Umständen nie täte, nur dadurch zustande kommt, dass die gesellschaftliche Übereinstimmung darin besteht, so zu tun, als spräche der Autor nicht von sich. Und tatsächlich spricht er ja auch nicht von dem Ich, das ins Kino geht, Kaffee trinkt, Freunde trifft und die Zeitung durchblättert, sondern von einem anderen – einem böseren, liebevolleren, offeneren, ängstlicheren, wahrhaftigeren Ich, als es sich je in Gesellschaft zeigen könnte. Der Schriftsteller erschrickt, wenn ihm klarwird, dass man meint, er öffne seine Seele, weil er tatsächlich seine Seele öffnet, wenn auch unter dem Schutz der Konvention, so zu tun, als wüsste man das nicht; der Schriftsteller erschrickt, wenn ihm klarwird, dass im Grunde keiner an diese höfliche Übereinkunft glaubt. Und dabei hat er doch gedacht, er wäre der Einzige, der nicht darauf hereingefallen ist.
Dass Ingeborg Bachmann sich in den Vorlesungen gegen die Identifikation des biographischen Ich mit dem Ich in den Gedichten wehrt, ist also zu erwarten, aber im Zuge dessen entwickelt sie eine faszinierende Theorie der Subjektivität. Am unverhülltesten spreche von sich, wer von ganz anderem zu sprechen scheine. Die am stärksten geschützte und daher auch am wenigsten private literarische Form sei das Tagebuch. Gerade weil es offiziell jede Offenheit erlaube und die bewährte Form der Selbstenthüllung sei, sei es in Wahrheit das Genre, in dem das Ich am stärksten gepanzert auftrete. Führt man den Gedanken weiter, folgt daraus: So, wie also ein Tagebuch weniger intim ist als ein Gedicht, ist ein Gedicht weniger persönlich als eine Erzählung.
Wie angenehm übrigens, dass sie in diesen Vorträgen nicht unverschlüsselt von sich selbst spricht. Nie erklärt sie, was sie sich beim Schreiben dieses oder jenes Gedichtes gedacht hat, sie verrät nicht, welche Kurzgeschichte sie für ihre beste hält. Sie spricht, als wäre sie bloß Leser, und ihr Autorentum behält sie für sich wie eine Privatsache.
Ingeborg Bachmanns beste Kurzgeschichte trägt den Titel Unter Mördern und Irren. Ein männlicher Erzähler hockt mit Wiener Kulturfunktionären beisammen, die sich «mehr als zehn Jahre nach dem Krieg», und wie fast jeden Abend, um ihren Stammtisch versammeln. Es wird geraucht, es wird schwadroniert, der Abend wird wieder lange dauern: «Viel später erst, gegen Morgen, würden wir den Frauen über die feuchten Gesichter streichen im Dunkeln und sie noch einmal beleidigen mit unserem Atem, dem sauren starken Weindunst und Bierdunst, oder hoffen, inständig, daß sie schon schliefen und kein Wort mehr fallen müsse.»
Am Tisch sitzt ein gewisser Haderer, Abteilungsleiter beim Radio, der bei der Wehrmacht war, und ein vielbeschäftigter Kulturmanager namens Hutter, der auch bei der Wehrmacht war, und ein einflussreicher Kritiker namens Bertoni, der auch bei der Wehrmacht war. Am Tisch sitzt normalerweise auch ein gewisser Steckel, an diesem Tag nicht erschienen, der in der Emigration war und für Bertoni gebürgt hat, sodass dieser seinen Posten zurückbekommen konnte, und da sitzen auch ein gewisser Friedl, ein gewisser Herz und ein gewisser Mahler, die, wie der Erzähler, auf der anderen Seite gestanden haben. Sie waren Verfolgte, sie haben irgendwie überlebt, jetzt sitzen sie mit am Tisch und plaudern und trinken wie die anderen auch, denn es ist ja alles schon über zehn Jahre her.
Aus dem Nebenraum dringt dumpfes Singen herüber, dort findet ein Wehrmachts-Kameradschaftstreffen statt, aber der Vorsitzende ist ein alter Freund von Bertoni. Er kommt kurz herüber, schüttelt einige Hände, plaudert in leutseliger Kühle und geht wieder. Dann nähert sich ein Zeichner. Er bekommt ein paar Schilling und fertigt Karikaturen der um den Tisch sitzenden Männer an, aus denen ihre Schwäche und betrunkene Eitelkeit so deutlich hervorleuchten, dass sie ihn fortscheuchen. Jetzt aber sind sie aufgewühlt. Im Alkoholdunst beginnen die, die Soldaten waren, von ihren Erinnerungen zu sprechen.
[Haderer] legte die Hand auf die Augen. «Ich möchte nichts missen, diese Jahre nicht, diese Erfahrungen nicht.»
Friedl sagte wie ein verstockter Schulbub, aber viel zu leise: «Ich schon. Ich könnte sie missen.»
So wird plötzlich gegen die Übereinkunft des Schweigens verstoßen, und es sind die Opfer, die sich schämen, als hätten sie etwas Falsches getan. «Wir waren gezwungen, zuzuhören und vor uns hinzustarren, das Brot zu zerkleinern auf dem Tisch, und hier und da wechselte ich einen Blick mit Mahler, der den Rauch seiner Zigarette ganz langsam aus dem Mund schob, Kringel blies und sich diesem Rauchspiel ganz hinzugeben schien.» Schließlich geht der Erzähler zur Toilette und trifft dort am Waschbecken den in Panik aufgelösten Friedl.
«Warum sitzen wir, Herr im Himmel, beisammen! Besonders Herz verstehe ich nicht. Sie haben seine Frau umgebracht, seine Mutter …»
Ich dachte krampfhaft nach, und dann sagte ich: «Ich verstehe es. Doch, ja, ich verstehe es.»
Friedl fragte: «Weil er vergessen hat? Oder weil er, seit irgendeinem Tag, will, daß es begraben sei?»
«Nein», sagte ich, «das ist es nicht. Es hat nichts mit Vergessen zu tun. Auch nichts mit Verzeihen. Mit all dem hat es nichts zu tun. […] Damals, nach 45, habe ich auch gedacht, die Welt sei geschieden, und für immer, in Gute und Böse, aber die Welt scheidet sich jetzt schon wieder und wieder anders. Es war kaum zu begreifen, es ging ja so unmerklich vor sich, jetzt sind wir wieder vermischt, damit es sich anders scheiden kann, wieder die Geister und die Taten von anderen Geistern, anderen Taten. Verstehst du? Es ist schon so weit, auch wenn wir es nicht einsehen wollen. Aber das ist auch noch nicht der ganze Grund für diese jämmerliche Einträchtigkeit.»
Friedl rief aus: «Aber was dann! Woran liegt es denn bloß? So sag doch etwas! Liegt’s vielleicht daran, daß wir alle sowieso gleich sind und darum zusammen sind?»
«Nein», sagte ich, «wir sind nicht gleich. Mahler war nie wie die anderen, und wir werden es hoffentlich auch nie sein.»
Ingeborg Bachmann muss in Wien an der Seite Hans Weigels nicht wenige solcher Abende erlebt haben. Was die Erzählung so beeindruckend macht, ist, dass sie nicht bei der Empörung stehen bleibt. Sie geht in der Erforschung moralischer Komplikationen bis zum Äußersten.
Friedl flüsterte: «Dann ist eben alles doch mit allem im Bund, und ich bin es auch, aber ich will nicht! Und du bist auch im Bund!»
Ich sagte: «Im Bund sind wir nicht, es gibt keinen Bund. Es ist viel schlimmer. Ich denke, daß wir alle miteinander leben müssen und nicht miteinander leben können.»
Am Ende gibt es eine Schlägerei und einen Toten, und einer der Frontsoldaten murmelt etwas von «unerträglicher Provokation». Wieder einmal sind es die Täter, die in der Seele gekränkt wurden.
Die Moral der Erzählung liegt schlicht und einfach darin, dass es keine Moral gibt. Die fürchterlichsten Verbrechen sind geschehen, aber aus diesem Umstand lässt sich nichts lernen und nichts gewinnen. Verbrechensopfer werden nicht bessere Menschen, sie werden nur beschädigt und gebeugt. «Das ist das Furchtbare, […] die Opfer, die vielen, vielen Opfer zeigen gar keinen Weg.»
Der Film Peter schießt den Vogel ab sperrt die Wirklichkeit so radikal aus, dass sogar die harmlosesten Komödien-Topoi darin weiter entschärft werden mussten, als könnte man sie dem deutschen Publikum sonst nicht zumuten. Der Held ist ein Hotelportier namens Peter Schatz, er lernt eine junge Frau kennen, die beiden verlieben sich, sie darf aber nicht erfahren, dass er Portier ist. Weil er arm ist? So wäre es in traditionellen Komödien, dort würde die Frau es schließlich entdecken, es würde ihr aber nichts ausmachen, und die beiden könnten einander in die Arme fallen. Die Idylle ist nach Schillers Definition das Reich des aufgelösten Kampfes; sie findet in einer Welt statt, in der es keine realen Konflikte gibt, sondern nur Missverständnisse, die verschwinden, sobald man sie erkennt. Auch Peter schießt den Vogel ab will idyllisch sein, aber schon ein Missverständnis, das mit sozialen Klassen zu tun hätte, wäre für den deutschen Film unerträglich. Also darf Peter Schatz der Frau seines Herzens die Tatsache, dass er Hotelportier ist, deshalb nicht verraten, weil sie in einer Telefonzentrale arbeitet, häufig in Hotels anrufen muss und die Portiers stets unhöflich zu ihr waren. Naheliegenderweise also hat sie sich geschworen, sich nie im Leben in einen Portier zu verlieben.
Wer kommt auf solche Ideen? In diesem Fall ein gewisser Géza von Cziffra, ein ungarischer Adeliger, Freund von Max Liebermann und Albert Einstein. Das Porträt, das Rudolf Schlichter von ihm gemalt hat, ist ein Hauptwerk der Neuen Sachlichkeit und hängt heute in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Während Géza von Cziffra Konfektionsblödsinn fürs deutsche Publikum anfertigte, fand er nebenbei noch die Zeit, ein wirklich berührendes Buch über die gemeinsamen Pariser Exiljahre mit seinem Freund Joseph Roth zu schreiben. Muss man ihn sich als geschlagenen Zyniker vorstellen, als einen Friedl, Mahler oder Steckel? Er hat sich nie dazu geäußert, er hat sich nie distanziert, weder von Deutschland noch von seinen Filmen. Alle drei Peter-Alexander-Schmonzetten des Jahres 1959 sind sein Werk.
Diese Filme sind voller Pointen wie: «Er heißt Vogel? Und er hat auch einen Vogel», oder: «Wir wollen es gemeinsam begießen – ich meine: genießen», oder: «Ein Hurra auf den Standesbeamten, der imstande war, dem Stand der Ehe standzuhalten!» Häufig wird geniest, dann sagt Peter Alexander mit verschmitzter Miene: «Prost!» Wann immer Peter etwas Schweres hebt, spuckt er in seine Handflächen, wann immer er sich an irgendeine Arbeit macht, spitzt er vorher die Lippen und reibt seine Hände. Wird er von einem Hund gebissen, hebt er den Fuß, hält seinen Knöchel und ruft: «Ui!» Wenn er sich ärgert, hebt er die Hand und streckt drohend den Zeigefinger in die Höhe. Wenn er an eine Frau denkt, in die er sich verliebt hat, lächelt er verklärt, blickt zum Himmel und streichelt seine linke Hand mit seiner rechten. Von Film zu Film wiederholt sich verlässlich das Repertoire, jede Situation hat ihre rituell vorgeschriebene Geste, und nie darf es eine sein, die ein gewöhnlicher Mensch je in einer solchen Lage vollführen könnte, nie darf eine Bewegung, ein Blick, ein Laut auch nur im Entferntesten authentisch wirken. Wäre all dies kunstvoller, man könnte von Verfremdung sprechen, so aber ist es nur eine giftige, alles durchdringende Falschheit. Wenn Hotelportier Schatz sich mit Amerikanern unterhält, spricht er als Beweis seiner Weltläufigkeit nicht etwa Englisch, sondern Deutsch mit englischem Akzent, was von den Ausländern, die ebenfalls Deutsch mit Akzent sprechen, so erfreut aufgenommen wird, als könnte er tatsächlich ihre Sprache. Kommt er durch eine unerwartete Erbschaft zu Geld, so tut er so, als wäre er ein reicher Rinderfarmer aus – jawohl – Argentinien.
Tatsächlich: Argentinien. Wir schreiben das Jahr 1959, und der Film zeigt uns einen Mann, der vorgibt, aus Argentinien zurück in die alte Heimat zu kommen. Warum muss es Argentinien sein, warum nicht Kenia, Brasilien, Australien oder Südafrika? Was musste ein Zuschauer dieser Zeit denken, wenn er einen Landsmann aus Argentinien zurückkommen sah, jenem Land, in dem es vermutlich mehr Leser von Warndienst West gab als irgendwo sonst? Der Film ist doch sonst so manisch darauf versessen, an nichts Unangenehmes zu erinnern – weshalb also ausgerechnet Argentinien?
Wer anfängt, auf solche Details zu achten, dem öffnet sich eine Geisterwelt der Schatten und Echos. Warum wird ein unsympathischer Hoteldirektor namens Adler von allen immer Adi genannt, nicht Adli, sondern Adi, was keineswegs eine gängige Koseform für den Namen Adler ist, sondern für den Vornamen Adolf? Warum treten ständig pensionierte Offiziere auf? Immer derselbe Typus: ein älterer Herr, knorrig steif und zu zivilem Sozialverhalten nicht mehr in der Lage, der beim Abschied die Hand an die Schläfe legt und «Abtreten!» sagt. Natürlich ist der tattrige General außer Dienst eine beliebte Komödiengestalt des 19. Jahrhunderts und wäre 1912 noch eher harmlos gewesen – aber schon 1919 ist er es nicht mehr, und schon gar nicht Ende der fünfziger Jahre, als jeder pensionierte deutsche Offizier Dinge hinter sich hat, die man wohl unaussprechlich nennen muss. Und warum wird in diesen penibel gewaltfreien Filmen so gerne über Verbrechen gesprochen? Erstaunlich oft treten – meist übrigens weibliche – Krimiautoren auf, die obsessiv das Wort «Mord» im Mund führen, was sich aber nie auf etwas in der Filmhandlung, sondern auf Bücher bezieht, über die man aber wiederum nur erfährt, dass darin schauerlich getötet wird. Dazu passt es gut, dass sich in Schlag auf Schlag einer der Helden eine zu jeder vollen Stunde knallende Cowboy-Kuckucksuhr an die Wand hängt, woraufhin der Nachbar in der Nebenwohnung bei jedem Anschlag des Mechanismus mit dem Schrei «Die bringen einander um!» aus dem Schlaf fährt.
Wird man auf diese Dinge aufmerksam, scheint in die hektische Fröhlichkeit etwas Gespenstisches einzudringen, mühsam Ausgesperrtes wird so plötzlich sichtbar, als erschienen Geister aus leerer Luft. Vergessen ist eine anstrengende Übung, Verdrängung harte Arbeit. «Die Tilgung der Erinnerung ist eher eine Leistung des allzu wachen Bewußtseins als dessen Schwäche gegenüber der Übermacht unbewußter Prozesse», sagt Adorno, ebenfalls in Frankfurt, ebenfalls im Jahr 1959, im Vortrag Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit. Das Neben- und Miteinander von Tätern und Opfern, die gemeinsam Unterhaltungswerke verfertigen für ein traumatisiertes Publikum, das in panischer Verkrampfung Harmlosigkeit einfordert, hätte den Stoff zu einem großen Roman abgeben können, aber dieser Roman wurde nie geschrieben, oder richtiger: Die deutsche Nachkriegsliteratur als Ganzes, in ihrer Vielseitigkeit und ihrer Beschränkung, in dem, was sie behandelt, und dem, worüber sie schweigt, ist gewissermaßen dieser Roman.
Wie schade, dass der Erfinder des Begriffs Kulturindustrie sich nie über Peter Alexander geäußert hat. Denn es gab keinen anderen Unterhalter, der so lange so hoch in der Gunst des deutschen Publikums stand. 1926 geboren, ist er zu jung, um tief verstrickt sein zu können: Arbeitsdienst, Wehrmacht, Flakhelfer, Kriegsmarine, Kriegsgefangenschaft, ein abgebrochenes Medizinstudium, dann schon erste Erfolge als Schlagersänger. Ab Mitte der fünfziger Jahre hält Peter Alexanders Laufbahn ohne Unterbrechung und ohne Tief bis zum Beginn der neunziger Jahre an, als er nach über fünfzehn Millionen verkauften Platten immer noch in seiner alljährlich vom ganzen Land erwarteten Fernsehshow internationale Größen dazu zwingt, sich gemeinsam mit ihm zu erniedrigen.
«Wenn ich da so neben dem Johnny Cash stehe», sagt er glucksend zu dem verwirrten Weltstar im schlecht sitzenden Frack, «möchte ich am liebsten gleich mit ihm loslegen.» Seine Hände zucken, und sogleich ruft er auch: «Es juckt einen richtig!» Dabei zwinkert er verschwörerisch, wie er es immer tut, wenn er in eine Kamera blickt. So hetzt er von seinem zwanzigsten Lebensjahr bis zu seinem letzten Auftritt mit achtzig agil, lustig, hektisch und augenzwinkernd einem Ideal von Gelöstheit und Witz nach, das stets in Reichweite scheint und doch nie erreicht wird, als säße ihm der Satan im Nacken, als könnte er auf diese Art für ein ganzes Land jene Leichtigkeit zurückgewinnen, die es nie mehr besitzen wird.
Ich habe ihn einmal getroffen. Acht Jahre war ich alt und auf dem Heimweg von der Schule. Er trug einen Lodenmantel und einen Hut mit Gamsbart. Ich bat ihn um ein Autogramm. Er lächelte, zwinkerte, zog ein schon unterschriebenes Foto aus der Tasche und überreichte es mir. Dann ging er weiter, und ich sah ihm aufgewühlt nach. Er war der berühmteste Mensch, dem ich je gegenübergestanden hatte.