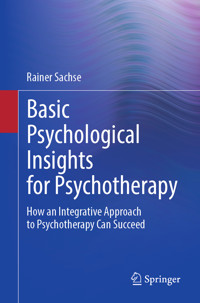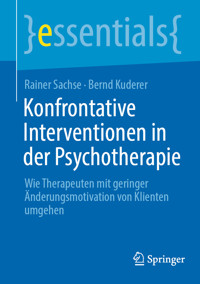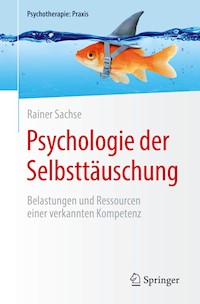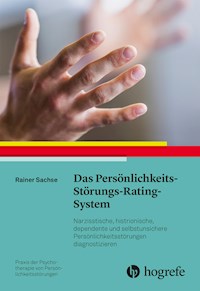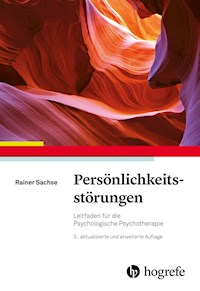28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Psychotherapie ist ein komplexer Prozess. Klientinnen und Klienten kommen mit unterschiedlichsten Symptomen und Störungen in die Therapie, ihre Anliegen und Ziele sind ebenso heterogen wie ihre Persönlichkeiten. Aber auch auf Therapeutenseite fließen viele Variablen mit ein, wie z.B. die gewählte Therapieform und die Persönlichkeit der Therapierenden. Wie kann angesichts dieser Komplexität eine Psychotherapie den Klientinnen und Klienten gerecht werden und nachhaltige Veränderungen erzielen? Der erfahrene Psychotherapeut Rainer Sachse diskutiert in diesem Buch Ansätze aus Wissenschafts-, Chaos- und Systemtheorie und integriert wichtige psychologische und psychotherapeutische Forschungsergebnisse, um daraus konstruktive Vorschläge abzuleiten, wie Psychotherapie weiterentwickelt werden kann: zu einer komplexen Psychotherapie, in der nicht nur störungsspezifische Aspekte betrachtet werden, sondern auch die Funktionsspezifität bei der Konzeptualisierung des Therapieprozesses eine entscheidende Rolle spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rainer Sachse
Komplexität in der Psychotherapie
Psychotherapie klientengerecht und nachhaltig gestalten
Prof. Dr. Rainer Sachse, geb. 1948. 1969–1978 Studium der Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Ab 1980 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum. 1985 Promotion. 1991 Habilitation. Privatdozent an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 1998 außerplanmäßiger Professor. Leiter des Institutes für Psychologische Psychotherapie (IPP), Bochum. Arbeitsschwerpunkte: Persönlichkeitsstörungen, Klärungsorientierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com by Getty Images / piranka
Satz: Sabine Rosenfeldt, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3127-7; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3127-8)
ISBN 978-3-8017-3127-4
https://doi.org/10.1026/03127-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
.
|5|Prof. Dr. Franz Caspar gewidmet
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Worum es geht
1.2 Was heißt genau, eine Psychotherapie soll Klienten gerecht werden?
1.3 Sinn des Buches
1.4 Das Konzept dieses Buches
Teil 1: Schlussfolgerungen aus erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Konzepten sowie aus Ergebnissen der Psychotherapieforschung
2 Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Überlegungen
2.1 These 1: Menschen müssen in ihren Kontexten handeln
2.2 These 2: Handlungen sollen effektiv sein
2.3 These 3: Realitätsmodelle sind erforderlich
2.4 These 4: Ein Realitätsmodell sollte valide sein
2.5 These 5: Eine „Realität“ existiert
2.6 These 6: Modelle können unterschiedlich valide sein
2.7 These 7: Modelle bilden Wissen
2.8 These 8: Modelle oder Theorien sind immer vorläufig
2.9 These 9: Wissenschaftliches Wissen ist immer hypothetisch
2.10 These 10: Wissenschaftliche Forschung führt zu maximal validen Modellen
2.11 These 11: Wissenschaftliche Forschung ist per definitionem reduktionistisch
2.12 These 12: Der notwendige Reduktionismus schränkt den Geltungsbereich wissenschaftlicher Aussagen ein
2.13 These 13: Experimente schaffen sehr valide, aber von ihrem Geltungsbereich her stark eingeschränkte Aussagen
2.14 These 14: Praxis ist deutlich komplexer als Forschung
2.15 These 15: Praktisches Handeln kann nur teilweise auf wissenschaftlichen Modellen basieren
2.16 These 16: Wissenschaftliche Modelle sind Heuristiken für die Praxis
2.17 These 17: Die eigene Expertise spielt eine wesentliche Rolle
2.18 These 18: Therapeuten arbeiten immer nur mit Hypothesen
2.19 These 19: Wissenschaftlich validierte Modelle können Expertise verbessern, aber nicht ersetzen
3 Schlussfolgerungen aus den Thesen für die Psychotherapie
3.1 Ziele der Wissenschaft Psychotherapie
3.2 Einschränkungen wissenschaftlicher Aussagen im Bereich Psychotherapie
3.3 Das Problem der Generalisierbarkeit
4 Ergebnisse der Psychotherapieforschung und Folgerungen für eine Konzeption von Psychotherapie
4.1 Heterogenität und Komplexität
4.2 Klienten-Variablen
4.2.1 Diagnosen
4.2.2 Eingangsvariablen des Klienten
4.2.3 Die Bedeutung der Störung
4.2.4 Weitere Variablen
4.3 Therapeuten-Variablen
4.3.1 Beziehungsgestaltung
4.3.2 Interaktionsvariablen
4.4 Prozess-Variablen
4.5 Therapieeffekte
4.5.1 Messung von Therapieerfolg
4.5.2 Wirken alle Psychotherapien gleich?
4.6 Schlussfolgerungen aus den Forschungsergebnissen
4.7 Komplexe und einfache Störungen: Eine entscheidende Variable für die Psychotherapie
4.7.1 Angststörungen
4.7.2 Besondere Bedingungen bei der Therapie von Phobien
4.7.3 Persönlichkeitsstörungen
4.7.4 Angststörung und Persönlichkeitsstörung: Ein psychologischer Vergleich
Teil 2: Verarbeitung, Modellbildung, Wissen und Expertise
5 Therapeutische Informationsverarbeitung, Verstehen und Modellbildung
5.1 Komplexität der Verarbeitung
5.2 Therapeutisches Verstehen
5.3 Verarbeitungsmodi
5.4 Bildung eines Klientenmodells
5.5 Das Situationsmodell
5.6 Prozesse der Modellbildung
5.7 Schlussfolgerungen
6 Die Bedeutung von Expertise des Therapeuten
6.1 Anforderungen an Therapeuten im Prozess der Psychotherapie
6.1.1 Anforderungen an die Informationsverarbeitung
6.1.2 Anforderungen an die Handlung
6.2 Therapeuten benötigen Expertise, um die Anforderungen der Therapie zu bewältigen
6.3 Definition von Expertise
6.3.1 Expertise erfordert spezifisches Training
6.3.2 Die Relevanz von Expertise hängt von der Anforderung ab
6.3.3 Expertise zeigt sich in Kompetenzen deutlicher als in Ergebnissen
6.4 Was zeichnet Experten aus?
6.5 Auch Experten können irren
6.6 Expertise und Heuristik
6.7 Das Scientist-Practitioner-Modell
6.7.1 Das Konzept
6.7.2 Kritik
6.7.3 Anforderungsprofile
6.7.4 Kommunikation
6.8 Empirische Evidenzen zur Expertise in der Psychotherapie
Teil 3: Der Therapieprozess
7 Der Prozess der Therapie
7.1 Warum eine Betrachtung des Therapieprozesses wesentlich ist
7.2 Viele relevante Aspekte entfalten sich erst mit der Zeit
7.3 Probleme und Themen ändern sich im Prozessverlauf mit hoher Wahrscheinlichkeit
7.4 Auch Ziele verändern sich im Therapieprozess
8 Ein hoch relevanter Aspekt des Therapieprozesses: Chaos und Struktur
8.1 Chaos im Prozess
8.2 Konsequenzen für die Therapie
8.3 Selbstorganisation
8.4 Therapieprozess: Wechsel von Chaos und Struktur
8.5 Der Weg entsteht beim Gehen
8.6 Die Bedeutung von Expertise wird erneut deutlich
8.7 Stringenz und Flexibilität des Therapeuten
8.8 Schlussfolgerungen für die Therapie
8.8.1 Was sind Systeme?
8.8.2 Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit
8.8.3 Interventionen und Veränderungen des Systems
8.8.4 Veränderungsprozesse
8.8.5 Destabilisierung
8.9 Rekursiver Therapieprozess
9 Bedeutung der Mikro-Ebene für eine Konzeption von Psychotherapie
9.1 Was ist eine Mikro-Ebene?
9.2 Relevanz der Mikro-Ebene
9.3 Aufgaben des Therapeuten auf Mikro-Ebene
10 Prozessforschung und therapeutische Konsequenzen: Das Beispiel der Steuerung von Klärungsprozessen
10.1 Forschungsvorgehen
10.2 Ergebnisse der Prozessforschung
10.2.1 Prozesssteuerung durch den Therapeuten
10.2.2 Konstruktive Steuerung
10.2.3 Klienten klären kaum von sich aus
10.2.4 Stufenfolgen von Klärungsprozessen
10.2.5 Nicht völlige Determiniertheit von Klärungsprozessen
10.2.6 Steuerung und Therapeut-Klient-Beziehung
10.2.7 Steuerung und Verstehen
10.2.8 Steuerung im Therapieverlauf
10.2.9 Steuerung und Qualität der Intervention
10.2.10 Steuerung und Eingangsvoraussetzungen von Klienten
10.3 Schlussfolgerungen
11 Die therapeutische Kommunikation: Das Drei-Ebenen-Modell
11.1 Inhaltsebene
11.2 Bearbeitungsebene
11.3 Beziehungsebene
11.4 Dimensionen der Psychotherapie
Teil 4: Verankerung der Psychotherapie in der Psychologie, Menschenbild und Therapieziele
12 Psychotherapie und Psychologie
12.1 Psychotherapie ist ein Teilgebiet der Psychologie
12.2 Schlussfolgerungen
13 Menschenbild und Therapiekonzeption
14 Psychotherapieziel Selbstregulation
14.1 Was ist Selbstregulation?
14.2 Ein theoretisches Modell der Selbstregulation
14.3 Selbstregulation und Selbstkontrolle
14.4 Selbstregulation in der Psychotherapie
Teil 5: Beispiele für Theorie- und Therapiekonzeptionen
15 Beziehungsgestaltung
15.1 Sinn einer Beziehungsgestaltung
15.2 Allgemeine Beziehungsgestaltung
15.3 Komplementäre Beziehungsgestaltung
15.3.1 Beziehungsmotive
15.3.2 Komplementarität zu Beziehungsmotiven im Therapieprozess
15.4 Schlussfolgerungen
16 Schemata und Schema-Klärung
16.1 Wozu Schemata?
16.2 Was sind Schemata und was tun sie?
16.3 Charakteristika von Schemata
16.4 Exekutive Schemata
16.5 Arten von Schemata
16.6 Schemata und Beziehungsmotive: Die Schema-Matrix
16.7 Klärung von Schemata
16.8 Schlussfolgerungen
17 Alienation und die Entwicklung von Therapiezielen
17.1 Individuelle Therapieziele
17.2 Das Konzept der Alienation
17.3 Wie Alienation psychologisch wirkt
17.4 Schlussfolgerungen für die Therapie
Literatur
Endnoten
|13|1 Einleitung
1.1 Worum es geht
Die Frage, wie Psychotherapie den Klientena gerecht werden kann, erscheint vielleicht merkwürdig, sie ist aber, wie hier gezeigt werden soll, hochgradig gerechtfertigt und angezeigt. Denn die Frage lässt sich gar nicht leicht beantworten, wenn man, wie hier, die Antwort nicht aus einer Ideologie heraus, sondern aus psychologisch-wissenschaftlichen Überlegungen heraus beantworten will.
Analysiert man gründlich, was es bedeuten kann, „Klienten gerecht zu werden“ und auch, inwieweit bisherige Psychotherapieverfahren Klienten gerecht werden, dann stößt man auf vielfältige Probleme. Das Erste, was man sieht, ist, dass Klienten hoch komplex sind, dass Probleme und Therapieprozesse hoch komplex sind. Und man erkennt, dass bisherige Therapieverfahren diese Komplexität z. T. ignorieren. Stellt sich eine Psychotherapie dieser Komplexität, dann, so wird deutlich werden, muss sie ihr Paradigma ändern: Denn hoch komplexe Klienten, Probleme und Prozesse erfordern eine hoch komplexe Psychotherapie. Und dies ist auch erforderlich, damit Psychotherapie den Klienten stärker als bisher gerecht werden kann: Indem sie viel stärker die Komplexität und Heterogenität von Klienten, die Komplexität von Problemen und von Therapieprozessen berücksichtigt.
Dies bedeutet aber auch, wie zu zeigen sein wird, dass Psychotherapie sehr viel komplexer werden muss, um die Komplexität von Klienten und Problemen gerecht werden zu können. Und dass ein Psychotherapeut sich der Komplexität stellen sollte und eine entsprechende Expertise entwickeln sollte. Daraus folgt wiederum, dass viele Aspekte der heute praktizierten Psychotherapie zumindest „suboptimal“ sind, einige widersprechen sogar stark dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Es soll daher versucht werden, grundsätzliche wissenschaftstheoretische Erkenntnisse und psychologische und psychotherapeutische Forschungsergebnisse aufzuzeigen sowie wichtige Erkenntnisse der Chaos- und Systemtheorie zu verwenden und aus ihnen abzuleiten, in welcher Richtung Psychotherapie weiterentwickelt werden kann.
Leider ist es auch nicht so, dass ich perfekte Lösungen hätte, aber ich kann zumindest einige Ansatzpunkte aufzeigen, über die man näher nachdenken kann. Was ich aufzeigen werde, bedeutet über weite Strecken eine Modifikation des bisherigen Psychotherapieparadigmas: Von einfach strukturierten Therapien hin zu (hoch) komplexen, die auch in der Lage sind, Probleme weit jenseits von „Symptomreduktionen“ zu |14|bearbeiten. Ob dies zu Denkanstößen führen wird, ist ungewiss. Natürlich kann man alle Argumente ignorieren und „buisiness as usual“ machen, das ist ja eine bewährte Lösung. Aber man könnte vielleicht auch in Dialoge eintreten und versuchen, offensichtliche Mängel zu beseitigen. Ich möchte deshalb auch in erster Linie Denkanstöße geben und Diskussionen anregen: Auch ich weiß im Augenblick nicht, wohin die Entwicklung gehen wird, bin aber hoch gespannt.
Es ist dem Leser vielleicht aufgefallen, dass eine Frage des Buches lautet, wie Psychotherapie dem Klienten „gerecht werden“ kann. Sie lautet nicht, wie man Psychotherapie möglichst effektiv oder effizient machen kann. Natürlich ist Effektivität von Psychotherapie eine relevante Dimension: Ein Klient will, dass Psychotherapie „etwas bringt“ und das ohne unnötigen Aufwand! Man muss jedoch sehen, dass Effektivität und Effizienz (vor allem Geschwindigkeit) nicht die einzigen Dimensionen einer Psychotherapie sind.
Psychotherapie stellt, vor allem wenn sie dazu dient, Lebensprobleme zu bearbeiten, einen wesentlichen Aspekt des Lebens selbst dar. Und wie bei allen relevanten Lebensaspekten ist Effektivität oder Effizienz nur ein Aspekt der Lebensgestaltung. Wenn ich Sex haben will, ist die effizienteste Methode, mit dem Verkehr in zwei Minuten fertig zu sein: Das spart maximal Zeit und Energie. Das ist so, aber will man das? Geht es wirklich um einen derart eingeschränkten Begriff von Effektivität als einzelnes Ergebnis pro Zeiteinheit oder Kosteneinheit? Wollen wir unser Leben und wollen wir Psychotherapie wirklich derart eingeschränkt definieren?
Wenn ich Spaß haben will, kann ich mir 2 – 3 Stunden Zeit nehmen, mich auf neue Erfahrungen einlassen, ohne zu wissen, was genau passieren wird. Das ist zweifellos nicht effizient, aber das macht dennoch Sinn. In vielen Bereichen zielt man nicht auf ein einzelnes, isoliertes Ereignis ab, das man in hohem Tempo erreicht; man zielt auf breite Ergebnisse ab, darauf, mehrere Ziele gleichzeitig zu erreichen und man akzeptiert, dass das Energie und Zeit kosten kann.
Will man Psychotherapie als ein Verfahren, mit dem man schnell möglichst eingegrenzte Effekte erzielt oder will man auch hier möglichst gute, nachhaltige Ergebnisse?
Gerade bei hoch komplexen Problemen ist es wesentlich, komplexe Ziele nachhaltig anzustreben, weil Klienten sehr oft mit komplexen Problemen in die Therapie kommen, für die es keine simplen, vorgefertigten Lösungen und manualisierte Lösungswege gibt. Viele Klienten wollen in der Psychotherapie keine Tauben-Angst „wegmachen“, sie wollen Lebensprobleme, unter Umständen existenzielle Probleme lösen, die sie stark belasten, ihre Gesundheit gefährden usw., die damit hoch relevant sind und um die sich Psychotherapie auf alle Fälle kümmern sollte. Sie wollen klären, was genau sie so antreibt, dass sie ihre Gesundheit ruinieren, was sie eigentlich wirklich wollen, warum sie Probleme mit einem Partner haben, wieso sie ständig Interaktionskonflikte produzieren usw. usw. Auch das sind hochkomplizierte Fragen, für deren Analyse und Beantwortung man gründlich klären muss, was u. U. viel Aufwand erfordert und viel Zeit kostet.
Viele Probleme von Klienten sind hoch komplex: Zu Therapiebeginn kann ein Klient oft nicht mal das Problem genau definieren, nicht sagen, was er will oder was eine Lösung sein könnte. Die Klärung selbst ist komplex, man muss sich Zeit lassen, sich Aspekte näher anzuschauen, gerät in Sackgassen, setzt neu an usw. usw. Um diese Pro|15|bleme zu lösen, muss man sich auf Prozesse einlassen, von denen man nicht wissen kann, wie sie ausgehen werden oder wohin sie einen führen werden, denn man weiß zu Beginn nicht, wo eine Lösung liegen wird und kann auch (noch) keine klaren Ziele definieren!
Psychotherapeuten brauchen die Kompetenz, diese Prozesse nicht nur zu begleiten, sondern konstruktiv zu steuern, dem Klienten deutlich zu machen, wo er langgehen sollte, welcher Frage er folgen sollte usw. Therapeuten können hier sehr konstruktiv wirken, aber sie müssen auch dem Prozess folgen, sie können keine Lösungen vorgeben, noch können sie Prozesse planen. Das alles mag aus der Perspektive einer Angst-Therapie unklar, unvorhersehbar, schlecht steuerbar und ineffizient erscheinen: Jedoch ist es eine relevante Alltagserfahrung, dass komplexe Probleme andere Vorgehensweisen brauchen als einfache, dass ihre Lösung anders verläuft und dass sie mehr Zeit erfordert. Und genau diese Aspekte sollen in diesem Buch ausführlich behandelt werden.
Gerade kreative Lösungen lassen sich nicht planen und nicht beschleunigen, jeder Zeitdruck macht die Lösung kaputt. Diese Aspekte sind auch in der Psychologie gut bekannt1. Und wir sollten ihnen folgen: Also sollten wir eine andere Form von Psychotherapie entwickeln, weg von Einfachheit, Planbarkeit, Determiniertheit, Effizienz: Wenn ich eine Schraube eindrehen will, kann ich allen diesen Prinzipien folgen, will ich ein komplexes Problem kreativ lösen, werden diese Vorgehensweisen meine Lösung „killen“.
1.2 Was heißt genau, eine Psychotherapie soll Klienten gerecht werden?
Wenn man sagt, Psychotherapie sollte Klienten gerecht werden, dann ist es natürlich wichtig zu präzisieren, was das genau bedeuten kann. Überlegungen, die im Laufe des Textes sehr viel genauer diskutiert werden, lassen es zu, mehrere Aspekte zu bestimmen, die die Frage beantworten, was genau „dem Klienten gerecht werden“ heißen soll. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte aufgelistet und anschließend kommentiert:
Psychotherapie sollte in erster Linie dem Klienten verpflichtet sein und nicht den Kostenträgern von Psychotherapie. Zwar sollte Therapie sich bemühen, kostengünstig zu sein, das darf aber niemals auf Kosten des Klienten gehen.
Um Klienten gerecht zu werden, sollte Psychotherapie sich weitgehend an Klienten anpassen, also „klientenzentriert“ sein. Psychotherapie stellt Anforderungen an Klienten. Können/wollen Klienten diese nicht erfüllen, dann sollte Psychotherapie zuerst Strategien entwickeln, um damit umzugehen. Psychotherapie sollte jedoch möglichst wenig erwarten, dass sich Klienten der Psychotherapie anpassen.
„Den Klienten gerecht werden“ bedeutet vor allem, dass Therapeuten komplexe Probleme des Klienten therapeutisch bearbeiten und bearbeiten können: Lebensprobleme, existenzielle Konflikte, Motivationskonflikte, dysfunktionale Schemta usw.|16|
4.Diese Aspekte bedeuten auch, dass Psychotherapie niemals die Anliegen, Schwierigkeiten, Meta-Probleme (s. u.) von Klienten ignorieren darf. Psychotherapie sollte Klienten nicht Methoden aufdrängen, die nicht angemessen sind oder Klienten durch Strategien zwingen, die sie im Grunde gar nicht wollen.
5.Psychotherapie ist eine Dienstleistung am Klienten, keine Zwangsjacke, und ein Klient ist auch nicht für den Therapeuten da oder Dienstleister für Therapeuten.
6.Psychotherapie sollte es ermöglichen, die Probleme, die Klienten tatsächlich haben und die sie lösen wollen, auch wirklich zu lösen.
7.Psychotherapie sollte auch dazu führen, die Probleme nachhaltig zu lösen, also so, dass nicht nur gute Lösungen entstehen, sondern die Lösungen auch über lange Zeit und über ein breites Spektrum wirken.
8.Daher können Effektivität (= die Wirkung der Therapie) und Effizienz (= Wirkung pro Zeiteinheit oder pro Kosteneinheit) nicht allein
–durch die Kürze der Therapie bestimmt werden,
–durch enge Effektivitätsmaße bestimmt werden.
9.Psychotherapie muss die enorme Heterogenität von Klienten und die enorme Komplexität von Therapieprozessen beachten.
10.Das bedeutet, dass Klienten ganz unterschiedliche therapeutische Zugänge, Strategien, Ziele, Effektmaße usw. brauchen, damit Psychotherapie ihnen überhaupt gerecht werden kann.
11.Psychotherapie muss berücksichtigen, dass Klienten nicht nur „Symptome“ oder einfache Probleme als Probleme aufweisen, sondern komplexe persönliche Probleme wie dysfunktionale Schemata, Konflikte, internale Stressbedingungen, unklare Motive usw.
12.Psychotherapie darf sich daher nicht nur auf einfache Probleme oder Symptome konzentrieren.
13.Klienten weisen nicht nur Lebensprobleme auf, die sie in der Psychotherapie lösen wollen. Klienten weisen auch „Metaprobleme“ auf, also Probleme, die es ihnen erschweren, sich auf Psychotherapie oder Prozesse einzulassen, wie z. B.
–mangelndes Vertrauen zum Therapeuten,
–mangelnde Änderungsmotivation u. ä.
14.Um Klienten gerecht werden zu können, muss sich Psychotherapie auf solche Metaprobleme von Klienten einstellen können und sich Klienten anpassen. Sie sollte also adaptive Strategien für diese Klienten entwickeln.
15.Klienten können aber aufgrund ihrer Problematik auch Probleme damit haben, sich auf Therapie, den Therapeuten oder Therapieprozesse überhaupt einzulassen. So weisen viele Klienten massive Vertrauensprobleme auf und trauen sich daher nicht, Therapeuten zu Therapiebeginn selbstwertbelastende Informationen zu geben. Das erschwert es zusätzlich, schnell ein valides Klienten-Modell zu erstellen. Für solche Klienten sollte eine Psychotherapie spezielle Strategien der Beziehungsgestaltung entwickeln, um im Therapieprozess Vertrauen systematisch aufzubauen.
16.In einer Psychotherapie sollte ein Therapeut nicht nur extrinsische Therapiemotivation erzeugen, also eine Motivation, Ziele zu erreichen oder Probleme zu lösen. Er sollte auch versuchen, intrinsische Motivation zu fördern. Denn diese impliziert, dass ein Klient sich in hohem Maße auf schwierige Prozesse einlässt, sich selbst|17|wertbelastenden Inhalten stellt, sich angemessen Zeit lässt, Ausdauer zeigt usw. Intrinsische Motivation erhöht die Effektivität von Psychotherapie.
17.Um all das zu leisten, muss Psychotherapie komplexer und vielfältiger werden, denn sonst kann sie der enormen Heterogenität der Klienten und Prozesse nicht gerecht werden.
18.Und Psychotherapie muss deutlich mehr in der Psychologie verankert werden, um Konzepte der Motivationstheorie, der Kognitions-, insbesondere der Wissens- und Sprachpsychologie, der Sozialpsychologie u. Ä. zu integrieren, die man benötigt, um die Komplexität der Klienten-Bedingungen und Klientenprozesse angemessen theoretisch zu modellieren.
Zu 1: Letztlich ist das natürlich eine politische Entscheidung: Nur sollten wir als Psychotherapeuten nicht politisch handeln, sondern therapeutisch. Wir sollten das vertreten, was wir für richtig halten und nicht zu Gehilfen von Krankenkassen werden. Psychotherapie sollte für Klienten da sein und ihnen genau das anbieten, was sie brauchen. Davon sollten wir als Psychotherapeuten ausgehen, und wenn das schwierig durchzusetzen ist, sollten wir uns dafür einsetzen.
Zu 2: „Klientenzentriert“ soll hier in einem psychologischen, nicht in einem idiologischen Sinne gemeint sein. Klientenzentriert bedeutet schlicht, dass Klienten im Zentrum der Therapie stehen und dass Psychotherapie primär versuchen sollte, sich an die Eigenheiten und Möglichkeiten der Klienten anzupassen. Nur wenn das nicht möglich ist, kann Psychotherapie definieren, dass Klienten bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, um Therapie zu machen. Natürlich kann das im Einzelfall sein, aber adaptive Indikation sollte vor selektiver Indikation stehen. Sicher stellt Psychotherapie hohe Anforderungen an Klienten, aber sie sollte Strategien entwickeln, die Klienten dabei helfen, sie auch zu erfüllen. Diese können irgendwann ausgeschöpft sein, dann hat die Therapie leider für Klienten „nichts mehr im Angebot“. Aber diese Möglichkeiten sollten auch ausgeschöpft werden!
Zu 3: Viele Klienten kommen mit diffusen Problemen in die Therapie, mit diffusen Belastungen, Konflikten oder mit durchaus unklaren existenziellen Problemen, problematischen Lebensentscheidungen usw. Die Probleme erzeugen hohen Leidensdruck, viele weitere psychische und somatische Probleme und sie haben massive langfristige Folgen. Aber: Die Probleme sind hoch komplex, unklar, schwer definierbar u. ä. Auch für solche Probleme muss aber Psychotherapie „zuständig“ sein, auch dann, wenn man Klienten nicht in die Kategorien von DSM oder ICD einordnen kann.
Zu 4: Psychotherapie sollte genau klären, was Klienten tatsächlich in der bzw. durch die Therapie wollen. Ein Therapeut kann entscheiden, ob dies therapeutisch erreichbar ist oder er kann mit den Klienten diskutieren, ob das sinnvoll ist. Und wenn nicht, kann er mit dem Klienten andere Ziele erarbeiten. Letztlich bestimmt jedoch immer der Klient darüber, ob er Therapie machen will oder nicht, und darüber, was er in der Therapie erreichen will und was nicht. Wenn immer möglich, sinnvoll und machbar, sollte Psychotherapie sich nach dem Klienten richten. Psychotherapie sollte den Klienten jedoch nicht „in bestimmte Methoden pressen“, weil diese gerade verfügbar sind oder dem Klienten nur die Erreichung solcher Ziele anbieten, die besonders leicht erreichbar sind. Wenn wir Klienten nur das anbieten, was therapeutisch leicht oder schnell mach|18|bar ist, verhalten wir uns wie der Mann, der den Schlüssel unter der Lampe sucht, weil es dort hell ist und nicht auf dem matschigen Feld, auf dem er ihn verloren hat: Man kann sich manchmal fragen, ob alle Therapeuten diese Watzlawick-Metapher kennen! Wenn ein Therapeut bestimmte Probleme nicht lösen kann, weil er dafür nicht ausgebildet ist, ist das völlig in Ordnung: Kein Therapeut kann alles können! Aber die Psychotherapie als solche sollte die Probleme da lösen, wo sie sind.
Zu 5: Therapeuten sind für Klienten da, nicht Klienten für Therapeuten. Daher sollte ein Therapeut nicht erwarten, dass ein Klient sich auf die Methode einlässt, die der Therapeut kann, obwohl das gar nicht sinnvoll ist, sondern er sollte u. U. den Klienten weiterverweisen an einen Therapeuten, der dieses Problem lösen kann. Solche Therapeuten sollte es dann allerdings auch geben.
Zu 6: Um festzustellen, welche Probleme ein Klient wirklich hat und an welchen Problemen zentral gearbeitet werden sollte, muss ein Therapeut zunächst einmal genau analysieren, was die Probleme sind. Es gibt jedoch viele Klienten, die zu Therapiebeginn ihre Probleme gar nicht definieren können oder Ziele gar nicht bestimmen können: Daher muss ein Therapeut sich oft Zeit nehmen und den Klienten bei der Klärung dieser Aspekte helfen. Und viele Klienten haben komplexe, persönliche Probleme und keine klar umrissenen Ängste usw., sodass ein Therapeut sich auf komplexe Probleme einlassen muss und die Kompetenz aufweisen sollte, sich mit solchen Problemen zu befassen.
Zu 7: Es sollte in der Therapie nicht nur darum gehen, schnell irgendwelche Effekte zu erzielen: Vielmehr sollte angestrebt werden, nachhaltige Effekte zu erzielen. Dies sind Therapieergebnisse,
die nicht nur begrenzte Effekte beim Klienten haben, sondern breite Effekte, also viele Lebensbereiche des Klienten betreffen;
die den Klienten zu einem Löser für zukünftige Probleme machen, anstatt nur das jeweilige Problem zu lösen;
die dazu führen, dass die Effekte über längere Zeit anhalten und so die Wahrscheinlichkeit absenken, dass ein Klient eine zweite oder dritte Therapie braucht, dass er stationäre Aufenthalte braucht, dass er Medikamente braucht usw.
Solche Effekte sind nicht nur günstig für den Klienten, sie sind langfristig auch günstig für die Kostenträger. Damit ist es erforderlich, die Kriterien für Effektivität und Effizienz grundlegend zu überdenken. Kurze Therapien mit oberflächlichen Effekten sparen unmittelbar Geld, aber ganz sicher nicht in der Summe, sondern sind letztlich Geldverschwendung. Aus der Ökologie und dem Klimaschutz sollte doch langsam klar sein, dass kurzfristiges Sparen, kurzfristige Ziele usw. wenig Sinn machen. Erforderlich ist das Anstreben von Nachhaltigkeit, und das bedeutet immer auch, dass es erforderlich ist, unmittelbar mehr auszugeben um langfristig mehr zu sparen! Die Bearbeitung komplexer Probleme ist aufwändig und kostet Zeit: Ja, das ist psychologisch so und das lässt sich auch nicht ändern! Die Frage ist aber, ob es nicht sehr viel sinnvoller ist, in solche Arten von Therapien „zu investieren“.
Zu 8: Das bedeutet jedoch auch, dass man Effektivität, also Therapieerfolg, neu definieren muss und das bisherige Definitionen nicht uneingeschränkt gelten können. Und das bedeutet auch, dass „Effizienz“ nicht nur durch kurzfristige Zeiteinheiten und Kosteneinsparungen definiert werden kann. Offenbar kann man durch solche Effizienz-Kriterien nicht nur Planeten, sondern auch Klienten „zugrunde richten“.
|19|Zu 9: Wie im Text ausführlich zu zeigen sein wird, sind Klienten und Prozesse höchst komplex: Klienten haben unterschiedlichste Arten von Problemen, Eigenheiten, Therapievoraussetzungen, Erwartungen, Interaktionsstile usw. usw. Daher kann es niemals für alle Klienten eine Therapie oder eine therapeutische Strategie geben. Der Heterogenität der Klienten muss die Psychotherapie eine Heterogenität der Therapien entgegensetzen. Es wird zu zeigen sein, dass man einfache Therapieverfahren nicht auf komplexe Probleme anwenden kann: Komplexe Probleme verlangen andere Denkmodelle, Analyse-Techniken, therapeutische Vorgehensweisen. Und man kann Ergebnisse einfacher Therapien von einfachen Problemen niemals sinnvoll auf die Therapie komplexer Probleme generalisieren.
Zu 10: Man kann also Psychotherapie nicht auf wenige Ansätze reduzieren, und man kann Klienten nicht nur Ansätze anbieten, die zwar gut erforscht sind, die sich jedoch nur für wenig komplexe Probleme eignen. Der Komplexität der Klienten sollte die Psychotherapie auch eine Komplexität der Psychotherapie entgegensetzen, die geeignet ist, auf das zu reagieren, was die Klienten „in die Therapie mitbringen“.
Zu 11: Klienten weisen manchmal Probleme auf, die sich als „Symptome“ klassifizieren und durch Diagnostiksysteme wie DSM oder ICD erfassen lassen. Sehr häufig weisen Klienten aber auch Probleme auf, die sich weder als „Symptome“ beschreiben lassen, noch durch ICD oder DSM erfassbar sind. Klienten können hoch komplexe, hoch existenzielle Probleme aufweisen, die eine komplexere Analyse erfordern, eine komplexeres therapeutisches Vorgehen, komplexe Erfolgsmaße und die dem Therapeuten auch ein höheres Maß an Expertise abverlangen. Natürlich kann man sagen, all das seien keine Gegenstände von Psychotherapie, und wenn man Psychotherapie endgültig ad absurdum führen will, kann man das tun. Falls nicht (was erstrebenswert wäre!) muss sich Psychotherapie in hohem Maße auf die Bearbeitung solcher Probleme einstellen.
Zu 12: Man kann argumentieren, dass die Bearbeitung komplexer Probleme ja keine „Krankheitsrelevanz“ habe und daher nicht Gegenstand der Psychotherapie sei. Sollte man das tun, ist allerdings das Ignorieren psychologischer Forschungsergebnisse kaum noch zu toppen. Denn die Psychologie zeigt nun wirklich in aller Deutlichkeit, in welch hohem Ausmaß dysfunktionale Schemata, Konflikte, internale Stressfaktoren, Beziehungskonflikte usw. psychische und gesundheitliche Probleme verursachen. Nur „offizielle“ Symptome für psychotherapierelevant zu halten bedeutet, einen ganzen bedeutsamen Wissenschaftsbereich zu leugnen: Wie will man dann noch behaupten, Psychotherapie sei „wissenschaftlich fundiert“? Das ist sicher eines der großen Rätsel unserer Zeit.
Zu 13: Verschiedene Arten von „Meta-Problemen“ spielen in der Psychotherapie eine entscheidende Rolle: Sie treten besonders, aber keineswegs nur bei Klienten mit Persönlichkeitsstörungen auf. Klienten haben oft große Probleme, zu Therapiebeginn ihre Probleme zu definieren, überhaupt zu wissen, was ihre Probleme sind, zu wissen, was sie eigentlich wollen, oder was sie in der Therapie erreichen wollen. Will man Klienten hier gerecht werden, dann kann man als Therapeut sich aber nicht auf solche Aspekte konzentrieren, „die schon klar sind“, weil dies sehr wahrscheinlich gar nicht die wirklich relevanten Probleme sind! Vielmehr müssen Therapeuten und Klienten sich längere Zeit mit der Frage befassen, worum es in der Therapie überhaupt gehen soll. Erst |20|dann, wenn das klar ist, kann eine Entscheidung über Ziele, Methoden usw. getroffen werden! Damit ist das augenblicklich gängige Vorgehen, eine „Exploration“ zu machen, eine „Anamnese“ zu erheben, eine „Diagnose“ zu erstellen und dann bis zur fünften Stunde eine endgültige Therapieentscheidung zu treffen, nicht angemessen: Ja, es muss sogar als hochgradig unpsychologisch angesehen werden, und es kann den Klienten in gar keiner Weise gerecht werden.
Zu 14: Vielmehr sollte man eine längere Klärungsphase vorschalten, die bei manchen Klienten sehr kurz, bei vielen Klienten jedoch länger ist, und man sollte unbedingt ein individuelles Fallkonzept erstellen, aus dem man therapeutische Entscheidungen ableiten kann. Eine rein deskriptive Diagnostik reicht bei komplexen Problemen in gar keiner Weise aus.
Zu 15: Auch diese Überlegungen führen zu dem Ergebnis, dass ein Therapeut sich zu Therapiebeginn nicht darauf verlassen kann, vom Klienten valide Informationen zu erhalten. Das bedeutet auch: Relevante und valide Informationen über Probleme usw. erhält der Therapeut mit hoher Wahrscheinlichkeit erst im Laufe des Prozesses. Dies lässt ein Vorgehen, bis zur fünften Stunde „Diagnosen“ zu stellen und „Therapieplanungen“ zu machen, erneut hoch absurd erscheinen!
Zu 16: Ein Klient will Probleme loswerden und Kosten reduzieren: Das ist völlig ok. Doch daraus resultiert eine extrinsische Therapiemotivation. Viel wirksamer für ein effektives Handeln ist aber eine intrinsische Motivation: Die erzeugt Interesse, Anstrengungsbereitschaft, die Tendenz, sich Schwierigkeiten zu stellen usw. (vgl. Deci, 1975, 1980; Deci & Ryan, 1980a, 1980b, 1982, 1985, 2000). Daher wäre es wichtig, wenn Therapeuten sich darum bemühen würden, im Therapieprozess auch eine intrinsische Motivation zu erzeugen: Wenn Klienten ihre eigenen Prozesse spannend finden würden, wenn sie selbst wissen wollen würden, wie ihr Problem funktioniert, wenn „sie sich selbst auf die Schliche kommen“ wollen u. Ä. Natürlich kann der Hauptzweck von Therapie nicht darin bestehen, den „Prozess zu genießen“, aber da der Prozess oft schmerzlich und unangenehm ist, ist dieser Effekt auch nicht wahrscheinlich. Dennoch ist der Aufbau intrinsischer Motivation für die Therapie enorm hilfreich.
Zu 17/18: Aus allem Gesagten resultiert, dass Psychotherapie komplexer, vielfältiger, differenzierter werden muss. Und Psychotherapie sollte noch weit stärker als bisher Konzepte der Psychologie berücksichtigen, denn Psychologie ist die Rahmenwissenschaft für Psychotherapie.
1.3 Sinn des Buches
In diesem Buch geht es um die Frage, wie die Konzeption von Psychotherapie den Klienten gerecht werden könnte, also wie ein theoretisches und vor allem ein praktisches Konzept von Psychotherapie dazu aussehen kann oder aussehen sollte: Es wird diskutiert, welche Grundannahmen, Aspekte und Erkenntnisse in ein Konzept von Psychotherapie eingehen können und sollen. Damit soll in gewisser Weise ein Bild eines „Paradigmas von Psychotherapie“ entworfen werden und dieser Entwurf soll aufgrund wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnisse untermauert werden.
|21|Anhand eines solchen Entwurfes sollen auch bestehende Psychotherapieformen kritisch betrachtet werden, und es sollen andere Entwicklungslinien aufgezeigt werden, entlang derer sich Psychotherapie entwickeln könnte. Natürlich ist dieser Entwurf weit davon entfernt, vollständig oder bis in alle Details durchdacht zu sein, aber ich hoffe, dass er zu Diskussionen anregen kann darüber, was aktuell verbessert oder verändert werden könnte.
Es geht mir darum, aus bisherigen Forschungskonzepten, Forschungsergebnissen und Praxiserfahrungen Schlussfolgerungen abzuleiten, wie Theorie und Praxis der Psychotherapie im Sinne des Ziels, Klienten stärker gerecht zu werden, weiterentwickelt werden könnten. Ich möchte sehr grundlegend mit erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Überlegungen beginnen, nicht weil ich ein Philosophie-Experte bin, sondern weil sich daraus nicht nur für theoretische Konzepte, sondern – vielleicht: erstaunlicherweise – auch für die Praxiskonzeption relevante Schlussfolgerungen ableiten lassen.
Ich möchte Ergebnisse aus der Psychotherapieforschung diskutieren, vor allem um zu zeigen, wie hoch komplex Psychotherapie ist und sein kann, um damit auch zu zeigen, dass eine Beschränkung von Psychotherapie auf wenige „zugelassene“ Ansätze unangemessen ist. Da aus meiner Sicht Psychotherapie ein Fach der Psychologie ist, sollen auch Ergebnisse und Theorien der Psychologie in die Konzeption eingehen. Abbildung 1 stellt das Gesagte bildlich dar.
Abbildung 1: Wissenschaftliche Erkenntnis und praktische Anwendung: Ein Paradigma für die Psychotherapie
Im Einzelnen soll reflektiert und begründet werden,
welche Schlüsse aus wissenschaftlichen Konzepten und Ergebnissen für die Theorie und Praxis der Psychotherapie gezogen werden können;
welche zentralen Aspekte und Erkenntnisse in Theorie und Praxis der Psychotherapie berücksichtigt werden können (die z. T. zurzeit nicht ausreichend berücksichtigt werden);
dass man weder wissenschaftliche Erkenntnisse noch in der Praxis gezogene Schlussfolgerungen als „letzte Wahrheiten“, sondern immer nur als (mehr oder we|22|niger) gut belegte Hypothesen betrachten kann und welche Konsequenzen sich daraus ergeben;
dass Forschung immer nur zu vorläufigen Ergebnissen auf dem gegenwärtigen Erkenntnisstand und zu „Vermutungswissen“ führt, aus dem keine allgemeingültigen Vorschriften abgeleitet werden können;
dass Klienten- und Therapeuten-Prozesse hoch komplex und heterogen sind und dass damit auch der Therapieprozess hoch komplex ist und damit äußerst hohe Anforderungen an den Therapeuten stellt, denen er nur unter bestimmten Umständen gerecht werden kann;
dass keine Therapie alle Klienten erreichen kann und keine wirklich optimalen Ergebnisse erbringt und dass deshalb ein heterogenes Angebot von Therapien erforderlich ist;
dass „All-Aussagen“ (z. B. „alle Klienten weisen Merkmal X auf“) in aller Regel weder als theoretische Aussagen, noch als Beschreibungen von Praxisprozessen geeignet sind;
dass praktische Psychotherapie sich immer auf sehr konkrete, hoch spezifische Einzelfälle bezieht und wissenschaftliche Erkenntnis, um „angewandt“ werden zu können, immer „übersetzt“, angepasst, modifiziert werden muss: daher ist das Verhältnis von Forschung und Praxis ein hoch komplexes und praktisch keinesfalls eine einfache „Umsetzung“ von Forschung.
1.4 Das Konzept dieses Buches
An dieser Stelle folgt eine kurze Übersicht über die Teile des Buches, um eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie das Buch aufgebaut ist und welche Inhalte thematisiert werden.
1. Schlussfolgerungen aus erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Konzeptionen und Forschungsergebnissen der Psychotherapie
Um ein grundlegendes Konzept von Psychotherapie zu entwickeln, ist es erforderlich, theoretisch weit zu greifen: Wie zu zeigen sein wird, basieren einige der Konzepte auf erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Konzeptionen. Auf Annahmen darüber, was überhaupt durch Wissenschaft erkannt oder theoretisch konzipiert werden kann, welcher Art wissenschaftliches Wissen überhaupt ist u. ä. Diese Überlegungen, so wird deutlich werden, sind nicht Gedankenspiele gelangweilter Akademiker, sondern aus ihnen lassen sich sehr wesentliche und sehr elementare Schlussfolgerungen für die psychotherapeutische Praxis ableiten; Schlussfolgerungen, die auch für das praktische Handeln von großer Tragweite sind (was man auf den ersten Blick wohl nicht vermuten würde).
Für eine Grundkonzeption von Psychotherapie ist es aber auch erforderlich, sich an Forschungsergebnissen der Psychotherapieforschung zu orientieren (auf dem Hinter|23|grund der wissenschaftstheoretischen Konzeption): Entwickelt man ein Konzept von Psychotherapie, dann ist es essenziell, zur Kenntnis zu nehmen, welche Schlussfolgerungen sich aus Forschungsergebnissen ableiten lassen. Eine zentrale Schlussfolgerung wird sein, dass Klient, Therapeut, Therapien, psychotherapeutische Prozesse usw. hoch komplex sind, dass die beteiligten Variablen stark heterogen sind und dass dies in der psychotherapeutischen Praxis berücksichtigt werden sollte. Abbildung 2 stellt diese beiden konzeptuellen Grundlagen dar.
Abbildung 2: Folgerungen aus Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie
2. Verarbeitungsprozesse, Modellbildung und Expertise
Die ersten relevanten Schlüsse, die aus den vorherigen Ausführungen gezogen werden können, sind, dass aufgrund der extrem hohen Komplexität psychotherapeutischer Prozesse sehr hohe Anforderungen an die Verarbeitungsprozesse des Therapeuten gestellt werden: Ein Therapeut muss die komplexe einlaufende Information in Realzeit verarbeiten. Aufgrund dieser Verarbeitungen muss er ein Modell des Klienten entwickeln, das eine Wissensbasis für weitere Verarbeitungen und therapeutische Entscheidungen darstellt. Dazu verwendet er Wissen das z. T. aus wissenschaftlichen Erkenntnissen gewonnen wurde, das sich aber auch aus Praxiserfahrung entwickelt. Um diese Prozesse realisieren zu können, benötigt ein Therapeut ein sehr hohes Ausmaß an Expertise: Wie wir sehen werden, ist für die Konzeption der psychotherapeutischen Praxis Expertise von zentraler Bedeutung. Abbildung 3 stellt diese Faktoren dar:
Abbildung 3: Zusammenhang zwischen den Konzepten
|24|3. Therapieprozess
Der konkrete Prozess der Psychotherapie, d. h. die Interaktionen von Therapeut und Klient, die „im“ Klienten und Psychotherapeuten ablaufenden Prozesse usw. sind von großer praktischer und theoretischer Bedeutung. Therapeuten sollten diesen Prozessen in der praktischen Arbeit extrem viel Aufmerksamkeit schenken. Die genaue Bedeutung der Prozesse und die relevanten Prozessaspekte müssen geklärt werden. Darüber hinaus ist es wesentlich, sich mit dem Aspekt der Mikro-Ebene zu befassen, also mit dem, was im Einzelnen im Zeitverlauf geschieht.
Aspekte von Chaos und Struktur spielen eine Rolle: Ein Psychotherapieprozess ist nur zum Teil strukturiert und strukturierbar, er verläuft zu einem erheblichen Teil chaotisch. Und Klienten weisen große Schwierigkeiten auf, den Prozess von sich aus zu strukturieren. Und genau dies führt zum Aspekt der Prozesssteuerung durch den Therapeuten. Abbildung 4 stellt diese Komponenten dar.
Abbildung 4: Komponenten des Therapieprozesses
4. Verankerung in der Psychologie, Menschenbild und Therapieziele
Ein ganz wesentlicher Aspekt einer Konzeption von Psychotherapie ist die Verankerung in der Psychologie: Man kann psychotherapeutische Prozesse, Verarbeitungsprozesse von Therapeuten, Veränderungsprozesse von Klienten u. ä. nicht ohne Verwendung grundlegender psychologischer Theorien und Erkenntnisse verstehen.
Ein weiterer Aspekt von großer Bedeutung ist auch das Menschenbild von Psychotherapie: Dies speist sich zum großen Teil aus der Psychologie, aber auch aus anderen Quellen: Aus ihm leiten sich aber wesentliche Ziele von Psychotherapie, Haltungen der Therapeuten u. a. ab. Aus Psychologie, Psychotherapieforschung und Menschenbild leitet sich die grundlegende Konzeption von Psychotherapiezielen ab, die durch Psychotherapie allgemein oder durch spezifische Psychotherapien im Besonderen angestrebt und erreicht werden sollen. Dies betrifft die prinzipiellen Ziele, nicht die jeweils individuellen Ziele von Klienten. Aber auch deren Entwicklung hängt von psychologischen Faktoren ab. Abbildung 5 stellt diese Komponenten dar.
Abbildung 5: Verankerung in der Psychologie
5. Beispiele für Theorie- und Therapiekonzeptionen
Die dargestellten Überlegungen können nicht in aller Breite an Therapiekonzeptionen oder an Therapietheorien expliziert werden. Daher sollen lediglich drei Beispiele näher ausgeführt werden, die für ein Therapiekonzept grundlegend sein können:
Der Aspekt der Beziehungsgestaltung durch den Therapeuten.
Der Aspekt dysfunktionaler Schemata und ihrer Klärung.
Der Aspekt der Alienation und dessen Bedeutung für die Entwicklung individueller Therapieziele.
Beziehungsgestaltung durch den Therapeuten ist ein zentraler Aspekt eines psychotherapeutischen Vorgehens, vor allem, weil dadurch bestimmte Therapieprozesse erst möglich gemacht werden.
Das Konzept des „Schemas“ ist für die Psychotherapie sehr fruchtbar, da viele Klientenprobleme durch Schemata determiniert beschrieben werden können. Therapeutische Ansätze der Schema-Klärung und Schema-Bearbeitung haben sich als fruchtbar erwiesen.
Der Aspekt der sogenannten „Alienation“, der Entfremdung einer Person von ihren impliziten Motiven, ist wichtig, um das psychologische Funktionieren von Problemen zu verstehen, aber auch, um zu verstehen, wann und wie man in der Therapie individuelle Therapieziele entwickeln kann.
6. Gesamtkonzept
Aus den dargestellten Elementen ergibt sich nun das Konzept des Buches. Es ist in Abbildung 6 dargestellt.
Abbildung 6: Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aspekten
Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird im Text in der Regel das generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen umfassen gleichermaßen alle Geschlechter (m/w/d). Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
|27|Teil 1:Schlussfolgerungen aus erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Konzepten sowie aus Ergebnissen der Psychotherapieforschung
In diesem Teil sollen Vorschläge für eine Veränderung von Psychotherapie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleitet werden, nicht aus einer „Ideologie“ von Psychotherapie. Daher werden hier relevante wissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt, aus denen sich signfikante Schlussfolgerungen ableiten lassen.
Begonnen wird mit sehr grundlegenden erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Überlegungen: Diese sind erforderlich, um zu reflektieren was genau „wissenschaftliche Fundierung“ heißt und was genau darauf folgen kann und was nicht; dies ist auch wichtig, um den Aspekt des Verhältnisses von Forschung zu Praxis zu reflektieren und neu zu bestimmen, denn der Anspruch der Forschung sollte durchaus einer kritischen Reflektion unterzogen werden.
|29|2 Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Überlegungen
Für einige der grundlegenden Argumentationen dieses Buches ist es wesentlich, die Konzepte von Psychotherapie und vor allem die Erörterungen der Beziehung zwischen wissenschaftlicher Forschung und Praxis im Bereich der Psychotherapie in einen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Kontext einzubetten, denn diese Einbettung macht bestimmte Aspekte, um die es mir geht, sehr deutlich.
Dabei will ich nicht auf die gesamte Komplexität von erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Fragen eingehen (vgl. Bartels & Stöckler, 2009; Carrier, 2006, Carrier, 2009; Ernst, 2016; Gabriel, 2016; Grundmann, 2017; Popper, 2009a; Reichel & Parat de la Riba, 1992), sondern will nur die Aspekte herausgreifen, die für die vorliegende Konzeption relevant sind. Dabei will ich keine Basis-Erörterungen auf erkenntnistheoretischer Ebene betreiben; vielmehr möchte ich aus erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Positionen einige Grundthesen ableiten, die für die weiteren Ausführungen von Bedeutung sind. Daher will ich, aus Gründen der Übersichtlichkeit, die relevanten Erkenntnisse in Form von „Thesen“ präsentieren. (Dies dient dazu, sich auf die Essentials konzentrieren zu können – nicht dazu, sich als „Reformator“ zu präsentieren.)
2.1 These 1: Menschen müssen in ihren Kontexten handeln
Man muss davon ausgehen, dass Menschen immer von bestimmten Aspekten „der Realität“ umgeben sind: Von Dingen, von Lebewesen, von Menschen. Diese schaffen jeweils einen Kontext, in dem Menschen leben müssen. Sie müssen sich schützen, für ihr Wohlergehen sorgen, ihre Wünsche zu erfüllen versuchen, sich nach sozialen Erwartungen und Wünschen richten usw. Ein besonders wesentlicher Aspekt individueller Realität ist der soziale Kontext: Der bestimmt sehr große Teile unseres Lebens! Und dieser Kontext variiert ständig: Situationen ändern sich, vor allem soziale Situationen stellen immer wieder von Neuem hohe Anforderungen (vgl. Aronson et al., 2007; Bierhoff, 1998; Jonas et al., 2007; Middlebrook, 1974; Myers et al., 2014; Smith & Mackie, 2007).
Daraus folgt, dass Menschen in diesen Kontexten ständig handeln müssen: Sie müssen Situationen analysieren, Entscheidungen treffen und Handlungen ausführen. Täten sie dies nicht, würden sie sehr schnell in große Probleme kommen.
|30|Man kann also feststellen:
Menschen leben in bestimmten „Segmenten der Realität“: In einem physikalischen Kontext, gesellschaftlichen Kontext, sozialen Kontext usw.
Dieser Kontext stellt ständig eine Reihe komplexer Anforderungen, auf die Personen reagieren müssen: Sie müssen auf Erwartungen reagieren, Handlungen ausführen, um Kontrolle auszuüben, Ziele zu verfolgen usw.
Personen müssen ständig Informationen verarbeiten, Entscheidungen treffen, Handeln usw.
täten sie das nicht, wären sie nicht lebensfähig.
Dabei sind einige Handlungen einfach, andere hoch komplex.
Aber: Menschen müssen in ihren Kontexten effektiv handeln, und dazu brauchen sie Wissen, das „in der Realität funktioniert“. Sie müssen aber auch dann handeln, wenn ihnen in einem Bereich wissenschaftlich validiertes Wissen nicht zur Verfügung steht oder es in diesem Bereich ein wissenschaftlich validiertes Wissen gar nicht gibt. Ganz offensichtlich gibt es andere Wissensbasen, die effektives Handeln ermöglichen, und auf die muss offensichtlich immer wieder zugegriffen werden.
Etwas Derartiges gilt nun auch für den Bereich Psychotherapie: Ein Therapeut ist mit sehr unterschiedlichen Problemen, Klienten-Charakteristika, therapeutischen Prozessen konfrontiert. Er ist mit der gesamten Komplexität menschlicher Existenz konfrontiert (das klingt gewaltig, ist aber schlicht zutreffend). Und er ist gezwungen, damit ständig umzugehen: Zu analysieren, Wissen anzuwenden, Modelle zu bilden, Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Auch ein Therapeut kann sich nicht leisten, nicht zu handeln: Das wäre untherapeutisch, unethisch und entspräche auch nicht den Erwartungen des Klienten. Und auch ein Therapeut muss sich auf umfangreiches „Erfahrungswissen“ stützen, schon deshalb, weil niemals für alle Aspekte von Psychotherapie valide wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen können.
2.2 These 2: Handlungen sollen effektiv sein
Um in ihrem jeweiligen Kontext zurecht zu kommen, müssen Personen aber nicht nur handeln, sie müssen möglichst effektiv handeln, also dafür sorgen, dass angestrebte Effekte möglichst eintreten und unerwünschte Effekte möglichst ausbleiben:
Personen wollen, dass ihre Handlungen effektiv sind. Dies ist auch für ein Überleben oder ein Leben in einem bestimmten Kontext wichtig.
Effektiv bedeutet, dass eine Handlung die intendierte Wirkung (Konsequenz) entfaltet, d. h. dass sie für eine Person möglichst viele Gewinne und möglichst wenig Kosten erzeugt.
Das ist natürlich auch für den therapeutischen Kontext zutreffend: Therapeuten wollen (und sollten) so handeln, dass sich der Zustand des Klienten möglichst verbessert und nicht verschlechtert. Ein Therapeut versucht daher, nicht „irgendwas“ zu tun, son|31|dern etwas zu tun, von dem er annehmen kann, dass es effektiv ist. Um dies zu tun, benötigt er ein hohes Maß an Expertise; er muss, wie Walter Kintsch es formuliert hat, in der Lage sein, „das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun“.
2.3 These 3: Realitätsmodelle sind erforderlich
Effektives Handeln setzt voraus, dass man den Kontext, in dem man handelt, kennt: Man braucht Wissen darüber, welche Handlungen mit welchen ungefähren Wahrscheinlichkeiten zu welchen Ergebnissen führen. Eine Person braucht daher ein Modell der Realität, an dem sie sich orientieren kann (Anderson, 1983; Johnson-Laird, 1983; Seel, 1991). Eine Wissensbasis, die der Orientierung in einem Realitätskontext dient, soll als „Modell“ bezeichnet werden. Ein hoch elaboriertes und empirisch geprüftes Modell soll als „Theorie“ bezeichnet werden.
Daher gilt:
Um Situationen interpretieren zu können, um Entscheidungen zu treffen und um zu handeln, insbesondere, um effektiv zu handeln, muss eine Person ein Modell (über die Realität), einen Satz von Annahmen über den Kontext, haben, in dem sie handelt. Sie muss z. B. wissen, wie die sozialen Regeln sind, welche Handlungen welche Konsequenzen und welche Wahrscheinlichkeiten sie haben usw. Ohne ein solches Wissen sind effektive Handlungen nicht möglich.
Eine solche Wissensbasis kann man als ein „Realitätsmodell“ oder als „Modell“ bezeichnen. Es sollte alle wichtigen Informationen über den Kontext enthalten, die eine Person benötigt.
Theorien sind unerlässlich, um Daten und „Fakten“ überhaupt interpretieren und ihnen Sinn verleihen zu können, denn „Fakten“ erklären sich nie selbst, sie müssen immer innerhalb eines theoretischen Kontextes interpretiert werden.
2.4 These 4: Ein Realitätsmodell sollte valide sein
Wiederum braucht eine Person für ein effektives Handeln nicht irgendein beliebiges Modell: Sie braucht ein zutreffendes (= valides) Modell, aus dem zutreffende Schlussfolgerungen gezogen werden können (Grundmann, 2017). Das bedeutet, das Modell oder die Theorie muss empirisch bestätigt oder belegt sein. Modell und Theorien können und sollten sich also „bewähren“ (Bauberger, 2016; Chalmers, 1999; Holzkamp, 1967; Wiltsche, 2013) oder einen hohen „Bestätigungsgrad“ aufweisen (Wiltsche, 2013).
Das bedeutet:
Im Alltag sollte ein Modell über die Realität möglichst valide (zutreffend) sein. Es sollte also Annahmen enthalten, die sich durch eine entsprechende Prüfung bestä|32|tigen lassen. Es sollte z. B. zutreffende Prognosen darüber erlauben, welche Handlungen zu welchen Konsequenzen führen, und es sollte zutreffende Erklärungen über eingetretene Effekte ermöglichen (sodass zutreffende Schlussfolgerungen möglich sind). Dabei kann ein Modell nicht nur aus „Daten“ oder „Beobachtungen“ bestehen: Es besteht auch aus (nicht bewiesenen und z. T. nicht beweisbaren) Annahmen, Schlussfolgerungen u. Ä. (Bauberger, 2016).
Je valider die Annahmen eines Modells sind, desto eher ermöglicht es der Person ein effektives Handeln.
Die Validität eines Modells kommt dadurch zustande, dass das Modell auf Empirie basiert: Die Person muss (begründbare) Schlüsse aus realen Erfahrungen (aufgrund schon vorhandenen Wissens) ziehen, sie muss Annahmen des Modells testen und aus den Ergebnissen Schlüsse ziehen. Das bedeutet, das Modell muss auf Erfahrung beruhen, ständig durch Erfahrung modifizierbar, elaborierbar oder falsifizierbar sein.
Man kann davon ausgehen, dass eine solche Empirie, die man als Alltagsempirie bezeichnen kann, sich prinzipiell nicht von einer Empirie wissenschaftlicher Forschung unterscheidet: Sie unterscheidet sich nur graduell im Ausmaß und der Rigorosität der Testung (Vollmer, 1975), also im Ausmaß ihrer „Bewährung“.
Die Bestätigung/Validität einer Theorie ist kein Alles-oder-Nichts-Prinzip, sondern ein Kontinuum: Alltagstheorien sind meist weniger gut validiert als wissenschaftliche Theorien, dennoch sind sie empirisch validiert.
Im Bereich der Wissenschaft werden Theorien gebildet, d. h. umfassende Modelle über bestimmte Realitätsbereiche, die z. T. hoch komplex sind, deren Formulierung und Prüfung strengen wissenschaftlichen Kriterien genügt. Theorien haben im Bereich der Wissenschaft insofern Priorität, als dass sich aus Theorien (neue) Hypothesen und Fragestellungen ableiten lassen, denen theoretische Annahmen der Formulierung von Beobachtungen und der Interpretation von Daten zugrunde liegen. Theorien ermöglichen Vorhersagen, Erklärungen und sind sinnstiftend (Chalmers, 2007; Good, 1967; Holzkamp, 1967; Kuhn, 1967; Penrose, 2010; Popper, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d; Poser, 2001).
Dennoch ist das Erfordernis zu handeln von der Validität des Modells unabhängig: Eine Person muss in einem Kontext auch dann handeln, wenn sie nur über ein unvalides (oder defizitäres) Modell verfügt. Die Validität bestimmt aber wesentlich die Effektivität dieses Handelns!
2.5 These 5: Eine „Realität“ existiert
Es ist für den Alltag ebenso wie für die Wissenschaft sinnvoll anzunehmen, dass eine „Realität“ existiert, die für Personen die Bedingungen des Lebens und Handelns schafft und die bestimmt, ob eine Handlung effektiv ist oder nicht (vgl. Bunge & Mahner, 2004; Vollmer, 1975). Zwar ist der Solipsismus (Konzept, das die Realität nur in der |33|Vorstellung existiert) prinzipiell nicht widerlegbar, ergibt aber als Konzept weder für Alltagserfahrung, noch für wissenschaftliche Forschung irgendeinen Sinn (Vollmer, 1993). Dies ist vor allem so, da der Solipsismus im Detail zu exakt den gleichen Vorhersagen führt wie ein Modell, das von Realität ausgeht: Damit ist das Gedankengebilde eine bloße Spielerei ohne jegliche Relevanz.
Dabei kann man Folgendes annehmen:
Diese Realität manifestiert sich für Personen immer in bestimmten Realitätsbereichen, also bestimmten Kontexten.
Man sollte auch annehmen, dass eine Realität (zumindest eine physikalische) auch existiert, unabhängig von Menschen und unabhängig davon, ob Menschen sie wahrnehmen oder verstehen.
Die Realität bestimmt die Möglichkeiten der eigenen Existenz und des eigenen Handelns.
2.6 These 6: Modelle können unterschiedlich valide sein
Ein Modell kann z. B. Annahmen über Aspekte der physikalischen Realität enthalten („wenn man vor eine Laterne läuft, erzeugt das Schmerzen“) oder Annahmen über soziale Realität („wenn ich X tue, reagieren andere mit Y“).
Die Annahmen eines Modells können nun unterschiedlich valide sein. Wie ausgeführt, ist die Bestätigung oder Validität einer Annahme ein Kontinuum: Von schwach empirisch validiert bis zu extrem gut empirisch validiert. In einem Modell kann es daher Annahmen geben, die völlig unzutreffend sind, die damit zu hoch ineffektiven Handlungen führen. Es kann Annahmen geben, die hoch valide sind, die damit zu hoch effektivem Handeln führen.
Darüber hinaus gilt:
Ein Modell kann auch verschiedene Annahmen enthalten: hochgradig zutreffende, teilweise zutreffende, unzutreffende und dysfunktionale, also solche, die nicht nur keine positiven, sondern (stark) negative Effekte bewirken.
Valide Annahmen sind solche, die im Alltag erprobt sind, die getestet wurden, wobei aus Daten auch zutreffende Schlüsse gezogen werden.
Jede Annahme, die solchen Kriterien genügt, soll als empirisch validiert gelten.
Damit sind nicht nur wissenschaftlich erforschte Annahmen empirisch validiert: Auch Alltagsannahmen können empirisch validiert sein.
Das Ausmaß oder die Qualität der empirischen Validierung kann aber sehr unterschiedlich sein.
Ist ein Modell im Alltag getestet worden, geht es auf zutreffende, interpretierte Beobachtungen u. Ä. zurück, dann soll es als „alltagsvalidiert“ gelten.
Ist es nach (strengen) wissenschaftlichen Kriterien validiert, dann soll es als „wissenschaftlich validiert“ gelten.
|34|In jedem dieser Bereiche kann es aber Abstufungen im Ausmaß der Validierung geben.
Ein Modell, das eine Person ihrem Handeln zugrunde legt, kann im Wesentlichen alltagsvalidiert oder zum großen Teil wissenschaftlich validiert sein. Oft kann ein Modell sowohl Annahmen mit Alltagsvalidierung als auch solche mit wissenschaftlicher Validierung enthalten.
2.7 These 7: Modelle bilden Wissen
Modelle, die empirisch validiert sind und zumindest alltagsvalidiert sind, sollen als „Wissen“ bezeichnet werden (Ernst, 2016; Ramsey, 1990). Wissen ist die Basis einer Person für Situationsinterpretationen, Entscheidungen, Handlungen usw. (vgl. Beckenkamp, 1995; Engelkamp & Rummer, 2006; Hammerl & Grabitz, 2006; Seel, 1991; Zimmer, 2006). Nach dem Gesagten kann Wissen nun sehr unterschiedlich valide sein. Außerdem gilt, dass Interpretationen, Entscheidungen und Handlungen von Personen noch auf andere psychologische Faktoren als Wissen zurückgehen können: Auf Schemata, Motive, Emotionen usw. In solchen Fällen können sie zu unvaliden Modellen führen, die zu Fehlinterpretationen und zu dysfunktionalem Handeln führen. Diese „psychologischen Determinanten“ sollen hier aber nicht weiter berücksichtigt werden.
2.8 These 8: Modelle oder Theorien sind immer vorläufig
Ein Modell über einen Realitätsbereich fußt immer nur auf einer begrenzten Zahl von Beobachtungen und Schlussfolgerungen, und die hängen u. a. vom angewandten Paradigma, der Theorie, dem gegenwärtigen Erkenntnisstand, den verwendeten Methoden ab (Kuhn, 1967; Poser, 2001). Ein Modell bildet daher immer nur einen Teil des Kontextes ab, und es tut es immer nur „auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung“. Und diese begrenzte „Datenbasis“ erlaubt nur begrenzte Schlüsse über den Kontext: Es kann immer Kontextaspekte geben, die nicht berücksichtigt wurden. Es kann beipielsweise sein, dass man von unzureichenden Annahmen o. Ä. ausgegangen ist.
Daher gilt:
Jedes Modell, jede wissenschaftliche Theorie muss für Veränderungen offen sein, geprüft werden können und immer wieder geprüft werden.
Jedes Modell kann und sollte also durch neue Beobachtungen, neue Daten, neue Schlussfolgerungen u. ä. in Frage gestellt, modifiziert, elaboriert oder falsifiziert werden können.
Modelle sind nie abgeschlossen, endgültig, unhinterfragbar oder unmodifizierbar. (Solche Aspekte gelten nur für Glaubensdogmen, nicht für empirische Modelle.)
|35|Modelle bilden damit einen Realitätsbereich immer nur vorläufig und unvollständig ab. Damit ist es maximal möglich, empirisch gut belegte Hypothesen über Aspekte der Realität zu schaffen, es ist aber nie möglich, letztlich genau zu sagen, was „Realität“ genau ist. Auch ist die Annahme unzutreffend, dass „Daten“ oder Beobachtungen eine Theorie direkt bestätigen können: Daten müssen immer interpretiert werden, und das geschieht mithilfe der Theorie. Beobachtungen sind theorie-geleitet und ergeben erst im Rahmen der Theorie Sinn. Damit gibt es keine „absolut objektiven“, Theorie-unabhängigen „Indikatoren“, die eine Theorie direkt „beweisen“ können (Bauberger, 2016; Kuhn, 1967; Lakatos, 1970, 1971; Lakatos & Musgrave, 1974; Poser, 2001; Stegmüller, 1969; Vollmer, 1975).
Modelle stellen also nie „die Wahrheit“ dar, also Annahmen, die unverrückbar, unhinterfragbar, unmodifizierbar u. a. sind. Es gibt verschiedene Begriffe von „Wahrheit“ (Ernst, 2016; Ramsey, 1990; Tarski, 1944, 1993): Wahrheit kann bedeuten, dass eine Aussage mit der Realität übereinstimmt (wobei das prinzipiell aber nur sehr schwer feststellbar ist; vgl. Baumann, 2015). Wahrheit kann aber auch bedeuten, dass eine Annahme „absolut wahr“, „endgültig wahr“, „unverrückbar wahr“ ist (wie bei Max Frisch, 1967, Seite 52: „Die wir nennen die große Ordnung, die wahre Ordnung, die einzige Ordnung und die endgültige Ordnung.“). Ich möchte den Begriff „Wahrheit“ hier in dieser zweiten Bedeutung verwenden. Nach Ernst (2016) kann man erkenntnistheoretisch auf den Begriff „Wahrheit“ gänzlich verzichten.
„Wahrheit“ in diesem Sinne kann es weder in Alltagsmodellen, noch in wissenschaftlichen Modellen geben.
Einige Menschen scheinen so etwas wie „absolute Wahrheit“ psychologisch zu benötigen, z. B. sogenannte „Kreationisten“: Leider werden durch das Bedürfnis nach „Wahrheit“ Aussagen nicht „wahr“, sondern die Personen erliegen lediglich unterschiedlichen Ausmaßen von Selbsttäuschung (siehe Sachse, 2020d).
2.9 These 9: Wissenschaftliches Wissen ist immer hypothetisch
Wissenschaft führt dazu, dass immer wieder Theorien und Ergebnisse in Frage gestellt werden („Skepsis“; Walach, 2005; von Weizsäcker, 1990), immer wieder neue Fragestellungen entwickelt werden, immer neue Daten zugänglich werden, aus denen neue Schlüsse gezogen werden müssen: Dadurch werden neue Modelle entwickelt, alte Modelle in Frage gestellt, modifiziert, elaboriert oder unter Umständen verworfen. Wissenschaft ist daher nie ein abgeschlossener oder abschließbarer Prozess, und was an Neuem gefunden wird, ist auch kaum prognostizierbar.
In einer extremen Formulierung kann man sogar sagen, dass Wissenschaft nicht „auf Fakten basiert“, sondern „Fakten konstruiert“ (Radecke & Teufel, 2010). Wenn eine Theorie jedoch (in einem gewissen Ausmaß) nur Fakten generiert oder zumindest Fakten interpretiert, dann kann sie auch nicht einfach „durch Fakten belegt“, „be|36|wiesen“ werden: Fakten sind nicht „an sich existent“ und „erklären sich auch nie selbst“: Das verweist wieder auf den hypothetischen Charakter von „empirischen Belegen“. In jedem Fall kann man aber nie sagen, ob und in welchem Ausmaß eine Theorie „die Realität abbildet“ (Genz, 2002; Heisenberg, 1959). Denn das könnte man ja nur sagen, wenn man schon a priori wüsste, was „die Realität“ ist. Das ist aber nicht möglich.
Wissenschaft lässt sich damit durch eine Reihe von Aspekten bestimmen:
Ein wesentliches Motiv der Wissenschaft ist Skepsis, also die Bereitschaft, Annahmen immer wieder zu hinterfragen. Allerdings muss auch ein Wissenschaftler eine Theorie (vorläufig) für zutreffend halten, um sie überhaupt zum Gegenstand weiterer Erörterungen zu machen (vgl. Brecht, 1967; Ernst, 2016; Popper, 2009d; Sachse, 2020a; Sagan, 1997).
Genau wie Alltagsmodelle, so werden und sollen auch wissenschaftliche Modelle und Theorien ständig hinterfragt werden können und hinterfragt werden, neu getestet werden. Sie werden ständig durch neue Beobachtungen, Daten und Schlussfolgerungen in Frage gestellt, modifiziert, elaboriert und gegebenenfalls falsifiziert.
Obwohl Wissenschaft zu hoch validen Annahmen führt, die sich zu Theorien entwickeln, ermöglicht auch Wissenschaft nie die Entwicklung abgeschlossener Modelle (vgl. von Weizsäcker, 1992).
Wissenschaftliche Theorien sind nie (endgültig) verifizierbar. Sie können sich lediglich im System der Wissenschaft selbst oder in ihrer Anwendung bewähren (d. h. sie können in einem bestimmten Kontext „gut funktionieren“, sie zeigen eine mehr oder weniger hohe „Brauchbarkeit“; vgl. Popper, 2005, S. 207), was aber wiederum bedeutet, dass sie sich immer nur vorläufig bewähren (Kuhn, 1967; Popper, 2005; Ruß, 2004; Vollmer, 1993; Walach, 2005). Jeder Versuch, eine Theorie einer „Letzt-Begründung“ zuzuführen, mündet in einem unlösbaren Dilemma (vgl. Albert, 1968). Unbezweifelbare Wahrheiten lassen sich nicht schaffen (Albert, 2000), es sei denn durch eine (letztlich nicht begründbare) Dogmatik (die jedoch dem Sinn von Wissenschaft eklatant widerspricht).
Wissenschaft erzeugt damit immer nur valide Aussagen auf dem aktuellen Kenntnisstand: Dieser kann sich aber jederzeit ändern und eine Modifikation der Aussagen auslösen, zu völlig neuen Modellen führen usw. Außerdem enthält eine wissenschaftliche Theorie immer unbewiesene Annahmen, und ihre theoretischen Begriffe definieren oft nicht „Aspekte von Realität“, sondern gehen auf operationale Definitionen zurück, d. h. wissenschaftliche Aussagen werden oft erst durch die angewandte Methode geschaffen und erhalten dadurch hoch spezifische Bedeutungen, die mit Phänomenen der Realität unter Umständen nur noch wenig übereinstimmen (Bauberger, 2016). Diese Definitionen schränken damit auch wieder den Geltungsbereich einer Theorie ein.
Dies soll an einem Beispiel erläutert werden: Misst man z. B. in der Psychotherapie „Therapieerfolg“ mit bestimmten Instrumenten, z. B. Fragebögen, so ist „Erfolg“ nur im Hinblick darauf definiert und definierbar: Er ist damit kein „allgemeiner Erfolg“, sondern ein hoch spezifisch eingeschränkter Erfolg. Und das, was erfasst wird, kann unter |37|Umständen mit dem, was durch eine Therapie angestrebt wird, gar nichts zu tun haben, d. h. der so erfasste Erfolg kann für ein spezifisches therapeutisches Verfahren völlig irrelevant sein!
Außerdem bedeutet eine Operationalisierung von „Erfolg“, dass streng genommen nie „etwas, das ohne den Test schon existiert, ‚gemessen‘ werden kann“: Vielmehr wird etwas durch die Tests definiert, also erst geschaffen: Die Bezeichnung „messen“ ist daher im Grunde irreführend (Bauberger, 2016). Erfolg wird nicht durch Tests „gemessen“, sondern erst durch Tests definiert.
Trotz aller Validität führt Wissenschaft daher nie zu „Wahrheit“, also zu „Letzt-Erkenntnissen“, die nicht mehr modifizierbar, verbesserbar, hinterfragbar sind. Ein wissenschaftliches Modell ist damit immer nur „das im Augenblick am Besten mögliche“. Wissenschaftliche Modelle sind daher immer vorläufig und so lange gültig, bis eine neue Entwicklung Veränderungen veranlasst. Auch sehr gut validierte wissenschaftliche Modelle verlieren damit nie den Charakter von Hypothesen: Sie sind im Augenblick gültig und gut belegt, aber sie können jederzeit verändert, vor allem können sie jederzeit in Frage gestellt werden (Popper, 2005, 2009d spricht von „Vermutungswissen“).
Dass Forschung nie abgeschlossen ist oder abgeschlossen sein kann, macht schon die bisherige Forschungsgeschichte deutlich. Popper (2005, S. 47) formuliert das so: „Die naturwissenschaftlichen [und im Prinzip alle; Anmerkung des Verfassers] Theorien sind in ständiger Umwandlung begriffen (und dies ist) charakteristisch für Wissenschaft.“ Daher ist jedes wissenschaftliche Wissen „Vermutungswissen“ (Hempel, 1965a, 1965b, 1965c, 1967, 1974; Popper, 2005; Ruß, 2004; von Fraassen, 1980; Wiltsche, 2013). Dabei können die Veränderungen in kleinen Schritten vorangehen, sie können aber auch gewaltige „Sprünge“ machen, also zu ganzen „Paradigmenwechseln“ führen (Kuhn, 1967). Und die neuen Erkenntnisse und Theorien können alte Theorien modifizieren, erweitern oder einen neuen Bezugsrahmen herstellen oder sie können sogar alte Annahmen vollständig falsifizieren (Popper, 2005).