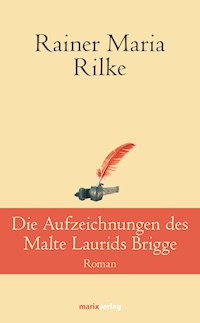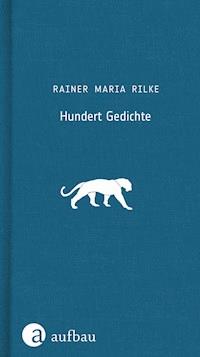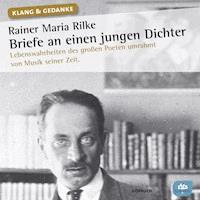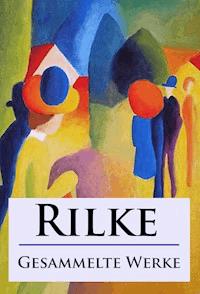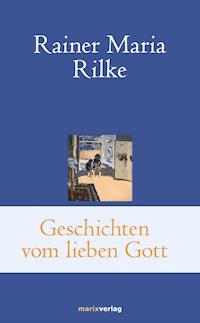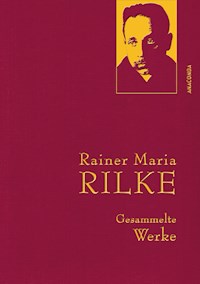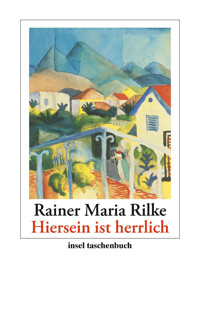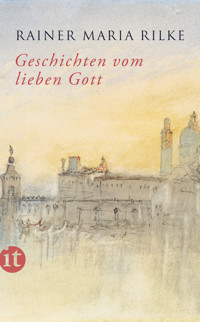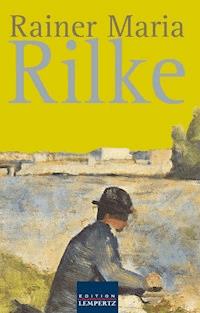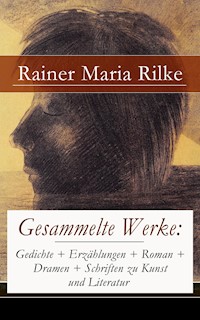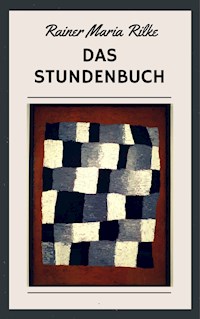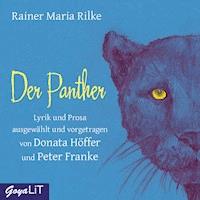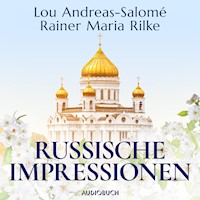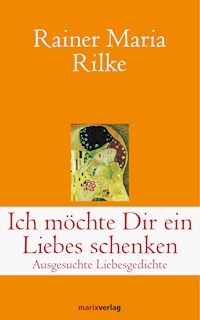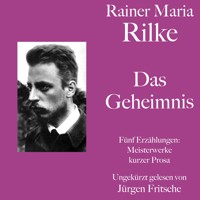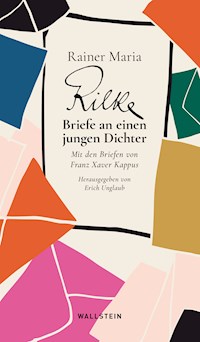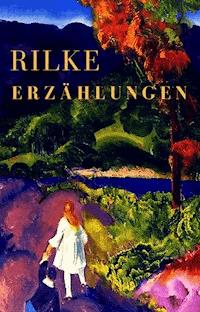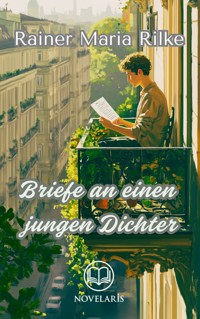Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
König Bohusch ist eine Erzählung von Rainer Maria Rilke. Auszug: Als der große Mime Norinski um drei Uhr nachmittags in das National-Café, welches vor dem Prager tschechischen Theater liegt, eintrat, erschrak er ein wenig, lächelte aber gleich darauf sein verächtlichstes Lächeln: in dem Spiegel, schräg gegenüber der Tür, hatte sich irgend eine entfernte Ecke des Saales gefangen, und er hatte drinnen eine schiefe Marmorsäule und unter dieser Säule einen kleinen, buckligen Mann erkannt, dessen seltsame Augen dem Eintretenden wie lauernd aus einem unförmigen Kopfe entgegenstarrten. Das Fremde dieses Blickes, in dessen Tiefen irgend ein unerhörtes Geschehen sich dunkel zu spiegeln schien, hatte ihn einen Augenblick in Schrecken versetzt. Nicht etwan, weil er besonders furchtsamer Natur gewesen wäre, sondern infolge des profunden und versonnenen Wesens, welches so großen Künstlern meistens eignet und durch dessen Wall sich jedes Ereignis gleichsam durchbohren muß.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
König Bohusch
König BohuschAnmerkungenImpressumKönig Bohusch
Als der große Mime Norinski um drei Uhr nachmittags in das National-Café, welches vor dem Prager tschechischen Theater liegt, eintrat, erschrak er ein wenig, lächelte aber gleich darauf sein verächtlichstes Lächeln: in dem Spiegel, schräg gegenüber der Tür, hatte sich irgend eine entfernte Ecke des Saales gefangen, und er hatte drinnen eine schiefe Marmorsäule und unter dieser Säule einen kleinen, buckligen Mann erkannt, dessen seltsame Augen dem Eintretenden wie lauernd aus einem unförmigen Kopfe entgegenstarrten. Das Fremde dieses Blickes, in dessen Tiefen irgend ein unerhörtes Geschehen sich dunkel zu spiegeln schien, hatte ihn einen Augenblick in Schrecken versetzt. Nicht etwan, weil er besonders furchtsamer Natur gewesen wäre, sondern infolge des profunden und versonnenen Wesens, welches so großen Künstlern meistens eignet und durch dessen Wall sich jedes Ereignis gleichsam durchbohren muß. Dem Original gegenüber empfand Norinski nichts Ähnliches. Er übersah den Verwachsenen sogar eine ganze Weile, während er mit unnötiger Wichtigkeit den andern am Stammtisch die Hand reichte. Die Händedrücke nahmen eine ziemliche Zeit in Anspruch, denn jeder hatte gleichsam drei Akte. Erster Akt: Zögernd folgt die Hand des Schauspielers dem Flehen der entgegengestreckten Hände. Zweiter Akt: Seine Hand spricht nachdrücklich zu der, welche sie umfaßt: Merkst du auch die Bedeutung dieses Moments? Dritter Akt und Katastrophe, wobei Norinski jede Hand verächtlich losließ, fortwarf: Oh du Erbärmlicher, das kannst du ja gar nicht merken . . . Diese Erbärmlichen waren diesmal: Karás, der lange blasse Kritiker des ›Tschas‹, ausgezeichnet durch einen überaus langen Hals und – wie ein boshafter jüdischer Kollege mal behauptet hatte – einen überaus höflichen ›Adamsapfel‹, welcher jeden Tropfen durch die Einsamkeit der Kehle bis an den Kragenrand, wo er sich nicht mehr verirren konnte, begleitete und von dort diensteifrig auf seinen Posten zurückschnellte, Schileder, der schöne Maler, der so traurige Dinge malte, der Novellist Pátek, der Lyriker Machal, der Student Rezek, der etwas abseits saß, aus einem großen Stammglas heißen Tschaj mit viel Kognak trank und schwieg. Endlich schien Norinski auch den Buckligen zu bemerken. Er lachte: »König Bohusch!« und streckte mit ironischem »Majestät« die Hand über den Marmortisch. Der Kleine fuhr auf und schickte ihm, um die Mimenhand nicht warten zu lassen, überhastig seine gelben unreifen Finger entgegen, so daß sich die beiden Hände wie Vögel in der Luft haschten. Dem Bohusch kam das ziemlich drollig vor, und er ließ ein zitterndes, zerbrochenes Lachen hören, das er ängstlich unterbrach, als er bemerkte, wie die Blatternarben auf Norinskis Stirne sich unter ärgerlichen Falten versteckten. Der Mime murmelte etwas, gab die Jagd auf und sagte in schlechter Laune zu Karás:
»Ihr schreibt auch einen Kohl, mein Lieber. Aber das sag ich dir, ich spiele meinen Hamlet das nächstemal just so, wie gestern. Ich spiele eben meinen. Verstehst du, Liebster?«
Karás schluckte irgendwas hinunter und sagte etwas von der Auffassung, die andere bekundet hätten, Bedeutende; er möchte nur Kainz nennen oder – der Student Rezek trank heftig sein Glas aus, und Norinski sagte erregt:
»Liebster, was geht mich ein deutscher Hamlet an. Du wirst doch nicht etwan behaupten wollen, wir dürften nicht auch unsere Meinung haben? Ist der Shakespeare ein Deutscher? Nun, was gehn uns also die Deutschen dabei an? Ich nehme meine Auffassung sozusagen direkt aus dem Englischen.«
»Das einzig richtige«, sanktionierte Pátek und strich den spitzen Modebart mit gepflegten Fingern.
»Dein Kostüm übrigens, ich meine vom malerischen Standpunkt –« besänftigte der schöne Maler, und rasch wandte sich ihm Norinski zu. »Ja«, gähnte er so ganz obenhin, und dann mit herablassender Gönnerstimme: »Was macht denn Ihr Schauspiel, Machal?«
Der Lyriker schaute eine Weile schweigend in sein Absinthglas und erwiderte leise und kummervoll: »Es ist Frühling.«
Alle erwarteten noch etwas, aber der Dichter schien schon wieder unterwegs nach dem blassen Garten seiner Träume. Er sah sein Absinthglas wachsen und wachsen, bis er selbst sich mittendrin fühlte in dem opalnen Licht, ganz leicht, ganz gelöst in dieser seltsamen Atmosphäre. Nur Schileder hatte das gewaltige Wort ernst hingenommen. Es lag über ihm, so dicht, daß er auch nicht mit den Wimpern hätte zucken mögen. In seinem Tiefsten dachte er: Gott, das trifft jeder. Hat er denn etwas Besonderes gesagt? Das kann ich auch: es ist . . .
Er kam nicht zu Ende damit. Alle lachten, und Schileder atmete auf, als er an den Mienen der anderen sah, daß der Ausspruch doch nicht so gewichtig gewesen sein mochte. Karás wandte sich an den Lyriker: »Das heißt, es blüht dein Stück. Hm?«
Da sagte Machal seiner Muse mit einer Verbeugung: »Entschuldigen Sie –«, und kam ungern zurück aus der opalnen Welt; aber das Mißverständnis war auch zu arg: »Nein«, betonte er, »das heißt, ich bin zu traurig jetzt. Das heißt, es ist jetzt die Zeit, wo die Natur alles Werden mißversteht, das heißt, daß ich müde bin – müde dieses wunden Keimens.«
»Aber verzeih«, der Novellist tippte ihn mit dem modegelben Handschuh auf die Schulter, »das mag ja sein, aber das ist doch nicht Frühling.«
Und der Maler dachte: nein, das ist nicht Frühling.
»Im wunderschönen Monat Mai«, deklamierte der Mime.
»Einst«, hauchte der Dichter und machte eine Bewegung mit der Hand, mit welcher er dieses Einst noch weiter zurückdrängte, »einst war das vielleicht so, wie es in alten Gedichten steht – der Frühling: ›Licht und Liebe und Leben‹. Wer das noch glaubt, belügt sich.«
Er seufzte tief.
Wie schade, dachte der Maler, also kein Frühling mehr.
Machal aber erhob sein Gesicht, das durch große Sommerflecken entstellt war, hoch in das klare Nachmittagslicht und konnte durch das Fenster gerade die Rampe des Nationaltheaters sehen, längs welcher ein Schutzmann auf und nieder ging. Das wollte er nun gerade niemandem zeigen, allein er sagte gleichwohl: