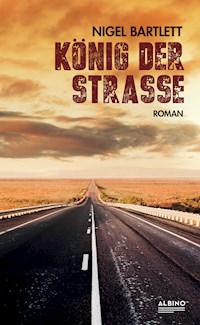
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albino Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als sein elfjähriger Neffe eines Tages plötzlich verschwindet, gerät David ins Fadenkreuz der Ermittler. Um seine Unschuld zu beweisen, bleibt ihm keine andere Wahl: Er selbst muss die Spur des verschollenen Jungen verfolgen. Seine Reise führt ihn an Orte, die er nie besuchen wollte, lässt ihn Dinge tun, die er nie für möglich gehalten hätte, und macht ihn zum einsamen Jäger der Wahrheit -- zum König der Straße. Ein packender Roadtrip und ein ergreifender Roman über die Suche nach einem geliebten Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Nigel Bartlett
KÖNIG DER STRASSE
NIGEL BARTLETT
KÖNIG DERSTRASSE
ROMAN
Aus dem Englischen von Andreas Diesel
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel King of the Road by Random House Australia
1. Auflage © 2016 Albino Verlag, Berlin in der Bruno Gmünder GmbH Kleiststraße 23-26, D-10787 Berlin
Copyright © Nigel Bartlett 2015First published by Random House Australia Pty Ltd, Sydney, Australia. This edition is published by arrangement with Random House Australia Pty Ltd via Michael Meller Literary Agency GmbH, MünchenAus dem Englischen von Andreas DieselUmsetzung Umschlag & Satz: Robert SchulzeAbbildung Umschlag: shutterstock.com / kwest
ISBN 978-3-95985-080-3eISBN 978-3-95985-188-6
Mehr über unsere Bücher und Autoren:www.albino-verlag.de
Für Graham und Valerie Bartlett, meine wundervollen Eltern
PROLOG
Ich trage immer noch ein Foto von Andrew in meiner Brieftasche, aber ein anderes als früher. Andrew ist derselbe wie immer, die Augen zu schmalen Schlitzen verengt, das braune Haar blond an den Spitzen. Allerdings will ich keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen: Ein Mann über dreißig mit dem Foto eines kleinen Jungen mit freiem Oberkörper, das wirkt einfach merkwürdig. Also habe ich das Bild durch ein anderes ersetzt, das am selben Tag aufgenommen wurde.
Die beiden Fotos sind fast identisch bis auf die Tatsache, dass er auf diesem hier ein T-Shirt trägt, dessen blaue, gelbe und braune Streifen den Himmel, den Sand und seine Haut imitieren. Ich kann mir vorstellen, dass andere Leute einen Blick auf das Bild werfen und einfach ›Was für ein niedlicher kleiner Junge‹ denken, aber wenn ich es anschaue, denke ich einfach ›Andrew‹.
Ich habe überlegt, das mit dem Bild ganz sein zu lassen, nur um sicherzugehen, aber ich habe Angst, dass ich vergesse, wie er aussieht. Ich weiß gar nicht, ob so etwas überhaupt passieren, ob das Aussehen einer Person wirklich aus dem Gedächtnis gestrichen werden kann. Ich lasse es lieber nicht darauf ankommen. Vor ein paar Tagen brach mir auf einmal der Schweiß aus, und ich musste an den Rand des Highways fahren, hektisch meine Brieftasche rausnehmen und das Bild anstarren, um mich zu erinnern. Danach war ich außer Atem und wie benommen, und das nur, weil mich der Gedanke gepackt hatte, die Person, die ich mir als Andrew vorstellte, sei irgendein anderer Junge, der Neffe irgendeines anderen. Ich leide normalerweise nicht unter Panikattacken, jedenfalls hatte ich früher nie welche – allerdings ist nichts mehr so, wie es früher mal war.
Ich habe in meiner Wohnung noch weitere Bilder von Andrew, und zwar an Stellen, wo man sie erwarten würde. Eines seiner Klassenfotos steht neben dem Sofa. Er sitzt im Schneidersitz in der ersten Reihe, die Arme fest überm Bauch verschränkt, der Rücken gerade und die Brust so vorgestreckt, dass er fast platzt. Er macht ein finsteres Gesicht und presst den Mund fest zusammen, als dürfe er keinen Mucks von sich geben. Er hat öfter mal Ärger in der Schule – nichts Ernstes, mehr so die Art von Ärger, die die Lehrer beim Aufstellen der Klasse vor dem Ausflug in ein Museum zur Verzweiflung bringt: »Andrew, bitte!«
Es gibt noch ein aktuelleres Schulfoto von ihm: Auf diesem ist er allein und strahlt die Kamera an, keine Spur von jugendlichen Sturmwolken am Horizont. Am Kühlschrank habe ich ein Bild befestigt, das er vor Jahren gemalt hat. Ich musste lächeln, als er es mir schenkte – es sieht aus wie etwas, das ich als Fünfjähriger gemalt hätte. Ein Haus, zu beiden Seiten der Tür rechteckige Fenster. Das Haus ist gelb, das Dach ist rot, weil Dächer nun mal rot sind. Rechts daneben steht ein Baum – ein dünner, brauner Strich mit einer grünen Krone, die wie Brokkoli aussieht, darauf rote Punkte für Äpfel. Die Wasserfarben verlaufen stellenweise ineinander. Oben rechts befindet sich die Sonne, hellgelb und mit stachelförmigen Strahlen in regelmäßigen Abständen. Darüber der Himmel, ein zwei Zentimeter breiter Streifen des strahlendsten Blaus, das man sich nur vorstellen kann. Es ist ein schönes Blau, aber man wollte nicht das Wohnzimmer damit streichen.
Ich werde diese Andenken an Andrew wie meinen Augapfel hüten. Es heißt immer, die schönsten Dinge im Leben wären keine Dinge, aber das stimmt für mich nur halb. Klar, mein Auto, meine Wohnung, die Klimaanlage, die mir nachts die Hitze vom Leib hielt – solche Sachen sind mir scheißegal. Aber die Fotos, die Bilder, der Kalender mit den australischen Stränden, den Andrew mir zum letzten Geburtstag schenkte – die kommen mir auf einmal wie die schönsten Dinge in meinem Leben vor. Ich könnte sie nicht ersetzen, wenn es in meiner Wohnung brennen würde oder jemand sie mir aus irgendeinem Grund wegnähme. Andrew ist schließlich nicht mehr hier, um sie mir erneut zu geben.
Aber ich muss mit solchen Gedanken vorsichtig sein. Keiner weiß, ob Andrew für immer weg ist. Keiner weiß, ob er tot ist oder ob ich ihn je wiedersehen werde.
KAPITEL 1
SAMSTAG
Es ist nicht so, wie es aussieht, wirklich nicht. Aber das behaupten wohl alle.
Ich telefoniere gerade mit Alexia, einer Frau, mit der ich ein Interview mache. Sie hat mich schon auf hundertachtzig gebracht, weil sie angeblich nur heute Zeit für mich hat. Dank ihres übervollen Terminkalenders muss ich am Wochenende arbeiten, wo ich doch eigentlich die Wohnung auf Vordermann bringen wollte, weil Andrew heute kommt.
Alexia macht Reiki mit Hunden. Bin ich wirklich so tief gesunken, dass ich mir eine Verrückte anhören muss, die behauptet, arthritiskranke Tölen durch Handauflegen zu heilen? Verschont mich.
Ich habe bereits alle Zitate, die ich brauche, und ich habe keine weiteren Fragen mehr, aber sie will einfach nicht den Mund halten. Mein Aufnahmegerät schneidet alles mit, und mein Herz wird schwer beim Gedanken an den vergeudeten Speicherplatz, den ihr Geschwätz auf meiner Festplatte belegen wird. Ich schalte auf Durchzug und spiele auf dem Rechner herum, während sie munter weiterquasselt.
»Ich wurde in Amerika von einem Meister ausgebildet, der schon seit vierzehn Jahren mit Kleintieren arbeitet.« Blablabla.
Ich rufe Facebook auf, sehe mich kurz um; seit gestern Abend nichts Neues. Ich rufe Outlook auf und sehe nach, worum ich mich noch kümmern muss. Genau, da ist eine Mail, die ich noch verschicken möchte. Ich schreibe an den Chefredakteur der Zeitschrift Living Beautiful wegen eines Anwesens, über das ich einen Bericht schreiben will. Hey Dom, tippe ich so sanft wie möglich, damit Alexia mich nicht hört, hier sind die Fotos vom Castlecrag-Haus. Was meinst du? Gruß, David.
Wenn Dom Ja sagt, fahre ich nächste Woche hin, treffe den Architekten, plaudere mit den Besitzern und lasse mich durchs Haus führen. Achthundert Worte, siebenhundert Kröten. Leicht verdientes Geld. Einfach nur dafür, in anderer Leute Heim herumzuschnüffeln.
Ich rufe den Bilderordner mit den Schnappschüssen auf, die die Besitzer mir geschickt haben. Das Haus wird noch besser aussehen, wenn es von einem Profi fotografiert worden ist. Jede Menge Holz und fein geschliffener Stein, toller Ausblick auf den Middle Harbour. Nichts Weltbewegendes, aber mir wird schon was Nettes dazu einfallen, wie immer.
Ich drücke auf die Pfeiltaste, und die Fotos nehmen mich mit auf eine virtuelle Besichtigung durch den Eingangsbereich, das repräsentative Wohnzimmer, das private Wohnzimmer, das repräsentative Esszimmer, die Küche und den privaten Essbereich. Die Treppe hinauf: das große Schlafzimmer mit eigenem Bad und Balkon, mehrere Kinderzimmer, ein Gästezimmer. Das ganze Haus ist in einem bemühten Modernismus gehalten und voller Designklischees, aber Dom wird es lieben. Ich bin am Ende der Bildstrecke angelangt und ertappe mich dabei, wie ich wahllos Fotos aus meinem eigenen Bilderordner anklicke: ein Foto von mir mit der Chilipflanze, die Cam und Vicky mir zum Geburtstag geschenkt haben; Cam und Vicky vor dem Clovelly Hotel; ich beim Ironman-Finale: ein Bild der Qualen und natürlich weit abgeschlagen hinter Cam.
Ich klicke weiter, aus reiner Lethargie und dem Bedürfnis nach visuellen Reizen. Ich hoffe, dass Alexia bald mal Luft holen muss, damit ich den Anruf auf höfliche Weise beenden kann. Das Problem dabei ist, dass sie wie ein Meereswesen aus dem Märchen anscheinend nie Luft holen muss. Sie ist teils Frau, teils Fisch und hundert Prozent langweilig.
Ich überlege, ihr einfach das Wort abzuschneiden, und klicke mich schneller durch die Bilder. Ich hoffe, dass sie das Klicken der Maus hört und den Wink mit dem Zaunpfahl versteht, aber wahrscheinlich glaubt sie, ich würde einfach nur mitschreiben. Sie fühlt sich durch mein scheinbares Interesse an ihren Worten noch ermuntert, denn ihre Stimme wird lauter und dringlicher. Und da sehe ich es.
Ich brauche einen Moment, um zu erkennen, was da los ist, als müssten meine Augen sich erst an die Dunkelheit in einem Zimmer gewöhnen. Das Bild ist pornografisch, doch wo ich anfangs glaubte, das Gesicht einer Frau mit offenem Mund zu sehen, ist das Gesicht eines Mädchens. Eines kleinen Mädchens. Sie ist kaum älter als neun, und ihr Gesichtsausdruck ist alles andere als lusterfüllt. Aber ist das wirklich ein Mädchen, was ich da sehe? Der Autofokus in meinen Augen bringt das Bild näher heran. Das ist ein Junge.
Ich fühle mich, als würde ich über einen Abhang stürzen; viel zu spät wird mir bewusst, dass es kein Zurück gibt und dass sehr bald schon – und zwar in dieser Minute noch – mein altes Leben vorbei sein wird.
Ich kann mir das Bild nicht länger als ein paar Sekunden ansehen, aber ich muss wissen, was kommt, wenn ich weiterklicke. Noch ein Bild, noch grotesker als das davor, und dann noch eins. Und noch eins. Derselbe Junge, anscheinend mit demselben Mann, dessen Gesicht unkenntlich gemacht ist durch einen digitalen Strudel – ein Strudel wie der in meinen Gedanken. Ich klicke und klicke. Neue Jungs, andere Männer. Gott weiß, wie viele Bilder das insgesamt sind.
Alexia redet immer noch.
»Tut mir leid, dass ich Sie unterbrechen muss«, sage ich. »Ich muss jetzt gehen.«
»Oh …« Sie klingt verwirrt und verärgert.
Ich behaupte, dass ich einen anderen Anruf annehmen müsste, lege auf und schalte die Aufzeichnung ab. Ich starre auf den Bildschirm. Mein Magen will seinen Inhalt von sich geben, egal auf welchem Weg.
Ich öffne die E-Mail des Hausbesitzers. Hat er mir etwa unwillentlich diese Bilder zusammen mit den Fotos von seinem eleganten Heim geschickt? Nein, von ihm stammen nur die vom Haus. Ich rufe Outlook auf und durchsuche fieberhaft meine Mails, rufe alle mit Anhängen auf. Ich klicke eine nach der anderen an, aber es sind zu viele. Es gibt Pressemitteilungen, JPEGs, TIFFs, PDFs, Word-Dokumente, Tausende davon – sie reichen mehr als fünf Jahre zurück. Wie könnte ich die alle durchforsten?
Außerdem wüsste ich doch, wenn ich diese Bilder aus einer E-Mail gespeichert hätte. Wenn sie mir allerdings niemand geschickt hat, wie sind sie dann auf meinen Computer gelangt? Hätte ein anderer sie herunterladen können? Ich zerbreche mir den Kopf, ob irgendwer sonst diesen Rechner benutzt haben könnte. Mir will niemand einfallen. Und außerdem habe ich keine Zeit, über die Herkunft der Bilder nachzudenken. Ich muss diesen Dreck loswerden, ein für alle Mal. Ich rufe den Ordner wieder auf. Die Fotos tragen alle den Titel ›Bright Star‹, gefolgt von einer Nummer, angefangen bei 001. Ich scrolle runter: Die letzte Zahl lautet 2879. Ich starre auf den Schirm, kann es einfach nicht fassen. Beinahe dreitausend Bilder. Auf meinem Computer.
Ich klicke das erste an, drücke die Hochstelltaste, markiere sämtliche Bilder. Ich zögere. Warum zögere ich? Hör auf damit, David, und tu es einfach, verflucht noch mal. Ich lösche sie. Weg damit. Ich rufe den Papierkorb auf. Da sind sie. Ich drücke auf ›Papierkorb leeren‹.
Mein Herz hämmert. Mir ist klar, dass die Bilder durch das Löschen nicht endgültig weg sind. Irgendwo, tief in meinem MacBook, lauern sie noch, ohne dass ich Zugriff auf sie habe, und dort werden sie mich bis ans Ende meiner Tage verhöhnen.
Ich werde den Rechner neu formatieren. Geht das, ohne dass mir sämtliche Dateien verlorengehen? Oder werden diese scheußlichen Bilder dann immer noch da sein? Ich weiß nicht, ob ich sie dadurch ein für alle Mal beseitige. Wen kann ich um Rat fragen? Sobald ich diese Frage stelle, wird man wissen wollen, was ich zu verbergen habe. Nein, ich muss den Computer loswerden. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich muss das ganze Gerät vernichten, nicht bloß auf eine Halde werfen, wo es sich jeder schnappen und wieder herstellen und dieses Geheimnis aufdecken kann, das ich unbedingt geheim halten will. Ich muss das verdammte Teil zu Kleinholz schlagen.
Es klingelt an der Tür. Es ist Andrew.
˜
Nach ein paar Stunden am Strand gehen wir einkaufen. Ich schiebe den Wagen, und Andrew schlendert mir voraus. Ab und zu nimmt er etwas aus dem Regal und sieht es sich genauer an. Er sammelt Transformer-Figuren aus Cornflakes-Packungen, und er betrachtet die Rückseite einer Schachtel, um zu erraten, welche Figur wohl drin ist.
»Ich brauche noch Optimus Prime«, sagt er. Die Familienpackung sieht in seinen Händen riesig aus.
»Aber was, wenn wieder Ratchet drin ist?«
»Dann tausche ich ihn in der Schule. Ratchet suchen alle.«
Er sieht mich an. Wenn ich die Packung kaufe, steht sie fünf Wochen lang im Küchenschrank herum, bis zu seinem nächsten Besuch. Bis dahin ist der Inhalt längst abgelaufen. »Na gut«, sage ich. Ich mache mir im Geist eine Notiz, eine Plastikbox für Frühstücksflocken zu kaufen.
Andrew grinst und legt die Schachtel in den Wagen. An Cams oder Vickys Stelle hätte ich ein Machtwort gesprochen – ich halte sehr viel davon, dass Eltern ihren Kindern nicht immer nachgeben. Aber ich halte auch sehr viel davon, dass ein Onkel seinen Neffen verwöhnen darf.
Ich kaufe Sachen zum Abendessen und Knabbereien für den Filmabend. In der Videothek sucht Andrew sich ohne Zögern den zweiten Teil von Captain America aus – den haben wir im Kino gesehen, und jetzt will er ihn zum zweiten Mal schauen. Meine Freunde haben schon oft gefragt, warum ich überhaupt in die Videothek mit ihm gehe, wo ich doch problemlos online einen Film downloaden könnte, aber wir sind beide verrückt nach den DVD-Extras. Man kann uns altmodisch nennen, aber ein Download ist nun mal nichts Halbes und nichts Ganzes.
Als wir wieder in meiner Wohnung in Erskineville sind, packe ich die Lebensmittel aus, während Andrew unter die Dusche geht, um sich von den Überresten des Nachmittags am Strand zu befreien: Salz, Sand und Sonnencreme. Ich hänge unsere Handtücher über den Balkon, meine Shorts über die Lehne des einen Gartenstuhls und seinen Schwimmanzug über den anderen. Morgen macht er beim Rettungssportfest mit, da braucht er ihn wieder.
Ich kann das Wasser in der Dusche plätschern hören; ich muss dringend pinkeln. Ein anderer würde einfach ins Bad stürmen, aber das ist eine der Regeln, an die ich mich halte, wenn Andrew hier ist: immer nur einer im Bad.
Andrew kommt seit ein paar Jahren ungefähr einmal im Monat übers Wochenende zu mir, und zwar seit er mich an einem Samstagabend anrief, als ich gerade ausgehen wollte.
»Kann ich für immer bei dir bleiben?«, fragte er mit seiner Piepsstimme; er war damals sieben.
»Na, ich weiß nicht«, sagte ich, »was ist denn los?«
Es stellte sich heraus, dass er sich mit seinem Vater, meinem Bruder Cam, gestritten hatte. Wir sprachen darüber, und ich erklärte ihm, dass er bei mir samstags auch um acht ins Bett gehen müsste.
»Aber warum?« Das zweite Wort klang viermal so lang wie das erste.
»Weil die Erwachsenen so etwas manchmal besser wissen«, antwortete ich. »Und du müsstest auch weiterhin Gemüse essen. Und du müsstest immer noch warten, bis ich mit dem Essen fertig bin, ehe du vom Tisch aufstehen darfst. Und vielleicht fallen mir sogar noch schlimmere Regeln als die deiner Eltern ein.«
»Bestimmt nicht«, sagte er, »bei dir dürfte ich alles.«
»Ich muss jetzt gehen. Gute Nacht.«
»Geh nicht.« Dieses Mal dauerte das zweite Wort fünfmal so lang wie das erste.
»Gute Nacht und schlaf recht schön.«
»David!«
»Und träum was Süßes.«
Ich legte auf.
Ich ging ins Schlafzimmer, zog das Hemd an, das ich gerade gebügelt hatte, schloss die Wohnungstür hinter mir ab und ging mit den Jungs auf Tour. Ich kannte Andrew gut genug und wusste, dass ich ihn nicht mit Samthandschuhen anfassen musste. Trotzdem …
Am nächsten Morgen hatte ich ein schlechtes Gewissen, und so rief ich Cam auf seinem Handy an. »Geht’s dem Kleinen gut?«, fragte ich.
»Ja, er war nur ziemlich frech. Vicky und ich hatten die Nase voll.«
»Wusstest du, dass er mich anrufen wollte?«
»Ich hab so etwas gesagt wie: ›Schön, wenn du bei David leben willst, dann ruf ihn doch an und frag, ob er dich lieber will als wir.‹ Ich glaube, ich war ziemlich grob.«
»Oh je«, sagte ich.
»Ich weiß.« Ich hörte, wie Cam die Luft durch die Zähne einsog. »Du kannst dir vorstellen, was Vicky dazu gesagt hat«, fügte er leiser hinzu. Sie war sicher ganz in der Nähe.
Nachdem ich aufgelegt hatte, lösten diese beiden Telefonate einen Gedankengang bei mir aus: Ich bin sein Onkel und sein Patenonkel – was auch immer das heutzutage noch heißen soll. Es ist unwahrscheinlich, dass ich jemals eigene Kinder haben werde, und ich sehe Andrew immer nur bei Familientreffen. Wie wäre es denn, ab und zu etwas mehr Zeit mit ihm zu verbringen? Ich könnte ihn Cam und Vicky an Samstagabenden abnehmen, damit er sich mal von seinen Eltern erholen und bei seinem Lieblingsonkel (gut, seinem einzigen Onkel) übernachten kann. Das wäre doch gar nicht so übel, oder? Tatsächlich hat es sich richtig bewährt. Wir genießen unsere Zeit zusammen, und ich freue mich auf die Wochenenden mit meinem Neffen.
Endlich höre ich, wie die Brause abgestellt wird, aber meine Blase muss noch ein paar Minuten durchhalten, während Andrew sich abtrocknet. Irgendwann kommt er mit einem Handtuch um die Hüften heraus und verschwindet in seinem Zimmer.
Sobald ich auf dem Klo fertig bin, drehe ich die Brause auf. Gerade habe ich mein nass geschwitztes Trikot ausgezogen, das von Sonnenmilch und Sand richtig klebt, da klopft es an der Tür. Ich mache auf. Andrew hat bereits ein sauberes T-Shirt und eine kurze Hose an.
»Kann ich rüber zu Lewis?«
Lewis’ Familie wohnt eine Etage unter mir im Hinterhaus.
»Okay, aber nicht lange. Es gibt bald Abendessen.«
Er läuft zur Wohnungstür.
»Bis später dann«, ruft er noch über die Schulter.
Ich schließe die Badezimmertür und stelle mich seitlich vor den Spiegel, um meinen Bauch zu prüfen – erst ziehe ich ihn ein, dann lasse ich ihn raus und stelle stolz fest, dass es zwischen den beiden Zuständen keinen großen Unterschied gibt. Ich spanne Brust- und Armmuskeln an und betrachte mich im Spiegel, um mich zu vergewissern, dass ich für einen Fünfunddreißigjährigen gut in Form bin. Jedenfalls besser in Form als viele Fünfundzwanzigjährige.
Nie ist Duschen schöner als nach einem brüllend heißen Tag am Strand. Ich bleibe ewig unter dem heißen Strahl stehen, lasse mir Kopfhaut und Schultern massieren, ehe ich die hölzerne Bürste nehme, Duschgel darauf gebe und mich damit von Kopf bis Fuß einreibe. Besonderes Augenmerk widme ich den Unterschenkeln und Fußknöcheln, denn dort klebt der Sand immer wie Leim fest. Dann benutze ich die Bürste zur Fußreflexzonenmassage. Angeblich soll dadurch das Blut besser fließen und verschiedene Organe sollen stimuliert werden – ich bin zwar kein Arzt, aber ich würde sagen, dass mir das unheimlich guttut.
Als ich fertig bin, ziehe ich mir ein Paar Shorts an und mache mich in der Küche ans Werk. Ich schneide das Hühnchen in Stücke und stelle den Teller in den Kühlschrank. Ich schäle und schneide die Karotten, zerkleinere den Brokkoli, schäle die Zuckererbsen, entkerne und schneide die Paprika. Der Computer fällt mir ein. Ich habe die Geschichte seit dem Morgen im Hinterkopf, ständig schnürt sie mir die Brust zu und wirft ihren Schatten über diesen sonnigen Tag. Vielleicht sollte ich zur Polizei gehen, aber wie würde das aussehen? Wie kam dieser Dreck bloß in meinen Besitz? Über einen Virus vielleicht? Wer weiß. Ich würde diese Sache niemals erklären können.
Ich finde die Vorstellung entsetzlich, das MacBook zu zerstören, aber mir ist klar, dass ich keine andere Wahl habe. Ich habe mal einen Artikel über Computersicherheit geschrieben und weiß, wie schwierig es ist, Dateien wirklich zu löschen. Im Moment kann ich allerdings gar nichts tun. Nicht, solange Andrew hier ist. Ich kann im Augenblick nur die Dokumente retten, von denen ich weiß, dass sie sauber sind. Alles andere muss weg. Und die Kostenfrage erst … Beim Gedanken daran verspüre ich eine schwere Last auf meinen Schultern.
Ich wasche das Gemüse und gebe es in einen Topf mit Wasser. Ich hacke ein wenig Koriander. Ich messe genügend Reis ab und tue ihn ohne Wasser in eine Pfanne. Dann frage ich mich, was ich jetzt machen soll, denn Andrew ist noch nicht zurück, und es ist sinnlos, den Herd einzuschalten, solange er weg ist.
Ich habe mich mittlerweile ein wenig abgekühlt; ich gehe ins Schlafzimmer, reibe den restlichen Schweiß ab und ziehe ein frisches T-Shirt an. Ich schlendere in die Küche zurück. Eine Tasse Tee oder lieber etwas Kaltes? Ich entscheide mich für Tee. Ich mache mir eine Tasse, gehe ins Wohnzimmer und setze mich aufs Sofa. Ich schalte den Fernseher an; Sydney Weekender ist gerade zu Ende. Gut. Gleich fangen Die Simpsons an.
So sehr ich diese Sendung auch mag, wenn Andrew nicht mit dabei ist, ist es einfach nicht dasselbe. Ich sitze da, starre auf den Bildschirm und weiß, dass das alles lustig und ziemlich clever ist, aber statt zu lachen grübele ich nur darüber nach, wie es den Machern gelingt, jahraus, jahrein so viele Folgen zu produzieren – und vor allem, wann Andrew endlich zurückkommt. Bei der zweiten Werbepause bin ich echt sauer. Gleich kommt die Sendung mit den lustigen Pannenvideos, und wenn das so weitergeht, werde ich dann in der Küche stehen. Ich kann kaum glauben, dass ich mir Gedanken darum mache, eine Sendung mit einem künstlichen Moderator, schlechten Off-Stimmen und den immergleichen alten Clips von tollpatschigen Frauen, die bei Hochzeiten hinfallen, zu verpassen. Die Show gehört nun mal zu unserem Ritual. Verdammt noch mal, ich war der Meinung, Andrew sei hier, um mich zu besuchen, nicht Lewis.
Als der Abspann der Simpsons läuft, gehe ich davon aus, dass Andrew binnen der nächsten Minuten zurück sein wird. Ich schalte um und warte darauf, dass unsere Sendung anfängt; dabei sage ich mir, dass es ganz egal ist, ob ich beim Kochen zwanzig Minuten oder so davon verpasse. Die Sendung mit den Pannenvideos fängt an, und ich höre im Hinterkopf die Alarmglocken schrillen, die immer dann losgehen, wenn Andrew am Strand länger als sonst braucht, um vom Eisstand zurückzukommen. Ich gebe nicht weiter darauf Acht, weil ich weiß, was es heißt: dass Andrew jede Minute auftaucht. Das ist immer so, und ich bin mir sicher, dass er gleich klingeln wird, um reingelassen zu werden.
Er klingelt aber nicht. Ich rufe Andrew auf seinem Handy an, aber ich höre nur den Anrufbeantworter. Das überrascht mich nicht – er lädt das Teil ja auch nie auf. Die erste Reihe von Videos ist vorbei, gleicht geht die zweite los, und ich verliere die Geduld. Ich schnappe mir die Schlüssel vom Couchtisch und trotte barfuß nach unten in den Hof. Erst dort fällt mir ein, dass ich gar nicht weiß, in welcher Wohnung Lewis und seine Eltern leben. Andrew und Lewis haben immer im Hof gespielt, wie man es in dem Alter eben so macht; erst in letzter Zeit spielen sie auch drinnen. Ich komme mir vor wie der schlechteste Onkel der Welt, weil ich nicht zu jeder Tageszeit genau weiß, wo Andrew sich aufhält.
Mist. Es gibt sechs Klingeln. Soll ich etwa jede drücken und nach Brett, Lewis’ Papa, fragen? Das könnte ich tun, aber ich finde den Gedanken grässlich. Ich finde es selbst immer nervig, wenn irgendein Fremder klingelt und behauptet, den Schlüssel vergessen zu haben. Gott weiß, wer das sein kann.
Ich überquere den Hof und gehe durch die Tür, die zur Garage führt. Ich sehe mein Auto, aber danach suche ich nicht. Bretts Auto ist nicht da. Das kommt mir komisch vor, aber so sehe ich wenigstens die Nummer seiner Wohnung, die auf den Boden gemalt ist – zehn. Ich überquere wieder den Hof und drücke auf die Klingel.
Niemand reagiert. Ich frage mich, ob ihre Klingel vielleicht kaputt ist; ich hatte in letzter Zeit Probleme mit meiner. Ich versuche es noch mal und warte. Die Alarmglocke in meinem Kopf schrillt nun beharrlicher, aber ich sage mir, dass Andrew bei Brett in Sicherheit ist, sie können mich eben einfach nur nicht hören. Allerdings steht Bretts Commodore nicht in der Garage. Entweder ist Brett nicht da, oder Gina ist damit unterwegs. Ich drücke erneut auf die Klingel. Immer noch keine Antwort. Was, wenn beide nicht daheim sind? Sie würden doch die Kinder nicht allein zurücklassen, oder? Ich werde allmählich wütend und drücke wieder auf die Klingel, diesmal länger.
»Lewis?«, rufe ich. »Lewis. Andrew.«
Keine Antwort. Ich staune darüber, wie laut meine Stimme durch den Innenhof schallt. Ich drücke in kurzen Abständen immer wieder auf die Klingel und hoffe, dass sie im Fall eines Ausfalls wenigstens ab und zu funktioniert.
»Lewis«, rufe ich. »Andrew.«
Schweigen. Ich laufe über den Hof, gehe wieder ins Vorderhaus und springe die Treppe hinauf in der Hoffnung, dass Andrew mittlerweile vor meiner Tür steht. Das tut er nicht, natürlich nicht, er hat ja auch gar keinen Schlüssel. Obwohl mir klar ist, dass er nicht in der Wohnung sein kann, sperre ich auf und suche alle Zimmer ab. Nein, er ist in den paar Minuten meiner Abwesenheit nicht auf mysteriöse Weise zurückgekehrt.
Ich habe mich sicher getäuscht, was Bretts Wohnungsnummer angeht. Ich gehe wieder treppab, nehme zwei Stufen gleichzeitig, gehe in die Garage und stehe wieder neben meinem Wagen. Ich starre den leeren Parkplatz gegenüber an. Habe ich mich geirrt? Ist das etwa nicht Bretts Parkplatz? Auf der einen Seite steht wie immer der gelbe Subaru, auf der anderen der silberfarbene Golf; der Platz, den ich anstarre, ist also ganz bestimmt seiner. Wo können Brett und Gina nur sein? Sie haben Andrew doch sicher nicht mitgenommen, ohne mir Bescheid zu geben. Mein Blut fängt allmählich zu kochen an.
Während ich dastehe und die Nummer auf dem Boden anstarre, höre ich, wie das Automatikgitter an der Einfahrt sich bewegt. Ich gehe ein paar Schritte in Richtung der Fahrrampe; Gott sei Dank, es ist der Commodore. Das Gitter bewegt sich für meinen Geschmack viel zu langsam, aber endlich sehe ich Brett hinterm Steuer und Gina auf dem Beifahrersitz. Den Rücksitz kann ich jedoch noch nicht erkennen.
Brett wartet, bis das Gitter ganz oben ist, ehe er in die Garage fährt. Er hebt die Finger vom Lenkrad, um mich zu grüßen, und ich erwidere mit einem Winken. Ich gehe beiseite, um ihn durchzulassen, Gina lächelt mich an, und Lewis auf dem Rücksitz winkt. Ich fühle endlich wieder Erleichterung – Andrew muss einfach neben ihm sitzen. Brett dreht den Wagen um, um rückwärts auf seinen Parkplatz zu fahren. Lewis steigt aus, seine Mutter steigt aus, die andere Hintertür öffnet sich, und ein Mädchen erscheint. Ein Mädchen, ungefähr dreizehn Jahre alt, mit sehr kurzen Shorts, einem pinkfarbenen Neckholder-Top über ihrer noch flachen Brust und einem Pferdeschwanz. Lewis’ Schwester Caitlin.
»Ich bin auf der Suche nach Andrew«, sage ich, während Brett noch einparkt. »Ich dachte, er wäre bei euch.«
Gina runzelt die Stirn.
»Lewis«, sage ich, »weißt du, wo Andrew ist?«
»Hab ihn nicht gesehen.« Er rückt näher an seine Mutter heran.
»Wo ist er dann?« Panik ergreift mich.
Brett steigt aus dem Wagen und verriegelt ihn automatisch.
»Stimmt was nicht, David?«, fragt Gina. Sie sieht besorgt aus.
Ihre Tochter rückt näher an Brett heran. »Ich kann Andrew einfach nicht finden.«
»Wir haben ihn nicht gesehen, Kumpel«, sagt Brett. »Wir waren den ganzen Nachmittag unterwegs.«
Ich verberge das Gesicht hinter den Händen und wende mich ab, damit sie meine Angst nicht sehen können. Ich will mich einen Schritt entfernen, halte dann aber inne. Ich drehe mich wieder zu ihnen um, lasse die Hände fallen und räuspere mich.
»Wo wart ihr denn?«, frage ich.
Brett muss merken, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Er senkt die Stimme und redet ganz sanft. »Wir waren bei Ginas Mutter, sie hat heute Geburtstag. Und Andrew haben wir nicht gesehen.«
Ich nehme die Worte in mich auf, versuche meine Gedanken zu ordnen. Sie haben ihn also nirgendwohin mitgenommen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Nein, ist es nicht. Das heißt, dass er irgendwo anders sein muss.
»Wann hast du ihn denn zuletzt gesehen?«, fragt Brett leise. Er hat den Kopf gesenkt und sieht zu mir auf, als versuche er, jemanden von einem Sprung in den Abgrund abzuhalten.
»Vor einer Stunde, vielleicht mehr«, platzt es aus mir heraus. »Er wollte zu euch, um mit Lewis zu spielen. Aber ihr wart nicht da.«
»Er kann nicht weit sein«, sagt Brett. »Ich helfe dir beim Suchen.«
Ich verspüre eine fast absurde Dankbarkeit, als würde Bretts Hilfe alles schon irgendwie zum Guten wenden.
»Gina, bring die Kinder rauf. David, du ziehst dir besser noch Schuhe an, dann machen wir uns auf die Suche.«
Brett steht in meinem Schlafzimmer über mir, während ich die Füße in meine Turnschuhe zwänge; für Socken bleibt keine Zeit.
»Mach die Schnürsenkel besser zu«, sagt er.
»Jepp, gute Idee.« Ich nicke und beuge mich vor, um mir die Schuhe zu binden. In einem solchen Moment wäre es mehr als unpraktisch, zu stürzen und mir den Hals zu brechen.
»Es ist doch so«, sage ich, als ich den zweiten Schuh zubinde, »warum ist er nicht einfach zurückgekommen, als er gemerkt hat, dass ihr nicht zu Hause seid?«
»Wie ist er heute Morgen hergekommen?«
»Sein Vater hat ihn gebracht«, antworte ich.
»Funktioniert deine Klingel denn?«
»Vorhin ging sie noch. Sollen wir mal probieren?«
Brett sieht mich zweifelnd an, nickt dann aber. »Dann können wir das auch ausschließen.«
Er geht nach unten, ich warte an der Gegensprechanlage. Er klingelt. Ich höre es laut und deutlich. Als er wieder oben ist, stehe ich mit Handy und Schlüssel bereit und schließe die Tür hinter mir.
»Das war es also nicht«, sagt Brett.
Wir gehen die Treppe hinab.
»Scheiße«, sage ich. »Ich war ja unter der Dusche. Wenn er gleich von euch zurückkam und klingelte, hätte ich ihn nicht gehört. Ich stand gute zehn Minuten unter der Brause. Er hätte aber doch bestimmt gewartet.«
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Andrew irgendwo ziellos in der Gegend herumläuft. Das passt überhaupt nicht zu ihm.
»Wir finden ihn schon«, sagt Brett.
Als wir den Hof überqueren, spähe ich in die Büsche – vielleicht, nur vielleicht hat Andrew sich ja auch versteckt und wartet ab, um mir vor die Füße zu springen und »Überraschung!« zu schreien. Aber nein. Keine Überraschung. Wir stehen am Hauseingang und suchen die Straße ab.
»Sollen wir uns aufteilen?«, frage ich.
»Ich denke schon. Wir sollten besser unsere Nummern tauschen.«
Wir tippen unsere Nummern in unsere Handys ein und gehen dann in entgegensetzte Richtungen. Ich komme an eine Kreuzung und bleibe stehen, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich weitergehen soll.
»Andrew!« Ich rufe seinen Namen. Meine Stimme klingt zögerlich, als hätte ich meine Schlüssel vergessen und wollte die Nachbarn nicht wecken. Jetzt ist allerdings nicht der Moment, um Rücksicht zu nehmen.
»Andrew!« Meine Stimme klingt lauter und dringlicher.
Ich gehe schneller, fange an zu rennen. Ich habe die Uhrzeit nicht mehr im Blick, aber ich weiß, je länger er fort ist, desto weiter kommt er, und desto schwieriger wird es, ihn zu finden. Ich rufe alle paar Sekunden Andrews Namen, dehne manchmal jede Silbe aus, um den Ruf länger zu machen: »Aaaaaandrewwww.«
Am Sportplatz bleibe ich bei dem niedrigen weißen Zaun stehen und schaue mich um.
»Andrew? Andrew!«
Zu meiner Rechten bewegt sich etwas. Ein Mann mittleren Alters taucht hinter dem Clubhaus auf, gefolgt von einem ältlichen Mischlingshund.
»Ist Ihnen der Hund weggelaufen?«, fragt der Mann.
»Nein«, sage ich genervt. »Mein Neffe.« Am liebsten würde ich ihn anschreien; wer zum Teufel nennt seinen Köter denn schon Andrew? »Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Er hat braune Haare und ist ungefähr so groß.« Ich zeige die Größe mit der Hand an.
»Leider nein. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn ich ihn sehe.«
»Danke«, rufe ich im Weiterrennen. Erst als ich weg bin, kommt mir der Gedanke: Wie will er mir denn Bescheid geben? Ich hätte ihm meine Nummer geben müssen. Volltrottel.
Anscheinend ist gerade Zeit zum Gassigehen, denn ich sehe überall Einzelpersonen und Paare mit ihren Haustieren an der Leine. Ich halte alle an und beschreibe ihnen Andrew. Dann gebe ich ihnen meine Nummer für den Fall, dass sie ihn sehen, und laufe weiter. Ein Mann mit Bürstenschnitt fragt, was Andrew anhat; es will mir nicht einfallen. Den ganzen Tag über hatte er seinen Schwimmanzug an, danach hab ich ihn nur ein paar Sekunden lang vor der Badezimmertür gesehen. »Gestreiftes T-Shirt, braune Shorts«, sage ich plötzlich, als ich mich auf einen Schlag erinnere. Die Beschreibung kommt zu schnell und klingt, als hätte ich sie mir gerade ausgedacht.
Ich muss wie ein Irrer wirken – liegt es daran, dass es niemanden zu bekümmern scheint, wenn ein kleiner Junge in der Großstadt verloren geht? Erst als ich eine Frau anspreche, die offensichtlich ausgehen will – rauchiges Make-up und hochhackige Sandaletten –, höre ich etwas, das mir Mut macht.
»Ich hab gerade eben einen Jungen gesehen, ganz in der Nähe meiner Wohnung«, sagt sie.
»Wo? Wo ist das?«
»Um die Ecke.« Sie weist auf die Straße, an der ich gerade vorbeigelaufen bin. »Er ging in die andere Richtung.«
»Tausend Dank.«
Ich renne los. Ich kann es kaum glauben. Endlich! Ich laufe um die Ecke die Straße entlang, aber einen Jungen sehe ich nicht. Ich renne weiter, sehe aber immer noch keinen Menschen. Irgendwann komme ich an eine T-Kreuzung. Ich spähe erst in die eine Richtung, dann in die andere, aber ich sehe kein Kind, überhaupt niemanden. Ich biege rechts ein und gelange ans Ende der Straße. Noch eine T-Kreuzung. In keiner Richtung eine Spur. Diese Straßen sind so eng, so vollgeparkt mit Autos, dass ich ohnehin nicht weit sehen kann. Anstatt noch mehr Zeit zu verschwenden, sprinte ich den Weg zurück, den ich gekommen bin.
Ich biege um die letzte Ecke. Er ist doch sicher nicht nach Newton gegangen, oder?
Da ist die Frau, der ich vor einer Minute begegnet bin; jetzt wartet sie an der Bushaltestelle. Sie starrt mich an, während ich zu Atem komme.
»Kein Glück gehabt?«
»Wie hat er denn ausgesehen? Also der Junge, den Sie gesehen haben.« Ich keuche und kriege kaum ein Wort heraus.
»Ungefähr so groß.« Sie zeigt eine Höhe an, die größer wirkt als Andrew.
»Braune Haare?«
»Ja! Oder auch schwarz.«
»Was hatte er an?« Ich beuge mich vor und atme tief durch.
»Keine Ahnung. Ein schlabberiges T-Shirt, lange Shorts, irgendwie cremefarben?«
»Oh, Mist.«
»Er hatte ein Skateboard, wenn Ihnen das weiterhilft.«
»Oh Gott. Nein, das hilft mir nicht. Das hilft mir ganz und gar nicht.«
Ich werfe mich auf den Sitz neben ihr an der Haltestelle.
»Tut mir leid«, sagt sie.
Ich vergrabe den Kopf in den Händen – mein Gesicht ist schweißnass. Die Hitze des Tages ist immer noch nicht gewichen. In meiner Tasche vibriert es, mein Handy klingelt. Es ist Brett.
»Gibt’s was Neues?«, fragt er.
»Nein, und bei dir?« Aber ich kenne schon die Antwort, wenn er seinen Anruf mit dieser Frage beginnt.
»Nein, Kumpel. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde auf der Suche.«
Wirklich schon so lange?
»Ich würde vorschlagen, dass wir uns zu Hause treffen und dann entscheiden, was als Nächstes passiert.«
Ich habe auch keine andere Idee, also stimme ich zu und stehe auf.
»Ich hoffe, Sie finden ihn.« Die Frau klingt wehmütig, als würde sie sich verantwortlich fühlen.
»Ja, danke.« Ein Teil von mir schiebt ihr tatsächlich die Verantwortung zu.
Als ich wieder zurück im Wohnhaus bin, sitzt Brett auf der Treppe. Er ist nicht so rot im Gesicht wie ich – wahrscheinlich ist er nicht so panisch gerannt wie ich. Ich hechte an ihm vorbei über die Stufen, doch nein, Andrew wartet nicht im Hof. Binnen Sekunden bin ich oben in der Wohnung, doch auch dort keine Spur. Natürlich, fällt es mir wieder ein, er hat ja schließlich keinen Schlüssel. Wir hätten Gina bitten sollen, in meiner Wohnung zu warten für den Fall, dass er zwischenzeitlich nach Hause kommt. Ich gehe wieder nach unten und setze mich zu Brett auf die Treppe.
»Wie weit bist du gekommen?«, frage ich und versuche, dabei nicht anklagend zu klingen. Ich sollte schließlich dankbar sein, dass er mir überhaupt hilft.
Er weist in die Ferne. »Fast bis nach Redfern«, sagt er.
»Wo können wir noch suchen?« Schon als ich die Frage stelle, weiß ich, dass die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Wo kann er nur hin sein? Wir sind nach Osten und Westen gelaufen, aber wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Bleiben noch Norden und Süden und alles dazwischen.
»Ist er womöglich nach Hause zu seinen Eltern?«, fragt Brett.
»Zu weit weg. Sie wohnen in Longueville. Und warum sollte er das tun?«
Ein Ausdruck huscht über Bretts Gesicht, den ich nicht deuten kann und der gleich wieder verschwunden ist.
»War Andrew wegen irgendwas sauer?«, fragt er.
»Ich glaube nicht – auf mich wirkte er ganz normal. Er hätte mir doch sicher gesagt, wenn irgendwas nicht in Ordnung war.« Ich lasse den Blick über die Straße schweifen und denke über Bretts Frage nach. »Zumindest hoffe ich, dass er es mir gesagt hätte.« Ich sehe Brett an. »Was machen wir jetzt? Soll ich die Polizei rufen?«
»Muss man dafür nicht vierundzwanzig Stunden warten?«
»Echt? Bestimmt nicht.« Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht.
»Mann, ich weiß nicht, was ich tun soll«, sage ich.
»Da sind wir schon zwei. Vielleicht taucht er ja gleich auf.«
Bretts Handy klingelt. »Hi, ja, ich bin vorm Haus mit David. Nein, noch keine Spur. Ich rufe dich gleich zurück.«
Mir wird klar, dass Gina mit dem Abendessen auf ihn wartet. Sie muss schließlich zwei Kinder ernähren.
»Geh ruhig nach Hause«, sage ich.
»Kumpel, ich kann dich so nicht allein lassen.«
»Nein, schon gut. Du hast recht, er wird schon wieder auftauchen.« Ich glaube selbst nicht daran. »Und wenn nicht, rufe ich die Polizei.«
Ich stehe auf und schaue die Straße in beide Richtungen entlang. Ich wende mich wieder Brett zu. Er wirkt besorgt. »Ich glaube, du solltest seine Eltern informieren«, sagt er.
»Geh essen«, sage ich.
Brett will protestieren, aber er schließt den Mund wieder und starrt mich an. Schließlich sagt er: »Aber nur, wenn du dir ganz sicher bist. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.«
Die Wohnung fühlt sich viel zu leer an, als ich die Tür hinter mir schließe. Ich gehe auf den Balkon und setze mich auf einen der Plastikstühle. Ich merke kaum, dass die Shorts, die ich vorhin zum Trocknen aufgehängt hatte, mein T-Shirt befeuchten. Ich starre Andrews Schwimmanzug auf dem anderen Stuhl an. Es ist gleich acht Uhr und fast schon dunkel. Das hatte ich bei der Suche eben nicht bedacht, doch jetzt ist ganz klar, dass die Nacht angebrochen ist. Es gibt kaum noch Licht.
Was, wenn er gerade im Moment hierher unterwegs ist? Ich springe auf, renne die Treppe hinunter und vors Haus. Keine Spur von Andrew.
Mein Handy klingelt. Ich reiße es aus der Tasche, aber es ist nur Brett.
»Ich komme noch mal raus, um dir zu helfen«, sagt er.
Gott sei Dank. Ich werde allein damit nicht fertig. »Ich bin vorm Haus«, sage ich.
Brett legt auf und erscheint kurz darauf auf der Treppe.
»Ich kann nicht einfach so dasitzen, während du hier nach Andrew suchst«, sagt er.
»Sieh dir das nur an«, sage ich, hebe die Hände und meine damit die Dunkelheit um uns herum. »Was soll ich nur machen?«
»Hast du schon seine Eltern angerufen?«
»Ich habe noch gar niemanden angerufen.« Ich setze mich auf die Treppe, Brett setzt sich neben mich.
»Wir sollten sie anrufen«, sagt er. »Vielleicht ist Andrew ja dort.«
Ich schüttele den Kopf. »Ist er nicht. Ich kann sie nicht anrufen. Noch nicht.« Ich habe Panik davor, was sie sagen, wie sie reagieren. Und wenn Andrew bald zurückkommt, habe ich sie für nichts und wieder nichts in Angst versetzt.
»Wenn es hier um Lewis ginge, würde ich es wissen wollen«, sagt Brett.
Das hilft mir nicht weiter, verwirrt mich nur noch mehr. Ich will bloß eines wissen: wie wir Andrew finden können. Wenn wir Cam und Vicky anrufen müssen, heißt das, dass alles ganz real ist – dass er wirklich verschwunden ist. Wo ist er? Die ganze Zeit schon blitzen grausige Bilder vor meinen Augen auf, selbst eben beim Rennen. Andrew irgendwo in einem Nachbarhaus, gefesselt und geknebelt. Andrew im Kofferraum eines Autos, wie er schreit und um sich tritt und doch von keinem Menschen gehört wird, während der Wagen über die Fernstraße davonrast. Andrew, wie er irgendwo im Gebüsch am Straßenrand liegt. Und viel, viel schlimmere Bilder, die sich wie ein Film aller in mir verborgenen Ängste vor meinen Augen abspielen.
Ich muss ihn zurückholen. Jetzt sofort.
»David, er ist nicht dein Sohn«, sagt Brett. »Ruf Andrews Eltern an.«
»Erst sollte ich die Polizei verständigen.«
Jetzt sieht Brett mich verwirrt an. Er legt das Gesicht in die Hände und starrt die Steinstufen an. Dann sieht er auf.
»Okay, gut.« Er klingt zuversichtlich, aber ich schätze, dass er ebenso überfragt ist wie ich. »Lass uns reingehen. Drinnen können wir besser überlegen.«
Ich stehe auf und folge ihm wie benommen nach oben. Er nimmt meinen Schlüssel und sperrt meine Wohnung auf. Er sieht mein Festnetztelefon, nimmt ab und horcht.
»Hast du einen Anrufbeantworter?«
»Ja, klar. Irgendwas drauf?« Mir war gar nicht in den Sinn gekommen, das zu prüfen.
Er schüttelt den Kopf und legt auf.
Brett geht zum Esstisch und nimmt sich einen Stuhl. Er spricht langsam, als wolle er beim Reden seine Gedanken ordnen. Ich nehme mir unwirsch den anderen Stuhl und setze mich ungeduldig hin. Mir dauert das alles viel zu lange.
Das geht jetzt schon zwei Stunden so, verflucht noch mal.
»Wir müssen an die Uhrzeit denken, und an die Tatsache, dass Andrew – wie alt ist?«, fragt Brett. »Zwölf?«
»Er ist elf.«
Er nickt und zieht die Mundwinkel nach unten, als wäre die ganze Sache schlimmer als gedacht.
»Rufen wir seine Eltern an. Wie heißen sie?«
»Cam und Vicky.«
»Ich würde sagen, wir rufen Cam und Vicky an und fragen, ob er daheim ist. Falls ja, dann ist alles in Ordnung.«
»Und falls nicht?«
»Dann sollen die beiden entscheiden, was zu tun ist.«
Sie würden mir eh nur sagen, dass ich die Polizei anrufen soll.
Also warum machen wir das nicht gleich? Ich stehe auf, nehme mein Handy aus der Tasche, stecke es aber gleich wieder weg, als mir einfällt, dass Andrew mich ja anrufen könnte. Stattdessen gehe ich zum Festnetzanschluss.
»Rufst du sie jetzt an?«
»Nein, die Polizei.«
Brett steht auf und kommt auf mich zu.
»Ruf zuerst Cam und Vicky an.«
Mein Herz hämmert gegen den Brustkorb. Ich kann sie nicht anrufen, nicht solange wir nicht jede Möglichkeit ausgeschöpft haben. Sie würden mir Andrew nie wieder anvertrauen.
»Und was, wenn die Polizei ihn schon gefunden hat?«
»Dann hätten sie dich angerufen«, sagt Brett. »David, du musst seine Eltern informieren.«
Wer ist dieser Mann, und weshalb sagt er mir, was ich zu tun habe? Weshalb lässt er mich nicht die Polizei rufen? Wir stehen da und beäugen uns. Ich halte den Hörer in der Hand. Die Sekunden verstreichen.
»Schon gut«, sage ich, »ich komme schon klar.«
»David, bitte, Kumpel.«
»Bitte geh einfach. Ich rufe jetzt die Polizei.«
Brett starrt mich an, wendet sich dann zur Tür.
»Gib mir Bescheid, wenn du mich brauchst«, sagte er. Er geht zur Tür, dreht sich noch einmal um: »Und lass mich wissen, wenn sich was tut.«
Brett lässt die Tür hinter sich ins Schloss gleiten. Ich lausche dem Telefon – es gibt das Besetztzeichen von sich, weil ich den Hörer zu lange in der Hand gehalten habe. Ich drücke auf die Gabel, um das Freizeichen zu bekommen. Ich will gerade die Nummer der Polizei wählen, als ich innehalte. Ich wähle stattdessen eine andere Nummer. Es klingelt ein paarmal, dann geht Dad ran.
»Hast du schon Cam und Vicky angerufen?«, fragt er, nachdem ich mich ausgekotzt habe.
»Nein, das kann ich nicht. Außerdem ist er dort eh nicht. Ich wollte gerade die Polizei anrufen.«
Schweigen am anderen Ende der Leitung.
»Dad?«
»Ich überlege gerade«, sagt er. Schweigen. Und dann: »Du musst Cam und Vicky anrufen.«
»Das geht nicht, Dad. Ich kann ihnen doch nicht sagen, dass ich ihr Kind verloren habe.«
»Verdammt noch mal, David. Gut, ich übernehme das. Ich rufe Cam und Vicky an. Aber die Polizei rufst du bitte selbst an. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden.«
»Danke, Dad, ich danke dir.«
Ich habe keinen Grund, erleichtert zu sein. Ich sehe auf die Uhr. Wie weit kommt ein Kind in zwei Stunden? Wie weit weg kann man ein Kind in zwei Stunden bringen?
Ich drücke auf die Gabel und höre wieder den Freiton. Ich atme tief durch und wähle dreimal die Null. Eine Telefonistin antwortet.
»Notfall: Polizei, Feuerwehr oder Krankenwagen?«
»Polizei«, antworte ich, ehe ich die Worte spreche, von denen ich nie geglaubt hätte, sie mal aus meinem Mund zu hören. »Ich muss ein vermisstes Kind melden.«
KAPITEL 2
SONNTAG
Detective Sergeant Greenwood steht mitten in meinem Wohnzimmer und sieht sich um. Er hat mich bereits gefragt, wie lange ich hier wohne, und ich warte darauf, dass er jetzt »Wirklich schöne Wohnung haben Sie« sagt.
»Mein Bruder hat auch so eine Wohnung«, sagt er stattdessen. »Er mag das. Muss man nicht viel zur Instandhaltung machen.«
Er sieht mich an, und ich frage mich, welche Schlüsse er aus meiner Umgebung, meinem Lebensumfeld zieht. Ich traue ihm zu, in mein Arbeitszimmer zu gehen, in dem Andrew immer übernachtet, und dort meine Unterlagen zu durchwühlen. Oder meinen Computer anzuschalten, um zu sehen, was ich auf dem Desktop habe. Mein Herz schlägt schneller.
Vicky und Cam waren schon hier, ebenso wie Mum und Dad. Sie sind wieder alle in Longueville und hoffen auf Neuigkeiten. Irgendwelche Neuigkeiten. Hier konnten sie nichts mehr tun, nachdem wir die ganze Nacht darauf gewartet hatten, dass das Telefon klingelt. Vorher hatten sie mich und die Polizei angeschrien, keine vernünftigen Antworten auf ihre Bitten und Forderungen bekommen und bei der Suche auf den Straßen meines Viertels nichts gefunden. Wir sind alle hundemüde und ausgelaugt und gleichzeitig aufgeputscht von Adrenalin und Angst.
Ich setze mich auf meinen Sessel, und Greenwood nimmt auf dem Sofa Platz, wobei er seine Anzugshosen an den Knien hochrafft. Ich glaube nicht, dass schon einmal jemand in einem Anzug auf diesem Sofa gesessen hat. Ich bin überrascht, dass ein Sergeant sich für einen Vermisstenfall interessiert – positiv überrascht. Das heißt, dass die Polizei sich wirklich um die Sache kümmert.
Sein Partner, Detective Constable Fahd, bleibt neben der Tür stehen. Ich merke, dass er mich ansieht, aber es erscheint mir irgendwie unpassend, ihm auch einen Sitzplatz anzubieten.
Greenwood greift in seine Jacketttasche und nimmt ein Notizbuch und einen Stift heraus.
»Als Single würde ich mir wohl auch so eine Wohnung nehmen«, sagt er. Smalltalk? Bei einem derartigen Anlass? Ich gebe keine Antwort darauf, und er fährt fort.
»Ich würde gern noch mal ein paar Dinge mit Ihnen durchsprechen, David.«
»Haben Sie denn immer noch nichts gehört?«, frage ich, und zwar schon zum zweiten Mal. Natürlich hat er nichts gehört. Ansonsten säße er wohl kaum hier und würde meine Lebensumstände kommentieren. Aber ich muss herausfinden, ob sie irgendeine Spur haben.
Er lächelt dieses tröstlich gemeinte Lächeln, das man immer dann sieht, wenn andere Menschen Mitleid haben, aber nicht wissen, was sie sagen sollen. »Wir tun unser Bestes.« Er fährt fast ohne Pause fort: »Also, meine Kollegen haben viele dieser Punkte schon gestern Abend mit Ihnen besprochen«, sagt er, wie um einer Beschwerde vorzugreifen, »aber manchmal tauchen Erinnerungen wieder auf, kommen wieder an die Oberfläche, zum Beispiel wenn man ein paar Stunden gut geschlafen hat.«
Greenwood richtet seinen Blick vom Teppich auf meine Augen. Ich habe alles andere als gut geschlafen. Sieht er das denn nicht? Und das soll ein Ermittler sein?
Ich nicke. Weiter.
»Können Sie noch mal schildern, was geschehen ist, nachdem Sie vom Strand heimgekommen sind?«, fragt er.
Ich seufze und sammle meine Gedanken. Ich rufe mir die Ereignisse des gestrigen Abends ins Gedächtnis und gebe mir Mühe, nichts auszulassen. Greenwood macht sich dabei Notizen und unterbricht mich ab und zu, um nachzuhaken – wann genau kamen Brett und Gina nach Hause, in welchen Straßen rannte ich auf der Suche nach Andrew herum, wie sah die Frau aus, mit der ich an der Bushaltestelle sprach. Fahd schaut von der Seite zu und sagt nichts.
»Also, Andrew traf Lewis gestern Abend nicht an, und sein Handy ist nicht hier«, sagt Greenwood, als ich fertig bin. Er spricht das ›s‹ undeutlich aus; ich frage mich, ob das an seinem weißen Schnurrbart liegt, der wie ein Vorhang über seiner Oberlippe hängt. »Hat Andrew je erwähnt, dass er hier in der Gegend noch andere Leute kennt?«
Ich lege die Stirn in Falten. Ich will ja schließlich helfen, selbstverständlich. Es ist nur schwer, sich an alles zu erinnern. Ich klopfe mit dem Finger auf den braunen Wildlederersatz der Armlehne, seufze und schüttele den Kopf.
»Könnte Andrew Freunden von Lewis begegnet sein? Oder jemandem, den er von Facebook kennt?«
»Er ist nicht auf Facebook.«
Greenwood macht sich eine Notiz, ehe er zu mir aufsieht. »Wirklich nicht? Ein Junge seines Alters?«
»Nein. Kein Facebook, kein Snapchat, kein WhatsApp, nichts dergleichen. Vicky untersagt es ihm.«
»Wären nur alle Eltern so klug«, sagt Greenwood.
Ich zucke die Achseln. »Kann man so sehen, muss man aber nicht. Sie ist der Meinung, er sollte lieber richtige Freundschaften schließen.«
»Hat er denn nicht viele Freunde?«
»Doch, hat er«, antworte ich, »aber eben keine in den sozialen Netzwerken. Er fühlt sich in dieser Hinsicht außen vor.«
Greenwood widmet sich wieder seinem Notizbuch. Ich warte ab, bis er damit fertig ist und mich wieder ansieht.
»Und Sie sagen, dies war das erste Mal, dass er länger wegblieb, als er sollte. Bis über die Abendbrotzeit hinaus. Und es kann nicht doch eine Person geben, mit der er sich getroffen hat?«
Ich schüttele wieder den Kopf und mache dabei ein nervöses Geräusch mit den Zähnen. Ich wünschte, mir würde irgendein Einfall kommen, wie ein Sechser im Lotto. Ich wünschte, ich könnte rufen: »Warten Sie! Da gibt es jemanden.«
»Tut mir leid«, sage ich.
Greenwood setzt sich anders hin, und sein Gesicht fällt in den Schatten, zeichnet sich vor der Balkontür als Silhouette ab. Die Sonne tritt hinter einer Wolke hervor, und dahinter wirkt der Himmel fast so blau wie auf Andrews Gemälde.
»Hat Andrew je Personen erwähnt, mit denen er hier mal zufällig ins Gespräch kam? Freundliche Leute? Angestellte in Geschäften? Oder Menschen, vor denen er sich fürchtete?«
Ich greife auf dem Tisch nach meinem eigenen Notizblock und Stift.
»Entschuldigung, ich will das mitschreiben.«
Ich schreibe Freundliche Leute, Angestellte in Geschäften, Menschen, vor denen er sich fürchtete, andere Freunde als Lewis. Darüber stehen schon ein paar andere Kritzeleien, meine eigenen Gedanken – Weggelaufen? In einem Auto entführt? Wessen Auto? Hier irgendwo in einem Haus?
Ich starre den Block an und schüttele den Kopf, ehe ich aufsehe. »Mir will nichts einfallen.«
Greenwood nickt erneut. Er wartet ein Weilchen ab, ehe er weiterspricht. »Sie haben gesagt, Andrew sei recht schüchtern, oder?«
»Ja, das ist er. Manchmal zumindest. Nicht bei mir oder bei seinen Eltern, oder bei Lewis und seinen Schulkameraden. Aber Ihnen gegenüber wäre er schüchtern. Nicht wegen Ihnen persönlich, meine ich, aber bei der ersten Begegnung mit Ihnen wäre er schüchtern. Er würde vermutlich lieber hier bei mir sitzen und erst mal nicht viel sagen. Ich würde wahrscheinlich für ihn reden müssen.«
Ich halte inne, weil mir die Luft wegbleibt. Ich weiß, worauf Greenwood hinauswill. Wenn Andrew so schüchtern ist, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass er einfach so mit einem völlig Fremden mitgeht, oder? Jedenfalls nicht freiwillig. Ich habe diese Situation im Geist schon viele hundert Male durchgespielt, scheint mir. Er würde mit niemandem mitgehen, außer man wendet Gewalt an, packt ihn von hinten, legt ihm eine große Hand über den kleinen Mund, steckt ihn mit eisernem Griff in ein Auto, wo er sich windet und um sich tritt …
Ich lege mein Gesicht in die Hände. Ich will Dunkelheit sehen, die Dunkelheit in meinen Händen, und nicht die Bilder in meinem Kopf, alles, nur nicht diese Bilder. Ich atme schwer, und meine Brust hebt und senkt sich, während ich um Fassung ringe.
Ich muss Greenwood zugutehalten, dass er mir eine Minute Pause lässt. Doch schon springt sein Kollege in die Bresche.
»Haben Sie sich in die Hand geschnitten, David?«, fragt Fahd. Es ist das erste Mal, dass er etwas sagt.
Ich nehme die Hände vom Gesicht und zeige das Pflaster auf meiner linken Handfläche.
»Das war vorgestern Abend, als ich Zwiebeln schnitt«, sage ich. »Das ist nichts.«
»Schmerzhaft«, erwidert er.
»In dem Moment schon.«
Er und Greenwood starren mich einen Augenblick lang an.
Dann schließt Greenwood sein Notizbuch und steckt es wieder in die Tasche.
»Die gefährlichen Sachen überlasse ich meiner Frau«, sagt er.
»Bitte?«
»Das Kochen«, sagt Greenwood und nickt in Richtung meiner Hand.
»Nun, ich habe keine Frau.«
»Ich auch nicht«, sagt Fahd. »Ich lasse mir meistens was vom Pizzaservice bringen.«
Er dreht sich um und nimmt meine Bücherregale in Augenschein. Der Mann scheint von einem großen Selbstvertrauen getragen zu sein. Vielleicht liegt das an seinem Aussehen; er hätte keine Probleme, eine Frau zu finden, wenn er nur wollte.
Ich bin verwirrt. Ich habe kein Auge zugetan, mein Neffe wird vermisst, und hier habe ich Inspektor Clouseau und seinen hübschen Begleiter, die über meine Essgewohnheiten sprechen wollen. Ja, ich will helfen, aber was soll das bringen? Ich muss hier weg. In einer Stunde soll ich bei Cam und Vicky sein.
»Ich will ja nicht unhöflich sein, aber sind wir fertig?«, frage ich.
Fahd wendet sich vom Regal ab, Greenwood erhebt sich vom Sofa.
»Wir sind fertig«, sagt er.
˜
Dad hat mich gebeten, ein paar Sachen für Cam und Vicky zu kaufen – Brot, Milch, was mir sonst noch so einfällt. Es kommt mir wie ein Sakrileg vor, in den Supermarkt zu gehen, während gerade die Welt untergeht. Es ist, als würde ich zu Andrew sagen: »Ich mache einfach weiter, als hätte es dich nie gegeben.«
Der Parkplatz ist halb leer. Die Tür öffnet sich vor mir, und schmerzhaft fällt mir ein, dass ich ja erst gestern mit Andrew hier war, auf dem Rückweg vom Strand. Ich wappne mich für die Flut der Gefühle, die gleich über mich einbrechen wird. Es geht schon los, als ich ein paar Avocados nehme. Da steht ein kleiner Junge, jünger als Andrew.
»Kein Brokkoli, Mama. Blumenkohl.«
»Ich kaufe beides.«
»Kein Brokkoli.«
Seine Mutter achtet nicht weiter auf ihn, nimmt sich einen besonders großen Brokkoli und wickelt ihn in eine Plastiktüte. Ich versuche, sie nicht anzustarren, während ich die Avocados drücke.
Sie wirkt abwesend; eine Haarsträhne hängt ihr ins Gesicht. Der Junge lehnt sich gegen die Gemüsetheke, mit der Hand zupft er sie am Rock. Die Frau legt den Brokkoli in den Wagen. Obst und Gemüse hat sie genug, sie fährt weiter. Der Junge bleibt zurück, lehnt sich noch einen Moment gegen die Theke, starrt ins Leere, dann rafft er sich auf und läuft ihr nach. Sie ist schon weg, und er sieht sich um, fragt sich, wo sie wohl hin ist. Er späht ans Ende eines Gangs und läuft los, um sie einzuholen.
Am liebsten würde ich ihr hinterherbrüllen: »Du dumme Kuh, lass dein Kind nicht aus den Augen!« Ich kann ihr aber keinen Vorwurf machen, ich habe mich früher selber so verhalten, bin zu schnell weiter, ehe ich gemerkt habe, dass Andrew nicht bei mir ist – dann bin ich wieder zurückgegangen, wenn er nicht hinterhergekommen ist. Manchmal stand er vor den Cornflakes-Packungen und versuchte, ihren Inhalt zu erraten. Einmal, als er noch viel jünger war, fand ich ihn neben einem Mann vor den Suppendosen. Als Andrew mich sah, wirkte er überrascht – er drehte sich mit dem Finger im Mund wieder um und sah, dass er neben einem Typen stand, dessen einzige Ähnlichkeit mit mir die Farbe seines T-Shirts war. Dann rannte er verschreckt auf mich zu.
»Ich dachte, das bist du«, sagte er mit großen Augen und griff nach meiner Hand.
»Dummerchen«, sagte ich und brachte ihn weg. Manchmal benahm ich mich wie ein Vater aus einer Comedy-Serie.
Ich kaufe für Cam und Vicky das gleiche Obst und Gemüse ein, wie ich es mir selbst kaufen würde. Normalerweise bin ich mit den Einkäufen schnell fertig – rein in den Wagen, ab zur Kasse. Aber heute warte ich lieber ein bisschen ab, bis die unaufmerksame Mutter und ihr Junge ein bisschen weiter sind, damit ihr Anblick mich nicht weiter quält.
Ich starre die Auswahl an Nüssen an. Mir ist klar, dass Cam und Vicky gerade nichts gleichgültiger ist als Walnüsse oder Cashews, geröstet oder nicht, aber ich versuche zu schätzen, wie weit Mutter und Sohn mittlerweile gekommen sind. Schwer zu sagen. Es kommt mir nicht so vor, als würde sie gerade den großen Wocheneinkauf erledigen, aber sie scheint auch nicht nur schnell was fürs Abendessen zu besorgen.
Ich entschließe mich, weiter einzukaufen und so schnell wie möglich von hier zu verschwinden. Ich biege um die Ecke; die Luft ist rein. Die Fleischtheke befindet sich hinten im Laden, jenseits von Milch und Joghurt. Ganz am Ende der Fruchtsaft. Was noch, was noch? Ich kann mich nicht ewig hier herumdrücken, also gehe ich weiter und fülle den Einkaufswagen mit allem, woran es Cam und Vicky fehlen könnte. Ich bin fast schon wieder in der Gemüseabteilung; keine Spur von der Mutter und ihrem eigenwilligen Sohn. Ich bin fertig.
Keine Schlange an der Kasse, nur eine Frau vor mir, die offensichtlich gerade ihren großen Wocheneinkauf erledigt hat. Ich stelle mich hinter ihr an und lege meine Artikel aufs Band. Das Band bewegt sich ein paar Zentimeter und bleibt stehen, als der Kassierer eine große Packung Windeln hochhebt. Dadurch fällt etwas zu Boden, was auf einer Packung Nudeln gelegen hat. Ich bücke mich, um es für die Frau aufzuheben. Ein Päckchen Tee. Scheiße. Was, wenn die beiden keinen Tee im Haus haben? Das wäre im Moment sicher auch kein Weltuntergang. Oder etwa doch? Ich weiß es nicht …
»Bin sofort wieder da«, sage ich dem Kassierer.
Als ich in den richtigen Gang komme, stehen die beiden da. Sie sucht sich gerade Kaffee aus, hält in jeder Hand ein Päckchen und liest das Etikett des einen. Der Junge schiebt den Einkaufswagen ans Ende des Gangs. Der Wagen schwankt langsam nach links, und der Junge versucht gegenzusteuern, damit er nicht in die Softdrinks fährt.
Ich kann nicht mehr an mich halten. »Sie werden ihn gleich verlieren«, sage ich.
Die Frau schaut mich an. Ich nicke ans Ende des Gangs, wo der Junge gerade versucht, den Wagen nach rechts zu lenken. Sie folgt meinem Blick und schnalzt mit der Zunge.
»Josh. Joshie.« Er achtet nicht auf sie. »Joshua.« Er dreht sich um, zieht die Augenbrauen nach oben. »Bleib da stehen!«, ruft seine Mutter.
Sie widmet sich wieder den Kaffeepäckchen. Ihr Sohn schiebt den Wagen weiter, gleich ist er um die Ecke und außer Sichtweite. Ich starre sie an – will sie ihn denn nicht aufhalten? Sie erwidert meinen Blick.
»Danke«, sagt sie und lächelt mit dem Mund, aber nicht mit den Augen.
Ich kann nichts weiter tun, wenn ich keine Szene machen will. Geh einfach weiter, David.
Ich bezahle meine Einkäufe, lade sie so schnell es geht in den Wagen und steige ein. Ich lehne mich zurück, schließe die Augen und atme tief durch. Ich spüre, wie mein Herz hämmert und meine Hände das Lenkrad vollschwitzen. Und das alles bloß wegen eines Einkaufs in einem verfluchten Supermarkt.
˜
Ich finde einen Parkplatz in der breiten, von Bäumen gesäumten Straße und bleibe eine Minute in meiner Roten Rakete sitzen. Es ist stickig heiß im Wagen – Andrew beschwert sich ständig darüber. Gestern, als wir vom Strand aus den Hügel hinauffuhren, kam es uns vor wie ein türkisches Dampfbad auf Rädern.





























