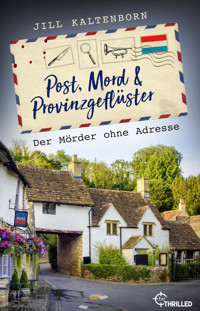Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Chirurgin Nina Wedemeyer ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Dorf im beschaulichen Lopautal bereitet sich auf das traditionelle Heideblütenfest vor, als ein Fund die Gemeinde erschüttert: 20 Jahre nach dem mysteriösen Tod der schönen Frederika taucht ihr verschollenes Tagebuch auf. Der Lehrer Johanning gerät unter Mordverdacht. Nur die junge Ärztin Nina ist von der Unschuld ihres Mentors überzeugt und beginnt zu ermitteln. Sie findet sich in einem Geflecht aus Lügen wieder, das ein ganzes Dorf um jene schicksalhafte Nacht gesponnen hat, und zweifelt bald an ihren eigenen Erinnerungen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jill Kaltenborn
Königinnen-Sonntag
Heide-Krimi
Zum Buch
In der Heide begraben Nach dem Tod eines Patienten flüchtet die junge Chirurgin Nina in ihren Heimatort in der Heide, in den sie nie zurückkehren wollte. Überraschend wird sie dort in Mordermittlungen hineingezogen, die einen 20 Jahre alten Cold Case betreffen. Damals kamen die Dorfschönheit Frederika und die Frau von Lehrer Johanning in derselben Nacht unter rätselhaften Umständen ums Leben. Als man bei den Vorbereitungen zum Heideblütenfest Frederikas verschollenes Tagebuch findet, wird Johanning als Mordverdächtiger verhaftet. Nina, damals eine wichtige Zeugin, ist die Einzige, die zu ihrem ehemaligen Mentor hält. Überzeugt, seine Unschuld beweisen zu können, stürzt sie sich in eigene Ermittlungen in dem verhassten Festtrubel und entdeckt mehr und mehr dunkle Geheimnisse der idealisierten Frederika. Bald wird Nina klar: Um den Fall zu lösen, muss sie sich eingestehen, dass vielleicht nichts so gewesen ist, wie sie dachte, und keiner so unschuldig ist, wie es scheint – sie selbst eingeschlossen.
Jill Kaltenborn wuchs in einem kleinen Ort in der Lüneburger Heide auf, der früh ihre Fantasie und die Liebe zu Geheimnissen beflügelte. Sie studierte Medizin in Hannover und Kapstadt, arbeitete anschließend als Ärztin und Medical Writer. Heute lebt sie mit ihrer Familie, Hund und Hühnern auf einem alten Gulfhof in Ostfriesland. »Königinnensonntag« ist ihr Debütroman.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © creatino / stock.adobe.com
ISBN 978-3-7349-3106-2
Widmung
Für Emmi
Prolog
In der Dunkelheit schlugen die Äste der Bäume am Seeufer wie wütende Peitschen nach mir. Als wollten sie mich bestrafen. Trotzdem rannte ich weiter.
»Hey!«
Mein Herz hämmerte so laut, dass ich das Rufen zunächst nicht wahrnahm.
»Dich meine ich!«
Erschrocken hielt ich inne. Dann erkannte ich ihre Stimme, die durch die laue Sommernacht an meine Ohren getragen wurde, und drehte mich um.
Mondän. Ich hatte ja keine Ahnung gehabt, was dieses Wort bedeutete. Bis ich sie dort im Mondlicht am Ufer des Stausees sitzen sah, in diesem weißen Kleid mit nassem Saum, als wäre sie durch das Wasser gewatet. Qualm stieg von ihrer Zigarette empor, die Haut schneeweiß, die blonden Haare in sanften Wellen auf der Schulter.
Meine Gedanken waren so wirr, dass ich mir gar nicht die Frage stellte, wieso sie um diese Uhrzeit allein dort saß.
Das kam erst später.
»Meyer, richtig? So nennen dich doch alle. Guck nicht wie ein angefahrenes Reh. Komm schon, setz dich zu mir. Ich kann weiß Gott eine Ablenkung vertragen und du auch, wie du aussiehst.«
Ich wischte mir über die geschwollenen Augen. Sie sollte mich nicht weinen sehen. Niemand sollte mich so sehen.
Sie deutete auf den Platz neben sich im Gras und zündete eine weitere Zigarette an, die sie mir entgegenhielt. Meine zitternden Beine bewegten sich auf das Glimmen zu.
Dankbar nahm ich die Zigarette entgegen. Dabei rauchte ich eigentlich gar nicht. Doch bei dem Gedanken, dass ihre Lippen das Ende berührt hatten, das ich nun an meine führen würde, fühlte ich mich geadelt. Vorsichtig zog ich daran und setzte mich zu ihr.
Einen Moment schwiegen wir. Wie zwei vertraute Fremde.
Die Luft war seltsam warm und legte sich wie ein beschützender, schwerer Mantel um mich. Ich sah mich in der Dunkelheit um. Vor uns der nachtschwarze Stausee, unzählige sanfte Lichter am Himmel. Und ein gruseliges Schattenspiel zwischen den Bäumen am gegenüberliegenden Ufer. Undeutliche Stimmen, die aufgeregten Rufe der anderen in der Ferne.
Sie schien keine Notiz davon zu nehmen. Ein länglicher Gegenstand blitzte im Gras neben ihr auf, als sie an ihrer Zigarette zog. Eine Flasche?
Unbekümmert richtete sie ihren Blick auf den klaren Nachthimmel und brach das Schweigen. »Ich glaube, die Sterne sind bloß dazu da, um uns an unsere Bedeutungslosigkeit zu erinnern. Daher funkeln sie so neckisch. Manchmal fühlt man sich von dieser Schönheit fast verarscht, oder?«
Ich sah ebenfalls in die bezaubernde Unendlichkeit über uns. Verarscht, ja. Verletzt, gedemütigt und hintergangen.
Ich nickte und versuchte, die Worte von mir abzuschütteln, indem ich trotzig an meiner Zigarette zog. Es wollte nicht recht gelingen.
Ich konnte kaum glauben, dass sie tatsächlich mit mir redete. Die große Frederika mit mir, dem kleinen Mädchen, dessen Vornamen sie vermutlich gar nicht kannte.
»Weißt du, das Wichtige im Leben ist doch eigentlich, sich von niemandem kleinkriegen zu lassen, oder? Geht es nicht bei allem nur darum?«
Ich nickte wieder eifrig, auch wenn ich nicht recht verstand, was sie meinte. Vielleicht verstand ich aber doch ein bisschen.
In der Ferne rief ein Uhu, ein Ast knackte im nahen Gebüsch, aber seltsamerweise fuhr ich nicht zusammen, sondern straffte meine Schultern.
Sie lallte, als sie weitersprach. »Es gibt einfach zu viele Idioten, die über uns bestimmen wollen. Glauben, dass sie alles mit uns machen können …« Sie stieß einen abfälligen Laut aus. »Aber das können sie nicht. Dürfen sie nicht. Okay? Niemand darf das. Und schon gar kein vermeintlicher Freund.«
Diese Worte trafen mich wie ein Schlag. Als meinte sie … Aber das konnte nicht sein. Nur ein Zufall. Sie konnte es nicht wissen. Und ich überlegte, nur für einen kurzen Moment, ob ich es ihr anvertrauen sollte. Nein! Das würde ich nicht. Niemals würde ich es jemandem sagen, das versprach ich mir in diesem Moment. Die Schürfwunden auf meinem Rücken pochten. Beschämt senkte ich den Blick.
Sie schnipste ihren Zigarettenstummel gekonnt in das endlose Schwarz, während ich den meinen unbeholfen auf dem Boden ausdrückte.
Dann sprach sie weiter, schneller nun, unklar, ob zu mir oder zu sich selbst. In dem Moment hätte sie mir alles erzählen können und ich hätte es für die ganze Wahrheit gehalten. »Falsche Versprechungen, falsche Beschützer, falsche Hoffnung … Ach, was ist das doch für ein herrliches Drecksloch hier!« Ein Lachen entfloh ihren Lippen und erzeugte ein unheimliches Echo über dem Wasser.
Ich dachte an die Flasche neben ihr und wollte danach greifen. »Da hilft nur Alkohol«, sagte ich, in der Hoffnung, erwachsen zu klingen.
Aber sie hielt meinen Arm zurück. »Alkohol ist ein Teufelszeug.« Dann ließ sie mich los und legte sich mit dem Rücken ins Gras. Meine Haut kribbelte da, wo sie mich berührt hatte.
»Obwohl der Scheiß auch hilft, die Welt klarer zu sehen. Vielleicht auch nur, die Gedanken endlich klar auszusprechen.« Sie richtete sich auf und schien direkt in meine Seele zu blicken. »Also, pass auf, Meyer, denn das ist wichtig: Du kannst alles sein, was du willst, hörst du?« Umständlich kramte sie in ihrer Rocktasche und zog einen mit Margeriten verzierten Füller hervor. Hielt ihn mir hin.
Ich verstand ihre Anspielung und musste grinsen. »Du kannst ihn gerne behalten«, entgegnete ich und fühlte dabei etwas wie Stolz.
Sie nickte, steckte ihn zurück in ihre Tasche. Dann fuhr sie fort. »Lass dich von niemandem kleinhalten. Du hast nur ein Leben. Und du bestimmst, wie das aussieht, niemand sonst, okay? Egal was passiert. Wenn dir Scheiße passiert, musst du darüberstehen und etwas Besseres draus machen. Sei unantastbar. Das ist nicht bloß ein Ratschlag. Das ist die einzige Möglichkeit, allem hier zu entkommen, diesem gottverdammten Ort.«
Nur wenige Stunden später war Frederika tot.
Und erst langsam dämmerte mir, dass sie mir in jener Nacht eigentlich etwas ganz anderes gesagt hatte. Etwas, was alles veränderte.
Kapitel 1
Sie fanden ihr Tagebuch kurz vor ihrem zwanzigsten Todestag, und ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass jemand versuchte, mir damit etwas zu sagen.
Wie eine verloren geglaubte Schatzkarte hatte es am Rande des ausgetrockneten Stausees auf der Theaterbühne darauf gewartet, entdeckt zu werden.
Und wie es der Zufall oder vielleicht sogar ein höhnischer Teufel so wollte, war ich genau heute, an diesem Mittwoch Ende Juli, in mein Auto gestiegen und an diesen Ort, dem ach so idyllischen Dorf meiner Jugend, zurückgekehrt, sodass ich die Neuigkeit brühwarm erfuhr.
Wie viele Male hatte ich dieses Ortsschild schon passiert?
Lopauthal. Wie ein ewiger Sommer.
Das Banner mit den anpreisenden Worten in diesem speziellen Lila der Heideblüte wurde im Rückspiegel langsam kleiner.
Ich hatte einfach rausgemusst aus der Stadt. Aus meinem Leben. Offen darüber nachgedacht, leise oder laut ausgesprochen, wohin ich fahren würde, hatte ich nicht. Und doch war die Entscheidung gefallen. Irgendwo zwischen den Anrufen meiner Kollegen und den besorgten Blicken meines Verlobten Stefan.
Unbezahlter Urlaub, so nannte es mein Chef. Ich nannte es: »Alles-infrage-stellen-wofür-ich-die-letzten-fünfzehn-Jahre-gearbeitet-hatte«.
In meiner Kindheit hatte Lopauthal etwas Magisches umgeben und der Sommer war seit jeher die Zeit gewesen, in der dieser Zauber an die Oberfläche drang. Ich sah durch die Windschutzscheibe. Aus Hunderten lila Blütenstängeln zusammengebundene Heidekronen, groß wie Medizinbälle, baumelten gemächlich von den Laternen entlang der Bundesstraße. Das Heideblütenfest stand kurz bevor.
Man sollte meinen, ich hätte hier eine märchenhafte Kindheit erlebt und würde nach wie vor gerne zurückkehren. Doch seit dieser einen Sache damals hatte ich mich bemüht, der trügerischen Idylle und den tratschenden Dorfbewohnern zu entkommen.
Bis heute.
Der Sommer präsentierte sich in unwirtlicher Höchstform, der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ich schaltete die Klimaanlage meines Minis aus und öffnete Fenster und Schiebedach. Die Hitze drang ein wie eine unerbittliche Masse und erfüllte das Wageninnere.
Wann war ich zuletzt länger als einen Anstandsnachmittag hier gewesen? Ich hatte den Ort gemieden, seit … seit ich zum Studium aufgebrochen war und mich nicht mehr umgesehen hatte.
Aber nun brauchte ich meinen Vater. Dringend. Seinen Optimismus, seinen Moralkodex, seinen Whisky. Vielleicht blieb ein Zuhause, wie verkorkst es auch sein mochte, doch immer noch ein Zuhause.
Ich nahm die geschlängelte Hauptstraße durch den Ort. Augenscheinlich hatte sich nicht viel verändert. Die große Backsteinkirche thronte zu meiner Linken auf ihrem Hügel, wie sie es seit Jahrhunderten tat. Vor dem angrenzenden Rathaus kündigten große Plakate mit einer austauschbaren Schönheit in weißem Kleid, rotem Samtumhang und einer Heidekrone auf dem Kopf das anstehende Blütenfest an. Vor dem kopfsteingepflasterten Hof des Heidjerkrugs saßen Besucher in bunter Radmontur und tranken ihr Bier.
Die Menschenschlange vor HenniesEisdiele bestand wie jedes Jahr aus unzähligen Touristen, in ihrer Kluft schwitzenden Motorradfahrern und Dorfkindern, die einen Hocker benötigten, um ihr wässriges Zimteis entgegenzunehmen. Die Sommerluft war geschwängert vom Duft nach frisch geschnittenem Gras und Spiritus, zu jeder Tageszeit wurde ein Grill angefeuert. Die Tauben gurrten gelangweilt von den Dächern und vermittelten einem das Gefühl, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt als ebendiesen bedeutungslosen Augenblick.
Gegenüber der Eisdiele bog ich links ab und fuhr den Weg zum Haus meines Vaters entlang, das sich am obersten Punkt der Bergstraße befand. Von dort bot sich ein fantastischer Blick über das Tal, das diesem Ort seinen Namen gegeben hatte. Es wurde von einem kleinen Bach durchzogen, der sich für satte Wiesen und uralte Eichenhaine teilte und anschließend wieder zusammenfloss. In der Mitte wurde er aufgehalten, um den Stausee zu speisen, an dem das Heideblütenfest seit jeher mit Theater und Feuerwerk eröffnet wurde.
Das Fest.
Mir schauderte bei dem Gedanken daran. Samstag in zwei Wochen wäre es so weit und der gesamte Ort würde für eine Woche vergessen, dass eine Realität außerhalb der Festlichkeiten existierte.
Sämtliche Dorfbewohner dürften bereits seit Monaten damit zugange sein, Motivwagen zu bauen, die schwimmende Bühne auf dem Stausee für das plattdeutsche Theaterstück zu renovieren oder Choreografien für die Wahl zum Heidekönig zu perfektionieren.
Hatte Papa nicht neulich erzählt, dass meine Stiefschwester Kitty, gerade achtzehn geworden, für die Königinnenwahl kandidieren wollte? In der Regel schaltete ich auf Durchzug, wenn es um Heideangelegenheiten ging. Aber wundern würde es mich nicht.
Langsam kam das zweistöckige Backsteinhaus in Sicht, in dem mein Vater mit seiner neuen Frau Margitta und deren Tochter Kitty wohnte. »Neu« war in diesem Zusammenhang das falsche Wort. Aber trotz der dreizehn Jahre, die sie inzwischen verheiratet waren, war ich mit Margitta nie warm geworden.
Da das Haus an einem Hang gelegen war, hatte man nur durch den liebevoll angelegten Garten von unten aus Zugang zur Wohnung. Von der Straße aus gelangte man zur Landarztpraxis Wedemeyer im Obergeschoss, die Papa vor Jahrzehnten von einem schon damals uralten Mann übernommen hatte, der irgendwann vergreist und dement im Altenheim verstorben war.
Die Fenster der Praxis standen weit offen. Der Parkplatz war bis auf den letzten Platz gefüllt – der Sommer war neben der Grippesaison eine der geschäftigsten Zeiten für den Landarzt. Angelhaken in Füßen, Touristen mit Sonnenstichen, Wespenstiche nach dem Genuss von Stachelbeerbaisertorten.
Ich parkte in der Einfahrt hinter dem kastigen Volvo meines Vaters. Mein Handy hatte ich auf lautlos gestellt und ließ es in meiner Hosentasche, um die verpassten Anrufe nicht zu sehen. Ich hatte Stefan einen Zettel hinterlassen, der erklärte, dass ich Zeit bräuchte. Nicht die feinste Art.
Ein tiefer Atemzug. Um mich zu sammeln. Um, zumindest für einen Moment, die jüngere Vergangenheit abzuschütteln und wieder ein Mädchen zu sein – gerade fühlte ich mich nicht wie die Vierunddreißigjährige, die ich war –, ein Mädchen, das nach Hause kam.
Ich öffnete die Autotür, bereit, mich dem zu stellen, was kommen mochte. Aus dem ersten Stock drang Gemurmel zu mir heraus. Es war anders, als ich es in Erinnerung hatte, aufgeregter, lauter, ein Gewusel fast. Nicht das geordnete Arbeitsgeplänkel mit bekannten Patienten. Dringlichkeit und Anspannung lag in den Stimmen, manche lauter, manche leiser, und ich versuchte, einzelne Worte auszumachen.
Unschlüssig, ob ich einfach hineinmarschieren sollte, näherte ich mich einem der offen stehenden Fenster oberhalb des Gartentors.
Und gerade als meine Hand den schmiedeeisernen Drücker erreichte, drangen die Worte durch das Fenster. Sie krochen zwischen den Mauerfugen hervor. Die Blätter der großen Eichen schienen sie zu wispern. Ja, ich hätte schwören können, selbst aus den Lautsprechern meines ausgeschalteten Autoradios dröhnte ihr Name. Und mit jedem Mal klangen die Worte mehr und mehr wie die Zeilen eines sehnsüchtigen Gebetes, das für immer unerhört bleiben sollte:
Frederika Petersen.
Es war die Stimme meines Vaters, die ich hörte, doch sie klang fremd. »Sie haben ihr Tagebuch gefunden. Der Fall wird wieder aufgerollt.«
Ich zog meine Hand vom Gartentor zurück, als hätte ich mich verbrannt. Das konnte nicht wahr sein! Das Tagebuch? Gerade jetzt?
Vermutlich hatte keiner damit gerechnet, dass es je wieder auftauchen würde. Frederika war Legende. Schon zu Lebzeiten. Das schönste Mädchen, das fast die Heidekrone getragen hätte, wenn sie nicht am Morgen des Königinnensonntags, dem Höhepunkt des Heideblütenfestes, mit eingeschlagenem Schädel im Schwimmbad gefunden worden wäre, mitten im Becken treibend. Dort, wo sich sonst der große, aufblasbare Krake befunden hatte, wenn man Bademeister Schülke glaubte.
Als wäre der Tod einer Provinzschönheit nicht genug gewesen, hatte das Schicksal oder der Mörder – auch das blieb bis heute ungeklärt – für eine zweite Wasserleiche gesorgt, die zur selben Zeit in drei Kilometer Luftlinie Entfernung in ihrem Gartenteich trieb. Ingrid Johanning, die Frau des ehemaligen Schulleiters. Ruhig und unscheinbar, etwas über sechzig, das komplette Gegenteil von Frederika. Und doch waren beide Frauen am gleichen Tag auf ähnliche Weise ums Leben gekommen.
Und da Wasserleichen in Lopauthal bis zu diesem Zeitpunkt sehr selten und zwei auf einmal fast unmöglich erschienen waren, hatte schnell festgestanden, dass beide Taten miteinander verbunden sein müssten. Doch bis heute konnte man sie niemandem nachweisen.
Die Todesfälle vom 15. August 1999 blieben Lopauthals düsterstes und mysteriösestes Kapitel.
Aber nun gab es ein neues Beweisstück. Das Tagebuch. Und ich könnte wetten, dass ich nicht die Einzige war, die bei dem Gedanken daran, welche Geheimnisse es offenbaren würde, ein mulmiges Gefühl hatte.
Kapitel 2
Ein Schwarm Mücken tanzte über dem Tümpel, als ich das Gartentor öffnete, die Kröten begannen träge ihr knarzendes Konzert. Die Sonne verschwand langsam hinter den hohen Eichen in der Ferne.
Als ich an die Terrassentür klopfte, antwortete keiner. Einen Schlüssel hatte ich nicht. Ich hätte in die Praxis gehen können, aber ich war nicht bereit. Insbesondere nach diesen Neuigkeiten.
Also setzte ich mich an den großen Holztisch unter dem Vordach und öffnete einen Roman, den ich mir vor Ewigkeiten gekauft und aus unerfindlichen Gründen in meine Reisetasche gesteckt hatte, auch wenn ich wusste, dass ich mich jetzt nicht darauf würde konzentrieren können.
Hoffentlich würde Papa bald seinen letzten Patienten verarztet haben, sodass ich ein paar Worte mit ihm wechseln konnte, bevor Margitta oder Kitty nach Hause kämen. In ihrer Gegenwart war er anders. Oder vielleicht war er auch nicht anders, vielleicht war es nur fremd für mich, seine Zuneigung und seine Güte teilen zu müssen.
Papa und Margitta hatten geheiratet, als ich bereits ausgezogen war. Da war Kitty fünf gewesen. Ein aufgewecktes Mädchen, zu dem ich keinen Zugang fand. Es nicht einmal versuchte. Ich hatte nie mit dieser neuen Familie unter einem Dach gelebt, sondern sie nur zu besonderen Anlässen besucht. Ich wusste, dass es mir schwerfallen würde, meinen Platz in ihrem Alltag zu finden. In Papas anderer Familie. So fühlte es sich an, wenn ich die drei sah. Als gehörte ich nicht dazu.
Schließlich waren es immer nur er und ich gewesen, solange ich denken konnte. Seit meine Mutter von diesem Reitunfall nicht zurückgekommen war.
Ich hörte Schritte näher kommen und wusste, dass aus meinem Wunsch, allein mit Papa zu sein, nichts werden würde.
Eine Woge warmen Lavendeldufts stieg mir in die Nase, als Margitta auf mich zukam. Sie sah aus, als wäre sie einem Film aus den Siebzigerjahren entsprungen: Ihre dunkelbraunen Locken waren zu zwei Zöpfen geflochten, die von einem dezent gemusterten Tuch aus dem Gesicht gehalten wurden. Ein künstlerisch auf ihrem Scheitel gebundener Knoten rundete das Bild ab. Sie trug eine schmutzige Latzhose, darunter lediglich ein Top, sodass ihre naturgebräunten, definierten Arme zum Vorschein kamen. Durch ihre chilenischen Wurzeln wirkte sie jugendlicher, als sie mit ihren siebenundvierzig Jahren war.
Heute wirkten ihre sonst tänzerischen Schritte eher schlurfend. Sie blickte zu Boden und schien mich nicht bemerkt zu haben. Als ich mich räusperte, um behutsam auf mich aufmerksam zu machen, zuckte sie kaum merklich zusammen und setzte ein Lächeln auf, das ungezwungen wirken sollte.
Schnell schlug ich mein Buch irgendwo in der Mitte auf, in der Hoffnung, unsere Unterhaltung auf das Notwendigste zu beschränken.
»Nina, ja richtig! Dein Vater hat gesagt, dass du heute kommst. Schön, dich zu sehen.« Sie ging an mir vorbei, legte mir ihre Hand kurz, aber liebevoll auf die Schulter und verschwand im Haus. Die Tür ließ sie offen.
Ich hörte, wie unsere Promenadenmischung Lisa von ihrem Platz unter der Treppe träge mit dem Schwanz wedelte, ohne sich die Mühe zu machen aufzustehen. Sie war inzwischen sechzehn und fast taub. Mein Vater hatte sie, um nicht allein zu sein, zu sich geholt, kurz bevor ich das Dorf für mein Studium verlassen hatte.
Was war mit Margitta los? Keine überschwängliche Begrüßung? Kein Festmahl und drei Torten, die zur Feier der Rückkehr der »verlorenen Tochter« warteten? Sollte ich ihr hinterhergehen? Aber wir hatten uns noch nie einfach unterhalten können.
Also entschied ich, sitzen zu bleiben. Lisa würde ich später begrüßen, Hundefell war der beste Trost, den die Welt zu bieten hatte. Ich zwang meine Augen, sich auf die tanzenden Buchstaben auf der Seite zu konzentrieren. Ich muss endlich …, stand dort. Ich muss endlich …
Dann wurde mir klar, was Margittas Latzhosenauftritt zu bedeuten hatte. Sie hatte vor einigen Jahren die Leitung des Theaters übernommen. Natürlich war sie heute dabei gewesen, als das Tagebuch bei den Bühnenarbeiten gefunden wurde. Ich klappte mein Buch zu und richtete mich auf. Vielleicht hatte sie etwas aufgeschnappt? Aber sie kannte die ganzen Verstrickungen von damals ja gar nicht. Gerade als ich mich erheben wollte, hörte ich leises Gemurmel im Wohnzimmer, das Klirren von Eiswürfeln, Schritte, die sich der Terrassentür näherten.
Die Fliegentür wurde geöffnet und Margitta kam herausgeschlürft, hinter ihr mein Vater. In den Händen drei Gläser und eine Flasche Single Malt. Eigentlich hielt mein Vater nichts davon, seinen Whisky mit Eis zu verwässern, aber heute schien er eine Ausnahme zu machen.
Nachdem er alles auf dem Tisch abgestellt hatte, trat er mit einem schiefen Lächeln und ausgebreiteten Armen auf mich zu. Seine weißen Bartstoppeln verrieten mir, dass er zu viel arbeitete. Ich stand auf, fast zwei Köpfe kleiner als er, und sank in seine Arme. Der tröstliche Geruch von Limette und Zeder drang mir in die Nase und ich musste meine Tränen wegblinzeln.
»Wie schön, dass du da bist, meine Kleine.« Er gab mir einen Kuss auf den Scheitel, wir lösten uns aus unserer Umarmung und setzten uns an den Tisch.
Margitta seufzte und starrte in ihr Glas, wo das Eis schmolz.
Über den goldenen Rand seiner Brille sah mein Vater mich ernst an. »Nina, entschuldige unsere Stimmung, aber … Also heute wurde …«
»Ich habe es schon gehört. Sie haben es gefunden.« Anscheinend hatte mich niemand bemerkt, als ich sensationslüstern unter dem Praxisfenster gelauscht hatte.
Er nickte, schenkte jedem großzügig ein, reichte uns die Gläser und prostete wortlos in die Runde. Dann trank er einen Schluck. Ich tat es ihm gleich. Margittas Hand zitterte, als sie ihren Whisky an den Mund führte.
Papa setzte sein Glas ab und räusperte sich. »Margitta ist fertig. Der ganze See ist abgeriegelt, Spurensicherung, Spürhunde, Kriminalpolizei. Alle anwesenden Arbeiter wurden befragt, was sie die letzten Tage gesehen hätten, ob sie Frederika kannten, ob jemand gesehen wurde, der das Buch dort deponierte … Es hat sie mitgenommen.« Er legte seine große Hand auf Margittas, die noch zerbrechlicher als sonst wirkte.
Daher wehte der Wind. Wahrscheinlich war der lebensfrohen Margitta in ihrem Leben noch nie etwas Düsteres widerfahren und sie hatte heute lernen müssen, dass selbst dieser Ort nicht davor gefeit war.
»Entschuldige.« Margittas Stimme war ein leises Krächzen. »Ich stelle mich ziemlich an, das Ganze kam einfach so überraschend. Gerade jetzt, wo wir kurz vor der Aufführung stehen. Und auch noch genau von dem Stück, das Ingrid Johanning damals …« Sie brach ab.
Wut kochte in mir auf. Es ging ihr tatsächlich um ein dämliches Theaterstück? Ich erinnerte mich an Plots mit immergleichen Wendungen und Amateurschauspieler, die sich am Plattdeutschen versuchten. Gefolgt von großem Feuerwerk, Tanz und Alkohol. Auch bekannt als »Der Flammensee«.
Und in jenem Sommer, als Ingrid Johanning und Frederika zu Tode gekommen waren, hätte dieses neue Theaterstück seine Uraufführung haben sollen. Es stammte aus Ingrid Johannings Feder. Mit niemand anders als Frederika in der Hauptrolle.
Bloß zur Aufführung war es nie gekommen. In der Nacht zuvor brach ein Feuer aus und verbrannte Bühnenbild samt Requisiten bis auf den Betongrund der Bühne. Die Leute zerrissen sich die Mäuler über interne Intrigen, Kabelbrände, Neider aus anderen Orten bis hin zur Mafia, russisch, italienisch, egal welche. Aber das allgemeine Interesse wurde bald von einem weit größeren Skandal in Anspruch genommen, als ausgerechnet die beiden wichtigsten Personen dieses Stückes eine Woche später tot aufgefunden wurden.
Das Theater. Der anscheinend einzige Berührungspunkt der beiden Toten.
Seitdem hatte das Manuskript in Frau Johannings Schreibtischschublade geruht, bis ihr Mann es nun zwanzig Jahre später herausgeholt hatte, um seiner verstorbenen Frau den ihr gebührenden Ruhm posthum zu ermöglichen. Mein Vater hatte mich diesbezüglich auf dem Laufenden gehalten, ob ich wollte oder nicht.
Margitta hatte ihre Sprache wiedergefunden. »Ich habe solche Angst, dass wir das Stück nicht aufführen können! Ich meine, abgesehen davon, wie schlimm das für die Mutter des armen Mädchens ist. Und für Albert …« Albert Johanning. Mein ehemaliger Lehrer, mein alter Freund. Der Tod seiner Frau würde ebenfalls erneut unter die Lupe genommen werden.
Margitta seufzte. »Wenn das nun alles wieder hochkocht … Es ist, als wäre das Stück verflucht. Schrecklich.« Sie schüttelte betrübt den Kopf.
Ich nahm einen großen Schluck. War sprachlos.
Einen Moment lang hingen wir alle unseren Gedanken nach. An tote Provinzschönheiten, an verfluchte Theaterstücke, an die schwierigsten Jahre eines alleinerziehenden Vaters, schätzte ich. Plötzlich klapperte das Gartentor so laut, das selbst Lisa im Inneren des Hauses träge wuffte, um halbherzig auf den Eindringling aufmerksam zu machen.
Kitty erschien wie eine Naturgewalt, als sie über den Rasen auf uns zufegte. Ihre langen Beine legten die Distanz in Windeseile zurück, die dunklen Haare wehten offen um ihr Gesicht. Sie trug ein gelbes Top und viel zu kurze Jeans. Für eine Sekunde dachte ich verwundert, sie wollte mich überschwänglich begrüßen, aber dann nahm sie Kurs auf ihre Mutter. Wie eine sensationslüsterne Reporterin, die gerade einen wichtigen Kronzeugen erspäht hatte. »Mama, ist das wahr? Das ist ja Wahnsinn. Erzähl, wo war es? Und wie ist das abgelaufen? Was sagt die Polizei?«
Wo immer Kitty sich den ganzen Tag herumgetrieben hatte, auch an ihr war die Nachricht über das gefundene Tagebuch nicht vorbeigezogen. Wie ein kleines Mädchen hüpfte sie vor ihrer Mutter auf und ab, was nicht zuletzt aufgrund ihrer Größe grotesk wirkte. »Hast du es gesehen, Mama, Freds Tagebuch?«
Dass meine Stiefschwester, die noch nicht einmal auf der Welt gewesen war, als Frederika diese verlassen musste, sie bei ihrem Spitznamen nannte, machte die Situation noch absurder.
»Nun sag schon, Mama! Das ist ja so abgefahren! Der Sommer wird echt immer besser! Ein richtiges Mysterium könnte gelöst werden.«
Mein Vater blickte ungläubig zwischen Kitty und mir hin und her und schien zu überlegen, wie er das temperamentvolle Wesen bändigen konnte. »Nun mach mal halblang, Kitty. Denk mal daran, was das für ihre Familie bedeutet. Für die Hansens. Für den ganzen Ort. Für Nina.« Dabei sah er mich nicht an.
Die Hansens. Ich ließ meinen Blick sinken. Auf meine Hand, an der ein glänzender Verlobungsring prangte. Ein großer, unpraktischer Fremdkörper.
Hauke Hansen, Frederikas damaliger Freund. Florian Hansen, mein ehemals bester Freund. Ein Schmerz in meiner Magengrube. Ich schloss die Augen so fest, bis ich Sterne tanzen sah und der Schmerz in ein sanftes Kribbeln überging.
Kitty unterbrach ihr Springen. Nun war sie die Ungläubige, die nicht verstehen konnte, dass keiner ihre Begeisterung teilte. »Ah, Nina!« Sie knuffte mich in die Seite. »Nina … Ich habe gehört, dass du es warst, die Fred zuletzt gesehen hat damals, nicht wahr? Also lebendig, meine ich. Das wird ja immer abgefahrener.«
Richtig, das war ich. Die wichtigste Zeugin im berühmtesten Mordfall unserer Gegend, die – zumindest in den Augen der anderen – gefälligst eine Antwort auf all die ungelösten Fragen hätte haben sollen. Aber keine hatte.
Ich schwieg.
Margitta hielt sich an ihrem Glas fest und flüsterte fast. »Das sind echte Menschen, Kitty! Das ist wirklich passiert.«
Als müsste Margitta sich der Absurdität ihrer Aussage bewusst sein, runzelte Kitty die Stirn. »Ja, klar, das weiß ich doch. Aber das ist es ja! Sie ist eine Ikone, das geheimnisvollste Mädchen aller Zeiten, das aus unerfindlichen Gründen den Tod fand … Daraus werden Filme gemacht.« Sie drehte sich um die eigene Achse, als würde sie sich bereits in der tragischen Hauptrolle dieser Verfilmung sehen.
Meinem Vater blieb der Mund offen stehen.
»Ja, nun hat der Film eine neue Szene, denn sie werden wieder tausend Leute verdächtigen. Niemand traut mehr irgendwem und es ist, als wäre die Zeit zurückgedreht worden. Nur ist sie das natürlich nicht, denn die ganze Scheiße, mit der man sich inzwischen zusätzlich befassen muss, ist trotzdem noch da!« Ich merkte erst, dass diese Worte meinen Mund verlassen hatten, als ich aufblickte und sah, dass sechs Augen wie gebannt auf mich gerichtet waren.
Mist. Nun wussten alle, dass mit mir etwas nicht stimmte. Wobei sie es sicher schon vorher geahnt hatten. Wieso sonst hätte ich fragen sollen, ob ich auf unbestimmte Zeit hier, in meinem Elternhaus, bleiben könnte?
Selbst der Hund schien trotz der tauben Ohren bemerkt zu haben, dass etwas nicht stimmte, denn er winselte vor der Fliegentür. Ich ertrug die angespannte Stimmung nicht, stand auf und ließ Lisa hinaus.
Sie fiepte. Dann drehte sie umständlich um und folgte mir nach drinnen, während die Fliegentür hinter uns zuschlug. Ich ließ mich aufs Sofa fallen. Zwar konnte ich die drei draußen noch hören, aber sehen wollte ich sie nicht. Also saß ich einfach da.
Lisa stand vor mir mit ihrer grauen Schnauze und den trüben Augen, ihr Schwanz wedelte aufgeregt hin und her. Wie ein alter Mensch, der am Ende seiner Tage wieder einem kleinen Kind glich. Ich knuddelte sie, bis das Halsband klimperte, und merkte erst, dass mir die Tränen kamen, als Lisas schwarze und weiße Flecken ineinander verschwammen und ein schmutziges Grau ergaben.
»Ich denke, unter diesen Umständen sollten wir das Grillen sein lassen. Ich habe absolut keinen Hunger.« Das war die ruhige Stimme meines Vaters von draußen.
Niemand antwortete.
»In Ordnung, Schatz?«, fügte er an Margitta gerichtet hinzu.
»Was?« Margitta klang, als wäre sie aus einer Trance erwacht. »Oh, ja … ich meine, nein, danke. Ich möchte auch nichts essen.«
Kitty nutzte die Gelegenheit, um sich von ihrer informationskargen Familie loszureißen. »Alles klar, macht nichts. Ich wollte eh zu Jonas und beim Wagenbau helfen. Die wollen heute Abend mit dem Gerüst von Emma anfangen. Ihr wisst schon, die Lokomotive aus dem Lummerland mit den Bergen und … Jedenfalls megacool. Aber vielleicht müssen wir nach der Sache heute noch mal brainstormen, ob wir etwas Passenderes finden. Mama, kann ich deine Latzhose haben? Die sieht super aus!«
Ich rollte mit den tränenden Augen, ohne dass mich jemand sehen konnte, und zog mein Handy aus der Hosentasche. Sieben Anrufe in Abwesenheit. Stefan. Ich schluckte. Wieder das Gewicht des Rings.
Die Fliegentür klapperte, als mein Vater den Raum betrat. Kein Mitleid, kein Ärger über meinen Ausbruch. Keine Frage danach, was mich bedrückte. Dafür liebte ich ihn.
»Übrigens war ich vorhin noch auf Hausbesuch bei Albert Johanning. Hat ihn ganz schön mitgenommen, die Sache, auch wenn er das natürlich nie zugeben würde. Und dann diese Herzgeschichte … Jedenfalls habe ich erwähnt, dass du kommst, und er bat mich, dir zu sagen, dass du zum Scrabblespielen eingeladen bist, egal wann. Ich glaube, er ist einsam.«
Albert Johanning. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es ihm dabei gehen musste, den Tag, an dem er seine Frau verloren hatte, nach all den Jahren erneut zu durchleben. Der arme Mann. Mein Lehrer. Mein alter Freund. Neben meinem Vater die eine Person, der ich keine Lügen würde auftischen können. Wie konnte ich ihm diese Einladung abschlagen?
Ich hörte, wie mein Vater die Gläser in die Spülmaschine räumte, als er leise hinzufügte: »Vielleicht gibt es ja bei dir auch etwas, was du mal loswerden musst.«
Kapitel 3
In den nächsten Tagen war nichts so verlässlich wie die strahlende Sonne am wolkenlosen Himmel, die Land und Leute verbrannte. Und mein Schweigen. Ich bekam die Worte nicht über die Lippen, die ich so dringend sagen musste: Papa, ich habe ein Menschenleben auf dem Gewissen.
Jedes Mal zwang ich mich erneut, die sich formenden Bilder aus meinem Kopf zu verbannen. Wie er dagelegen hatte, auf dem Operationstisch. Ängstlich, aber optimistisch. Wie ich selbstbewusst auf ihn zutrat und ihm versicherte, dass alles gut werden würde. Dass er seine kleine Tochter gleich wieder in den Armen halten würde. Meine größte Lüge.
Der unerbittliche Sommer führte dazu, dass es überall an Wasser fehlte. Unkontrollierbare, tödliche Feuer loderten in Südeuropa. Die Medien hielten die Menschen dazu an, nicht unnötig Trinkwasser zu verschwenden. In Lopauthal hingegen wurde darüber gefachsimpelt, ob man nicht doch einen Teil der Heideflächen bewässern sollte, damit die Touristen die versprochene lila Farbenpracht statt vertrocknetem Gestrüpp erwarten würde. Die Wagenbauer sagten Probleme bei der Dekoration ihrer Motive voraus, denn es gab nur ein paar schwer umkämpfte schattige Plätze, an denen das Heidekraut in der gewünschten Nuance strahlte, und diese waren bereits für die Kronendekoration an der Hauptstraße abgeerntet worden. Der Stausee hatte den niedrigsten Stand seit Aufzeichnungsbeginn. Die Idylle der schwimmenden Bühne, auf der man plante, das sagenumwobene Theaterstück der ertrunkenen Frau Johanning aufzuführen, hatte sich in einen skurrilen Betonblock in einer Schlickpfütze verwandelt.
Die Luft schien elektrisiert. Ich hatte das Gefühl, die Anspannung in jedem Grashalm zu spüren, der in der erbärmlichen Hitze um sein Überleben kämpfte. Alle warteten auf das erlösende Gewitter.
Der Fall Frederika, wie ihn die Tageszeitungen nun betitelten, rutschte wieder in die Schlagzeilen. Die Medien hatten Wind von dem Tagebuchfund bekommen und schöne tote Mädchen waren immer ein Garant für hohe Auflagen.
Ich versuchte, mich von all dem fernzuhalten. Ich war nicht viel mehr als eine Schaufensterpuppe, die auf einer der vielen Sitzgelegenheit des Hauses drapiert dasaß und alles daransetzte, nicht aufzufallen. Was schwieriger wurde, je fettiger meine Haare und unangenehmer der Geruch wurde, den ich ausströmte. Wann hatte ich eigentlich zuletzt geduscht?
Nicht zuletzt, um mich endlich unter die Dusche zwingen zu können, fragten Margitta und mein Vater abwechselnd in für sie angemessen erscheinenden Abständen, ob ich Herrn Johanning angerufen hätte. Das wollte ich schon, ich wollte es wirklich. Scrabble. Ablenkung. Vermutlich keine schlechte Idee.
Aber ich tat es nicht.
Stattdessen wartete ich weiter. Darauf, dass etwas geschah, oder darauf, dass im besten oder schlimmsten Fall nichts geschah.
Eine knappe Woche nachdem der Schmied Johan Müller Freds Tagebuch unter dem Gerüst auf der Bühne gefunden hatte, war die Arbeit der Spurensicherung beendet. Das rot-weiße Flatterband wurde aufgerollt und eingepackt und der Betonklotz für die Arbeiter freigegeben, die, wenn man Margitta glaubte, ein Wunder vollbringen müssten, um die Bühne pünktlich zur Eröffnungsfeier des Heideblütenfestes in zwölf Tagen vorzubereiten.
Man hatte, wie alle mit Bedauern vernahmen, keine Spuren sichern können, die darauf hinwiesen, wann oder von wem das Beweisstück abgelegt worden war. Das Tagebuch und Frederikas letzte Geheimnisse blieben unter Verschluss.
Auch ich zählte die Tage bis zum Festbeginn, allerdings aus einem anderen Grund.
Am Montag nach der Eröffnungsfeier würde mein Urlaub enden und ich mich wieder in meinem alten Leben einfinden müssen. Das war die Zeit, die mein Chef mir eingeräumt hatte, um »zu mir zu kommen«. Also blieben mir genau zwei Wochen, um herauszufinden, wie ich mit der Schuld auf meinen Schultern je wieder einen Arztkittel anlegen konnte, wo ich mir selbst nicht mehr traute. Obwohl ich meinen Beruf liebte.
Und bisher war ich keinen Deut weitergekommen.
Ich wusste, ich sollte an meine Zukunft denken und endlich zu einem Entschluss kommen, doch meine Gedanken wanderten wieder und wieder zurück zu dem Fall vor zwanzig Jahren.
Die Ermittler gingen davon aus, dass Frederika damals, als ich sie gegen zwei Uhr morgens zuletzt am alten Postschuppen im Ortszentrum gesehen hatte, aus unerklärlichen Gründen auf dem Weg zurück zum Freibad gewesen war. Dort, wo wir noch kurz zuvor die illegale Party zu ihrem Geburtstag gefeiert hatten, bevor die Bürgerwehr sie zerschlug. Im angrenzenden Stausee sollte Frederika dann ihren Tod finden. Am Datum ihrer Geburt, achtzehn Jahre später.
Und doch war ihre Leiche am nächsten Morgen im Freibad gefunden worden, nicht im Stausee, zweihundert Meter Luftlinie entfernt. Eingeschlagener Schädel hin oder her, aber daran war sie nicht gestorben. Sie war ertrunken.
Die Obduktion hatte Stauseewasser in ihren Lungen zutage gefördert. Kein Chlorwasser. Man glaubte, dass der Mörder die Leiche nur ins Schwimmbad geschleppt hatte, um es wie einen Unfall auf ihrer illegalen Party aussehen zu lassen. Und allein diese Tatsache brachte zwei wichtige und zudem beängstigende Fakten mit sich: Der Mörder kannte die Gepflogenheiten der Dorfjugend in jenem Sommer, vor allem die vom Alkohol beflügelten, nächtlichen Einbrüche in das Freibad. Und er war stark genug, Frederikas leblosen Körper über Baumwurzeln und Sandwege zu tragen. Im Dunklen noch dazu, Böschungen auf und ab, ohne auch nur von einer der zahlreichen in jener Nacht herumgeisternden Gestalten gesehen worden zu sein. Etwa von den Mitgliedern der Bürgerwehr, die uns Jugendliche aus dem Schwimmbad verscheucht hatten. Oder von einem von uns, die wir uns in allen dunklen Ecken der Umgebung versteckt hatten, um nicht erwischt zu werden. Oder von Eisdielenbesitzerin Henriette Hummel, die mit ihrem Mann die dritte Flasche Rotwein am Steg des Bootsverleihs geöffnet hatte, wie ich später erfuhr.
All diesen und noch weiteren Leuten hatte der Mörder während seiner Tat aus dem Weg gehen müssen. Über eine Strecke von zweihundert Metern, wenn sie am Westufer des Sees starb. Fast zwei Kilometer, wenn es das Ostufer war. Denn Spuren ihres Todeskampfes hatte es keine mehr gegeben. Bevor die Obduktion Rückschlüsse auf den Tatort hervorbringen konnte, hatte ein unerbittlicher Dauerregen alle verbliebenen Hinweise zu Frederikas letzten Stunden beseitigt.
So blieb zum Beispiel auch die mysteriöse Tatwaffe verschwunden.
Zwar war Frederika ertrunken, doch war der gebrochene Schädelknochen ihrer linken Schläfe Zeuge, dass jemand enorme Gewalt eingesetzt hatte, um sie zum Schweigen zu bringen. Sie musste ihren Angreifer noch gesehen haben, denn der Wunde nach zu urteilen war der Angriff von vorne gekommen. So wurde es sich damals erzählt. Mit einem schweren, scharfkantigen Gegenstand, der nun vermutlich irgendwo auf dem Boden des Sees lag. Ein Hammer, wurde gemutmaßt, der vielleicht vom Bühnenbau stammte, oder einfach einer der unzähligen anonymen Wackersteine vom Ufer des Sees. Gefunden hatte man die Tatwaffe und somit Rückschlüsse auf den Mörder aber nie.
Keine verwertbaren Spuren.
Genau wie bei Ingrid Johanning. Ihre Leiche hatte nicht einmal Verletzungen aufgewiesen. Sie war, wenn man so wollte, einfach nur ertrunken. Aber der Teich war keinen halben Meter tief. Wer ertrank denn in so einer Pfütze?
Und nun fragte ich mich natürlich, ob Kommissar Harald Ulrich mich erneut zu einem »Gespräch«, wie er es nannte, zitieren würde, um meine Aussage von damals zu überprüfen. Sicher würde er mich fragen, ob ich mich wirklich richtig erinnerte: Hatte Frederika das kleine rote Tagebuch tatsächlich dabeigehabt, als sie zum Postschuppen kam? Ja, das hatte sie, da konnte ich mich nur wiederholen. Das kleine Buch und die pinke Jacke. Beides wurde nicht bei ihrer Leiche geborgen, was seitdem so viele Fragen aufgeworfen hatte.
Kommissar Ulrich. Der musste inzwischen kurz vor der Rente stehen. Bisher hatte er mich in Ruhe gelassen. Nur mit meinem Vater konferierte er regelmäßig, wenn die beiden auf der Anlage beim Campingplatz Tennis spielten. Was eigentlich bedeutete, dass sie sich in der Pizzeria am Spielfeldrand trafen – das wusste das ganze Dorf.
Zwei Tage später kam mein Vater abends von seinem »Tennis-Match« mit Ulrich zurück. Für die dreißig Grad, die selbst jetzt noch herrschten, sah er erstaunlich frisch aus. Er berichtete, dass Ulrich den Fall an zwei Ermittler aus Lüneburg hatte abtreten müssen.
»Es gibt dort eine Cold-Case-Einheit, die die Sache nun übernimmt«, sagte er, während er in seinem Salat herumstocherte. Mein Blick fiel auf einen roten Fleck an seinem Hemdkragen, der verdächtig nach Tomatensauce aussah.
»Kein Opfer ist je vergessen«, warf Kitty schmatzend das Zitat einer Fernsehserie aus den frühen Zweitausendern ein. Woher kannte sie die denn, dazu war sie doch viel zu jung?
»Harald sagt, das sind eingebildete Milchbubis. Waren damals nicht mal alt genug zum Mopedfahren, als sich das alles zutrug. Wie ihr euch denken könnt, ist er nicht gerade erfreut.«
»Aber immerhin sind sie ja spezialisiert. Und manchmal tut es ganz gut, einen frischen Blick von außen auf eine Sache zu bekommen.« Zumindest war es mir im Krankenhaus manchmal so gegangen.
»Was du nicht sagst.« Das warme Lächeln meines Vaters, seine Hand auf meiner.
Er redete nicht mehr über Frederika.
»Martin, ist das da Blut oder Tomatensauce?« Kitty deutete angewidert auf den Hemdkragen meines Vaters und rettete mich so unwissentlich aus der Misere.
Am Freitag, zwei Tage nachdem ich von den Cold-Case-Beamten erfahren hatte und acht Tage vor Festbeginn, fing mich Margitta in der Küche ab.
»Ich mache mir Sorgen um deinen Vater.« Gerade drapierte sie unförmige weiße Blumen in einer zu großen Vase. »Wie er tagtäglich hart schuftet da oben bei der Hitze. All die zusätzlichen Touristen und nun auch noch die Arbeitsunfälle vom Theater. Zerquetschte Daumen, Splitter, Hitzschlag … Meinst du, du könntest ihm vielleicht ein bisschen zur Hand gehen, Nina?« Sie sah mich hoffnungsvoll an.
Ich fühlte mich von ihren Worten angegriffen. Sie stellte mich als faule Tochter dar, während sie selbst nicht einmal einen Führerschein besaß und ständig darauf angewiesen war, dass mein Vater sie hin und her kutschierte. Anstatt einer Antwort machte ich auf der Hacke kehrt und ging in mein Zimmer. Im Moment konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, einen Patienten zu behandeln. Die Tür schloss ich unnötig laut. Na toll. Zurück in dem Haus meiner Teenagerjahre, hatte ich offenbar das Gefühl, mich auch wie einer benehmen zu müssen.
Kurze Zeit später tat es mir leid.
Als ich wieder herauskam und beschämt in die Küche schlich, nickte Margitta wortlos über ihren riesigen Lilienstrauß in Richtung Wohnzimmer, wo mein Vater in seinem Ohrensessel saß. Mein schlechtes Gewissen verstärkte sich, als ich ihn über den Laptop gebeugt mit verengten Augen damit kämpfen sah, seinen Kopf nicht auf die Brust fallen zu lassen. Er schreckte hoch, als er diesen Kampf letztlich verlor.
Ich wusste, dass er die Abrechnungsziffern überprüfte, die eine Bürokraft am Tag notdürftig einpflegte. Dies war eine essenzielle Aufgabe, denn ohne die richtigen Abrechnungsziffern ging der Praxis bares Geld durch die Lappen.
»Papa«, hörte ich mich sagen, »was hältst du davon, wenn ich mich ein bisschen um deine Abrechnungen kümmere?«
Er blinzelte mehrfach, vielleicht, um sich zu vergewissern, dass er nicht träumte, vielleicht auch, um aufzuwachen. »Das wäre mir eine große Erleichterung, vielen Dank, mein Schatz.« Er gähnte, stellte den Laptop auf dem Wohnzimmertisch ab, als er aufstand, mich auf den fettigen Scheitel küsste und zu seiner Frau in die Küche ging. Ich nahm mir den Laptop vor, auf dem das Praxisprogramm noch geöffnet war, und fing einfach an, ohne nachzudenken. R51 für Kopfschmerzen, N30.0 für eine Blasenentzündung. Abrechnung für Abrechnung. Stefan hätte mich sicher für die Verschwendung meines Talentes gerügt.
Stefan. Irgendwann hatte ich mich überwunden, ihm zu texten. Wir hatten in den letzten Tagen einige nichtssagende Nachrichten ausgetauscht, die alle, sobald es etwas tiefer ging, mit einer Abweisung von mir endeten. Er akzeptierte es, aber ich sah an den immer seltener werdenden Emojis, wie enttäuscht er von meinem Verhalten war.
»Ach Nina, fast hätte ich es vergessen«, rief mein Vater mir aus der Küche mit einer Tasse Kaffee in der Hand zu. »Heute hatte Albert Johanning wieder einen Termin. Er lässt dir ausrichten, er erwarte dich am Samstag um drei zum Scrabble.«
Kapitel 4
Für Samstagnachmittag war endlich das langersehnte Gewitter angekündigt. Ich öffnete die quietschende Wagentür unserer weißen Rostlaube, setzte mich hinter das Lenkrad und sog meine Vergangenheit förmlich ein. In diesem alten Volvo hatte ich Autofahren gelernt. Ich konnte gar nicht fassen, dass er noch immer lebte. Er war wie Lisa, lief und lief, nur eben inzwischen etwas langsamer. Aufgeheizt von der Sonne potenzierte sich der Geruch nach nassem Hund, der sich in den bunten Schonbezügen und vermutlich auch längst in den Tiefen der Sitzpolster festgesetzt hatte. Instinktiv schaltete ich das Radio ein und kurbelte das Fenster herunter, wie ich es früher immer gemacht hatte. Diese liebenswerte, alte Schrottkarre!
Der durch die Sonne eingebrannte Eisfleck auf dem Armaturenbrett, der angeklebte Rückspiegel, der unter dem Gewicht zahlreicher Perlenketten nachgegeben hatte, das Brandloch im Rücksitz, als Viktor Eremin nach der letzten Abiklausur auf der Rückbank geraucht hatte, alles noch da.
Ich hätte meinen Mini nehmen können, aber er schien nicht auf diese Straßen zu gehören. Also zwang ich den Rückwärtsgang ächzend an seinen Platz und steuerte den Wagen aus der Einfahrt die Bergstraße hinunter ins Dorf. An der Backsteinkirche bog ich links ab, vorbei an einer lang gezogenen, mit Jalousien verdunkelten Fensterfront. Früher war hier ein Haushaltswarengeschäft gewesen. Schönewalds. Von Schrauben und Gartenartikeln über Schulwaren bis hin zu Spielsachen hatte man dort alles bekommen. Damals war ein Fünf-Mark-Gutschein von Schönewalds als Geburtstagsgeschenk gang und gäbe gewesen. Aber wie viele dieser Läden rentierte er sich in Zeiten von Amazon nicht mehr. Wahrscheinlich würden demnächst neue Wohnungen in dem Gebäudekomplex entstehen.
Herr Johanning wohnte hinter einem kleinen Wäldchen am Dorfrand, kurz bevor die Heideflächen begannen. Da ich keine Idee gehabt hatte, was ich meinem alten Lehrer mitbringen sollte, entschied ich mich dazu, einen Stopp bei Hennies Eisdiele einzulegen, um zwei Becher Spaghettieis zu besorgen.
Anschließend verließ ich den Ort entlang der Hauptstraße Richtung Westen. Vorbei am Heidjerkrug, dem Rathaus, der Kirche. Ich passierte die Ponyweiden des Nussbaumhofs, die Forellenfischerei, das Mühlencafé, das Maislabyrinth mit angrenzendem Blumenfeld, auf dem Gladiolen und Sonnenblumen wuchsen.
Als ich den Sandweg erreichte, der zu Albert Johannings Haus führte, wurde ich nervös. Wie begrüßte man seinen alten Freund und Lehrer, von dem man sich entfremdet hatte und zu alldem noch durch eine ungeklärte Mordermittlung mit ihm verbunden war?
Ich stellte den Wagen in der von Pflanzen überwucherten Einfahrt ab, stieg aus und hielt das verpackte Eis wie einen Schutzschild vor mich, trat die beiden Steinstufen hinauf und klopfte.
»Die Tür ist angelehnt«, hörte ich die vertraute Stimme meines Lehrers aus dem Inneren des Hauses.
Mit dem quietschenden Öffnen der Holztür drang mir ein altbekannter Geruch entgegen. Zigarillos, Druckerschwärze und Aftershave. Hatte ich Verfall erwartet, so wurde ich enttäuscht. Zwar war Johannings ohnehin fast kahler Kopf mit Altersflecken übersät und seine Wangen ein wenig eingefallen, sodass seine Ohren noch größer wirkten, doch hatte er das gleiche schiefe Lächeln auf dem Gesicht, das ich in Erinnerung hatte. Er war der einzige Mensch, den ich kannte, der es auch mit diesem Grinsen auf den Lippen schaffte, eine nur ihm bekannte Melodie tonlos zu pfeifen. Es klang, als würde irgendwo ein Wasserkessel zischen. Er trug eine Hose mit akkurater Bügelfalte, nicht grün, aber auch nicht braun, und ein darauf abgestimmtes Hemd, das er in die Hose gesteckt hatte. Die rot gestreiften Hosenträger waren der einzige Farbtupfer. Denn auch seine Haut wirkte fahl.
Mit Blick auf meine Hände sagte er: »Ah, meine Eislieferung. Ich hatte mich schon gefragt, wann die wohl eintreffen würde. Da sie auch noch in so netter Begleitung kommt, scheint heute mein Glückstag zu sein. Komm doch rein!«
Er war charmant, ohne charmant sein zu wollen. Das mochte ich an ihm. Das und so viel mehr.
»Ich hoffe, Sie haben nichts gegen Spaghettieis?«
»Gibt es überhaupt jemanden auf der Welt, der etwas gegen Spaghettieis hat?«, konterte er und schloss die Tür hinter mir.
Durch einen kleinen Windfang gingen wir in den Wohnraum, der durch einen hölzernen, altmodischen Tresen von der Küchenzeile abgegrenzt war. Die Schrägen des Hauses schenkten Gemütlichkeit. Viel sichtbares Holz. Eine große Glasfront, wie man sie sonst nur von modernen Loftwohnungen kannte, ermöglichte einen malerischen Ausblick über den Garten und die angrenzenden Heideflächen. An den Wänden stapelten sich Bücher. Das Ledersofa schien fast neu, während vor der großen Fensterscheibe ein abgegriffener, rissiger Sessel stand.
»Hier hat sich eigentlich kaum etwas verändert, seit du zuletzt hier warst. Wann mag das gewesen sein?«
»Das habe ich auch schon überlegt. Zu lange her, wie man immer so schön sagt.«
»Die Bemerkung trifft wahrlich zu. Und doch ist alles beim Alten. Ich bin kein großer Freund von Veränderungen. Zu viel Arbeit, zu viel Kraft, die man auch dafür benutzen kann, mit dem glücklich zu sein, was man hat.« Wieder pfiff er die Melodie seines Lebens, ohne es zu merken. »Lass uns nach draußen gehen, bevor das Eis schmilzt.« Er deutete auf einen kleinen Tisch auf der Terrasse vor der Fensterfront, auf dem bereits das Scrabblebrett aufgebaut stand. Im Hintergrund konnte ich die Umrisse des nun eingewachsenen Gartenteichs erkennen, in dem seine Frau den Tod gefunden hatte. Wie konnte er diesen Anblick tagtäglich ertragen?
»Gern.«
Wir schritten durch die Glastür auf ein Holzdeck, das durch eine Art Markise beschattet wurde. Moos und Spinnennester verrieten mir, dass sie lange nicht mehr eingefahren worden war.
Ich verteilte die Eisbecher, deren Waffeldeckel sich bereits in Schieflage befanden, und er lächelte wie ein kleiner Junge.
»Danke, ich weiß nicht, wann ich zuletzt etwas so sündhaft Leckeres gegessen habe. Ich sollte mir vornehmen, das häufiger zu machen. Wozu noch auf die gute Linie achten?« Er lachte. Dieses Lachen ging in ein Husten über.
Erst jetzt bemerkte ich, dass er vielleicht gar nicht pfiff, sondern dass es sich bei den Geräuschen um seine schwere Atmung handelte. War das schon immer so gewesen oder bloß irgendwann der Zeitpunkt gekommen, an dem das lebensfrohe Pfeifen einem überlebenswichtigen Röcheln gewichen war?
»Doch das darf ich dir gegenüber sicher gar nicht sagen. Eine Ärztin weiß es immer besser.«
Ich kannte kaum eine Berufsgruppe, die als Kollektiv betrachtet nachlässiger mit ihrer eigenen Gesundheit umging. »Ach ja, ich glaube, man sollte es einfach nicht übertreiben, egal was man macht. Eine gesunde Mischung aus allem ist noch das Beste.«
»Da hast du wohl recht. Aber wäre die Welt nicht langweilig, wenn wir alles nur durchschnittlich betreiben würden?«
»Langweilig und einfacher.«
Er stimmte mir zu. Wir aßen einige Minuten schweigend weiter.
»Wie geht es Ihnen?« Ich hatte die Worte bewusst frei formuliert, während ich die zerlaufene Sahne am Boden meines Pappbechers betrachtete.
»Tja, mein Herz will nicht so recht und die Zigarillos schmecken mir besser als meinen Lungen. Die Einsamkeit macht mir ein wenig zu schaffen. Weißt du, die Kinder haben wieder Kinder und selbst die haben nun Kinder. Ich bin dreifacher Urgroßvater. Doch mir scheint, je weiter sich die Gene streuen, desto uninteressanter wird der älteste noch lebende Verwandte. Ich kann es niemandem verübeln. Die Jugend ist nun einmal so.« Er stellte seinen Becher beiseite und ich sah, dass er kaum etwas gegessen hatte. »Also nichts, was eine gute Partie Scrabble nicht beheben könnte«, sagte er und fing an, das Spiel vorzubereiten.
Nachdem wir Buchstaben gezogen hatten, begannen wir zu spielen, als hätten wir die letzten zwanzig Jahre nichts anderes gemacht, als zusammen auf dieser Terrasse zu sitzen und schweigend Worte aus Holzbuchstaben zu formen.
Dann und wann schlug der Lehrer den bereitliegenden Duden auf, wenn er meine dem medizinischen Jargon entstammenden Worte nicht akzeptieren wollte. Ich merkte gar nicht, wie sich langsam, aber unaufhaltbar ein Wort am unteren rechten Spielbrettrand formte, zu dem Herr Johanning ein T, ein G und ein U legte und sagte: »Fünfzehn Punkte. Tagebuch.«
Ich blickte auf, vergaß, welches Wort ich gerade hatte legen wollen. »Wahnsinn, oder?«, entwich es mir.
»Ja, so ist es. Wahnsinn und vermutlich endlich an der Zeit.« Er sah mich nicht an. »Du bist!«
Ich konnte mich nicht auf das Spiel konzentrieren. »Fragen Sie sich nicht, was es mit Ihnen machen würde, wenn man den Mörder Ihrer Frau nach all den Jahren nun doch finden würde?«
Lange schwieg er. Ich war versucht, meine Frage zurückzuziehen.
»Dein Vater hat mir gesagt, dass du ein Problem mit der Arbeit hast, das dich belastet. Er hat nichts Näheres erwähnt, keine Angst. Aber eine Sache möchte ich dir ans Herz legen: Irren ist menschlich, aber dieses Irren zuzugeben und daraus zu lernen, ist das, was uns wachsen lässt. Anderenfalls wird man zum Schatten seiner selbst, und ehe man sichs versieht, ist kein Licht mehr da, das überhaupt noch einen Schatten werfen kann. Ohne das Licht gibt es nichts, was bleibt. Und wenn ein Schatten verschwindet, nimmt niemand Notiz. Verpass den Zeitpunkt nicht wie ich alter Mann.« Er nahm einen Löffel seiner warm gewordenen Eissauce und blickte in die Ferne.
Bevor ich etwas erwidern konnte, ertönte die Türklingel.
»Ah ja«, sagte Johanning, als erwartete er noch Besuch. Er erhob sich umständlich, indem er sich am Tisch abstützte, sodass sich das Spielbrett verzog und schiefe Worte zurückließ. »Entschuldige die Störung.« Dann straffte er den Rücken. Etwas wackelig auf den Beinen setzte er sich in Bewegung. Kurz bevor er die Terrassentür durchschritt, drehte er sich noch einmal um. »Es ist die Schuld. Sie ist das größte Übel. Sie frisst einen auf. Jeden Tag ein bisschen. Bis sie letztlich gewinnt. Denn das tut sie immer bei halbwegs vernünftigen Menschen. Danke, dass du noch einmal hier warst. Es hat mir sehr geholfen.«
Er ließ mich mit dem unguten Gefühl zurück, dass ich meinen unbeschwerten alten Freund vielleicht nie mehr wiedersehen würde.
Frederika, 08.07.1999
Er sagt, ich soll ihn Jo nennen. So würde er sich jünger fühlen. Ich finde es süß. Als wollte er für mich jemand anders sein.
Es ist nichts Verbotenes, was wir tun. Das weiß ich. Und trotzdem fühlt es sich so an. Vielleicht liegt es an den Nachrichten, die wir einander in dem hohlen Astloch der alten Eiche am See hinterlassen. Und daran, wie ich jedes Mal Angst bekomme, dass mich jemand sieht, wenn ich den schmiedeeisernen Wetterhahn in seinem Garten in die andere Richtung gucken lasse, um eine neue Botschaft anzukündigen. Dieser seltsame Hahn … So unscheinbar, wie er da eingewachsen am Beetrand steht und von den üppigen Rosenranken in seiner Position gehalten wird, sodass man sich vorsehen muss, wenn man sich ihm nähert. Genau richtig für unsere Zwecke. Mir zumindest ist er vorher noch nie aufgefallen.
Ich weiß gar nicht, wer von uns die Idee mit den geheimen Nachrichten hatte, aber mir gefällt sie. Wie in einem alten Liebesfilm, obwohl das auf uns natürlich gar nicht wirklich zutrifft.
Eigentlich reden wir ja nur. Aber das bedeutet manchmal so viel mehr als alles andere. Ich meine, wer unterhält sich heutzutage noch wirklich? Alles fing mit diesem Gespräch nach der Theaterprobe an, als ich auf der Bank unter der Eiche saß, weil die Johanning mal wieder völlig ungerecht zu mir war und ich nicht nach Hause wollte. Ich konnte einfach nicht mehr. Die Frau hat doch echt einen Schaden!
Er war so nett, so verständnisvoll. Und obwohl das zwischen uns nichts Verbotenes ist, darf niemand je davon erfahren, dass wir uns nun regelmäßig treffen. Das betont er immer wieder. Was es doch verboten macht. Vielleicht ist das auch der Reiz des Ganzen.
Heute am frühen Abend nach der Probe haben wir uns wieder auf der Bank unter der Eiche getroffen. Als alle weg waren. Das ist jetzt unser Platz. Gut geschützt durch die tief hängenden Äste, etwas abseits vom Weg. Wenn man nicht weiß, dass die Bank dort steht, sieht man sie nicht. Aber man selbst sieht alles. Den ganzen See.
Hauke habe ich gesagt, dass die Johanning mal wieder länger mit mir proben wollte. Das kommt in letzter Zeit so oft vor, dass er das nicht hinterfragt. Und wenn er es doch täte, wüsste ich gar nicht, ob er glauben würde, was dort wirklich geschieht. Ich weiß echt nicht, was die Johanningfürein Problem mit mir hat. Es wird immer schlimmer. Vielleicht hat sie einfach eine Schraube locker. Wer sonst ist bitte so launisch? Manchmal weiß ich nicht, wieso ich mir das Ganze eigentlich noch antue.
Nur Jo weiß, wie es wirklich ist. Vielleicht hat er Mitleid und trifft sich daher mit mir, weil er mir die Rolle ja irgendwie organisiert hat. Aber vielleicht genießt er die Gespräche einfach genauso wie ich. Wir reden über Gott und die Welt. Ich glaube, so viele Worte habe ich in dem ganzen Jahr noch nicht mit Hauke gesprochen.
Heute hat Jo mich nach meinen Zukunftsplänen gefragt. Hauke hat er dabei nie erwähnt. Ich auch nicht. Jo meint, ich sollte Schauspielerin werden. Vielleicht hilft er mir deshalb und übt meine Texte mit mir. Ich mag diese Traumwelt mit ihm, in der ich alles sein kann. Zumal er der Einzige ist, der keine Erwartungen an mich hat.
Kapitel 5
»Albert Johanning?« Eine eiskalte männliche Stimme drang bis zu mir auf die Terrasse.
Instinktiv klaubte ich die Scrabblesteine zusammen und verstaute sie in dem für sie vorgesehenen Samtsäckchen. Der Klang dieser Stimme sagte mir, dass es keine Gelegenheit für eine weitere Partie geben würde.
Die zweite Stimme bestätigte meine Vermutung. Kommissar Ulrich, eindeutig. »Natürlich ist er das, sonst hätte ich euch wohl kaum hierhergeführt.« Der Tonfall wurde sanfter, als er sich an meinen Lehrer wandte. »Entschuldige, Albert, dass wir dich stören. Aber wir müssen dir ein paar Fragen stellen.«
Leise stand ich auf, nahm die Eisbecher und den Spielkarton, wie um die Beweise meiner Anwesenheit zu verschleiern, und ging durch die geöffnete Terrassentür ins Wohnzimmer. Wer war es, den Ulrich da bei sich hatte? Das konnte doch nichts Gutes bedeuten! Lautlos legte ich meine Fracht auf dem Küchentresen ab und versteckte mich hinter der angelehnten Bleiglastür zum Windfang, denn ich war mir sicher, dass ich nichts von diesem Gespräch verpassen wollte.
»Hallo, Harald, meine Herren, wie kann ich weiterhelfen?«
Ich lugte durch den Türspalt. Dort stand mein Lehrer in seinen Hosen, die nun zu groß für seinen Körper schienen. Nicht nur, dass er abgenommen hatte, er wirkte deutlich kleiner als früher. Vielleicht lag es aber auch an dem Vergleich mit den Männern, die ihm gegenüberstanden: Harald Ulrich, der örtliche Polizeichef, der schon immer groß wie ein Bär gewesen war. Nun hatte er sich über die Jahre offenbar das dazugehörige Bäuchlein angelegt, das zu den Pizzeria-Besuchen mit meinem Vater passte. Sein einst rötlicher Bart war nun grau, ebenso die unförmigen Locken, die er früher kurz gehalten hatte, um sie zu Zucht und Anstand zu zwingen. Jetzt hatten sie den Kopf zurückerobert. War er mir als junges Mädchen bedrohlich erschienen, erinnerte er mich heute an ein sprechendes Walross aus einem Kinderfilm, das in einen Lockenwicklereimer gefallen war.
Neben Ulrich sah ich zwei junge Männer stehen, die aufgrund ihrer förmlichen Kleidung – identische Anzüge in Hellgrau und Dunkelblau – und Ulrichs Verhalten nur die Cold-Case-Beamten sein konnten.
Irgendwie wirkten sie grotesk vor der Tür des idyllischen kleinen Hauses meines Lehrers: glattrasiert, eckige, identische Kinnpartien. Sie waren vermutlich nicht älter als ich. Der Mann mit den hellen Haaren sah aus, als würde er die Rolle eines Ermittlers in dem nächsten amerikanischen Streifen spielen, und schien daher besonders finster dreinzublicken. Der Dunklere sah aus, als wäre er die Zweitbesetzung, falls sein Kollege schlappmachte.
»Mein Name ist Mertens«, sagte der Hellere, »das ist mein Kollege Koslowski. Herr Johanning, dürfen wir kurz reinkommen?«
»Wissen Sie, ich habe gerade äußerst wichtigen Besuch, auf den ich mich bereits lange gefreut habe, und würde diesen nur ungern durch Ihre Präsenz verschrecken.«
Nun hörte ich das Pfeifen bei jedem Wort, sein Atem wurde knapper.
Ulrichs Blick wanderte zu dem Volvo meines Vaters, der in der Einfahrt parkte. Er wusste, dass ich hier war.
»Wie Sie wünschen, Herr Johanning. Aber unsere Fragen möchten wir trotzdem loswerden. Wollen Sie Ihren Besuch vorher verabschieden?«
»Das wird nicht nötig sein.« Albert Johanning verkrampfte seinen Griff am Türrahmen. »Es wird wohl nicht allzu lange dauern, oder?«
Die Polizisten wechselten vielsagende Blicke. Mertens holte tief Luft. »Also gut. Herr Johanning, können Sie uns bitte noch einmal genau von ihren Erlebnissen der Nacht vom 14. auf den 15. August 1999 erzählen?«
»Meine Herren, das ist zwanzig Jahre her«, sagte Johanning.
Mertens hatte das Gespräch übernommen. »Vielleicht ist Ihnen inzwischen ja noch etwas eingefallen. Schließlich hatten Sie lange Zeit nachzudenken.«
»Ich bin nicht der Richtige, Ihnen zu erklären, wie das menschliche Gehirn funktioniert, aber zwanzig Jahre später weiß ich nicht mehr als damals.«
»Vielleicht waren wir nicht deutlich genug. Dann drücke ich mich klarer aus: Sie sitzen ganz schön in der Patsche.« Mertens’ Stimme klang nun rau. Ungeduldig.
»Albert, du hast es sicher gehört«, sagte Ulrich. »Es gibt neue Beweise. Und … nun ja, wie soll ich das jetzt sagen? Sie scheinen gegen dich zu sprechen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber was die kleine Petersen da schreibt …«
Mein Puls beschleunigte sich und auch in Johannings Erwiderung lag ein Zögern. »So?«
Mertens fuhr fort. »Herr Johanning, ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihnen ein Anwalt zusteht. Dass Sie uns jetzt nichts sagen müssen. Wir können das Ganze mit Rechtsbeistand auf dem Revier fortführen.«
»Danke, ich bevorzuge diesen Ort hier.«
Mertens warf seinem Kollegen einen Blick zu, nickte dann aber. »Na schön, wollen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Also … Wie gut kannten Sie die Verstorbene?«
Johannings Antwort kam prompt, das Zittern war verschwunden. »Wenn Sie mit der Verstorbenen meine Frau meinen, dann kannte ich sie ausgesprochen gut. Wenn Sie Frederika Petersen meinen, dann kannte ich sie so gut, wie man jemanden kennt, den man als Kind unterrichtet und anschließend einige Male bei Theaterproben betreut hat.«
»Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass Frederika Petersen das offenbar anders sah?«
Herr Johanning schien nun stärker zu schwanken. Ich überlegte, ob ich nicht alle vier hereinbitten und meinen Lehrer in seinem Ledersessel platzieren sollte. Kommissar Ulrich schien Johannings Verfassung ebenfalls aufgefallen zu sein. Er blickte an meinem Lehrer vorbei ins Innere des Hauses. Ich zog meinen Kopf schnell aus dem Türspalt zurück, aber irgendetwas an Ulrichs Blick sagte mir, dass er mich gesehen hatte. »Können wir nicht doch kurz reinkommen, Albert? Willst du dich setzen?«
»Nein, danke, ich genieße lieber die frische Luft.«
»Gehen Sie daher häufiger nachts spazieren?« Mertens ging nicht auf Ulrichs Einwand ein.
»Unter anderem.«
»Kann das jemand bezeugen?«
»In der Regel sind hier draußen nachts keine Menschen unterwegs. Mal ein Kauz oder vielleicht ein Reh.«