
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zacharias-Bartholomäus, der ewige Student, wohnt mit seinem alten Klavier und einem Schatz von selbst erlebten – oder auch nur selbst erfundenen – Geschichten in der Dachkammer von Philippas Großmutter. Er ist Philippas Superheld, der ihre Kindheit mit seinem Zauber erfüllt. Doch eines Tages geht er fort, um Astronaut zu werden, und auf einmal verliert Philippas Welt ihre Farbe und Freude. In einer schlaflosen Nacht denkt sie an die verzauberte Lagune in den peruanischen Anden, von der Zacharias-Bartholomäus ihr oft erzählt hat. Als sie die Augen aufschlägt, ist sie in Peru. Dort begegnet sie der dreizehnjährigen Milagros, die allein eine Familie ernährt, einer weisen Kräuterfrau, einem verruchten Bankräuber und den uralten Schwestern der verzauberten Lagune, die weit in der Vergangenheit zu leben scheinen. Unerwartete Abenteuer und denkwürdige Begegnungen spinnen ihre ganz eigenen Geschichten um Philippas Leben. Wer aber ist der geheimnisvolle Camino? Und vor allem: Können Esel reimen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Zeil, geboren 1980, hat in Freiburg und Benediktbeuern katholische Theologie studiert. Sie liebt Geschichten, Reime, Esel und Peru.
Voller Liebe für meine Familie
Am Strand Stand ein kleines Kind
mit einem Wasserball im Arm,
den plötzlich erfasste der Wind,
der ohne Warnung aufkam.
Er nahm den Ball mit sich
hinaus aufs offene Meer.
Und während der Ball entwich,
weinte das Kind so sehr.
Und als ich ihn entrissen sah
von einer großen Macht,
war etwas in mir den Tränen nah
und ich habe an Dich gedacht.
Inhaltsverzeichnis
1 Wenn einer zu den Sternen will
2 Plötzlich in Santo Rosario
3 Ohne Co-Pilot
4 Können Esel reimen?
5 Milagros
6 Zur verzauberten Lagune
7 Matsch
8 Beben
9 Angst
10 Pablo Bojórguez
11 Räuberische Gedanken
12 Freunde
13 Andenhexe
14 Der Mann im Traum
15 Schwester María-Alegre
16 So weit
17 Veränderung
18 Keine Sternschnuppe
19 Puna
20 Pakete
21 Großmutter
22 Adiós
23 Nach Lima
24 Postkarten
25 Zurück
1
Wenn einer zu den Sternen will
Und plötzlich stand alles still.
Die Schneeflocken hielten in der Luft inne, die Glocken der Kirche vor dem Fenster gaben nur noch einen einzigen, ewig andauernden, nie verklingenden Ton von sich. Die Menschen unten auf dem Weihnachtsmarkt erstarrten, die Lichterketten hörten auf zu blinken, und sogar die Tränen in Philippas Augen wollten nicht mehr fließen.
Nur einer bewegte sich noch: Zacharias-Bartholomäus, der Student. Unten vor der Haustür stand er mit seinem ausgebeulten alten Wanderrucksack und seinem abgenutzten Koffer und winkte hinauf zum Fenster im ersten Stock, wo Philippa ganz still stand und fassungslos zu ihm hinunter starrte.
Seit Philippa als kleines Mädchen nach Freiburg ins Haus ihrer Großmutter gezogen war, war er ihr Student gewesen, der ihr die verrücktesten Geschichten erzählt, die phantasievollsten Geschenke gebastelt und sich für sie die lustigsten Spiele ausgedacht hatte. Er hatte zur Untermiete in Großmutters Haus gewohnt, in der engen Kammer unter dem Dach, wo er all seine Schätze aufbewahrte. Die Augenklappe, die er einem verruchten Karibik-Seeräuber gestohlen hatte, den Ring einer isländischen Vulkanelfe, das bestickte Stofftaschentuch der Prinzessin der Südseeinsel Ni-Malsdage-Wesn und ein Schnurrbarthaar des weiß-roten weißrussischen Orakelkaters. Das Beste aber war ein altes Klavier, welches ihm die Großnichte eines gefeierten aber leider längst verstorbenen ungarischen Komponisten als Wetteinsatz überlassen hatte müssen, weil sie nicht geglaubt hatte, dass er Mozarts kleine Nachtmusik alleine fünfhändig (nämlich mit Händen, Füßen und Nase) spielen konnte. Wie oft hatte Philippa auf der Klavierbank in der Dachkammer neben ihm gesessen, wenn seine Finger über die Tastatur tanzten, geschickt die drei Tasten mieden, die dem ungarischen Meister herausgebrochen waren, und beinahe magische Klänge hervorzauberten.
Nun war sie zwölf, und er ging fort, um Astronaut zu werden, und würde nie wieder zu Philippa zurückkommen. Noch einmal drehte er sich zu ihr um, winkte und grinste unter seiner Mütze hervor und wäre beim Rückwärtsgehen fast mit einer der festlich geschmückten Weihnachtsmarktbuden zusammengestoßen.
Dann war er verschwunden, untergetaucht in der Menschenmasse. Da fielen die Schneeflocken wieder zu Boden, eifrig darauf bedacht, alle Pflastersteine, die noch unter der Schneedecke hervorblitzten, schnell zuzudecken. Die Kirchenglocken setzten ihr Geläut fort. Die Weihnachtsmarktbesucher gerieten wieder in Bewegung, und ein Schluchzen bahnte sich seinen Weg direkt aus Philippas laut trommelndem Herzen, wie ein wildes Tier, das aus seinem Käfig drängte, brach heraus und riss alle Tränen mit sich, so viele auf einmal, dass Philippa kaum noch atmen konnte. Fort, fort, fort. Kein Student mehr. Nur noch Leere. Leere. Leere.
»Weine nur, Philippa«, sagte eine sanfte Stimme hinter ihr, und Philippa fuhr herum und verbarg ihr Gesicht in Großmutters Weste. Diese roch nach Großmutter, nach Rosen und Seife und frisch gebackenen Keksen.
»Er wollte doch Klavierspieler werden! Oder Hochseilartist oder Spieluhrenbauer oder Glasbläser«, schluchzte Philippa durch den wollenen Stoff hindurch. »Das hat er mir immer erzählt. Glasbläser in einer Hütte im Schwarzwald. Nur eine halbe Stunde mit der Bahn von hier. Und jetzt will er plötzlich Astronaut werden und lässt mich allein.«
»Ich weiß, das tut weh«, flüsterte Großmutter, »und es wird noch lange weh tun. Aber wenn einer zu den Sternen will, dann hält ihn nichts auf der Erde. Dann muss man ihn fliegen lassen.«
Noch viele Jahre später, als Philippa längst erwachsen war und selbst drei kleine Töchter hatte, musste sie an diese Worte denken, die ihr die Großmutter an jenem tränenschweren Abend gesagt hatte. Und noch heute glaubt sie, dass ihre Großmutter eine weise Frau war.
Jene Nacht mit den Ereignissen, die sie mit sich brachte, war die sonderbarste im Leben von Philippa Dreisam.
Zum ersten Mal seit sie denken konnte behauptete Philippa, zu alt für Gutenachtgeschichten zu sein, und ging alleine zu Bett. Eine Gutenachtgeschichte von Großmutter vorgelesen zu bekommen hätte Philippa nur noch deutlicher spüren lassen, dass der Student nicht mehr da war. Seit Philippa im Haus ihrer Großmutter lebte, war es immer der Student gewesen, der sie zu Bett gebracht hatte, bis gestern, obgleich sie schon zwölf war. Er brauchte kein Buch, um Geschichten erzählen zu können. Mit geheimnisvoller Stimme wisperte er ihr die Abenteuer zu, die er selbst erlebt hatte, sodass Philippa staunte, erschauderte, losprustete, träumte, zusammenfuhr, sich die Decke über den Kopf zog, den Atem anhielt, freudig in die Hände klatschte und manchmal beinahe ein bisschen weinte. Wenn sie ihn fragte, ob er sich alles nur ausgedacht habe, riss er die Augen weit auf, zog die Brauen fast bis zum Haaransatz hinauf und raunte stets dieselben Worte: »Die ganze Welt ist eine Geschichte, kleine Philippa. Wer mag sie sich ausgedacht haben? Welcher Dichter schrieb sie auf, welcher Zimmermann feilte an ihr, welcher Maler machte sie bunt?«
Und Philippa blickte ihn voller Verwunderung an und wollte immer mehr Geschichten hören, solange bis die Großmutter durch den Türspalt blinzelte, der Student aufsprang, seinen nur vorgestellten Hut vor Philippa zog, sich tief wie ein Kavalier verbeugte und in wilden Pirouetten aus dem Zimmer wirbelte.
Nur manchmal, wenn Zacharias-Bartholomäus abends mit den anderen Studenten in der Bar an der Straßenecke Musik machte und auf seiner Blechflöte spielte, gab es für Philippa keine Gutenachtgeschichte, und Philippa verstand dies und freute sich auf den nächsten Abend.
Doch heute Nacht lag sie mit geschlossenen Augen in ihrem dunklen Zimmer und wusste, dass es keine Gutenachtgeschichten mehr geben würde. Nie mehr. Und sie musste an die verzauberte Lagune hoch oben in den peruanischen Bergen denken, wo Zacharias-Bartholomäus einmal einem schwarzen Reiter auf einem Geisterpferd begegnet war. Und an die zwei urigen uralten Ururururenkelinnen des letzten Urwald-Inkakönigs, die Zacharias-Bartholomäus in ihrem sagenumwobenen Haus vor dem gespenstischen Reiter versteckt gehalten und ihm zum Abschied die silberne Kette mit dem roten Stein geschenkt hatten, die Großmutter nun trug und nie ablegte, auch nicht, wenn sie schlafen ging.
Eine einzelne Träne kullerte über Philippas Nasenrücken und tropfte neben ihrem Ohr aufs Kopfkissen.
Und während sie versuchte, einzuschlafen, um die Leere nicht mehr zu spüren, die der Student und seine mit ihm verschwundenen Geschichten in Großmutters Haus hinterlassen hatten, tauchten immer wieder Bilder in der Dunkelheit vor ihren Augen auf, gleich hinter den geschlossenen Lidern, wo eigentlich kein Bild sein kann. Sie sah hohe, eisbedeckte Berge, die sich in einem kristallklaren See spiegelten. Sie sah zwinkernde Sterne, die ganz nah schienen, und ein Raumschiff, das ihnen entgegenflitzte, und möglicherweise hinter einem der kleinen, runden Fenster das lächelnde Gesicht eines Studenten, der ihr zuwinkte und in der Ferne immer kleiner wurde, bis sein Raumschiff nur noch ein winziger Punkt war, der selbst aussah wie ein Stern. Dann sah sie Menschen mit großen Hüten, vollgepackte Esel, die durch enge Straßen trabten, Raubvögel hoch oben in der Luft, Frauen mit bunten Röcken und langen schwarzen Zöpfen. Sie hörte fremde Musik; Flöten, Gitarren und Trommeln. Und Stimmen in einer Sprache, die sie mit einem Mal an ihre Mutter und die Tage ihrer Kindheit erinnerte. Endlich schlief sie ein.
2
Plötzlich in Santo Rosario
Philippa erwachte davon, dass ihre Stirn unsanft gegen eine Fensterscheibe schlug. Als sie die Augen öffnete, sauste gerade ein Gebirgsbach an ihr vorbei. Dann nahm sie wieder die Stimmen wahr, die sie während des Einschlafens gehört hatte, und ein ungewohnter, ledrig-würziger Geruch stieg ihr in die Nase.
Verwirrt fuhr sie herum, und ein leises Panikgefühl machte sich in ihrer Magengrube breit. Wo war sie bloß?
Philippa war in Peru. Verwunderlich daran war die Tatsache, dass es nicht den leisesten Grund dafür gab, dass sie plötzlich in Peru sein sollte. Sie hatte nämlich weder ein Flugzeug oder ein Schiff bestiegen, noch hatte sie eine Reise geplant, schon gar nicht ohne ihre Großmutter oder – sie schluckte, und sofort war ihr wieder, als versuchte ihr Herz, sich durch ein viel zu enges Schlüsselloch zu quetschen – ohne den Studenten. Zacharias-Bartholomäus war nicht mehr da. Am liebsten hätte sie gleich wieder zu weinen begonnen, aber wenn man mit einem Mal grundlos und unvorhergesehenerweise in Peru auftaucht, muss man so etwas hinten anstellen. Das wusste Philippa. Was sie hingegen nicht wusste, war, dass dies überhaupt Peru war, das Land, von dem Zacharias-Bartholomäus ihr am liebsten erzählt hatte, denn sie war nie zuvor dort gewesen. Das Einzige, was sie ganz sicher wusste, war, dass sie in einem völlig überfüllten Kleinbus mit an die Scheibe gelehntem Kopf und schmerzhaft verspanntem Genick erwacht war, über eine löchrige Straße holpernd, eingepfercht zwischen laut diskutierenden Bäuerinnen mit großen Hüten und schreienden Kindern auf dem Schoß, Körben und bunten Tüchern, aus denen Reisig herausragte (Letzteres wusste sie deshalb so genau, weil gerade in jenem Moment die Frau vor ihr sich erhob und ein Ästchen aus ihrem Bündel gemein in Philippas Nase piekte), alten Männern in Ponchos und einigen Schulmädchen, die mit zusammengesteckten Köpfen tuschelten und kicherten. Ein kleiner Junge trug ein Lämmchen im Arm. Angestrengt überlegte Philippa, wühlte in ihrem Kopf nach irgendeinem Gedankenfetzen, versuchte, sich zu erinnern, wie und weshalb sie hergekommen war. Es gab nichts zu erinnern, aber das konnte sie damals noch nicht wissen, und logisch war es auch nicht.
Noch oft denkt sie heute, nach so vielen Jahren, an diesen Moment zurück, diesen Augenblick, bevor sie alle in ihr Leben traten. Padre Teófilo und Lola, die urigen uralten Ururururenkelinnen des letzten Urwald-Inkakönigs mit ihrem Haus am Ufer der verzauberten Lagune, Milagros, das heldenhafteste Mädchen, dem Philippa je begegnet war, der Bankräuber Pablo Bojórguez, der mysteriöse kupferrote Esel und Camino, der unvergessliche Camino, und dann fällt ihr ein, wie leer ihr Leben gewesen war in jener Nacht, bevor sie es erfüllten mit ihren Geschichten, ihren Gedanken, ihrer unverdienten Liebe, und sie fragt sich, ob sie sie alle irgendwann einmal wieder sehen wird.
Der überfüllte Kleinbus wich jäh einem entgegenkommenden Fahrzeug aus, sodass Philippas Kopf abermals mit der Scheibe kollidierte und sie einen Moment lang mit weit aufgerissenen Augen in den Abgrund hinab starrte, auf den der Bus schnurstracks zusteuerte, ehe er wieder nach rechts lenkte und mit beachtlicher Geschwindigkeit entlang einer Bergwand fuhr. Niemand außer Philippa schien von dem Manöver beeindruckt zu sein, und niemand nahm Notiz von ihr. Wo war sie? Konnte dies ein Traum sein? Ihr Kopf schwamm, was sie darauf zurückführte, dass sie so durcheinander war. Konnte sie doch nicht wissen, dass sie sich bereits auf einer Höhe von fast dreitausendzweihundert Metern im andinen Hochland befand, obgleich sie hinter den Hügeln schon die ins Ewige Eis getauchten Berggipfel hervorblitzen sah.
»¡Bajamos!«, rief die Frau in der Reihe vor ihr, die schon eine Weile zuvor aufgestanden war, woraufhin der Kleinbus scharf bremste, die Schiebetür aufgerissen wurde und die Frau hinauskletterte. Sie trug außer ihrem Korb mit Reisig noch ein buntes Stoffbündel auf dem Rücken, und erst als Philippa zwei kurze Beinchen daraus hervorragen sah, verstand sie, dass die Frau ein Kleinkind auf den Rücken gebunden trug.
»Spanisch«, murmelte Philippa zu sich selbst, während der Bus wieder anfuhr. Die anderen Passagiere sprachen Spanisch, und zumindest das war gut, denn Spanisch war die Sprache ihrer Mutter. Mama kam aus dem spanischen Andalusien und hatte mit Philippa, als diese noch ein kleines Mädchen gewesen war und noch zu Hause bei ihren Eltern gewohnt hatte, immer Spanisch gesprochen. Sie tat es heute noch manchmal, sodass Philippa diese Sprache gut vertraut war.
»Wo sind wir? ¿Dónde estamos?«, fragte Philippa den alten Mann, der in gekrümmter Haltung und mit halb geschlossenen Augen neben ihr saß. Er hatte Lachfältchen um die Augen, schelmisch nach oben gekrümmte Mundwinkel und roch nach Kamille. Auf seinem Schoß trug er eine Tasche aus brüchig gewordenem Leder. Er hob den Kopf und blickte sie aus gütigen dunkelbraunen Augen an.
»Santo Rosario, niña«, antwortete er fast liebevoll, dann wandte er sich wieder ab und versank erneut in seinen Gedanken.
In einiger Entfernung konnte Philippa hinter Kurven einen Ort ausmachen, das war wohl Santo Rosario. Aber wo um alles in der Welt, auf welchem Kontinent, in welchem Land, in welcher verrückten Traum-Wirklichkeit mochte Santo Rosario liegen? Eines war sicher: Im Schwarzwald war es nicht.
Gerade noch fragte Philippa sich, ob es gut sei, dass der Kleinbus mit solch einer Geschwindigkeit in die Kurven fuhr, als sie mit einem Mal die Kuhherde erblickte. Es dauerte für Philippa nur einen Sekundenbruchteil zu erkennen, dass die Herde die gesamte Straßenbreite ausfüllte und dass ein Ausweichmanöver nur an der Bergwand enden oder in die Schlucht hinunter führen konnte. Sie presste die Augen zu und verbarg das Gesicht hinter ihren Armen. Der Bus machte keine Anstalten, zu bremsen. Sie wartete auf den Aufprall, auf Schreie, auf einen Knall, aber nichts geschah.
Zwei angstvolle Sekunden lang harrte sie aus, dann blickte sie hinter den Armen hervor, gerade noch rechtzeitig, um die letzten Kühe nicht nur unverletzt, sondern auch zutiefst unbekümmert hinter dem Bus verschwinden zu sehen.
»Wie kann das sein?«, rief sie. »Wie hat er das gemacht?« Aber wieder nahm kaum einer Notiz von ihr. Keiner. Außer einem.
Sie spürte seinen Blick bevor sie ihn sah. Suchend blickte sie sich um und konnte nichts Befremdliches erkennen, bis sie auf das Augenpaar im Rückspiegel aufmerksam wurde. Ein braunes Augenpaar, welches sie ganz ruhig anschaute und doch eine seltsame Regung in ihr hervorrief. So, als wäre sie ganz nah daran, sich an etwas zu erinnern, was sie vor langer, langer Zeit erlebt hatte. Wenn sie sich getraut hätte, wäre sie über die Sitzbänke hinüber geklettert, um sich den Menschen anzusehen, dem diese Augen gehörten, denn sie zogen Philippa auf geheimnisvolle Weise zu sich, lockten sie, sodass sich ihre Hände unwillkürlich an der Kopfstütze des Vordersitzes festklammerten. Es waren die Augen des Fahrers. Mit einiger Anstrengung wandte sie den Blick ab, und als sie nach Sekunden wieder zum Spiegel aufschaute, war das Augenpaar nicht mehr zu sehen.
Momente verstrichen. Dann kamen die Passagiere in Bewegung.
»Santo Rosario. Endstation!«
Zuletzt stieg auch Philippa aus, und obgleich sie gespannt war wie der Bogen des Mahagonivioloncellos, welches Zacharias-Bartholomäus einmal nach dem fünfhunderteinundneunzigsten siegreichen Mühlespiel in einer Nacht gegen den westindischen Brettspielmeister gewonnen hatte, und wusste, dass gerade etwas Außergewöhnliches mit ihr geschah, ahnte sie nicht, dass der Sprung aus dem Kleinbus der größte war, den sie je in ihrem Leben gemacht hatte.
3
Ohne Co-Pilot
Liebste Philippa,
nun also bist Du hier, und hier wirst Du bleiben. Länger als Du es willst, kürzer als Du es wollen wirst. Deinen Kummer hast Du mitgebracht, aber von so weit oben in den Bergen hat man eine bessere Aussicht, und manches erscheint von hier aus mit einem Mal ganz anders. Und man kann aus der Höhe Dinge entdecken, von denen man vorher gar nichts ahnte.
Gegenüber Fräulein Weemut-Zuckerrohr, Deiner Grundschullehrerin, hast Du Dich lange Zeit sehr klein gefühlt, weil sie so groß und ernst und streng war und so gut rechnen konnte und Du erst sechs warst und die Zahlen in Deinem Kopf durcheinander tanzten und sich nicht subtrahieren lassen wollten.
Dann hat Dich einmal der Student aus seinem Dachfenster schauen lassen, mit dem alten Fernrohr aus dem Vermächtnis von Fergus, dem Forscher, der vorgab, die Sprache der Sterne entschlüsselt zu haben.
Weit über die Dächer von Freiburg konntest Du schauen und auch durch den Hinterhof, bis ins Fenster eines Zimmers, in dem Fräulein Weemut-Zuckerrohr mit Lockenwicklern in den Haaren an ihrem Schreibtisch saß, Lakritzschnecken aß, in der Nase bohrte und mit dem Stuhl schaukelte, bis sie das Gleichgewicht verlor und mit Armen und Beinen fuchtelnd nach hinten sauste.
Einen Moment lang hieltest Du den Atem an, Philippa, und wolltest schon loslaufen, die Treppe hinab, durch den Hinterhof zum Nachbarhaus, um Deiner Lehrerin zu Hilfe zu kommen. Doch dann erschien Fräulein Weemut-Zuckerrohrs roter Kopf wieder im Fenster, und mit erschrockenem Gesicht rappelte sie sich auf, rückte den Stuhl wieder sorgfältig an den Schreibtisch, nahm einen Bleistift und vertiefte sich schnell in die Durchsicht eines Blätterstapels, der vor ihr lag. Sicher war sie froh, dass niemand ihr Missgeschick beobachtet hatte, denn sie konnte ja nicht ahnen, dass Dir das Fernrohr von Fergus, dem Forscher, alles gezeigt hatte.
Von diesem Tag an fandest Du sie gar nicht mehr so ehrfurchteinflößend und fühltest Dich nicht mehr klein in ihrer Gegenwart. Du musstest sogar immer heimlich ein wenig lachen, wenn Du sie sahst. Aber Dein Geheimnis hast Du ihr nie verraten.
Und weißt Du noch, als der Student Dir zum achten Geburtstag ein altes Fahrrad mit Beiwagen geschenkt hat? Er hatte es, so sagte er, von einem Ausflug zum Stamm der Bizzi-Kletten mitgebracht, die auf Eisschollen im Eismeer lebten und einander nur besuchen konnten, wenn sie ihre schwimmenden Fahrräder mit Beiwagen zu Hilfe nahmen. Leider schwammen diese Fahrräder nur im Eismeer, doch auf dem Festland konnte man auf ihnen fahren wie auf gewöhnlichen Fahrrädern.
An Deinem achten Geburtstag flitzte der Student mit Dir durch die ganze Stadt, dass die Passanten nur so aus dem Weg springen mussten, und Du, Philippa, saßest im Beiwagen und der Fahrtwind und das Lachen jagten Dir die Tränen in die Augen. Dann durftest Du radeln, und der Student setzte sich in den Beiwagen. Das war eine Zeit lang recht lustig, bis der Beiwagen in voller Fahrt abbrach und laut scheppernd mit dem Studenten zu Boden krachte, Du das Gleichgewicht verlorst und mit dem Fahrrad in eines der Bächlein stürztest, die durch Freiburg fließen. Zum Glück war Dein Co-Pilot sofort zur Stelle und fischte Dich aus dem Wasser.
»Ich habe dir doch gesagt, dass es nur im Eismeer schwimmt«, lachte er schallend, während er Dir mit seinem Ärmel das verdutzte Gesicht abtrocknete und versuchte, das Wasser aus Deinem langen, dicken Haarzopf zu wringen.
Nun hast Du keinen Co-Piloten mehr, Philippa. Doch Du bist nicht allein auf der Welt. Und nicht allein in Peru.
Die meisten Passagiere waren schon ihrer Wege gezogen, und auch der Kleinbus war quietschend und ratternd einem neuen Ziel entgegengefahren, da stand Philippa noch immer reglos an der Haltestelle und blickte auf die unbekannte Stadt hinunter. Santo Rosario.
Aus der Mitte eines Meers aus fremdartigen lehmbraunen Häusern ragten zwei Kirchtürme mit roten Kuppeldächern empor, und ihre großen Bogenfenster schienen zu Philippa hinaufzuschauen und sie neugierig zu beäugen.
»¿Estás sola, niña? Bist du ganz alleine, Kind?«, fragte eine Stimme hinter ihr, und als Philippa sich umdrehte, erkannte sie den alten Mann, der im Bus neben ihr gesessen, nach Kamille gerochen und ihr den Namen des Ortes verraten hatte. »Du bist nicht aus Santo Rosario. Ich habe dich noch nie hier gesehen, und ich kenne jede Seele in Santo Rosario. Du bist überhaupt nicht aus Peru, hab ich recht?«
Peru, also! Ohne zu antworten blickte Philippa den alten Mann an. Er hatte ein freundliches Lächeln, das ihn ein paar Augenblicke lang viel jünger wirken ließ. Trotzdem. Was sollte das alles? Auch wenn sie die Geschichten geliebt hatte, die der Student über Peru erzählt hatte: Sie wollte nicht hier sein. Nicht jetzt, nicht so plötzlich und nicht allein. Und schon gar nicht ohne zu wissen, wie sie hergekommen war.
»Ich möchte nach Hause zu meiner Großmutter in Freiburg«, sagte sie leise und merkte, wie ihre Stimme zu zittern begann. »Und zu Zacharias-Bartholomäus.«
Ganz leicht zog der alte Mann die Augenbrauen über der Nasenwurzel zusammen, gerade so, als würde er über etwas nachdenken.
»Ich bin Padre Teófilo, der Pfarrer von Santo Rosario«, sagte er und legte ganz sachte eine Hand auf Philippas Schulterblatt. »Was hältst du davon, wenn wir hinunter ins Pfarrhaus gehen, ich dir einen Tee mache und du mir deine Geschichte erzählst?«
»Hab keine Angst um Philippa, Patrizia«, sagte der junge Mann zu Großmutter, »sie wird viel Gutes erfahren und zurück sein, wenn die Zeit dafür gekommen ist.«
»Wenn du das sagst, habe ich keine Angst um sie«, antwortete Großmutter. »Ich vertraue sie dir an.«
Philippa saß mit einer Tasse Tee in der einen und einem Stück Fladenbrot in der anderen Hand in der kleinen weiß gekalkten Küche des Pfarrhauses. Auf ihrem Schoß lag eine dürre silbergraue Tigerkatze, die behaglich schnurrte und hin und wieder eine ihrer Krallen in Philippas Bein bohrte.
Philippa, Padre Teófilo und Lola, eine rotbäckige junge Frau, die in der Pfarrküche arbeitete, blickten einander ratlos an. Keiner von den dreien hatte jemals von einer Zwölfjährigen gehört, die sich abends im Haus ihrer Großmutter schlafen legte und am nächsten Tag auf der anderen Seite der Erdkugel erwachte. Über den einzigen Fernsprechapparat, den es in der kleinen Stadt gab, hatten sie Großmutter in Freiburg angerufen, und seltsamerweise hatte Großmutter Philippas Geschichte sofort geglaubt und nur gesagt, sie solle gut auf sich aufpassen und bald zurück kommen.
Philippa schüttelte den Kopf. Hatte Großmutter so viele der Erzählungen des Studenten gehört, dass sie solche Dinge tatsächlich für möglich hielt?
»Wir müssen dich zurückschicken«, murmelte Padre Teófilo. »Wir müssen dich in die Hauptstadt bringen, zur Behörde. Dort muss man doch irgendetwas für dich tun können.«
»Dann lass uns fahren«, rief Philippa und sprang auf, sodass die dürre Tigerkatze mit einem schrillen Miauen in die Höhe fuhr und verärgert im Flur verschwand.
Doch Padre Teófilo schüttelte voll Bedauern den Kopf. »Die Hauptstadt ist weit, mein Kind, und über den Bergen bricht schon die Dunkelheit herein. Heute Nacht wirst du hier bleiben müssen. Lola nimmt dich mit hinauf und zeigt dir, wo du schlafen kannst.«
Lola war begeistert, ein Kind im Haus zu haben.
»Wenn Juan zurück kommt«, sagte sie, während sie Philippa mit der fünften groben Wolldecke zudeckte, »möchte ich auch Kinder haben. Mindestens sieben!« Verträumt blickte sie aus dem Fenster in die Nacht hinaus. Die nackte Glühbirne, die von der Decke baumelte und das Zimmer schwach erhellte, flackerte. »Oh, wenn er doch bald zurückkäme! Dann heiraten wir und bauen uns ein Haus. Dann musst du mich besuchen kommen, Felipa!« Sie breitete die Arme aus und drehte sich wie eine Ballerina um ihre eigene Achse. »Du bekommst dein eigenes Zimmer, ein viel schöneres als dies hier, und jeden Tag kannst du –«
»Ich bleibe nicht hier!«, fiel ihr Philippa etwas zu heftig ins Wort. »Morgen fahre ich mit Padre Teófilo zur Behörde, und die schickt mich zurück nach Deutschland zu Großmutter.«
Da sah Lola mit einem Mal etwas traurig aus, deshalb fügte Philippa schnell hinzu: »Wo ist denn Juan? Wann kommt er wieder?«
Sofort hellte sich Lolas Miene auf, und sie setzte sich auf Philippas Bett. »Er ist nach Lima gefahren, in die Hauptstadt. Schon vor drei Jahren, gleich nach unserem Schulabschluss. Hier oben in den Bergen gibt es wenig Arbeit, so versucht er sein Glück unten, an der Küste, in der Hoffnung, genug Geld zu verdienen für ein gutes Leben hier in den Anden. Mal arbeitet er als Taxifahrer, mal hilft er Häuser bauen, verlegt Wasserrohre, verkauft Bananen auf dem Markt, fegt Straßen, putzt Autoscheiben, sammelt Müll auf, springt als Tankwart ein oder montiert Reifen.« Immer weiter in die Ferne rückte ihr verträumter Blick. »Seit drei Jahren haben wir uns nicht gesehen, aber jeden Monat schreibt er mir einen Brief. Sobald er genug gespart hat, kommt er zurück nach Santo Rosario, und dann wird geheiratet.«
Wenn Philippa das Gefühl hatte, Juan würde nicht in die Berge zurückkommen, so verschwieg sie es, denn Lola sah aus, als würde sie im nächsten Moment auf einer Wolke durch das Fenster in die Dunkelheit hinaus schweben.

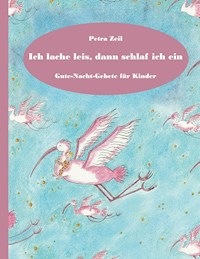


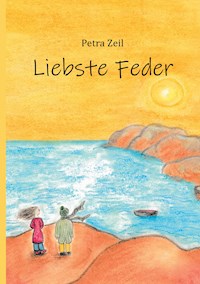














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









