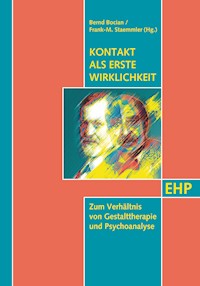
Kontakt als erste Wirklichkeit E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHP Edition Humanistische Psychologie
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: EHP-Edition Humanistische Psychologie
- Sprache: Deutsch
Das Buch verfolgt vor allem das Ziel, den Dialog zwischen Gestalttherapie und Psychoanalyse aufzunehmen und zu einer ausgewogenen Aufmerksamkeit für ihre Gemeinsamkeiten und Differenzen beizutragen. Es gibt in der Psychoanalyse die verbreitete Einsicht, dass nicht alle Störungen auf der Couch behandelt werden können. Die Geschichte der Psychoanalyse ist auch die Geschichte ihrer Orthodoxie. Ob Jung oder Rank, ob Ferenczi oder Reich, ob Fromm oder Perls - wer sich als Analytiker deutlich vom Mainstream entfernte, musste damit rechnen, zum Häretiker oder Dissidenten erklärt zu werden. Die neuere Psychoanalyse, insbesondere jene Strömungen, die sich "relational" bzw. "intersubjektiv" nennen, betonen inzwischen sehr viel stärker als früher die Bedeutung des aktuellen persönlichen Kontaktgeschehens zwischen Therapeut und Klient und legen sehr viel weniger Wert auf die Analyse der Übertragung. Sie nähert sich damit einer Position, die innerhalb der Gestalttherapie schon sehr viel länger vertreten wird. Umgekehrt hat sich unter Gestalttherapeuten eine größere Aufmerksamkeit für die entwicklungspsychologische Dimension, für Anamnese und Diagnostik entwickelt, wie sie in der Psychoanalyse schon sehr früh zu beobachten war. Dieses Buch ist nicht nur Teil des so lange überfälligen Dialogs zwischen Psychoanalyse und Gestalttherapie, sondern es trägt auch selbst dazu bei, dass dieser Diskurs vorankommt. Mit Beiträgen von: Martin Altmeyer, Frank-M. Staemmler, Bernd Bocian, Werner Bock, Lynne Jacobs, Tilmann Moser
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EHP – Edition Humanistische Psychologie
Hg. Anna und Milan Sreckovic
Die Herausgeber
Bernd Bocian, Dr. phil., Jg. 1954; Psychotherapeut (PtG) und Gestalttherapeut mit Weiterbildung in Reichianischer Körperarbeit und Tiefenpsychologischer Psychotherapie. Von 1985 bis 2000 Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gestalttherapie. Diverse Veröffentlichungen zum historischen und aktuellen Verhältnis von Gestalttherapie und Psychoanalyse. Autor des Buches Fritz Perls in Berlin 1893–1933: Expressionismus – Psychoanalyse – Judentum, von dem eine englische,italienische und spanische Übersetzung vorliegt. Lebt in Genua/Italien, ist dort Mitarbeiter der Quaderni di Gestalt und assoziiertes Mitglied der Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe). [email protected]
Frank-M. Staemmler, Dr. phil. Dipl.-Psych., Psychologischer Psychotherapeut, Jg. 1951; ist Mitbegründer des Zentrums für Gestalttherapie in Würzburg, und dort seit 1976 als Gestalttherapeut, Ausbilder und Supervisor tätig. Er ist Autor bzw. Herausgeber zahlreicher Fachartikel und mehrerer Bücher zu psychotherapeutischen Themen – zuletzt Das Geheimnis des Anderen – Empathie in der Psychotherapie und Was ist eigentlich Gestalttherapie? – Eine Einführung für Neugierige. Er war von 2002 bis 2006 Herausgeber des International Gestalt Journal und von 2007 bis 2009 Mitherausgeber der Studies in Gestalt Therapy. Er ist international in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten tätig und tritt häufig als Referent bei Tagungen und Kongressen im In- und Ausland auf. Sein aktueller Interessenschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Intersubjektivitäts- und Dialogischen Selbsttheorien sowie deren Umsetzung in die therapeutische Praxis. www. frank-staemmler.de. / [email protected]
© 2013 EHP – Verlag Andreas Kohlhage, Bergisch Gladbach www.ehp.biz
Der Beitrag von Lynne Jacobs wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Ludger Firneburg; Originaltitel: Insights from psychoanalytic self-psychology and intersubjectivity theory for gestalt therapists. The Gestalt Journal 1992, 15/2, 25-60.
Redaktion: Nina Zimmermann
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufb ar.
Umschlagentwurf: Gerd Struwe, Uwe Giese
Satz: MarktTransparenz Uwe Giese, BerlinGedruckt in der EU
Alle Rechte vorbehaltenAll rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.
print-ISBN 978-3-89797-082-3epub-ISBN 978-3-89797-566-8pdf-ISBN 978-3-89797-567-5
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Die Wiederentdeckung der Beziehung – Ein Paradigmenwechsel im psychoanalytischen Gegenwartsdiskurs (Martin Altmeyer)
Kontakt als erste Wirklichkeit – Intersubjektivität in der Gestalttherapie (Frank-M. Staemmler)
Von der Revision der Freud’schen Theorie und Methode zum Entwurf der Gestalttherapie – Grundlegendes zu einem Figur-Hintergrund-Verhältnis (Bernd Bocian)
Der Glanz in den Augen – Wilhelm Reich als ein Wegbereiter der Gestalttherapie (Werner Bock)
Zur Theorie regressiver Prozesse in der Gestalttherapie – Über Zeitperspektive, Entwicklungsmodell und die Sehnsucht nach Verständnis (Frank-M. Staemmler)
Der Schiefe Turm von Pisa – oder: Das unstimmige Konzept der »frühen Störung« (Frank-M. Staemmler)
Erkenntnisse der psychoanalytischen Selbstpsychologie und Intersubjektivitätstheorie für Gestalttherapeuten(Lynne Jacobs)
Geschichte und Identität – oder: Vom Wieder-in-den-Fluss-Steigen, ohne die Konturen zu verlieren (Bernd Bocian)
»Das Wichtigste ist die Flexibilität« – Ein Interview (Tilmann Moser & Frank-M. Staemmler)
Die Autoren
Anmerkungen & Literatur
Vorwort der Herausgeber
Wir alle kommen von Freud.(Lore Perls)
Es gehört zu den historischen Tatsachen, dass sich viele moderne Formen der Psychotherapie aus der Psychoanalyse heraus entwickelt haben – sei es in enger Verbindung mit ihr, sei es in heftiger Abgrenzung gegen sie. Das gilt mit Sicherheit für die Gestalttherapie, und zwar in beiderlei Hinsicht.
Ein Teil dieser historischen Tatsachen besteht darin, dass die deutschen Begründer der Gestalttherapie ihre psychoanalytische Ausbildung in Berlin, Frankfurt am Main und Wien absolvierten. Friedrich Salomon Perls und Lore Perls mussten, wie die Mehrzahl ihrer zumeist ebenfalls deutsch-jüdischen Kolleginnen und Kollegen, vom linken Flügel des damaligen Berliner Instituts bereits im Jahre 1933 emigrieren. Der Weg der beiden Perls, der zur Gründung einer eigenen Schule führen sollte, begann als »eine Revision der Freud’schen Theorie und Methode« (so der Untertitel von Perls’ 1942 veröffentlichtem ersten Buch); diese Revision weist deutliche Parallelen zu den Revisionen anderer psychoanalytischer Freigeister auf, die in ihrer therapeutischen Praxis gleichfalls innovativ und in ihrer politischen Haltung gesellschaftskritisch waren, wie z. B. Wilhelm Reich.
Wenn sie ihre neuen Vorgehensweisen in späteren Jahren demonstrierten, haben die Perls die Unterschiede zur orthodoxen Psychoanalyse bisweilen recht einseitig betont – eine Haltung, die in der Folge zu einer forcierten Abgrenzung von Gestalttherapeuten gegenüber der Psychoanalyse führte und von Psychoanalytikern gerne mit Nichtbeachtung, Abwertung oder heftiger Kritik an der Gestalttherapie beantwortet wurde. Im Zuge solcher Auseinandersetzungen kamen die Beschäftigung mit den Gemeinsamkeiten und der kollegiale Dialog zwischen beiden therapeutischen Richtungen aus unserer Sicht viel zu kurz. Ein borniertes, auf die jeweils eigene Therapieschule begrenztes Denken ist jedoch heute nicht mehr zeitgemäß.
Als wir uns Ende der 1990er-Jahre zum ersten Mal mit der Herausgabe des Buches »Gestalttherapie und Psychoanalyse« (Bocian & Staemmler 2000) beschäftigten, verfolgten wir daher vor allem das Ziel, den Dialog zwischen Gestalttherapie und Psychoanalyse anzuregen und zu einer gleichmäßigen Aufmerksamkeit für die Verbindungen und die Differenzen zwischen ihnen beizutragen. Wir wissen natürlich nicht, inwiefern unser damaliges Buch tatsächlich dazu beigetragen hat, dass sich die Situation in den Jahren seither deutlich verändert hat. Aber es hat vielleicht einen kleinen Beitrag zu jenen erfreulichen Konvergenzen geleistet, die sich seither – nicht nur im deutschsprachigen Raum – zwischen den neueren Entwicklungen in der Gestalttherapie einerseits und der Psychoanalyse andererseits ergeben haben.
Die Konvergenzen zeigen sich nicht nur in vielen Bereichen und Aspekten der therapeutischen Theorien und Praxen, sondern auch in häufigeren und intensiveren persönlichen Kontakten zwischen Vertretern der beiden Richtungen. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen: Die neuere Psychoanalyse, insbesondere jene Strömungen, die sich »relational« bzw. »intersubjektiv« nennen, betonen inzwischen sehr viel stärker als früher die Bedeutung des aktuellen persönlichen Kontaktgeschehens zwischen Therapeut und Klient und legen sehr viel weniger Wert auf die Analyse der Übertragung. Sie nähert sich damit einer Position, die innerhalb der Gestalttherapie schon sehr viel länger vertreten wird (vgl. z. B. Staemmler 1993). Umgekehrt hat sich unter Gestalttherapeuten eine sehr viel größere Aufmerksamkeit für die entwicklungspsychologische Dimension entwickelt, wie sie in der Psychoanalyse schon sehr früh zu beobachten war.
Zugleich begannen Psychoanalytiker, den noch vor 20 Jahren nahezu ausschließlich hervorgehobenen Stellenwert der frühen Kindheit für das spätere psychische Geschehen bei Erwachsenen zu relativieren und Entwicklungen im Jugend- und Erwachsenenalter stärker zu gewichten. Dieser neuere Blickwinkel »würdigt das Phänomen der Entwicklung als einen fortwährenden, lebenslangen Prozess, der nicht nur eine Vergangenheit hat, sondern auch in der Gegenwart existiert und sich auf eine Zukunft zubewegt« (Emde 2011, 779) und nähert sich damit gestalttherapeutischen Positionen deutlich an. Auf der anderen Seite hat die Gestalttherapie ihren früher übertrieben engen Fokus auf das Hier-und-Jetzt deutlich erweitert und schenkt der Zeitdimension als einem Kontinuum ausgiebigere Beachtung (vgl. z. B. Polster 1985; Staemmler 2001; 2011).
Auch auf persönlicher Ebene hat sich einiges getan. So begegnen viele Gestalttherapeuten und Psychoanalytiker einander inzwischen mit Aufgeschlossenheit und Interesse; z. B. kooperieren sie nicht nur im Rahmen von Tagungen, Arbeits- und Supervisionsgruppen oder Buchprojekten, sondern lassen sich auch auf freundschaftliche Beziehungen ein. In einem Interview mit der italienischen Gestalttherapeutin Margherita Spagnuolo Lobb sagt die intersubjektive Psychoanalytikerin Donna Orange:
In dieser Periode meines Lebens schreibe ich nicht nur für Psychoanalytiker, sondern für alle, die ich als Humanisten in der Psychotherapie definiere, zu denen ich besonders die Gestalttherapie rechne. Ich arbeite mit Personen wie Lynne (Jacobs), Frank (Staemmler), Dan (Bloom) und jetzt mit dir sowie anderen Gestalttherapeuten zusammen – Personen die ich sehr schätze –, und ich will nicht mehr exklusiv für Psychoanalytiker schreiben. (Orange & Spagnuolo Lobb 2010, 25)
Wir können in diesem Zusammenhang auch von eigenen positiven Erfahrungen berichten: Bernd Bocian ist in Italien seit Jahren assoziiertes Mitglied der Genueser Gruppe der SIPRe (Italienische Vereinigung der relationalen Psychoanalyse), wo er u. a. an einer Intervisionsgruppe teilnimmt. Dort hat er die Erfahrung gemacht, dass sein ins Englische und ins Italienische übersetztes Buch »Fritz Perls in Berlin« (Bocian 2007; engl.: 2010; ital.: 2012) auch bei psychoanalytischen Kollegen auf Interesse stößt, was zu positiven Rezensionen in wichtigen psychoanalytischen Fachzeitschriften (Ricerca Psicoanalitica; Psicoterapia e Scienze Umane) geführt hat. Die italienischen Gestalttherapeuten der Gruppe von Margherita Spagnuolo Lobb stehen übrigens seit einigen Jahren in freundschaftlich-kritischem Austausch mit Daniel Stern von der Boston Change Process Study Group.
Frank-M. Staemmler unterhält persönlichen Kontakt mit Bob Stolorow (vgl. z. B. Stolorow 2007a; Stolorow, Brandchaft & Atwood 1996) und ist befreundet mit Donna Orange (vgl. z. B. Orange 2004; 2011), zwei Psychoanalytikern der intersubjektiven Orientierung, die in entsprechenden Veröffentlichungen ihre weitgehende Übereinstimmung mit seinen Positionen, zum Beispiel zum Thema Empathie (Staemmler 2009), bekundet haben (vgl. Orange 2009; Stolorow 2007b).
Als wir nun vor der Wahl standen, das Buch aus dem Jahr 2000 entweder einfach nur neu aufzulegen oder aber es zu überarbeiten, wurde uns klar, wie umfangreich und weitgehend die seither stattgefundenen Veränderungen sowohl innerhalb der Psychoanalyse als auch innerhalb der Gestalttherapie gewesen sind. Wir haben uns daher entschieden, einige zusätzliche Texte in das hiermit nunmehr unter verändertem Titel erscheinende Buch aufzunehmen, die schlaglichtartig die Konvergenzen der letzten Jahre beleuchten.
Wir haben dabei weder den Anspruch, eine umfassende Bestandsaufnahme des aktuellen Diskussionsstandes zu leisten – es gibt erfreulicherweise schon sehr viel mehr Literatur zum Thema als wir in dieses Buch aufnehmen konnten –, noch die Absicht, die grundlegenden erkenntnistheoretischen Fragen zu behandeln, die sich aus den verschiedenen anthropologischen und philosophischen Grundannahmen beider Therapieverfahren ergeben. Das alles wäre sicher wünschenswert und interessant, kann aber nicht zugleich geschehen.
Das Buch beginnt mit einem kurzen Beitrag von Martin Altmeyer, in dem dieser die »Wiederentdeckung der Beziehung« in der Psychoanalyse als einen Paradigmenwechsel würdigt und in ihrer Bedeutung für die Praxis charakterisiert. In dem darauf folgenden Text von Frank-M. Staemmler (»Kontakt als erste Wirklichkeit«) geht es gleichfalls um die grundlegende Bedeutung des unmittelbaren Kontakts sowie der intersubjektiven Dimension in der Psychotherapie; viele der dabei verwendeten Quellen werden heute sowohl von fortschrittlichen Gestalttherapeuten als auch von modernen Psychoanalytikern zur Begründung ihrer jeweiligen Positionen herangezogen.
Es folgt ein umfangreicher Text von Bernd Bocian, der die historischen Entwicklungen detailliert nachzeichnet, in deren Verlauf die Gestalttherapie sich formiert hat. Er macht deutlich, dass die beiden Perls zwar durch die Verarbeitung unterschiedlicher Einflüsse und durch die Zusammenarbeit mit Paul Goodman in Amerika zum Entwurf eines eigenen Ansatzes kamen. Darin aber integrierten und bewahrten sie zugleich wertvolle Impulse, die der Freudianischen Psychoanalyse zu einem großen Teil durch die von ihren orthodoxen Vertretern praktizierte Ausgrenzung Andersdenkender verloren gegangen sind. Dies wird am Beispiel Wilhelm Reichs in besonderer Weise deutlich. Darum haben wir der Übersicht von Bernd Bocian einen Text von Werner Bock beigestellt, der sich eingehend mit der wichtigen Bedeutung des psychoanalytischen ›Dissidenten‹ Wilhelm Reich für die Entwicklung der Gestalttherapie befasst.
Auf diese historisch orientierten Kapitel folgen drei Beiträge, die sich schwerpunktmäßig mit praktisch-therapeutischen Fragen befassen und dabei sowohl aus psychoanalytischen als auch aus gestalttherapeutischen Quellen schöpfen. Frank-M. Staemmler erläutert sein gestalttherapeutisches Verständnis von der Arbeit mit regressiven Prozessen, wobei er sich einerseits vom psychoanalytischen Regressionsbegriff abgrenzt, zugleich aber auch auf wichtige analytische Autoren und ihre Regressionskonzepte zurückgreift. In einem weiteren Beitrag setzt sich Frank-M. Staemmler kritisch mit dem Konzept der sogenannten frühen Störung und ihren theoretisch praktischen Implikationen auseinander. Lynne Jacobs, die die oben erwähnten Konvergenzen personifiziert und sich sowohl als Gestalttherapeutin als auch als intersubjektive Psychoanalytikerin versteht, versucht in ihrem Kapitel, Parallelen zwischen neueren Strömungen innerhalb der Psychoanalyse, nämlich Objektbeziehungstheorie und Intersubjektivitätstheorie, und gestalttherapeutischen Positionen aufzuzeigen.
In einem weiteren Beitrag vertritt Bernd Bocian die Ansicht, dass es sich bei dem Entwurf der Gestalttherapie von Perls, Hefferline und Goodman (1951) um ein innovatives Projekt handelte, das die Tradition einer interaktiv verstandenen Psychoanalyse aufnahm und konsequent weiterführte. Zudem weist er auf die Potenziale hin, die sich für eine so kontextualisierte Gestalttherapie heute ergeben.
Das Buch schließt mit einem Interview, das Frank-M. Staemmler mit Tilmann Moser über einige historische und aktuelle Themen geführt hat, die das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Gestalttherapie betreffen.
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre. Wenn Sie Feedback für uns haben, freuen wir uns; unsere E-Mail-Adressen finden Sie im Verzeichnis der Autoren. Rückmeldungen an die einzelnen Autoren leiten wir gerne an diese weiter.
Abschließend wollen wir noch darauf hinweisen, dass wir der besseren Lesbarkeit zuliebe auf die Verwendung maskuliner und femininer Formen verzichtet haben. Wir bitten natürlich besonders die Leserinnen um ihr Verständnis dafür und hoffen, dass sie sich auch durch die konventionellen, maskulinen Formulierungen angesprochen fühlen können.
Bernd Bocian und Frank-M. Staemmler
Martin Altmeyer
Die Wiederentdeckung der Beziehung – Ein Paradigmenwechsel im psychoanalytischen Gegenwartsdiskurs
Die Psychoanalyse hat das Graben in der Tiefe übertrieben. Im Fluss des Lebens fließt alles mehr oder weniger weit oben. Die allertiefste Tiefe ist eine Illusion. (Sudhir Kakar, Indischer Psychoanalytiker)
1. Die intersubjektive Wende: Modernisierung der Psychoanalyse
Obwohl es sich im Kern um die Entfaltung eines ureigenen Potenzials der Psychoanalyse handelt – um eine Wiederentdeckung der Beziehung nämlich –, kann man bei dieser Tendenz, die seit den 1980er-Jahren zu erkennen ist, von einem Paradigmenwechsel sprechen. Etwas verkürzt können wir es so ausdrücken: Was seit der Aufgabe der Verführungstheorie zum »äußeren Faktor« erklärt worden, als »durchschnittlich zu erwartende Umwelt« (H. Hartmann) neutralisiert geblieben oder in esoterischen Tiefenspekulationen über eine aparte Innenwelt ganz aus dem psychoanalytischen Blick verschwunden war, kehrt in die Theorie und klinische Praxis der Psychoanalyse zurück: die für die Psyche konstitutive Bedeutung von sozialen Beziehungen und einer widerständigen Außenwelt.
Mit dieser Rückkehr wird nicht nur der entscheidenden Wirkung von Interaktion und Handeln auf die Strukturbildungen der Psyche Rechnung getragen, sondern auch das Denken-in-Beziehungen von Innen, Außen und Zwischen psychoanalytisch erneuert. Diese Erkenntnis nötigt dazu, unser dynamisches Verständnis des psychischen Geschehens aus den Beschränkungen eines epistemisch überholten Organismus-Modells heraus zu lösen, das uns immer noch glauben lässt, die Seele sei eigentlich im Körper zu Hause und suche bloß notgedrungen Kontakt zur physischen und sozialen Umwelt. Stattdessen wird die Psyche heute eher als Organ der Vermittlung von innen und außen verstanden, das dementsprechend strukturiert ist. Die Psyche ist ihrer Natur nach relational; es gehört zu ihren Hauptfunktionen, zwischen Innen und Außen, Selbst und Objekt, Ich und Realität zu vermitteln. Der Mensch ist keine Monade. Das werdende Subjekt bedarf nicht nur einer »haltenden«, sondern auch einer resonanten und responsiven Umgebung, wenn es so etwas wie Identität ausbilden will: der Spiegelung im Anderen, der Anerkennung durch signifikante Bezugspersonen, einer »freundlichen« Realität. Im lächelnden Gesicht der Mutter erhält der Säugling eine erste Ahnung davon, wer er ist: Wenn ich gesehen werde, bin ich. Auf die identitätsstiftende Wirkung intersubjektiver Spiegelung hat schon Donald Winnicott (1971) verwiesen, den man innerhalb der Psychoanalyse zusammen mit Michael Balint (1969) und Hans Loewald (1986) zu Recht als Pionier ihrer intersubjektiven Wende würdigt.
Wer die Theoriegeschichte der Psychoanalyse rückwärts liest, wird ihren relationalen Charakter bereits in Freuds Formulierung entdecken, das Ich verdanke sich dem Niederschlag vergangener Objektbeziehungen und könne als eine Art Sediment seiner eigenen Interaktionsgeschichte begriffen werden (Freud 1923/1940). Auch das lebenslange Bedürfnis geliebt zu werden, das Freud zum Kern des Narzissmus erklärt (Freud 1914/1963) und entwicklungspsychologisch aus der neonatalen Abhängigkeit des Säuglings ableitet (Freud 1926/1948), steht quer zu seiner Triebpsychologie, die den Narzissmus bekanntlich als libidinöse Besetzung des Selbst definiert und zur objektlosen Selbstliebe erklärt hatte (vgl. Altmeyer 2004).
Allerdings handelt es sich bei solchen Fundstücken um eine metapsychologische Seitenlinie im Werk des Begründers der Psychoanalyse, den man deshalb nicht zum Urvater ihrer intersubjektiven Wende erklären sollte. Denn ungeachtet der Einsprüche, z. B. von Sandor Ferenczi (1932/1984), blieb Freud in der von Descartes gebahnten Spur eines Innen-Außen-Dualismus befangen, der ein vermittelndes Drittes und damit ein Zwischen (= Inter) nicht kennt. Die metapsychologische Trennung von Subjekt und Objekt spiegelte sich auch im antagonistischen Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, Trieb und Kultur, Fantasie und Realität – Gegensätze, die Freud weitgehend unvermittelt ließ. So übertrug sich die monadologische Perspektive der Triebtheorie in die Strukturtheorie, in die Entwicklungspsychologie und in die klinische Theorie und konnte sich selbst auf die psychoanalytische Sozialpsychologie ausdehnen, wo die intrapsychischen Begriffe im gesellschafts- und kulturkritischen Anwendungsdiskurs sozialpsychologisch überdehnt wurden.
Prominente Vertreter der Psychoanalyse, die deren latente Intersubjektivität zu entfalten versuchten (wie John Bowlby, Harry Stack Sullivan, W. R. D. Fair-bairn, Sandor Rado oder Erich Fromm), wurden als »Dissidenten« ausgegrenzt oder verließen freiwillig die psychoanalytische Vereinigung, um eigene Schulen aufzubauen. Dazu gehörten nicht zuletzt auch Carl Rogers und Fritz Perls mit ihren Bemühungen, vom trieb- und Ich-psychologischen Mainstream ihrer Zeit abweichende psychotherapeutische Methoden zu entwickeln.
Inzwischen hat die intersubjektive Wende sämtliche Schulen des psychoanalytischen Pluralismus ergriffen, wenn auch in unterschiedlicher Reichweite und Tiefe. Heute rechnen sich die meisten Strömungen, von den (Post-) Kleinianern und Bionianern bis hin zur Selbstpsychologie, von den Adler-Schülern bis zu denen von C. G. Jung einer – in einem übergreifenden Sinne des Begriffs – relationalen Psychoanalyse zu (als »Relationale Psychoanalyse« im engeren Sinne bezeichnet sich eine eigene, von Stephen Mitchell und Jessica Benjamin begründete Schule). Die Amöbensage ist verabschiedet, und man stützt sich übereinstimmend auf eine intersubjektive Entwicklungstheorie. Ein dialogisch-interaktives Verständnis der analytischen Situation wird miteinander geteilt. Eine Philosophie der Beteiligung, der Aktivität, des Engagements hat die klassische Vorstellung von der Neutralität des Analytikers ersetzt, der einmal als objektiver Beobachter, weiße Wand oder glatter Spiegel fungieren sollte.
Die Unterschiede der verschiedenen Strömungen betreffen auf klinischer Ebene eher praktische Fragen, etwa die Art der Rollenverteilung zwischen Analytiker und Analysand, die spezifische Qualität der therapeutischen Beziehung, die Balance von Selbstoffenbarung und Zurückhaltung (vgl. Mitchell 2003). Solche Fragen aber hängen von der Schaffung einer therapeutischen Atmosphäre ab; sie sind eng an die Person des Analytikers oder der Analytikerin gebunden, insbesondere an deren Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit, und deshalb auch nicht allgemein zu beantworten.
2. Innen, Außen, Zwischen: Das ›Inter‹ als neue Kategorie der Metapsychologie
Das Individuum entwickelt sein Seelenleben nicht wie der Apfel aus dem Kern und wird ebenso wenig durch ein genetisches Programm wie durch Triebschicksale determiniert. Das naturalistische Entwicklungsmodell, demzufolge der Einzelne seine im biologischen Substrat enthaltenen psychischen Dispositionen lediglich entfaltet, verfehlt ebenso wie das kulturalistische Modell sozialer Prägung den eigentümlichen Charakter der conditio humana: Die Menschwerdung verdankt sich in hohem Maße einem ständigen Austausch zwischen dem Individuum und einer soziokulturellen Umwelt, die nicht zuletzt aus anderen Subjekten besteht. Jedes menschliche Wesen wird soziobiologisch wie mental in Gattungsbeziehungen hineingeboren und entwickelt sein Selbst im Rahmen dieser Beziehungen: durch narzisstisch, libidinös oder aggressiv gefärbte Bindungen, durch Akte der Identifizierung und Abgrenzung, durch soziales Feedback und andere reflexive Mechanismen, durch Anpassungszwänge und Widerstandsleistungen hindurch.
Ein Ursache-Wirkungs-Verhältnis im Sinne einer schlichten Kausalität existiert im Seelischen nicht. Die menschliche Psyche wird nicht hergestellt. Der einzelne Mensch ist nicht das Produkt seiner Natur, aber auch nicht das Produkt von Umständen. Er ist überhaupt kein Produkt – weder das genetisch programmierte Ergebnis bestimmter Sequenzen auf der Doppelhelix noch das Ergebnis in der Tiefe des Unbewussten wirkender Triebkräfte. Andererseits entstehen individuelle seelische Strukturen, die als Ensemble auf der mentalen Hinterbühne wirken und die Persönlichkeit ausmachen, auch nicht aus eigener Schöpfungskraft: Das Subjekt generiert sich nicht selbst und schon gar nicht aus freien Stücken (wie etwa in der romantischen Idee vom Selbstentwurf gedacht). Paradoxerweise individuiert sich der Einzelne gerade dadurch, dass er sich seine lebensgeschichtlich kontingenten Erfahrungen mit sich selbst und anderen intrapsychisch aneignet.
Im Prozess seiner Individuierung verwandelt der Mensch die von den Biowissenschaften unterstellte »Kausalität der Natur« in eine »Kausalität des Schicksals«, und zwar auf dem Wege der Selbstaufklärung, die ihn dazu nötigt, Verantwortung für seine eigene Biografie zu übernehmen (vgl. Habermas 2005, im Anschluss an Kant und Hegel). In diesem Sinne könnte man den psychoanalytischen Prozess als eine nachholende Aneignung der eigenen Lebensgeschichte durch den Patienten begreifen, der zuvor mit seinem Leben hadert und die Verantwortung dafür an seine genetische Ausstattung, an die mangelhafte Erziehung durch seine Eltern, an die Schwächen der gesellschaftlichen Bildungssysteme, an seine ökonomische Unterprivilegierung oder an die sozialen Verhältnisse im Allgemeinen abgeben mochte.
Gewiss ist der zunächst relativ hilflose Säugling in einem elementaren Sinne von Pflege und Versorgung abhängig. Aber von Geburt an besteht er darauf, Rückmeldungen auf seine Lebensäußerungen zu erhalten – und zwar nicht nur in Gestalt der Befriedigung seiner unmittelbaren Existenzbedürfnisse (Nahrung, Wärme, Sicherheit), sondern auch Antworten, die ihm eine Rückmeldung zu den Wirkungen seiner eigenen Aktivitäten bieten, signifikante Reaktionen seiner Bezugspersonen im Sinne einer Bestätigung, eines Echos oder einer Spiegelung. Dieses Bedürfnis nach Reflexion im Anderen begleitet das werdende Subjekt und bleibt ihm lebenslang erhalten. Als Wunsch nach intersubjektiver Anerkennung gehört es offenbar zu unserer mentalen Grundausstattung und schlägt in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit so manche lebensweltliche Kapriolen. So hat sich in den interaktiven Formaten des Fernsehens oder in den sozialen Netzwerken im Internet eine panoptische Kultur etabliert, die an dieses Grundbedürfnis, von anderen gesehen zu werden, andockt – gelegentlich bis zur Auflösung jeglicher Schamgrenze (vgl. Altmeyer 2003).
Was Freud noch als Stufen der Libidoentwicklung unter dem Begriff der »Triebschicksale« zu erfassen suchte, würden wir heute eher als »Beziehungsschicksale« begreifen: Interaktionserfahrungen, die sich in die Psyche des Individuums auf reflexivem Wege einschreiben. Denn erst in der Interaktion mit seiner sozialen Umwelt gewinnt der Mensch eine Ahnung davon, wer er ist. Durch seine Beziehungen hindurch erwirbt er ein Verhältnis zu sich selbst und zur Welt. Es ist die psychische Sedimentierung seiner Beziehungserfahrungen, die die eigene Persönlichkeit formen. Bis ins hohe Alter bleibt der Mensch auf diesen Kontakt zu anderen angewiesen, wenn er seelisch gesund bleiben will.
Wenn solche intersubjektiv vermittelten seelischen Bildungsprozesse aus der Bahn geraten oder gar entgleisen, sprechen wir von psychischer Störung oder Krankheit. Dann finden wir auf der klinischen Ebene die intersubjektive Dimension auch in der Psychopathologie. In aller Regel gilt: Wo die Beziehungen zur sozialen Umwelt gestört sind, erkrankt auch die Seele, und wo die Seele erkrankt, sind auch die Beziehungen zur sozialen Umwelt gestört.
3. Im klinischen Fokus der zeitgenössischen Psychoanalyse: Die psychotherapeutische Beziehung
Was für das normale Seelenleben gilt, hat Gültigkeit auch für jene seelischen Erkrankungen, mit denen wir es in aller Regel im Behandlungszimmer zu tun haben. Sie werden nicht länger als isolierte Normabweichungen im Rahmen eines bestimmten Krankheitsmodells verstanden, sondern als Resultat einer gestörten Beziehungsgeschichte, die in neurotischen und psychotischen Symptomen, Borderline-Strukturen oder anderen Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten mit Krankheitscharakter ihren Niederschlag gefunden hat. Solche Einsichten verändern unser Verständnis der psychotherapeutischen Situation ebenso wie unser Selbstverständnis als Therapeuten.
Vereinfacht gesagt steht klinisch nicht mehr der intrapsychische Konflikt des Patienten im Zentrum, den der Therapeut qua Deutung aufzulösen hat, sondern die Beziehung zwischen Patient und Therapeut, in der sich das problematische Verhältnis des Patienten zur Welt und zu sich selbst entfaltet. In der Dynamik von Übertragung und Gegenübertragung, aber auch in den vielfältigen Enactments, die den therapeutischen Prozess begleiten, erkennen wir Beziehungsangebote des Patienten, in die wir uns unvermeidlich verwickeln lassen und die wir eben deshalb gemeinsam mit ihm bearbeiten können.
Zwar bleibt die psychotherapeutische Beziehung auch in dieser Neujustierung asymmetrisch, weil Analytiker und Analysant nach wie vor in unterschiedlichen Rollen am analytischen Prozess beteiligt sind. Sie bekommt aber eine egalitäre Färbung, weil der Analytiker der Wechselseitigkeit in der Beziehung mehr Aufmerksamkeit widmet, z. B. lässt er den Patienten an seinen therapeutischen Überlegungen teilhaben. Indem er seine Deutungen als probatorisch deklariert, anstatt sein Wissen mehr oder weniger autoritativ anzuwenden, verringert sich das Machtgefälle. Dass er sich – anders als in der klassischen Psychoanalyse – mehr im »Hier und Jetzt« bewegt und stärker als Person, als emotional engagierter und mitfühlender Teilnehmer zu erkennen gibt, verändert auch die Atmosphäre in der psychoanalytischen Situation.
Diese Entwicklung hat freilich auch eine Kehrseite. Bestand das Ziel der Kur früher darin, den Patienten in die Lage zu versetzen, am Ende der Behandlung seine wirkliche Lebensgeschichte möglichst wahrhaftig zu erzählen, haben sich einflussreiche Schulen der Psychoanalyse im letzten Vierteljahrhundert von der Leitidee einer lebensgeschichtlichen Rekonstruktion zunehmend entfernt: In der psychoanalytischen Moderne wird eher konstruiert als rekonstruiert. Wo Übertragung einst als Widerstandsphänomen gegen unerträgliche Erinnerungen galt, geraten tatsächliche Erinnerungen unter Verdacht, im Dienste des Widerstands gegen die Übertragungsbeziehung zu stehen.
In der auf Melanie Klein und Winfried Bion zurückgehenden Schule der Objektbeziehungstheorie geht es nahezu ausschließlich um die Beziehungsdynamik in der analytischen Situation: »History is rumor« (Bion). Es verwundert deshalb nicht, dass wir in manchen ihrer Falldarstellungen mehr über die Feinheiten des therapeutischen Mikrokosmos erfahren als über die wirkliche Biografie des Patienten. Und in den narrativen Ansätzen, die sich auf die phänomenologisch-hermeneutischen Traditionen der Philosophie berufen, wird gemeinsam mit dem Patienten bloß noch eine kohärente Geschichte erzeugt, ein Narrativ, das ohne Bezug zur außersprachlichen Wirklichkeit auszukommen meint.
Im amerikanischen Intersubjektivismus wiederum neigt man epistemologisch einem radikalen Konstruktivismus zu, der Subjektivität und Intersubjektivität so stark in den Blick nimmt, dass Objektivität in Gestalt von lebensgeschichtlicher Vergangenheit und äußerer Realität weitgehend ausgeblendet wird. Dabei genügt ein »schwacher« Konstruktivismus (vgl. Cavell 2006), um den seelischen Paradoxien im Sinne Winnicotts erkenntnistheoretisch gerecht zu werden. Was Winnicott als lebenslange Aufgabe des Einzelnen betrachtete, nämlich innere und äußere Realität voneinander getrennt und doch in Verbindung zu halten, gilt auch für die psychoanalytische Situation: Wie der Säugling eine objektive Außenwelt vorfindet, die er subjektiv dennoch erfinden muss, wird die tatsächliche Vergangenheit des Patienten unter Mitwirkung des Therapeuten rekonstruiert und zugleich konstruiert. Es gibt eine biografische Wahrheit, nach der beide am therapeutischen Prozess Beteiligten suchen – und die sie in demselben Prozess gemeinsam neu erschaffen.
Ungeachtet aller Unterschiede hat gerade die Konzentration der Gegenwartspsychoanalyse auf das Beziehungsgeschehen in der analytischen Situation die Kluft zu psychotherapeutischen Verfahren anderer Provenienz verringert. In dem Maße wie die therapeutische Interaktion in den Fokus gerät, ergeben sich Annäherungen an nicht-psychoanalytische Therapieverfahren wie die Gesprächspsychotherapie, die Gestalttherapie oder bestimmte Spielarten der Körperpsychotherapie (vgl. den ausgezeichneten Übersichtsband zum Körpergeschehen in der psychoanalytischen Therapie von Geißler und Heisterkamp, 2007), die dem »Hier und Jetzt« in der therapeutischen Beziehung immer schon Bedeutung zuerkannt haben. Bei allen Unterschieden in klinischer Theorie und therapeutischer Praxis nähert man sich einander an, ohne dass sich schon von einer Konvergenz der Psychotherapieschulen sprechen ließe.
Bestätigt wird diese Entwicklung durch den Zentralbefund der komparativen Psychotherapieforschung. Der entscheidende Faktor für die Wirksamkeit einer Psychotherapie scheint weniger die psychotherapeutische Methode zu sein als vielmehr die Person des Therapeuten und damit die therapeutische Beziehung. Diese Einsicht sollte die gesamte Profession ermuntern, die alten Schlachtfelder zu verlassen und sich in komparativen Studien dem Beziehungsgeschehen in der Psychotherapie zu widmen.
Frank-M. Staemmler
Kontakt als erste Wirklichkeit – Intersubjektivität in der Gestalttherapie1
Eine Person … ist ein Individuum, das wirklich mit dieser Welt lebt …, in echter Wechselbeziehung mit der Welt in allen Berührungspunkten, in denen der Mensch mit der Welt zusammentreffen kann. (Martin Buber in: Rogers & Buber 1992, 201)
Aus heutiger Sicht lässt sich sagen, dass die Gestalttherapie, so wie sie von Perls, Hefferline und Goodman am Anfang der 1950er-Jahre entworfen wurde, nicht nur zur damaligen Zeit innovativ war, sondern bis heute eine prominente Stellung in der zeitgenössischen Avantgarde der Psychotherapie einnimmt. Natürlich gab es eine Vielzahl von Mängeln, die der kritischen Überprüfung bedurften und viele Gestalttherapeuten angeregt haben, zahlreiche Bücher und Artikel zu verfassen, in denen sie die Theorie der Gestalttherapie weiterentwickelten. Doch die bahnbrechenden Grundlagen, die von Perls et al. (1951; dt. 2 Bd.: 2006, 2007) seinerzeit geschaffen wurden, waren aus meiner Sicht die entscheidende Voraussetzung für die nachhaltige Vorreiterrolle der Gestalttherapie auf dem Gebiet der Psychotherapie.
Der andere und das Selbst – Du und Ich
Als einschlägiger Beleg und als besonders wichtiges Beispiel für diese Behauptungen kann die folgende Feststellung gelten, die man bereits im ersten Absatz des Grundlagenwerks der Gestalttherapie findet:
»Der Kontakt selbst ist die erste und unmittelbarste Wirklichkeit« (Perls et al. 2006, 21).
In diesem Satz spiegelt sich ein Verständnis von Psychotherapie im Besonderen und darüber hinaus von Psychologie im Allgemeinen, das zu der Zeit, als es formuliert wurde, revolutionär war.2 Es hatte allerdings zunächst mehr den Charakter einer Hypothese als den einer ausgearbeiteten Theorie. Perls et al. überließen es ihren Nachfolgern, ihren Ansatz detailliert theoretisch auszuarbeiten und mit den Ergebnissen wissenschaftlicher und philosophischer Untersuchungen zu untermauern, etwa mit denen der Säuglingsforschung oder der Phänomenologie. So war es z. B. Lynne Jacobs, die mit Rückgriff auf solche Quellen die ursprüngliche Feststellung paraphrasierte:
Die grundlegende Annahme ist, dass jede Subjektivität intersubjektiv ist, d. h. dass jede Erfahrung ein ko-emergentes Phänomen einander überlagernder Subjektivitäten darstellt. … Es gibt kein Selbst, das der Beziehung vorausgeht, kein Selbst existiert vorgängig zu oder unabhängig von der es umgebenden Umwelt. (2005, 45)
– bzw. unabhängig von einem Anderen, wie man zur Unterstreichung des für den psychotherapeutischen Bereich wesentlichen Punktes hinzufügen könnte. Perls et al. haben es sogar noch radikaler und allgemeiner ausgedrückt, als sie »das ›Selbst‹ als System der Kontakte in jedem Augenblick« (2006, 31) definierten und dabei nicht nur an den zwischenmenschlichen Bereich dachten, sondern auch an den sozialen, biologischen und physikalischen.
Im Folgenden möchte ich mich allerdings auf das personale Selbst konzentrieren (im Unterschied zu dem, was man als »organismisches Selbst« bezeichnen könnte, das jedoch nur einen Teil des Ganzen ausmacht) sowie auf seine Kontakte mit anderen Personen, weil dies der Bereich ist, auf den sich in der Psychotherapie der überwiegende Teil der Aufmerksamkeit richtet. Denn die Kontakte zwischen Menschen sind zweifellos viel mehr als nur physische Kontakte; sie schließen die gegenseitige Anerkennung als Personen ein, d. h. die Würdigung des jeweils Anderen nicht nur als Körper, sondern als »Leib«, der ebenso über eine eigene Perspektive und einen eigenen Geist verfügt wie ich selbst, die Wahrnehmung des jeweils Anderen als eines interdependent Handelnden sowie schließlich die Wertschätzung für seinen eigenständigen Beitrag zur gemeinsamen Schaffung von Bedeutung und Sinn – kurz: Persönliche Kontakte zwischen Menschen sind intersubjektive Ereignisse.
Der Begriff der Intersubjektivität als solcher taucht im Buch »Gestalttherapie« allerdings nicht auf, auch wenn viele der zentralen Gedanken, aus denen sich das Konzept der Intersubjektivität zusammensetzt, bereits darin zu finden sind. In Anspielung auf und im Widerspruch zu Descartes’ berühmt-berüchtigtem Diktum »cogito, ergo sum« könnte man, um Intersubjektivität plakativ zu charakterisieren, mit Altmeyer sagen: »Videor, ergo sum« (2003, 261) – ich werde gesehen, also bin ich. Das Selbst entsteht in den Augen des Anderen; es ist sowohl entwicklungspsychologisch als auch prinzipiell immer sekundär; der Andere ist primär: »Der Mensch wird am Du zum Ich«, hat Buber (1936, 36) kurz und knapp festgestellt; der Andere ist schon immer im Selbst enthalten.3
Durch die Blicke des Du, der anderen Person, die mich anblickt und anspricht, werde ich mir meiner selbst als ein erlebendes Subjekt bewusst.
In den Blicken des Du, einer zweiten Person, die mit mir als einer ersten Person spricht, werde ich meiner nicht nur als eines erlebenden Subjekts überhaupt, sondern zugleich als eines individuellen Ichs bewusst. Die subjektivierenden Blicke des Anderen haben eine individuierende Kraft. (Habermas 2005, 19)
Dazu gehört notwendigerweise auch, dass ich sehe, wie ich angeschaut werde. »Das Blickverhalten ist in seiner spezifischen Wechselseitigkeit (mutualité) für die Entwicklung der menschlichen Kommunikation und Persönlichkeit von zentraler Bedeutung. … Weil menschliche Augen ›sprechen‹ können und sie dem Gegenüber ein fundamentales Erkennen vermitteln – ›Das bist Du!‹« (Petzold 1995, 442 – Hervorhebung im Original).
Ein Selbst zu sein, d. h. Subjektivität, beruht auf der Bezogenheit auf Andere und entwickelt sich im Kontakt mit ihnen. Die Anderen, die von ihrer eigenen Perspektive aus gesehen gleichfalls Selbste sind, werden vice versa auch ihrerseits nur durch den Kontakt mit Anderen zu dem, was sie jeweils sind. Das Selbst und der Andere können nur in Gegenseitigkeit existieren; ihr Wesen ist durch und durch intersubjektiv. Manche Philosophen und Wissenschaftler nehmen sogar an, dass Bewusstsein im Allgemeinen auf Intersubjektivität beruht: »Der Kern allen menschlichen Bewusstseins scheint in einem unmittelbaren, nicht-rationalen, nicht-sprachlichen, völlig untheoretischen Potenzial für den Rapport des Selbst mit der Psyche eines Anderen zu bestehen« (Trevarthen 1993, 121).
Trevarthen, der hauptsächlich Entwicklungspsychologe ist, hat bei dieser Feststellung die ersten Lebensjahre im Auge. Die intersubjektive Dimension des Bewusstseins geht jedoch auch im Erwachsenenleben nicht verloren. Wie ein östlicher Philosoph, der Intersubjektivität als »Zwischen-Sein« bezeichnet, sagt,
sind unsere bewussten Akte nicht ausschließlich von uns selbst bestimmt, sondern auch von den Anderen. Das bedeutet keineswegs, dass es sich um einen ›Austausch‹ von ansonsten einseitigen intentionalen Handlungen drehte, die zwischen Menschen hin- und hergehen. Vielmehr gibt es nur eine ›Verbindung‹, die von beiden Beteiligten bestimmt wird. Innerhalb einer Beziehung des ›Zwischen-Seins‹ durchdringen darum die jeweiligen bewussten Erfahrungen der Beteiligten einander. (Watsuji 1934, zitiert nach Arisaka 2001, 200 – Hervorhebungen von mir)
Mit westlicher Sprache gesagt, kann man
… sich Bewusstsein … denken … als sozialen Akt: Ich habe ein Erlebnis, aber auf intersubjektivem Weg erfasse ich intuitiv, wie der andere mein Erleben sieht. Nun gibt es zwei Perspektiven in Bezug auf mein Erleben, und ich erlange ein Bewusstsein anderer Art, das ich intersubjektives Bewusstsein nennen möchte. Bewusstsein ist somit nicht unbedingt das Werk meines eigenen Gehirns; es kann die Leistung meines und jemandes anderen Gehirns sein. Das gehört zum Leben in einer intersubjektiven Matrix dazu, welche eine implizite Erfahrung bewusst werden lässt, weil sie öffentlich ist und reflektiert werden kann. Aber diese Art Bewusstwerdung ist anders als die übliche. (Stern et al. 2006, 38 f. – Hervorhebung von mir)
So unüblich diese Form der Bewusstwerdung im Alltagsleben auch sein mag (ich meine allerdings, sie ist gar nicht so selten) – innerhalb der intersubjektiven Matrix mit ihren Therapeuten dürfte sie die häufigste Art für Klienten darstellen, sich bislang impliziter Dimensionen ihres Erlebens bewusst zu werden.
Kontakt als primordiale, verkörperte Bedingung des Menschseins
Daniel Sterns Einsichten können noch einige weitere, speziell anthropologische Aspekte des Kontaktgeschehens zwischen Menschen beleuchten, die Perls et al. als »erste Wirklichkeit« bezeichnet haben: Stern versteht Intersubjektivität nämlich als eine »Bedingung des Menschseins« und vertritt
die Ansicht, dass sie zudem ein angeborenes, primäres Motivationssystem darstellt,das für das Überleben der Art unverzichtbar ist und einen ähnlichen Status besitzt wie die Sexualität oder die Bindung.
Das Bedürfnis nach Intersubjektivität ist einer der wichtigsten Motivatoren, die eine Psychotherapie vorantreiben. Patienten möchten vom Therapeuten wahrgenommen werden und ihn wissen lassen, wie sie sich in ihrer Haut fühlen. (Stern 2005, 109)
Wie der Begriff der Intersubjektivität schon sagt, geht es dabei nicht um eine Einbahnstraße. Im Englischen gibt es das Sprichwort: »It takes one to know one«, was man etwa so übersetzen kann: »Man muss selber so beschaffen sein wie der, den man erkennen will.« Beide, Klienten und Therapeuten, »bilden gemeinsam ein intersubjektives System reziproker, gegenseitiger Einflussnahme« (Stolorow et al. 1996, 65). Wenn Klienten von ihren Therapeuten erkannt und verstanden werden wollen, müssen sie ihre Therapeuten auch erkennen und verstehen – jedenfalls in einem gewissen Maß. Wie sollten sie sonst in der Lage sein zu wissen, dass sie erkannt und verstanden werden? Damit
führen Intersubjektivität und ihre empathische Basis weg von dem simplen cartesianischen Bild eines isolierten individuellen Bewusstseins, das die Existenz des anderen durch Analogiebildung hochrechnen muss, und hin zu einer Vorstellung, in der subjektive Erfahrungsbereiche einander gegenseitig durchdringen – mit der Folge, dass Identität und Individualität eher relative als absolute Gegebenheiten sind. (Midgley 2006, 104)
Was Midgley hier »gegenseitige Durchdringung« nennt, was Stolorow et al. oben als »reziproke gegenseitige Einflußnahme« bezeichnen und was Perls et al. als »gesunde Konfluenz«4 charakterisieren, lässt jene »Begegnungsmomente« möglich werden, über die Stern so eloquent schreibt. Er gibt auch ein schönes Beispiel:
Denken wir zum Beispiel an die Patientin, die sich plötzlich aufsetzte, um ihre Therapeutin anzusehen. Unmittelbar nach dieser überraschenden Aktion starrten beide einander durchdringend an. Es herrschte Schweigen. Zwar wusste die Therapeutin nicht genau, was sie tun würde, aber ihr Gesichtsausdruck entspannte sich langsam, bis die Andeutung eines Lächelns ihren Mund umspielte. Dann beugte sie den Kopf ein wenig nach vorn und sagte: »Hallo!« Die Patientin blickte sie weiterhin an. Mehrere Sekunden lang blieben sie in diesem Blickkontakt gefangen. Einen Moment später legte sich die Patientin wieder hin und setzte ihre Arbeit auf der Couch fort; aber nun arbeitete sie intensiver und auf eine bislang unbekannte Weise, die neues Material zutage treten ließ. Die gemeinsame therapeutische Arbeit wurde dadurch drastisch verändert.
Das »Hallo« (in Verbindung mit Gesichtsausdruck und Kopfb ewegung) konstituierte einen »Moment der Begegnung«, in dem die Therapeutin eine authentische persönliche Reaktion zeigte, die der unmittelbaren Situation (dem Jetzt-Moment) auf eine vollkommene Weise angepasst war. Die Reaktion bewirkte einen deutlichen Wandel der Therapie. Sie bildete einen Drehpunkt, an dem eine Quantenveränderung des intersubjektiven Feldes stattfand. (Stern 2005, 175 f.)
Die Fähigkeit zur intersubjektiven Bezogenheit, das grundlegende »Mitsein« (Heidegger 1953, 113 ff.), das die Art und Weise von Menschen, in der Welt zu sein, prägt, das »eingeborene Du« (Buber 1936, 355) scheint primordial zu sein. Natürlich entwickelt es sich in Kindheit und Jugend weiter und nimmt im Laufe des Lebens zunehmend differenzierte Formen an, die sich auf der Basis wiederholter und vielseitiger Erfahrungen gegenseitiger Empathie herausbilden, wie ich in meinem kürzlich erschienenen Buch »Das Geheimnis des Anderen« vielfach belegt habe (vgl. Staemmler 2009) – aber es beginnt nicht erst dann; im Keim war es immer vorhanden, wie Heidegger betont: Das »fürsorgende Erschließen des Anderen [erwächst] … nur aus dem primären Mitsein mit ihm …. ›Einfühlung‹ konstituiert nicht erst das Mitsein, sondern ist auf dessen Grunde erst möglich« (1953, 124 f.). Um diesen Sachverhalt zu beschreiben, hat der Säuglingsforscher Stein Braten (2007) den Begriff der »altero-zentrierten Partizipation« geprägt. Stern fasst prägnant zusammen, was Braten damit meint, nämlich
die angeborene Fähigkeit, das, was der Andere erlebt, ebenfalls zu erleben (gewöhnlich außerhalb des Gewahrseins). Sie ist ein unwillkürlicher Akt des Erlebens, in dessen Prozess das Zentrum der eigenen Orientierung und Perspektive im Anderen verortet zu sein scheint. Sie ist kein Wissen über den Anderen, sondern eine Teilnahme an seinem Erleben. Altero-zentrierte Partizipation ist die basale intersubjektive Fähigkeit, durch die Nachahmung, Empathie, Mitleid, emotionale Ansteckung und Identifizierung ermöglicht werden. Wiewohl angeboren, wird diese Fähigkeit im Laufe der Entwicklung erweitert und verbessert. (Stern 2005, 247)
Diese primordiale Fähigkeit zur intersubjektiven Bezogenheit ist auch auf der neuronalen Ebene fest verankert, z. B. in der Form der sogenannten »Spiegelneurone«, die in den frühen 1990er-Jahren entdeckt wurden6 und in denen einer ihrer Entdecker, Vittorio Gallese, nichts Geringeres als die »neuronale Basis der Intersubjektivität« (2003) sieht. Weil wir von Beginn unserer Existenz an so ausgerüstet sind, verfügen wir schon lange, bevor wir sprechen können und
bevor wir in der Lage sind, das Verhalten Anderer zu erklären oder vorherzusagen, über die Fähigkeit, mit Anderen zu interagieren und sie auf der Ebene ihrer Gesten, Intentionen und Emotionen … sowie auf Basis dessen zu verstehen, wie sie sich gegenüber uns und Anderen in pragmatischen … Alltagsaktivitäten verhalten. (Gallagher 2005, 230)
Und weil alle Menschen über diese neuronale Begabung verfügen, sind sie zugleich mit einem »überindividuellen neuronalen Format« (Bauer 2005, 166 – Hervorhebung im Original) versehen. Es bildet die neuronale Voraussetzung, die sie – zusammen mit den Voraussetzungen, die von Kultur und Sprache geschaffen werden – in die Lage versetzt, in einen »gemeinsamen zwischenmenschlichen Bedeutungsraum« (a. a. O. – Hervorhebung im Original) hineinzuwachsen und diesen mitzugestalten.
Diese Ausstattung zeigt eine nahezu permanente Aktivität, die »offenbar Teil des Normalzustands des Gehirns ist; ohne Anstrengung oder Absicht evaluiert und analysiert es ständig vergangene, gegenwärtige oder mögliche zukünftige soziale Beziehungen, wann immer nicht-soziale Fragestellungen nicht die ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen« (Iacoboni et al. 2004, 1171). Mit anderen Worten: Zusätzlich zu ihren unmittelbaren Kontakten mit Anderen sind Menschen mit virtuellen Kontakten beschäftigt, wann immer ihre aktuelle Situation es ihnen erlaubt. Wir sind nie allein; selbst wenn wir es aus der Sicht eines Beobachters zu sein scheinen, sind wir mit den Anderen durch das Erleben von ihrer Abwesenheit verbunden. Selbst dann bleibt der Kontakt unsere erste Wirklichkeit – der allgegenwärtige Hintergrund, vor dem das Alleinsein zur Figur wird.7
Die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zur Intersubjektivität entstammen der Beobachterperspektive. Sie stellen damit nur eine von mehreren Perspektiven dar, unter denen man Intersubjektivität untersuchen und feststellen kann, dass sie verkörpert ist. Aus der phänomenologischen Perspektive (der ersten Person) gesehen, die von Gestalttherapeuten bevorzugt eingenommen wird, begegnet man im unmittelbaren Kontakt mit der anderen Person jedoch »nicht einem reinen Körper mit einer versteckten Seele, sondern einem einheitlichen Ganzen« (Zahavi 2005, 150). Daher bestand Merleau-Ponty darauf: »Die Intersubjektivität ist eine Interleiblichkeit« (1972, 248), die sich in einer Vielzahl von unmittelbar erfahrbaren Phänomenen manifestiert; ich habe das an anderer Stelle (Staemmler 2009, 97 ff.) ausführlich dargestellt und möchte diesen Punkt hier nur kurz mit Varela zusammenfassen:
Ich verstehe den Anderen nicht als ein Ding, sondern als eine Subjektivität, die der meinen als ein alter ego ähnlich ist. Durch seinen Leib bin ich mit dem Anderen verbunden, zunächst als mit einem Organismus, der dem meinen ähnelt, aber auch als mit einer wahrgenommenen verkörperten Präsenz … in meinem Erfahrungsfeld. (Varela 1999, 81)
Kontakt als erste Wirklichkeit im therapeutischen Veränderungsprozess
Bis hierher habe ich Kontakt als erste Wirklichkeit im Sinne einer entwicklungspsychologischen Sequenz sowie im Sinne eines fundamentalen Aspekts des menschlichen Wesens betrachtet. Im nun folgenden dritten Teil dieses Textes möchte ich mich mit persönlichem Kontakt als einem wesentlichen Bestandteil des Veränderungsprozesses in der Gestalttherapie befassen.
Weil Gestalttherapeuten ihren Klienten vorzugsweise in einer »Ich-Du-Haltung« (Hycner & Jacobs 1995) gegenübertreten, schaffen sie die Voraussetzung dafür, dass »Begegnungsmomente« entstehen können, d. h. Momente, in denen der persönliche Kontakt zwischen den Teilnehmern der Begegnung eine ungewöhnliche intersubjektive Dichte erreicht (vgl. Sterns Beispiel oben). Solche Momente lassen sich auch als Beispiele für eine stark ausgeprägte »gegenseitige Durchdringung« (Midgley 2006) oder für eine intensive »reziproke gegenseitige Einflussnahme« (Stolorow et al. 1996) verstehen. Sie sind Fälle besonderer zwischenmenschlicher Verbundenheit und gemeinsamer Kreation von Bedeutung und Sinn8 – »Ich und Du, hier und jetzt« –, in denen die unmittelbare Erfahrung der Beteiligten in ungewöhnlich großem Maß durch ihre gemeinsame Situation geformt wird.
Diese Situation lässt sich mit der intensiven Beteiligung an einem Spiel vergleichen, das Gadamer wie folgt charakterisiert:
Alles Spielen ist ein Gespieltwerden. Der Reiz des Spieles, die Faszination, die es ausübt, besteht eben darin, daß das Spiel über den Spielenden Herr wird …. Das eigentliche Subjekt des Spieles … ist nicht der Spieler, sondern das Spiel selbst. (1990, 112 – Hervorhebung im Original)
Anders gesagt, die psychologischen Prozesse von Klient und Therapeut werden zu Teilen »eines einzigen Systems, das aus zwei Teilsystemen besteht … – einem dyadischen System« (Tronick 1998, 293), und dieses dyadische System »enthält mehr Information und ist komplexer … als jeder individuelle Bewusstseinszustand [der des Klienten und der des Therapeuten] allein« (a. a. O., 296); man könnte hier auch von einem »intersubjektiven Bewusstseinszustand«9 sprechen. Ich denke dabei an eine »lebendige Erfahrung einschließlich einer intersubjektiven Resonanz, die sich nicht auf das Bewusstsein eines der Teilnehmer allein reduzieren lässt« (Neimeyer 2005, 81).10
Durch diese Resonanz gewinnen die Individuen, die von ihrer gemeinsamen Situation »gespielt werden«, Zugang zu einer Erfahrungsdimension, die ihnen ohne den dyadisch erweiterten Bewusstseinszustand unzugänglich bliebe. So wie LSD und manche andere Drogen »Pforten der Wahrnehmung« (Huxley 1954) öffnen können, die normalerweise geschlossen bleiben, so kann das Eintreten in ein dyadisches System den Beteiligten die Türen zu Erfahrungen eröffnen und bislang unzugängliche Erlebnisdimensionen erschließen, die bis dahin nur Aspekte ihres Erfahrungspotenzials gewesen waren.
Wenn dieser Erfahrung Aufmerksamkeit geschenkt und sie einigermaßen häufig wiederholt wird, kann sie in das jeweilige Repertoire der einzelnen Personen eingehen und zu einer zugänglichen Ressource werden, aus der sie zukünftig schöpfen können. Um einen von Vygtoskys Begriffen zu benutzen: Die Teilnahme an der gemeinsamen Situation und der intersubjektive Bewusstseinszustand, der mit ihr einhergeht, ermöglicht den Beteiligten das Erreichen einer »höheren psychischen Funktion« (Vygotsky 1992); »höher« im Vergleich zu den psychologischen Funktionen, die ihnen zur Verfügung standen, bevor sie sich auf die dyadische Erfahrung einließen.
Ich entscheide mich nicht zufällig dafür, Vygotskys Begriff hier zu benutzen, denn der große russische Forscher und Theoretiker war – soweit ich weiß – der erste Psychologe, der versuchte, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse auf der Basis einer Theorie der Intersubjektivität zu erklären und nicht auf der Grundlage individualistischer Annahmen. Aus Vygotsky’scher Perspektive ist der intersubjektiv entstehende Vorgang der Veränderung, den ich oben skizziert habe, nämlich nicht als ein Prozess zu verstehen, in dessen Verlauf ein Individuum (üblicherweise »Klient« genannt) bestimmte Eigenschaften eines anderen Individuums (üblicherweise »Therapeut« genannt), die es an diesem beobachtet hat, internalisiert (oder »introjiziert« oder »assimiliert«). Was vielmehr »interiorisiert« wird – wie Vygotsky den Vorgang nennt, um ihn von psychoanalytischen Konzepten wie »Internalisierung« oder ähnlichen Vorstellungen11 zu unterscheiden –, ist die Begegnung mit dem Anderen und ihre entsprechende Qualität.
Was der Klient dabei lernt, ist also nicht etwas, das der Therapeut zu ihm sagt oder mit ihm macht, sondern es ist etwas, das zwischen den beiden geschieht. Gegenstand der Interiorisierung ist die Art der Interaktion, der bestimmte Kontakt, und nicht individuelles Verhalten. Und diese Interaktion war bereits etwas, bei dem der Klient eine Rolle spielte (ebenso wie der Therapeut), aber sie war mehr und anders als die Summe der in sie eingehenden Teile. Die Interiorisierung findet mit Bezug auf die gesamte Kontaktsituation statt, die die individuellen Beiträge transzendiert. Vygotsky fasst es so zusammen:
Der entscheidende Mechanismus, der hinter höheren geistigen Funktionen steckt, ist das Kopieren sozialer Interaktionen; alle höheren psychischen Funktionen sind internalisierte soziale Beziehungen. Diese höheren psychischen Funktionen bilden die Basis für die soziale Struktur des Individuums … Selbst wenn wir geistige Prozesse betrachten, bleibt ihr Wesen quasi-sozial. In ihrer eigenen Privatsphäre behalten Menschen die Funktionen sozialer Interaktion bei. (Vygotsky 1981, 164)
So gesehen ist es nicht der Therapeut, der den Klienten unterstützt (wie es im individualistischen Paradigma erscheinen mag). Das Unterstützungssystem besteht in der Qualität der Interaktion, die sich ergibt (»emergiert«), wenn Klient und Therapeut sich ihrer gemeinsamen Situation überlassen und in einen intersubjektiven Bewusstseinszustand eintreten (vgl. Staemmler 2009, 199 ff.). Das Unterstützungssystem ist ein gemeinsames. Daher trägt auch seine Transformation in eine höhere psychische Funktion durch den Interiorisierungsprozess des Klienten das intersubjektive ›Format‹ eines »Selbstmit-dem-Anderen«, d. h. ein dialogisches Format. Kurz, alle Subjektivität ist interiorisierte Intersubjektivität: Kontakt ist die erste Wirklichkeit.
Vygotskys Konzept der Interiorisierung beschreibt, wie Erfahrungen von Menschen, die zunächst im empathischen persönlichen Kontakt zwischen ihnen stattfinden, danach in einem weiteren Schritt von den beteiligten Personen zu ihren eigenen gemacht (»interiorisiert«) und in eine höhere psychische Funktion umgeformt werden, die dann ihr jeweiliges Erleben von sich selbst beeinflusst und ihnen zur Verfügung steht, wenn sie entweder allein sind oder neue soziale Kontakte aufnehmen. Überdies legt die Interiorisierung von Erfahrungen persönlichen Kontakts und zwischenmenschlicher Verbundenheit den Boden, auf dem ein weitergehendes Gefühl von Bezogenheit wachsen kann, das z. B. die Zeit des Abschieds am Ende einer Therapie überdauern kann.
Schluss
Die intersubjektiven Momente persönlichen Kontakts zwischen Klient und Therapeut bilden den Ausgangspunkt für die Entwicklung höherer persönlicher Funktionen. Manchmal nehmen sie den Charakter von außergewöhnlichen Erlebnissen an, manchmal sind sie subtiler. Eugene Gendlin (1962, 38 f.) hat sie aus der Perspektive des Klienten anschaulich beschrieben:
Mein Eindruck von dir, dem Zuhörer [Therapeuten], berührt mein Erleben, während ich spreche, und deine Antwort bestimmt zum Teil mein Erleben im nächsten Moment. Was in mir vorgeht und wie ich lebe, während wir miteinander sprechen und interagieren, wird wesentlich beeinflusst durch jedes Wort und jede Bewegung, durch jeden Gesichtsausdruck und jede Haltung, die du zeigst …. Insofern ist es nicht so, dass ich dir von mir erzähle, wir dann herausarbeiten, wie ich mich ändern sollte, und ich es danach irgendwie tue. Vielmehr verändere ich mich, während ich spreche und denke und fühle, denn deine Reaktionen sind zu jedem Augenblick Teil meines Erlebens, das sie zum Teil beeinflussen, hervorrufen, symbolisieren und mit dem sie interagieren.
Mit anderen Worten: Der Kontakt ist die erste und unmittelbarste Wirklichkeit.
Bernd Bocian
Von der Revision der Freud’schen Theorie und Methode zum Entwurf der Gestalttherapie – Grundlegendes zu einem Figur-Hintergrund-Verhältnis1
Gestalttherapie lässt sich bewusst auf die Vieldeutigkeit der Wirklichkeit und die unterschiedliche Lesbarkeit der Welt ein. Entsprechend geht auch eine umfassend-festschreibende und allgemeingültige Selbstdefinition für mich an der Intention des Gestaltansatzes vorbei. Diese Haltung läuft zwar zu mittlerweile populären erkenntnistheoretischen Überlegungen parallel, macht aber das Leben in einem Arbeitsfeld, das weitgehend von objektivierenden, naturwissenschaftlich-medizinischen Menschenbildern dominiert wird, nicht einfach. Als Gestalttherapeut bleibt mir Raum für die eigenständige Assimilation der Grundkonzepte und Grundhaltungen und die kreative Konstruktion der eigenen Position im jeweiligen Arbeitsfeld. Das beinhaltet Freiheit und die Chance, den Gestalt-Ansatz mit Eigen-Sinn zu füllen, kann aber auch Identitätsunsicherheit und Last bedeuten. Die Fundierung der gestalttherapeutischen Praxis, durch das Herausarbeiten und Erarbeiten unterschiedlicher historischer und neuer Kontexte, bleibt entsprechend eine ständige Aufgabe und Chance. Mein Weg zur Gestalttherapie und meine Identitätsfindung in diesem Feld verlief über die Bekanntschaft mit den Arbeiten kreativer psychoanalytischer Freigeister wie Wilhelm Reich, Sandor Ferenczi, Georg Groddeck und Erich Fromm. Entsprechend liegt mir daran, die psychoanalytischen Wurzeln der Gestalttherapie einmal grundlegender und differenzierter herauszuarbeiten, als das bisher geschehen ist.
Ein Umstand, der eine entsprechende Sichtweise des Gestaltansatzes erschwert, ist die Tatsache, dass der psychoanalytische Kontext des Schlüsselwerkes »Gestalt Therapy« von 1951 sich nicht leicht erschließt. Wie das erste Buch der beiden Perls’ enthält es zwar einen Übungsteil, ist aber gleichzeitig für ein psychoanalytisch vorgebildetes Publikum geschrieben. Beide Bücher nehmen Bezug auf eine große Anzahl psychoanalytischer Autoren2 und Konzepte, ohne diese genau zu benennen, und sowohl die Perls’ als auch Goodman zitieren zumeist aus dem Gedächtnis. Die Gründergruppe hat (glücklicherweise) kein systematisches Lehrbuch hinterlassen. Ich werde deshalb im Weiteren viel aus den Originalwerken der Gestaltgründer zitieren, dabei frühe mit späten Arbeiten verbinden, sowie verstreute Hinweise zusammenbringen und ordnen, um einen strukturierteren Grund als bisher für das Verständnis der Beziehung von Gestalttherapie und Psychoanalyse zu legen. In diesem Rahmen wird, ausgehend von biografischen Verbindungen, die Revision zentraler theoretischer und praktischer psychoanalytischer Konzepte (Triebtheorie, Ich, freie Assoziation, Unbewusstes, Verdrängung, Deuten, Widerstand, Übertragung etc.) durch die beiden Perls’ und Goodman behandelt. Des Weiteren (vgl. Kap. II) geht es um das Verhältnis zwischen Psychoanalyse, Gestaltpsychologie und Kleinkindforschung, und Fritz Perls’ therapeutischer Stil wird rückblickend aus Sicht der Objektbeziehungstheorien betrachtet. Abschließend, in Kap. III, beschäftige ich mich mit dem historischen Herkommen des Gestaltansatzes aus der linken Strömung der psychoanalytischen Kulturkritik und einer zivilisationskritischen Naturphilosophie, sowie mit Freud als ein historisches Symbol für einen Haltungswechsel in der Psychiatrie. Es geht mir hierbei im Wesentlichen nicht darum, etwas Neues vorzustellen, sondern darum, den damals erreichten Stand (möglichst im Original) in Erinnerung zu rufen und auch nachvollziehbar zu machen.
Als Motiv für diese Arbeit kommt hinzu, dass ich mich seit Jahren über Arbeiten ärgere, die immer wieder die theoretischen Grundlagen der Gestalttherapie als einseitig und in sich widersprüchlich bezeichnen. Die Grundmuster der Kritiken sind über die Jahre ähnlich geblieben, da sie sich in der Regel schwerpunktmäßig auf die Transkriptionen von Workshops des alten Fritz Perls beziehen und der Kontext von Ort und Zeit ihrer Entstehung (ihr Demonstrationscharakter für ein therapeutisch vorgebildetes Publikum, die historische Bedeutung des Esalen-Instituts Ende der 60er-Jahre, etc.) nur ungenügend oder gar nicht berücksichtigt wird. Der persönliche und lebensgeschichtliche Hintergrund von Perls wird ebenfalls meist außer Acht gelassen. So zum Beispiel, dass er ein erfahrener psychoanalytischer Kliniker war, der die Grenzen und Gefahren solcher Veranstaltungen kannte (vgl. Perls 1969/1986, 10 f.; L. Perls 1992, 14). Oder sein mit zunehmendem Alter abnehmendes Interesse an einer auf Krankenbehandlung reduzierten einzeltherapeutischen Psychotherapie zugunsten des Versuches, alternativkollektive Lebensformen auf der Basis einer direkten und unverstellten zwischenmenschlichen Kommunikation zu initiieren. Nichtsdestotrotz wird gerade das transkribierte Seminarmaterial benutzt, um immer wieder ein Urteil über die Qualitäten »der Gestalttherapie« insgesamt zu fällen.
Ich teile auch die quasi interne Kritik von Hilarion Petzold3 nicht (z. B. Petzold 1987, 1993), die F. Perls und P. Goodman als Vertreter zweier kaum zu vereinbarender Positionen behandelt und von der Vernachlässigung des Sozialen und einem a-historischen Hier-und-Jetzt-Ansatz ausgeht. Dies gilt auch für die Annahme von Gordon Wheeler (1993), dass der Gestaltansatz figur- und kontaktfixiert sei. Ich hoffe, zukünftigen Kritiken, die in eine ähnliche Richtung weisen, ein Stück Boden entziehen zu können, indem ich an einen zentralen historischen Kontext der Gestalttherapie vertiefend wiedererinnere.
Ich werde in diesem Artikel deutlich machen, dass sich viele gestalttherapeutische Grundkonzepte aus der psychoanalytischen Bewegung heraus entwickelt haben. Die seit geraumer Zeit diskutierten Ähnlichkeiten mit der modernen Psychoanalyse werden verständlicher, da diese zum Teil Erfahrungen dissidenter Psychoanalytiker wiederentdeckt hat, die nicht in den Lehrkanon der orthodoxen Psychoanalyse aufgenommen worden waren, in der Gestalttherapie aber in rudimentärer Form überlebt haben. Von daher würde ich nicht nur von einer Annäherung sprechen, sondern auch von einem Wiedererkennen. Die gestalttherapeutische Revision orthodoxer Positionen hat eine Ahnenreihe, die sich überwiegend aus Dissidenten der Freud’schen Schule zusammensetzt, die mit einer aktiven, dialogischen und ganzheitlichkreativen Haltung experimentiert haben. Mit diesen Männern und Frauen und diesem Teil der Geschichte der Psychoanalyse fühle ich mich als Gestalttherapeut zutiefst verbunden und ich bin nicht bereit, ihn den offiziellen Nachlassverwaltern Freuds zu überlassen.
Entsprechend teile ich auch Positionen nicht, die davon ausgehen, die Gestalttherapie »stehe für sich« (vgl. Rumpler 1996). Vor dem Hintergrund der Geschichte unseres Ansatzes assoziiere ich damit eine narzisstisch anmutende Selbstzentriertheit. Fritz und Lore Perls und Goodman haben 1951 den qualitativen Sprung in ein eigenes therapeutisches Verfahren gemacht, es bleibt für mich aber Figur vor dem Hintergrund der Geschichte der psychoanalytischen Bewegung. In meiner Lesart der Gestalttherapie ist mir nicht nur die Innovation (etwa der neue erkenntnistheoretische Kontext, der innerhalb der DVG zuerst durch Heik Portele betont worden ist), sondern in starkem Maße auch die Tradition wichtig. Ich fühle mich mit einem Vorgänger- und Vorfahrenfeld verbunden und verbinde das gestalttherapeutische Autonomieprinzip mit einer Identität, die sich nicht eltern- und familienlos konstruiert, wie F. Perls das oft tat, sondern sich als selbstständiger und erwachsener Teil einer Familiengeschichte betrachtet Erwähnen möchte ich auch, dass scheinbar gestalttypische Begriffe und Konzepte, wie Ganzheit, Hier und Jetzt, Wachstum, Kontakt, Awareness etc., sich schon bei den analytischen Freigeistern finden lassen. Was die Gestalttherapie vielleicht »einzigartig« (vgl. Bocian 1997a) macht, ist für mich zum einen die Radikalität, mit der die Gründer dissidente psychoanalytische Theorie- und Praxisansätze aufgehoben, integriert und zum Teil weiterentwickelt haben. Zum anderen, dass sie darüber hinaus auch noch bemüht waren, dies mit den damals fortschrittlichsten Strömungen der Wahrnehmungspsychologie und -philosophie zu verbinden, was sie den Versuch einer Synthese von »Kontakt- und Tiefenpsychologie« nannten. Dies Unternehmen war seiner Zeit voraus.
Kapitel I: Geschichte und Biografie – Revision der Triebtheorie und der Theorie des Selbst
Geschichte und Biografie
Das Wissen um die eigene Geschichte gehört zum Prozess der Identitätsbildung. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine deutsche Amnesie aufmerksam machen, die kaum wahrnimmt, dass die Gestalttherapie ohne den Hitlerfaschismus höchstwahrscheinlich gar nicht entstanden wäre. Der Entstehungsprozess der Gestalttherapie kann historisch im Kontext der Emigrationsgeschichte der deutschen Psychoanalyse nach 1933 betrachtet werden, und in unseren Ansatz sind Überlebenserfahrungen von Deutschen eingegangen, die durch Deutsche vertrieben worden sind. Meiner Ansicht nach sind einige Ideen der damaligen linken Berliner Kultur-Avantgarde mit den beiden Perls’ emigriert und lassen sich ebenso im Hintergrund vieler Gestaltkonzepte finden, wie die Grenzerfahrungen, die sie als deutsche Juden machen mussten.4
An dieser Stelle will ich mich auf die biografischen Beziehungen von Fritz und Lore Perls zur Psychoanalyse konzentrieren. In die folgenden Angaben will ich einige für das Verständnis der Entstehungsgeschichte der Gestalttherapie wichtige Daten und Zusammenhänge einfließen lassen, die bisher nicht bekannt waren oder veröffentlicht worden sind. Im Rahmen meiner Nachforschungen ist mir klar geworden, wie tief sowohl Fritz und Lore Perls als Privatpersonen als auch der Gestalt-Ansatz insgesamt im geistig-kulturellen Klima der Weimarer Republik (1918-1933) verwurzelt sind. Die unruhige und blutige Zeit zwischen dem Ende des ersten Weltkriegs und der Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten, die das Ende der Republik bedeutete, war auch eine Zeit der kreativen und sozial-utopischen Aufb ruchstimmung. Berlin war ihr Zentrum und weltweiter Anziehungspunkt, wegen der vielfältigen neuen Entwicklungen und Experimente im Bereich der Politik, Kunst und Alltagskultur. Die beiden Perls haben diese Wurzeln nie verloren und in New York in Paul Goodman einen geistesverwandten Menschen getroffen. Es ist nicht verwunderlich, dass es abermals eine soziale Auf- und Umbruchstimmung war, die dem Gestalt-Ansatz im Amerika der 60er-Jahre, wenn auch teilweise in verkürzter Form, zur Verbreitung verholfen hat. Mich mit den soziokulturellen Wurzeln im Deutschland der Weimarer Jahre und dem Einfluss der deutsch-jüdischen Erfahrungen gründlich beschäftigt zu haben (vgl. Bocian 2007), war mir, gerade als europäischer und deutscher Gestalttherapeut, Verpflichtung und Herzensangelegenheit zugleich.
I. Frankfurt und Wien
Friedrich (Fritz) Salomon Perls (1893-1970), Sohn jüdischer Eltern und seit 1921 promovierter Arzt, beginnt in Berlin, wo er sich während der Jahre der Weimarer Republik in linken Künstler- und Intellektuellenkreisen bewegt, aus persönlichen Gründen im Jahre 1925 eine Psychoanalyse bei Karen Horney. Als er im September 1926 für ein Jahr als Assistent zu Kurt Goldstein geht, der in Frankfurt die Neurologie von der Gestaltpsychologie und einem organismisch-ganzheitlichen Standpunkt aus revolutioniert und mit dem Kreis der Gestalttheoretiker um Wertheimer eng verbunden ist, setzt er seine Analyse bei Clara Happel fort. An Goldsteins Institut lernte er u. a. Siegmund Heinz Fuchs kennen, der, nach seiner Emigration aus Hitlerdeutschland, in England unter dem Namen S. H. Foulkes zu einem Pionier der analytischen Gruppentherapie werden wird. Foulkes (1992) hat ebenso wie Perls in seinen Arbeiten gestaltpsychologische Termini und Erkenntnisse verwendet. Als Clara Happel Perls’ Analyse nach ca. einem Jahr für beendet erklärt, rät sie ihm, zur Supervison nach Wien zu gehen. Perls folgt ihrem Rat und geht im September 1927 im Rahmen seiner Facharztausbildung für ca. sechs Monate an die Wiener Nervenklinik, wo er unter Julius Wagner-Jauregg und Paul Schilder arbeitet. Psychoanalytische Supervision bzw. Kontrollanalysen erhält Perls durch Helene Deutsch, Leiterin des Lehrinstituts der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung und durch Eduard Hitschmann, Direktor des psychoanalytischen Ambulatoriums in Wien. Er nimmt intensiv an den Aktivitäten der Wiener Vereinigung teil, besucht zahlreiche Seminare und Vorträge, hört u. a. Referate von Paul Federn und Anna Freud und beteiligt sich an einigen der nach den Vorträgen stattfindenden Diskussionen. Im »Korrespondenzblatt der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung« wird er neben Wilhelm Reich, Paul Federn, Heinz Hartmann und anderen Diskutanten als »Dr. Perls (a. G.)« vermerkt. Als Kandidat des Berliner Instituts gilt er in Wien »als Gast« (vgl. IZP 14/1928, 436 f.). In der Wiener Zeit haben die Pionierarbeiten Paul Federns (1978) zur Ich-Psychologie und zur Psychosenforschung Einfluss auf Perls, und Federns Begriff »Ich-Grenze« soll für Perls lebenslang von Bedeutung bleiben. Von Bedeutung ist weiterhin, dass Perls bereits in Wien an Wilhelm Reichs »therapeutisch-technischem Seminare« im Ambulatorium der Wiener Vereinigung teilnahm und somit bereits zu diesem Zeitpunkt mit der sich vor dem Hintergrund der psychoanalytischen Ich-Psychologie gerade entwickelnden Charakteranalyse in Kontakt kam, und nicht erst, wie bisher angenommen, als Reich im Jahre 1930 von Wien nach Berlin übersiedelte (vgl. Bocian 2007, 200 f.). Im März 1928 geht er nach Berlin zurück, arbeitet sowohl ärztlich wie psychoanalytisch und setzt seine Ausbildung als Kandidat des Berliner Instituts fort.
In Frankfurt hatte er Lore Posner (1905-1990) kennengelernt, die seine Frau werden wird. Lore Posner, aus einer jüdischen Familie des Pforzheimer Bürgertums stammend, ist dort eine der ersten weiblichen Studentinnen. Sie studiert Gestaltpsychologie, nimmt an Veranstaltungen von Goldstein teil und promoviert bei dem Gestaltpsychologen Ademar Gelb. Durch Perls inspiriert, beginnt sie ebenfalls eine kurze Analyse bei Clara Happel, um danach zu Karl Landauer zu wechseln, den sie als Person und als Lehranalytiker sehr schätzt. Dass sie parallel zu ihrer Analyse modernen Ausdruckstanz und rhythmische Gymnastik praktiziert, ist für ihre therapeutische Entwicklung von großer Bedeutung. Karl Landauer, ein Analysand von Freud, ist zu dieser Zeit eine bedeutende Persönlichkeit innerhalb der deutschen Psychoanalyse. Seine Arbeiten zur »Theorie der Affekte« (1991), seine Betonung des Zusammenhangs von eigenständigem Denken und Fühlen, sowie seine therapeutische Haltung, die auf eigenständige Weise die Anregungen von Ferenczi, Rank und Groddeck zur aktiven Technik aufgreift, beeinflussen Lore Perls und somit auch die Gestalttherapie. Karl Landauer stirbt im Januar 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen den Hungertod. Da er nicht nach Amerika emigriert war, wird er von der Psychoanalyse quasi vergessen. Seine Bedeutung wird von der deutschen Psychoanalyse der Nachkriegszeit erst durch die Bemühungen von Hans Joachim Rothe (1987) wiedererinnert. Innerhalb der Gestalttherapie bleibt er bis 1997 so gut wie unbekannt.5





























