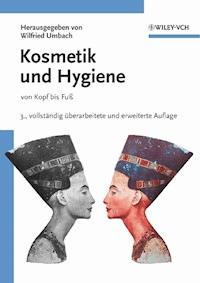
Kosmetik und Hygiene E-Book
61,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der wissenschaftliche Fortschritt ist unaufhaltsam. Seit der 2. Auflage hat es auf den Gebieten der Kosmetik und der Hygienemittel sowie der Nachbardisziplinen bedeutende Weiterentwicklungen gegeben. Für die Neuauflage wurden daher die Kapitel grundlegend überarbeitet und aktualisiert.
Einen breiten Raum nehmen neue biochemische Erkenntnisse zu Vorgängen in der Haut, physikalische bzw. physikalisch-chemische Messmethoden zur Wirksamkeitsbestimmung, neue Formulierungstechniken in der Produktentwicklung, weitere Optimierung des Verbraucher- und Umweltschutzes sowie der aktuelle Stand der EU-Gesetzgebung ein.
Neu aufgenommen wurden die Kapitel über Definition und Bewertung von Cosmeceuticals, neue Erkenntnisse in der Altershautforschung und Herstellung von Parfümölen.
Das Werk gibt einen breit gefächerten Überblick über kosmetische Mittel und Hygienemittel von der Forschung über Entwicklung und Anwendung bis zur Herstellung der verschiedenen Produktgruppen unter Berücksichtigung der toxikologischen, dermatologischen und mikrobiologischen Absicherung.
Das Buch richtet sich vorwiegend an Chemiker, Biochemiker, Lebensmittelchemiker, Chemieingenieure, Dermatologen, Toxikologen, Mikrobiologen, Pharmazeuten und Physiker mit Tätigkeitsschwerpunkt Kosmetik, Studenten dieser Fachrichtungen, Fachkosmetiker, Mitarbeiter und Verantwortliche des Kosmetik-Marketings, der Untersuchungsämter, der Verbraucherschutzverbände, Wissenschaftsjournalisten und last but not least Kosmetik-interessierte Laien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Author
Copyright
Vorwort
Autorenliste
1 Historische Entwicklung der Kosmetik
1.1 Kulturelle und religiöse Einflüsse auf die Kosmetik
1.2 Die Kosmetik in den einzelnen Kulturepochen
1.3 Literatur
2 Gesetzgebung und Kosmetik
2.1 Hintergrund
2.2 Die Regelung in der Europäischen Union
2.3 Die deutsche Gesetzgebung
2.4 Andere Gesetzgebungen,Verordnungen und Regelungen
2.5 Naturkosmetik
2.6 Literatur
3 Anwendungsgebiete kosmetischer Mittel
3.1 Die Haut
3.2 Neue Erkenntnisse der Altershautforschung
3.3 Die Mundhöhle (Cavum oris)
3.4 Das Haar
3.5 Literatur
4 Kosmetische Wirkstoffe: Wirkung und Wirksamkeit - Ein allgemeiner Überblick
4.1 Aufgaben und Ziele der Kosmetik und Wirkstoffkosmetik
4.2 Wirkung und Wirksamkeit
4.3 Der kosmetische Wirkstoff
4.4 Nachweis kosmetischer Wirkungen
4.5 Exemplarische Darstellung der Wirkungsweisen
4.6 Wirkung und Nebenwirkung
4.7 Wirkung kosmetischer Mittel auf die Persönlichkeit
4.8 Ausblick
4.9 Literatur
5 Cosmeceuticals – Definition und Bewertung
5.1 Definition
5.2 Bioaktive Wirkstoffe
5.3 Wissenschaftliche Bewertung
5.4 Rechtliche Bewertung
5.5 Zusammenfassung
5.6 Literatur
6 Messmethoden zur Bestimmung der Wirksamkeit kosmetischer Mittel
6.1 Haut
6.2 Zahn
6.3 Haar
6.4 Literatur
7 Kosmetische Mittel zur Reinigung, Pflege und zum Schutz der Haut
7.1 Seife und Syndet
7.2 Flüssige Wasch-, Dusch- und Badepräparate
7.3 Hautpflegemittel
7.4 Fußpflegemittel
7.5 Lichtschutzmittel
7.6 Insekten abwehrende Mittel (Insect Repellents)
7.7 Rasiermittel
7.8 Haarentfernungsmittel
7.9 Literatur
8 Kosmetische Mittel zur Zahn-, Mund- und Zahnersatzpflege
8.1 Zahn- und Mundpflegemittel
8.2 Prothesenreinigungsmittel und -haftmittel
9 Kosmetische Mittel zur Haarbehandlung
9.1 Haarwaschmittel
9.2 Haarpflegemittel
9.3 Haarverformungsmittel
9.4 Frisurfestigungsmittel
9.5 Haarfarbänderungsmittel
9.6 Literatur
10 Kosmetische Mittel für dekorative Anwendungen
10.1 Dekorative Korperpflegemittel
10.2 Hautbräunungsmittel
10.3 Literatur
11 Kosmetische Mittel zur Beeinflussung des Körpergeruchs
11.1 Duftmittel
11.2 Deodorantien (Desodorantien, Deos, Deomittel)
11.3 Antitranspirantien
12 Parfümierung kosmetischer Mittel
12.1 Aufgaben und Kosten
12.2 Parfümierung einzelner Produktgruppen
12.3 Anwendungstechnik: Aufgaben,Tests und Testmethoden
12.4 Duftauswahl
12.5 Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Parfümölen
13 Mikrobiologie kosmetischer Mittel
13.1 Mikrobieller Verderb von kosmetischen Mitteln
13.2 Beurteilung der mikrobiologischen Qualität kosmetischer Mittel
13.3 Elemente einer mikrobiologischen Qualitätssicherung kosmetischer Mittel
14 Infektionsprophylaxe in Kosmetik-, Fußpflege- und Frisiersalons einschließlich Tätowieren und Piercen
14.1 Infektionsrisiken
14.2 Bauliche Voraussetzungen und Innenausstattung der Arbeitsstätten
14.3 Maßnahmen der prophylaktischen und gezielten Keimbekämpfung
14.4 Beseitigung von Abfüllen
14.5 Impfprophylaxe
14.6 Maßnahmen bei Verletzungen
14.7 Hausbehandlungen
14.8 Hygieneplan
14.9 Anleitung und Überwachung
14.10 Ordnungswidrigkeiten
14.11 Literatur
15 Verträglichkeit kosmetischer Mittel
15.1 Toxikologie
15.2 Dermatologie
15.3 Literatur
16 Qualitätssicherung kosmetischer Mittel
16.1 Weiterentwicklung der Qualitätssicherung
16.2 Heutige Trends in der Qualitätssicherung
16.3 Qualitätssicherung in Konzeption und Entwicklung
16.4 Qualitätssicherung bei Ausgangsmaterialien
16.5 Fertigprodukte
16.6 Mikrobiologische Qualitätssicherung
16.7 Audits
16.8 Kundenreklamationen
16.9 Ausblick
16.10 Literatur
17 Allgemeine Grundprinzipien zur Herstellungstechnologie kosmetischer Mittel
17.1 Definitionen
17.2 Misch- und Homogenisiersysteme
17.3 Herstellverfahren
17.4 Literatur
18 Herstellung von Parfümölen
18.1 Einleitung
18.2 Herstellen von Parfümölmustern
18.3 Parfümölproduktion – Das Compounding
18.4 Sicherheitsaspekte in der Parfümölproduktion
18.5 Literatur
19 Aspekte des Umweltschutzes bei kosmetischen Mitteln
19.1 Umweltrelevanz kosmetischer Produkte
19.2 Kriterien zur Umweltsicherheitsbewertung chemischer Verbindungen
19.3 Relevante gesetzliche Regelungen für kosmetische Produkte und Inhaltsstoffe
19.4 Literatur
20 Hygienemittel
20.1 Historische Entwicklung
20.2 Medizinische Aspekte der Menstruation
20.3 Intravaginaler Menstruationsschutz
20.4 Extravaginale Hygieneprodukte
20.5 Literatur
21 Der Markt für Körperpflegemittel
21.1 Wirtschaftliche Entwicklung 1991–2001
21.2 Wirtschaftliche Entwicklung 2002
21.3 Verbraucherausgaben 2002
21.4 Marktverhältnisse
21.5 Mitarbeiter
21.6 Mittelstand
21.7 Anhang
Abkürzungs- und Akronymverzeichnis
Stichwortregister
Herausgeber
Prof. Dr. Wilfried Umbach
ehem. Mitglied der Geschäftsführung der Henkel KGaA, Düsseldorf zuständig für Forschung/Technologie Bockumer Straße 143 40489 Düsseldorf
1. Auflage 1988
2., erweiterte Auflage 1995
3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2004
Titelbild
Büste der Nofretete, ausgestellt in:
Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Berlin-Charlottenburg.
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei der Deutschen Bibliothek erhältlich.
© 2004 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim
Gedruckt auf säurefreiem Papier
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind. All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this book, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law.
Print ISBN 9783527309962
Epdf ISBN 978-3-527-66351-4
Epub ISBN 978-3-527-66350-7
Mobi ISBN 978-3-527-66349-1
Vorwort zur 3. Auflage
Im letzten Dezennium hat sich die stürmische Entwicklung auf dem Gebiet der Kosmetik in Forschung, Entwicklung und Anwendung sowie deren Nachbarschaftsdisziplinen, wie z.B. der Biochemie, Toxikologie, Dermatologie und physikalischen Messmethodik fortgesetzt. Vor allem neue biochemische Erkenntnisse zu Vorgängen in der Haut bestimmen den Trend auf diesem Sektor.
Auch die 2. Auflage dieses Buches ist vom Markt gut aufgenommen worden. Inzwischen sind fast 10 Jahre vergangen, so dass, um aktuell zu sein, eine Neuauflage erforderlich war.
Die bewährte Gliederung wurde prinzipiell beibehalten. Fast alle Kapitel wurden tief greifend überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Wie in früheren Auflagen wurde auch das Kapitel ,,Hygienemittel“ aufgrund des Interesses der Leserschaft wieder mit aufgenommen und überarbeitet, obwohl diese Produktgruppe vom Gesetzgeber nicht den kosmetischen Mitteln zugeordnet wird. Im Rahmen der Infektionsprophylaxe wurde die Ausarbeitung um Tätowieren und Piercen ergänzt. Drei neue Kapitel wurden eingeführt: Neue Erkenntnisse der Altershautforschung, Cosmeceuticals – Definition und Bewertung sowie Herstellung von Parfümölen. Gegenüber der 2. Auflage wurde auf die Themen unreine Haut, Intimpflege, Depig- mentierung und Verpackungen aus verschiedenen Gründen verzichtet. Im letzten Buchkapitel wurde erstmals eine 10-Jahresübersicht zur Entwicklung des Kosmetikmarktes gegeben.
Die enormen Anstrengungen zur weiteren Optimierung des Verbraucherschutzes spiegeln sich in den vielfältigen Veränderungen der EU-Kosmetik-Gesetzgebung wider: Erweiterte Sicherheitsanforderungen, Kennzeichnungsvorschriften und Produktangaben. Seit 1976 wurden bis heute u.a. 7 Änderungs- und 30 AnpassungsRichtlinien erlassen. Die deutsche Kosmetik-Verordnung hat die EU-Regelungen bisher in 33 Änderungs-Verordnungen umgesetzt. Die Übernahme der 7. Änderungs-Richtlinie ist derzeit in Vorbereitung.
Für die vorliegende Neuauflage konnten viele Autoren aus der 2. Auflage, aber auch zahlreiche neue gewonnen werden, allesamt Spezialisten auf ihren Gebieten. Damit wurde der hohe Sachstand des Werkes wieder sichergestellt. Allen Autoren bin ich zu großem Dank verpflichtet.
Der Leser wird feststellen, dass die neue Auflage nunmehr im Wiley-VCH Verlag, Weinheim, und nicht mehr im Georg Thieme Verlag, Stuttgart, erschienen ist. Die neue Aufmachung signalisiert diesen Wechsel sehr deutlich. Für die gute Ausstattung und Promotion sowie die ausgezeichnete Koordination und Kooperation möchte ich dem Verlag, insbesondere Herrn Dr. Rainer Münz, meinen Dank aussprechen.
Herrn Dr. Hinrich Möller, Monheim/Rh, der mich schon bei der 1. Auflage unterstützte, möchte ich herzlich danken für die gewissenhafte und kritische Durchsicht und Bearbeitung der Manuskripte.
Düsseldorf, im Juni 2004
Prof. Dr. Wilfried Umbach
Autorenliste
Dr. Dirk Alert
Beiersdorf AG
20245 Hamburg
Dr. Harald Albrecht
Beiersdorf AG
20245 Hamburg
Dr. Rudolf Bimczok
Wella AG
Berliner Allee
65 64274 Darmstadt
Dr. Sabine Birkel
Wella AG
Berliner Allee
65 64274 Darmstadt
Dr. Thomas Blatt
Beiersdorf AG
20245 Hamburg
Dr. Alexander Boeck
Henkel Fragrance Center GmbH
Hentrichstraße 17–25
47809 Krefeld
Dr. Peter Busch
Gottfried-August-Bürger-Straße 10
40699 Erkrath
Dr. Andrea Conrads-Wendtland
Johnson & Johnson GmbH
Kaiserswertherstraße 270
40474 Düsseldorf
Dr. Wolf Eisfeld
Cognis Deutschland GmbH & Co. KG
40551 Düsseldorf
Dipl.-Ing. Peter Finkel
Sara Lee HBC Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
40589 Düsseldorf
Dr. Thomas Förster
Henkel KGaA
40191 Düsseldorf
Dr. Michael Franzke
Wella AG
Berliner Allee 65
64274 Darmstadt
Dr. Peter Galow
Wilkinson Sword GmbH
Schützenstraße 110
42659 Solingen
Dr. Bert Gruber
Schwarzkopf & Henkel Production
Europe GmbH & Co. KG
Amerner Weg 7
41751 Viersen
Prof. Dr. Michael Heinzel
Henkel KGaA
40191 Düsseldorf
Dr. Klaus-Dieter Hellwege
Zahnarzt
Hauptstraße 17
67742 Lauterecken
Dr. Horst Höffkes
Henkel KGaA
40191 Düsseldorf
Dr. Detlef Hollenberg
Henkel KGaA
40191 Düsseldorf
Walter Hönig
Am Beissel 18
50374 Erftstadt
Dipl.-Ing. Birgit Huber
Industrieverband Körperpflege- und
Waschmittel e.V.
Karlstraße 21
60329 Frankfurt
Prof. Dr. Axel Kramer
Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Universität Greifswald
Hainstraße 26
17487 Greifswald
Prof. Dr. Günther Lang
Wella AG
Berliner Allee 65
64274 Darmstadt
Dr. Wolfgang Matthies
Henkel KGaA
40191 Düsseldorf
Dr. Georg Meine
Henkel Fragrance Center GmbH
Hentrichstraße 17–25
47809 Krefeld
Dr. Hinrich Möller
Haydnstraße 27
40789 Monheim am Rhein
Prof. Dr. Lothar Motitschke
Am Eichelkamp 18
40723 Hilden
Horst Neufeld
SSL Healthcare Deutschland
GmbH & Co. KG Edisonstraße 5
63477 Maintal
Dr. Andrea Riepe
Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Straße 40
65823 Schwalbach am Taunus
Dr. Stephan Ruppert
Beiersdorf AG
20245 Hamburg
Dr. Hartmut Schiemann
Wella AG Berliner Allee 65
64274 Darmstadt
Dr. Dr. Gerhard Josef Schmitt
Goerdelerstraße 12
63741 Aschaffenburg
Dr. Günther Schneider
Beiersdorf AG
20245 Hamburg
Dr. Werner Schneider
Aptos Raymar
Apdo 0133
08350 Arenys de Mar
Spanien
Dr. Jörg Schreiber
Beiersdorf AG
20245 Hamburg
Dr. Eric Schulze-zur-Wiesche
Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG
Hohenzollernring 127–129
22763 Hamburg
Dr. Annette Schwan-Jonczyk
Wella AG
Berliner Allee 65
64274 Darmstadt
Dr. Josef Steber
Henkel KGaA
40191 Düsseldorf
Dr. Winfried Steiling
Henkel KGaA
40191 Düsseldorf
Dr. Bernd Stroemer
Industrieverband Körperpflege- und
Waschmittel e.V.
Karlstraße 21
60329 Frankfurt
Prof. Dr. Wilfried Umbach
Bockumer Straße 143
40489 Düsseldorf
Dr. Sven Untiedt
Beiersdorf AG
20245 Hamburg
Prof. Dr. H.-P. Werner
HygCen GmbH
Bornhövedstraße 78
19055 Schwerin
Prof. Dr. Klaus-Peter Wittern
Beiersdorf AG
20245 Hamburg
Dr. Peter Wülknitz
Henkel KGaA
40191 Düsseldorf
1
Historische Entwicklung der Kosmetik
1.1 Kulturelle und religiöse Einflüsse auf die Kosmetik
Kosmetik ist mehr, als nur das Körperäußere zu pflegen und zu verschönern. Kosmetik bedeutete auch immer, auf sichtbare, riechbare und fühlbare Weise der Welt und den Mitmenschen zu begegnen. Diese Art der Begegnung hat mit dem jeweiligen Weltverständnis und dem daraus abgeleiteten Menschenbild zu tun. Damit ist Kosmetik unauflösbar mit Religionen und Kulturkreisen verwoben, mehr noch, sie spiegelt die Grundbefindlichkeiten wie auch die technischen Möglichkeiten des Menschen wider.
Im „Darüber hinaus“ der Religion weigert sich der Mensch, seine biologische Begrenztheit anzuerkennen. Wo wird das deutlicher sichtbar als in den Totenkulten der einzelnen Völker, besonders eindrucksvoll dort, wo das Weiterleben nach dem Tod mit der Unversehrtheit der Körperhülle in Zusammenhang gebracht wird? Die Ägypter der Pharaonenzeit entwickelten aus dieser Vorstellung eine ausgefeilte Nekrokosmetik (Abb. 1.1-1) mit Balsamierungstechniken, die heute noch Bewunderung hervorrufen.
Die Religion gab über die Jahrtausende hinweg maßgebliche Impulse für die kosmetische Gestaltung. Bei einer Reihe von afrikanischen Völkern werden bei Initiationsriten Mädchen und Jungen im Gesicht oder am ganzen Körper weiß bemalt, um damit das Absterben – den Tod der Kindheit – und daran anschließend die Wiedergeburt zu symbolisieren. In Indien kennzeichnet ein kleiner kreisförmiger weißer Fleck über der Nasenwurzel die Zugehörigkeit zur Brahmanenkaste.
Die gegenseitige Beeinflussung griechisch-idealistischer Philosophie und christlicher Religion erzeugte vielfach Kosmetikfeindlichkeit. Da der Mensch aber gar nicht anders kann, als sich mit seinem Äußeren zu zeigen, also immer auch ein „anthropos kosmetikos“ ist, kam es aus dieser geistigen Konstellation heraus zu charakteristischen Kosmetikhandlungen: Die Tonsur der Mönche galt als Zeichen ihrer Öffnung für das Göttliche; im 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes legte Paulus frommen Frauen und Mädchen das Tragen langer Haartrachten nahe. Kreuzritter ließen sich oftmals ein Kruzifix eintätowieren, um sich dadurch im Todesfall ein christliches Begräbnis zu sichern.
Obwohl Kosmetik zweifellos das Ergebnis eines menschlichen Grundgefühls ist, steht sie seit jeher im Kreuzfeuer der Kritik. Warum? Zum einen: Kosmetik hat mit der Herausstellung der Person zu tun. Persönliche Motive oder persönlicher Geschmack aber sind anfechtbar. Eine Veränderung des Körperäußeren kann als narzisstisch, eitel, wenig anmutend oder sogar hässlich beurteilt werden. In den 1960er-Jahren wurden die „Pilzfrisuren“ der Beatles abgelehnt; heute wundert man sich über das irokesenhafte Aussehen der „Punks“ oder fürchtet sich vor gewalttätigen glatzköpfigen Rechtsradikalen. Zum anderen: Kosmetik folgt nicht nur großen, über Jahrzehnte beständigen Bewusstseinsströmungen, sondern spiegelt ebenso kurze Modewechsel wider und wird daher gern mit dem Attribut „oberflächlich“ gekennzeichnet. Aus alledem leitet sich das Schillernde und zum Widerspruch Reizende der Kosmetik ab. Das Wort „Kosmetik“ selbst zeigt diese Ambivalenz. „Ho kosmos“ ist im Griechischen die Schönheit, die aus der Ordnung kommt. War im alten Sparta der „kosmetes“ noch der hoch angesehene Ordner, der, mit erheblichen Rechten ausgestattet, über die gegenseitige Rücksichtnahme zu wachen hatte, so war schon kurze Zeit später derselbe Wortstamm negativ belegt: „He kosmeter“ ist die eitle, oberflächliche Putzjungfrau. Diesem Auf und Ab kosmetischer Wertschätzung begegnen wir über die Jahrtausende. Das Mittelalter legt Wert auf die unsterbliche Seele des Menschen und verdammt folgerichtig die Eitelkeit menschlicher Schönheitspflege. Von der Renaissance an beginnt der Mensch, sich von geistlichklerikaler Vorherrschaft zu befreien, und wird sich selbst zum Maßstab aller Dinge. Dementsprechend legt er größten Wert auf seine äußere Erscheinung. Selbst in unserer rational bestimmten Zeit erleben wir die ambivalente Haltung zur Kosmetik auf Schritt und Tritt. Von jeder Litfaßsäule lachen uns kosmetikgepflegte Menschen an. Wenn es aber darum geht, Sündenböcke für gesellschaftliche Malaisen zu finden, dann steht die Kosmetik an vorderster Front. Tierversuche für die Kosmetik, für menschlichen Luxus also, wer kann das verantworten?!
Abbildung 1.1-1 Grab des Neb-Amun, Theben: Klagende Witwen vor Mumien (aus Hawkes, J., 1977)
1.2 Die Kosmetik in den einzelnen Kulturepochen
1.2.1 Kosmetische Praktiken in sehrfrühen Kulturen
Aus Funden in Alicante und Lascaux wissen wir, dass schon in prähistorischer Zeit Frauen ihre Gesichter mit roter Farbe bemalten. Ähnliche Praktiken haben sich bei Naturvölkern in Reservaten bis in unsere Tage erhalten; z. B. bemalen sich die Jivaro-Indianer im Amazonasgebiet mit eigenartigen Mustern; die Papuas bemalen ihre Gesichter und schmücken sich mit schillernden Federn von Paradiesvögeln, um ihre Schönheit und männliche Stärke zur Geltung zu bringen.
Mit dem Auftreten der Völker in Indien und im Vorderen Orient nimmt unser Wissen auf dem Gebiet der Kosmetik schlagartig zu. Assyrer, Chaldäer und Babylonier verbrannten in öffentlichen Tempeln oder in Hausschreinen aromatische Substanzen, Harze, spezielle Hölzer oder Riechgummen. Sie legten damit die Anfänge der Parfümerie. Das alte Ägypten könnte man als die Wiege der Kosmetik bezeichnen. Beide Geschlechter dieses alten Kulturvolkes schminkten Lippen und Wangen in verschiedenen Rottönen, zogen die Brauen mit Stibium (Antimon) nach und färbten die unteren Augenlider mit pulverisiertem Malachit. Zur Färbung der Haare waren Henna und Indigo weit verbreitet (Abb. 1.2-1). Auch das jüdische Nachbarvolk besaß hohes kosmetisches Wissen. Im Buch Esther wird beschrieben, wie eine atemberaubend schöne junge Jüdin zwölf Monate lang für die Brautschau am persischen Hof in Susa vorbereitet wurde: Sechs Monate wurde sie jeden Tag mit Myrrhenöl eingerieben, sechs Monate mit Spezereien und anderen Schönheitsmitteln.
1.2.2 Zusammenhang zwischen Pharmazie und Kosmetik in der hellenistischen Periode
Die Unterscheidung zwischen Innerem und Äußerem des Menschen, wie es für die Moderne typisch ist, zwischen nur Ästhetischem und Körperlich-Funktionalem war der Antike fremd. Dementsprechend gab es zu dieser Zeit auch keine strikte Trennung zwischen Medizin und Kosmetik. Hippokrates von Kos (4. Jh. v. Chr.) – der „Vater der Medizin“ – überliefert in seinem 2. Buch der Abhandlungen über Frauenkrankheiten eine umfangreiche Sammlung kosmetischer Rezepturen, z. B.: Um dem Gesicht ein schönes Aussehen zu verleihen, verreibe man die Leber einer Eidechse mit Olivenöl und streiche sie mit unverdünntem Wein auf. Zur Glättung von Runzeln verreibe man Molybdän in einem steinernen Mörser, gieße abgestandenes Wasser darüber, forme Kügelchen daraus, trockne sie und lasse sie vor dem Gebrauch in Olivenöl zergehen. Bei Haarausfall verreibe man Labdanum zusammen mit Rosen- und Liliensalbe und behandle damit die Kopfhaut.
Abbildung 1.2-1 Letzte Handreichung der Königin Anchsen-Amun bei der Toilette des Königs (aus Desroches-Noblecourt, C., 1963)
Athen war Modezentrum und Hochburg der griechischen Kosmetik. Man bezog aus Ägypten und Phönizien Spiegel, Schminktöpfchen, Hautsalben und parfümierte Seifen. Die vornehme Griechin schmückte sich in ausgesuchter Weise für den Gatten. Sie zog sich die Augenbrauen mit Schwärze nach und bemalte die Lippen. Zum blonden Haar wünschte sie sich eine möglichst schneeweiße Haut. Diesem Ziel wurde mit kräftigem Auftrag von Bleiweiß-Schminke nachgeholfen. Sie wusste um die Begrenztheit ihres Tuns; ihre Vorbilder waren die Göttinnen, und so wünschte sie sich, schön zu sein wie Aphrodite, klug wie Athene und tüchtig wie Hera, die Gemahlin des Zeus.
1.2.3 Kosmetik bei den Romern
Im Laufe ihrer Geschichte veränderte sich die Lebensweise der Römer vom Asketisch-Einfachen hin zum Angenehmen, wenn nicht gar zum Luxuriösen. Senat und Kaiser schenkten dem Volk nicht nur Sportplätze zur körperlichen Ertüchtigung, sondern auch großartig ausgestattete Bäder. In diesen Caldarien, „Heißbädern“, trafen sich Clubs von Müßiggängern, Geschäftsfreunden und Sportlern, um sich der Unterhaltung und Körperpflege gleichermaßen zu widmen.
Kosmetik war noch ein fester Bestandteil der Medizin. Plinius der Ältere (24–79 n. Chr.) schrieb eine Enzyklopädie, die nicht nur das chemische, botanische und pharmazeutische Wissen der damaligen Zeit zusammenfasste, sondern auch ausführlich auf kosmetische Formulierungen und Parfümkompositionen einging.
Galenus von Pergamon (129–199 n. Chr.), der berühmteste Arzt der damaligen Zeit, erforschte gründlich die Gebiete der Anatomie, Hygiene, Pathologie und Pharmazie und wurde der Begründer der Galenik, also der Kunst der Zubereitungen auf dem pharmazeutischen und kosmetischen Gebiet. Berühmt ist seine Kaltcreme (unguentum refrigerans), die aus 12,5% Bienenwachs, 50% Olivenöl und 37,5% Rosenwasser bestand. Sie war bei römischen Frauen außerordentlich beliebt als Mittel gegen trockene Haut, besonders aber um die Spuren des Alterns zu mildern.
In Rom war alles erhältlich, was der Schönheit und dem Gepflegtsein diente: Parfums aus dem Osten, die Haare germanischer Sklavinnen, Lippenstifte, Schminken, Bastperücken oder Schönheitspflästerchen aus Ägypten.
1.2.4 Einflüsse des Orients auf die Kosmetik im Früh- und Hochmittelalter
Bei der Verschmelzung von einzelnen Kulturen und Weltanschauungen gewann im Abendland das Christentum die Oberhand. Seine insbesondere in der Zeit der Kirchenväter betonte Leibfeindlichkeit wirkte sich auf die Kosmetik negativ aus. Kaiser Theodosius ging so weit, im Jahr 395 n. Chr. öffentliche Bäder und alle nackt ausgeführten sportlichen Aktivitäten zu verbieten. Die geistliche Führungsschicht wurde ermutigt, kosmetische Mittel (insbesondere Lippenstifte und Rouge) als heidnisch zu verdammen. Eine Frau, die ihr Gesicht bemalte, galt als Hure. Wegen dieser Engstirnigkeit im westlichen Kulturkreis verlagerten sich viele wissenschaftliche Aktivitäten ins Morgenland. Byzanz wurde zur Kulturmetropole; orientalische, vor allem arabische Einflüsse gewannen zunehmend an Bedeutung.
Kaiser Justinian schloss 529 n. Chr. die berühmte von Plato eingerichtete Akademie in Athen und vertrieb damit die bedeutendsten Professoren seiner Zeit. Viele von ihnen fanden in der indischen Universität in Jundishapar neue Wirkungsmöglichkeiten. Hier vermischten sich abendländische und orientalische Einflüsse und befruchteten die unterschiedlichen Wissensgebiete – auch die Kosmetik und als ein Teilgebiet davon die Zubereitung wertvoller Parfums.
Der Islam, der sich vom 7. Jh. n. Chr. an erstaunlich schnell zu einer Weltreligion entwickelte, zeigte sich weltoffen und zerstörte nicht das, was er vorfand. Indem die großen Werke aus allen Ländern ins Arabische übersetzt wurden, avancierte die arabische Welt zur Hauptträgerin des damaligen Wissens, auch des Wissens auf den kosmetikbezogenen Gebieten der Physiologie, Hygiene, Ernährung, Gymnastik und Massage.
Mit dem Zerfall des islamischen Reichs im 11. Jh. n. Chr. gewann Europa wieder an kultureller Bedeutung. Es wurden neue Universitäten gegründet und viele wissenschaftliche Schriften ins Lateinische übersetzt. Nikolas von Salerno veröffentlichte die erste Pharmacopeia und beschrieb darin 150 Drogen. Immer noch wurden Pharmazie, Medizin und Kosmetik als zusammengehörende Wissensgebiete verstanden.
1.2.5 Trennung der Kosmetik von der Medizin im Spütmittelalter
Mit dem raschen Erkenntniszuwachs und einer allmählichen Entwicklung eines neuen Verständnisses der Wirklichkeit wurden viele Wissensgebiete selbstständig, so auch die Kosmetik. Erste Ansätze dazu finden sich bei Henri de Mondeville zu Beginn des 14. Jh. n. Chr. Er schrieb ein großes Lehrbuch der Chirurgie und unterschied darin klar zwischen pathologischen Veränderungen der Haut, die medizinischer Therapie bedürfen, und verschönernden Behandlungen der Haut, für die kosmetische Mittel zuständig sind. Von diesem Zeitpunkt an entwickeln sich Kosmetik und Dermatologie zu unterschiedlichen Disziplinen.
In Europa finden im ausgehenden Mittelalter, ganz besonders aber in der Zeit der Renaissance, auf allen Gebieten tiefgreifende Veränderungen statt. Der Mensch löst sich mehr und mehr von kirchlicher Bevormundung und entdeckt sich selbst. Nahezu alle Gebiete der Wissenschaft und Kunst erfahren eine Blütezeit, auch die Kosmetik. Allerdings ist die Kosmetik noch nicht im modernen Sinn verwissenschaftlicht. Ihr haftet noch immer viel Mysteriöses an; sie ist von magischen und abergläubischen Praktiken durchdrungen und steht der geheimnisumwitterten Lehre der Alchemie nahe. So nimmt es nicht wunder, dass in dieser Zeit viele Scharlatane ihr Unwesen treiben, z. B. Guiseppe Balsame, der Scharen von Gläubigen hinterging, indem er behauptete, er sei im Besitz einer wirksamen Rezeptur zur Erlangung ewiger Jugend.
In Frankreich wird die elegante Lebensführung Ziel aller Wünsche, am stärksten zur Zeit des Sonnenkönigs Ludwig XIV. ausgeprägt. Man trägt immer höhere und verrücktere Perücken, klebt sich Mouches (Abb. 1.2-2) ins Gesicht, um schöner und interessanter zu erscheinen, und pudert Perücke, Gesicht, Kleider und alle Körperteile. Die oftmals stark parfümierten Puder sollten Körperschmutz und -geruch verbergen, was bei vielen Menschen damals durchaus notwendig war, da sie wochenlang nicht badeten.
Abbildung 1.2-2 Mouche-Büchse, Email (Deutschland, 1770; aus Kloos,W., 1979)
1.2.6 Einfluss von Wissenschaft und Industrialisierung auf die Kosmetik der Neuzeit
Was im ausgehenden Mittelalter bereits angelegt war – die objektive Betrachtungsweise der Welt, die Betonung der menschlichen Vernunft als Instrument für die Verbesserung des Lebens und schließlich die Erhebung des Menschen zum Maß aller Dinge – wird in der Neuzeit ungeheuer gesteigert. Spekulatives Denken wird zurückgedrängt; durch experimentelle Methoden werden gesicherte Erkenntnisse über Welt, Natur und Mensch gesammelt.
Das Wissen auf allen Gebieten nimmt explosionsartig zu. Für die Kosmetik ist der Aufstieg der Chemie von besonderer Bedeutung. Diese liefert Stoffe, die bisher kaum oder gar nicht zugänglich waren. Daher werden Produkte, die früher nur mit größter Mühe und in kleiner Stückzahl produziert werden konnten, zu billigen Gebrauchsartikeln, über die jedermann verfügen kann. Das Zeitalter der Industrialisierung und Vermassung beginnt.
Immer besser gelingt es, das menschliche Äußere im gewünschten Sinne zu pflegen und zu verändern. Chirurgische und prothetische Techniken gewinnen an Bedeutung: Facelifting, Haartransplantation und Kontaktlinsen sind dafür nur einige Beispiele. Eine hochentwickelte Galenik sowie neue chemische Wirkprinzipien ermöglichen in einfacher und sicherer Weise lang erträumte kosmetische Effekte: Haare können permanent gefärbt, blondiert und dauergewellt werden, Sonnenschutzcremes bieten sicheren Schutz vor schädlicher Strahlung, spezielle Abrasionskörper in Zahnpasten reinigen in schonender Weise Zahnoberflächen. Praktisch alle in dem vorliegenden Buch beschriebenen kosmetischen Mittel und Möglichkeiten haben ihren Ursprung in dem Erfindungsgeist der letzten zwei bis drei Jahrhunderte. Wichtiger als alle neuen technischen Möglichkeiten ist jedoch die Tatsache, dass moderne kosmetische Mittel im Gegensatz zu den „Geheimrezepten“ früherer Zeit für die Gesundheit unbedenklich sind.
1.2.7 Veränderte Schwerpunkte für die Kosmetik in unserer Zeit
Die gegenwärtigen Anforderungen an die Kosmetik lassen sich aus der Gesetzeslage ablesen. Kosmetische Mittel werden immer mehr vereinheitlicht und internationalisiert, sie müssen für die Gesundheit des Verbrauchers völlig unbedenklich sein und sollen die Umwelt möglichst wenig belasten. Immer mehr „Lebenswege“ kosmetischer Präparate werden in Ökobilanzen ermittelt. Nicht mehr die kosmetische Wirkung des Stoffes, die er am Körper vollbringt, steht allein im Vordergrund, sondern auch, ob er ressourcenschonend gewonnen und ohne Schaden für die Umwelt entsorgt werden kann. Die Gesetzgebung will darüber hinaus auch irreführenden Werbeaussagen ein Ende setzen. Schon in naher Zukunft müssen alle ausgelobten Wirksamkeiten objektiv überprüfbar sein. Diese Anforderungen können gestellt und realisiert werden, weil in den letzten Jahren die Informationstechnik sich geradezu explosionsartig entwickelt hat; sie beeinflusst inzwischen alle logistischen, formulierungs-, produktions- und messtechnischen Vorgänge und gestaltet sie übersehbarer und schneller. Die Entwicklungszeiten für neue Produkte werden kürzer, das Zeitrad dreht sich immer rascher, der Fortschritt wird zur Gewöhnung! Fragen jedoch wie „Wozu?“, „Sollen wir alles tun, was wir können?“, „Was ist der Sinn unserer Aktivität?“ werden immer hartnäckiger gestellt. Ein großer Teil der Bevölkerung verlangt die Rückbesinnung auf überkommene Werte, auf Sinngehalte, die von einem ganzheitlichen Eingefügtsein des Menschen in soziale und welthafte Beziehungen ausgehen. Die Stärke einer modernen Kosmetik wird sich darin erweisen, inwieweit sie sich auf diese Fragestellungen einlässt.
Kosmetik hat zu tun mit der Pflege und der Verschönerung des Menschen. Was ihr im Laufe der Geschichte nicht gelungen ist und was ihr auch in Zukunft nicht gelingen wird, ist die Aufhebung menschlicher Begrenztheit. Sichtbares Zeichen unseres Begrenztseins ist das Altern, gegen das weder Technik noch kosmetisches Verdecken helfen. Hier müssen andere Kräfte freigesetzt werden! Dabei sollte bedacht werden: Die Aufgabe der Kosmetik besteht darin, unsere Person hervorzuheben und zur Geltung zu bringen. Sie hat dann ihr Ziel erreicht, wenn sie uns das werden lässt, was wir sein wollen. Versteht sie sich jedoch als eine menschliche Aktivität, die lediglich unserer Sucht nach „Mehr scheinen wollen“ nachkommt, wird sie sich durch Goethes Faust belehren lassen müssen:
„Du bist am Ende – was du bist.
Setz dir Perücken auf von Millionen Locken,
Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken,
Du bleibst doch immer, was du bist.“
1.3 Literatur
DESROCHES-NOBLECOURT, C. (1963),Tutench-Amun, Ullstein Verlag, Berlin.
HAWKES, J. (1977), Bildatlas der frühen Kulturen, Bertelsmann Verlag, Gütersloh.
kLOOS,W. (1952), Spiegel der Schönheit, Coriolan GmbH, Hamburg.
kLOOS,W. (1979), Die Sammlung Schwarzkopf im Herrenhaus Steinhorst, Karl Wachholtz, Neumünster.
PAQEL, J. (1912), Geschichte der Kosmetik, in Handbuch der Kosmetik, Joseph, M. (Hrsg.), von Veit & Comp., Leipzig, S. 746ff.
SCHADEWALDT, H. (1975), Zur Geschichte der Kosmetik, Ärztl. Kosmetologie2, 74–85.
WALL, F. E. (1974), Historical Development of Cosmetic Industry, in Balsam, M.S., Sagarin, E. (Hrsg.), Cosmetics Science and Technology, John Wiley & Sons, New York, S. 37–161.
2
Gesetzgebung und Kosmetik
2.1 Hintergrund
Die Einführung des europäischen Binnenmarktes hat insbesondere auch zum Ziel, in der gesamten Europäischen Union (EU) einheitliche Regelungen zu schaffen. Für kosmetische Mittel besteht eine solche Gesetzgebung in Form der EG-Kosmetik-Richtlinie (EG-KRL) bereits seit 1976. Allerdings ist die Umsetzung dieser Gesetzgebung in den einzelnen Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher Schnelligkeit und Gewissenhaftigkeit erfolgt. Während der deutsche Gesetzgeber die Umsetzung sehr exakt vollzogen hat, haben einige andere Länder die EG-KRL bis heute noch nicht vollständig in ihr nationales Recht überführt. Hinzu kommen die neuen Mitgliedstaaten, die bis zum Beitritt ihre bestehenden nationalen Gesetze an die EGKRL angepasst haben müssen.
Bisher hatten die Staaten noch die Möglichkeit einzelne Stoffe selbst zu regeln. Doch auch diese Ausnahme soll gestrichen werden, und dann müssen die Mitgliedstaaten bei der Regelung einzelner Stoffe die Schutzklausel ziehen, das heißt, sie müssen innerhalb kürzester Zeit den übrigen Mitgliedern der EU und der Europäischen Kommission den Beweis dafür liefern, dass eine von ihnen vollzogene strengere Regelung gerechtfertigt ist. Ist dies nicht der Fall, so muss die Regelung zurückgenommen werden.
Basierend auf der langjährigen Erfahrung mit der EG-KRL hat der Gesetzgeber die Richtlinie immer wieder modifiziert, um den hohen Anforderungen an kosmetische Mittel gerecht zu werden. Wesentliche Änderungen ergaben sich mit der 6. und der 7. Änderungs-Richtlinie, die eine Vielzahl neuer Auflagen für die Hersteller kosmetischer Mittel mit sich bringen. Diese Regelungen sollen insbesondere die hohen Anforderungen an den gesundheitlichen Verbraucherschutz für kosmetische Mittel weiter verbessern.
2.2 Die Regelung in der Europäischen Union
Die EG-KRL wurde am 27. Juli 1976 erlassen und regelt EU-weit Voraussetzungen für das Inverkehrbringen kosmetischer Mittel. Inzwischen wurde diese Richtlinie mehrfach geändert. Insgesamt sind 30 Anpassungs-Richtlinien und 7 ÄnderungsRichtlinien veröffentlicht. Darüber hinaus wurden 9 Richtlinien über Analysenmethoden zur Kontrolle der Zusammensetzung kosmetischer Mittel bekannt gegeben.
Während mit den Anpassungs-Richtlinien Regelungen für in den Anhängen genannte Stoffe getroffen wurden, d. h. Anpassungen an den technischen Fortschritt, z. B. Verbote einzelner Stoffe, wurden mit den Änderungs-Richtlinien prinzipielle Änderungen, z. B. die Modifizierung der Kennzeichnungs-Vorschriften, vorgenommen. Während Änderungs-Richtlinien der Zustimmung des Rates der EU und des Europäischen Parlamentes bedürfen, erfolgt die Verabschiedung von AnpassungsRichtlinien durch das einfache Verfahren unter Einbeziehung des Anpassungs-Ausschusses.
2.2.1 Definition der kosmetischen Mittel
Im Artikel 1 der EG-KRL ist die Definition kosmetischer Mittel festgelegt:
Kosmetische Mittel sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die dazu bestimmt sind, äußerlich mit den verschiedenen Teilen des menschlichen Körpers (Haut, Behaarungssystem, Nägel, Lippen und intime Regionen) oder mit den Zähnen und den Schleimhäuten der Mundhöhle in Berührung zu kommen, und zwar zu dem ausschließlichen oder überwiegenden Zweck, diese zu reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern und/oder den Körpergeruch zu beeinflussen und/oder um sie zu schützen oder in gutem Zustand zu halten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























