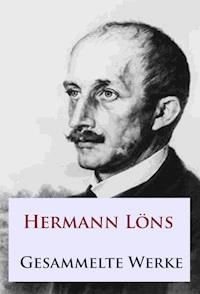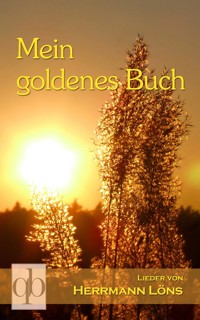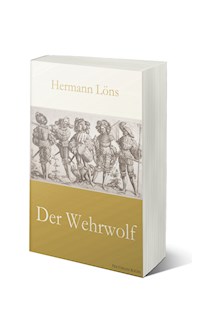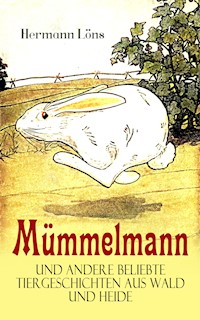Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein Buch für Heger und Pfleger. Löns zeigt hier die Seiten der von ihm so geliebten Jagd auf, die weit über das Schießen eines Tieres hinausgehen.
Das E-Book Kraut und Lot wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kraut und Lot
Hermann Löns
Inhalt:
Hermann Löns – Biografie und Bibliografie
Kraut und Lot
Der Jäger
Der Heger
Das eine Jahr
Tote Zeit
Wenn der Tauber ruft
Hahnenfieber
Raubzeug
Der Grenzbock
›Hurra, die Enten!
Die Lockjagd
Auf Birkwild
In der Feiste
Ein Mastjahr
Holztreiben
In Reih und Glied
Die Betze rennt
Hahn in Ruh!
Ein rohes Vergnügen
Das andere Jahr
Im weißen Zeug
Balzjagdsünden
Anstandsregeln
Der Standhauer
Tinamu & Cie.
Der Bock treibt
Pfui laut!
Vom Hochsitz
Jägerlatein
Volle Wände
In Acht und Aberacht
Der Überjäger
Wahr too!
Jagd und Politik
Auf der Wildbahn
An der Bergwiese
Auf dem Bullerberge
Vor den Bruchwiesen
Abseits der Welt
Waldpfingsten
Vor der Brandung
Auf dem roten Haititel
Am Forellenwasser
Hinter dem Sommerdeiche
In der wilden Wohld
Quer durch den Bruch
Die Höltenkammer
Unter der schwarzen Wand
Auf weißer Heide
Im hohen Venn
Moorfrühling
Am Deipenmoor
In den Hungerbergen
Im Schweinebruch
Der Beberteich
An der Beeke
Am Abstich
Den Bach entlang
In Risch und Rohr
Auf Pirsch im Porst
Durch Dick und Dünn
Am Fließe
Unter dem Hange
Über dem Sommerdorfe
Am Langenkampe
Ho Rüd'hoh
Rauhreif
Nebel
Vollmond
Blachfrost
Anstand
Märzenschnee
Vor dem Uhu
Unter dem Espenbaume
Auf dem Abendstrich
Vor Tau und Tag
Minne im Moor
Im Frühlicht
Des Täubers Ruf
Um die Unterstunde
Am schwarzen Luch
Gewittersegen
Am Wildbache
Am Aeschenwasser
Südsüdwest
Von Knick zu Knick
Zwischen den Hecken
Strandgang
Auf der Lauer
Mit dem Frett
Auf der Heide
Im gelben Bent
Auf der Stoppel
Ein grüner Bruch
Am Heidsee
Vor der Wildwiese
Auf dem Einlaufe
Die stille Nacht
Über dem Tale
Auf Sauen
Kraut und Lot, H. Löns
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster, Deutschland
ISBN: 9783849624408
www.jazzybee-verlag.de
Hermann Löns – Biografie und Bibliografie
Deutscher Journalist und Schriftsteller, geboren am 29. August 1866 als Sohn des Gymnasiallehrers Friedrich Löns und dessen Frau Clara in Kulm (Westpreußen), verstorben am 26. September 1914 in Loivre, Frankreich. Nach dem Abitur 1886 studiert er Medizin, Naturwissenschaften und Mathematik in Münster, Greifswald und Göttingen. 1890 bricht er das Studium ab und wird kurz darauf Hilfsredakteur bei der "Pfälzischen Presse" in Kaiserslautern. Nach kurzen Engagements bei mehreren anderen Zeitungen und der Hochzeit mit Elisabeth Erbeck 1893 veröffentlicht er erste satirische Gedichte im "Hannoverschen Anzeiger". 1901 lässt Löns sich scheiden und zieht nach Bremen. Es folgen seine bekanntesten Erzählungen und Bücher über das Leben in der Lüneburger Heide und es zieht ihn immer mehr ins Reich der Natur und des Tierlebens. Als der Erste Weltkrieg ausbricht meldet sich Löns freiwillig um ein Kriegstagebuch zu schreiben. Er fällt schließlich an der Front.
Wichtige Werke:
Mein grünes Buch, 1901Mein goldenes Buch, 1901Mein braunes Buch, 1907Der letzte Hansbur, 1909Dahinten in der Heide, 1909Mein blaues Buch, 1909Mümmelmann, 1909Der Wehrwolf, 1910Das zweite Gesicht, 1911Der zweckmäßige Meyer, 1911Auf der Wildbahn, 1912Da draußen vor dem Tore, 1912Mein buntes Buch, 1913.Goldhals, 1914Die Häuser von Ohlenhof, 1917Aus Wald und Heide, 1920Kraut und Lot
Der Jäger
Der weiß es nicht, was Jagen ist, der nur im Felde knallt;
Denn Jagen, das ist Pirschen Im heimlichstillen Wald,
Und Jagen, das ist Schleichen In Heideeinsamkeit,
Und Jagen, das ist Schweifen In Moorunendlichkeit,
Ist Harren hinter Klippen Ist Lauern an dem Strand;
Wer nur im Wald zu jagen weiß, Hat nie die Jagd gekannt.
Der Heger
Das Schießen allein macht den Jäger nicht aus; Wer weiter nichts kann bleibe besser zu Haus.
Doch wer sich ergötzet an Wild und an Wald, Auch wenn es nicht blitzet und wenn es nicht knallt,
Und wer noch hinauszieht zur jagdlosen Zeit, Wenn Heide und Holz sind vereist und verschneit,
Wenn mager die Äsung und bitter die Not,
Das eine Jahr
Tote Zeit
Wenn die Jagd auf den Hasen schließt, dann beginnt auch für den Durchschnittsjäger die Schonzeit.
Einige sind dessen froh; Tag für Tag Kesseltreiben oder Standtreiben mitzumachen, das ist bei hartem Sturzacker und steifem Nordostwind auf die Dauer kein Genuß mehr, so herrlich es einem anfangs auch dünkt. Andere aber sind voller Betrübnis. Neidischen Herzens gedenken sie der Männer, denen es vergönnt ist, auf Sauen, geltes Wildbret und geringe Hirsche zu pirschen oder am Seestrande und Flußborde allerlei fremdes Geflügel anzugehen, und sehnsüchtigen Herzens wünschen sie den Vorfrühling herbei, der ihnen Schnepfenstrich und Hahnenbalz beschert.
Nur wenige sind es, die auch in der stillen Zeit zu Holze ziehen. »Was soll ich draußen?« sagt man sich, »es gibt doch nichts zu schießen!« Meistens gibt es das allerdings nicht, aber ein gerechter Weidmann vergißt sein Wild und seine Jagd auch wintertags nicht; er sieht einmal zu, ob das Rehzeug nicht Not leidet, ob es nicht nötig ist, den Hühnern und Fasanen zu schütten, ob es nicht am schneehellen Abend bei den Kohlgärten knallt und ob die Pässe und Wechsel schlingenfrei sind.
Ein Gang in die Jagd lohnt sich immer, vorzüglich zur kargen Zeit. Es hat geschneit und es hat getaut. Hartschnee deckt die Saat, zugeweht sind die Himbeeren, verschneit ist das Heidkraut. Dankbar nehmen es die Rehe auf, tritt der Mensch ihnen von ihren Ständen zu der Äsung Bahn, denn allzu leicht klagen sie an den Läufen, müssen sie sich selber die Wechsel durch die scharfe Schneekruste treten, und die laufkranken Stücke reißt dann ohne viel Mühe der Fuchs. Eine Kleinigkeit ist es für den dickbestiefelten Jäger, über der Saat und auf heidwüchsigen Blößen den Schnee zu zertreten und hin- und hergehend das Himbeer- und Brombeergestrüpp vom Schneebehange zu reinigen; leichte Arbeit ist es, hier und da mit der kurzen Wehr für Proßholz zu sorgen, wenige Mark kostet es, den Abraum, der beim Ausasten der Obstbäume beiseite fällt, in die Jagd zu fahren und an passenden Stellen auszulegen, aber reiche Frucht trägt alles das dem Jäger.
Nicht nur einen Wechsel auf die Zukunft bringt so pflegliches Tun, es fällt nebenbei auch noch mancherlei ab, was nützlich und angenehm ist. Freischützen und Ströpper sehen sich sehr vor in einer Jagd, in der der Jäger auch dann auftaucht, wenn das Wild Schonzeit hat, und die Dorffixe, die sich das Hetzen angewöhnten, bleiben gern zu Hause, spürten sie einmal Nummer acht mit Pfeffer und Salz auf den Keulen. Auch glückt es dem Jäger gar zu leicht, den heimlichsten seiner heimlichen Böcke wieder zu Blick zu bekommen und sich einen Vers darauf zu machen, wo er den Herrn Geheimrat im jungen Sommer, wenn Dickung und Stangenort grüne Mauern sind, zu suchen hat, und so haut er sich heute schon hier einen Pirschsteig und da eine Bucht und sorgt für einen Hochstand oder eine Kanzel, wo es nötig ist. Ab und zu aber kommt dann auch ein Tag, an dem der Gang sich bar bezahlt.
Am hohen Ufer des schnellen Baches holt der Jäger den Erpel herunter und schmückt mit den krummen Wirken den Hut; aus dem hohen Schnee tritt er das Kaninchen, und schießt er das erste Mal auch daneben, er lernt es bald, zu unterscheiden, was es heißt, das Wild in die Schrote hineinlaufen zu lassen; heute erbeutet er im gelben Röhricht am Teiche den überzähligen Fasanenhahn, morgen glückt es ihm, aus der pfeilschnell dahinbrausenden Schar Birkwild einen stolzen Hahn herunterzuholen, und ist er ganz begnadet, so bringt er auch wohl einen seltenen Gast mit, eine Trappe, einen Säger oder ein anderes Stück fremden Wassergeflügels.
Je öfter der Jäger zwischen Schonzeit und Jagdaufgang zu Holze zieht, um so mehr sieht er ein, daß es keine tote Zeit gibt. Ist er harter Art, macht er sich aus kniehohem Schnee und pfeifendem Winde nichts, so dünken ihm Wald und Heide zur winterlichen Zeit ebenso schön wie sommertags.
Wenn der Hunger hinter dem Hartfrost im Walde hergeht, dann hat es der Fuchs gut. So manches Reh, das mit zerschundenen Läufen dahinzieht, fällt ihm zur Beute, und manchen kümmernden Hasen reißt er im Lager. Niemals ist die Maus leichter zu greifen als unter dem Schnee, und rund um die Gehöfte liegen die Abfälle von den Schlachtfesten. So wird Reineke bald der Balg zu eng, und das üppige Leben bringt ihn auf zärtliche Gedanken. Die Betze rennt. Baue, die lange unbefahren waren, führen auf dreißig Gänge gegen den Wind, starke Wechsel führen aus allen Dickungen zu ihnen, und rundumher ist der Schnee zertreten.
Der Jäger, der von der Fütterung kommt und vergnüglich der guten Dinge gedenkt, die ihn im Kruge erwarten, fährt zusammen, denn aus dem raumen Orte kommt ein Gekreisch, das gellend durch den Wald schallt. Hier ist es, da ist es, jetzt dort und nun wieder hier, es schwillt an und ebbt ab, steigert sich zu bellendem Gemecker, geht in ein langes Gekeife über und bricht jäh ab. Unwillkürlich flog die Waffe von der Schulter, spannte der Daumen die Hähne. Erste Dämmerung verwischt die Umrisse der Buchen, aber der Himmel ist hoch und der Schnee leuchtet. Da, wo der Wurfboden der Fichte als schwarzer Klumpen droht, fahren drei Schatten durcheinander, verknäulen sich, lösen sich, verschwinden und tauchen wieder auf.
Vergessen ist Frost und Kälte, Hunger und Durst. Heiß läuft es dem einsamen Manne über den Rücken, und unter der Mütze kribbelt es ihm, als wäre sein Haar gut abvermietet. Er weiß nicht, soll er oder soll er nicht, nämlich Stand halten oder sich heranpirschen, oder aber, denn für Schrot ist es noch zu weit, den Rieker auf den Drilling schlagen und eine Kugel wagen. Hätte er es nur getan, denn fort ist die liederliche Bande und treibt ihr zuchtloses Spiel mit Gekreisch und Gerauf in der Dickung weiter. »Pech!« denkt der Jäger und kratzt sich den Kopf. Aber langsam sinkt seine Hand an der Joppe nieder, schließt sich um den Kolbenhals, noch langsamer knicken sich die Ellbogen ein, krümmen sich und heben sich die Arme, und noch viel langsamer richtet sich die Laufmündung der Waffe dahin, wo zwischen den Bäumen zwei lange schwarze Streifen bald erscheinen, bald verschwinden. Jetzt tauchen beide Schulter an Schulter auf dem Schnee wieder auf, und da denkt der Mann der Kunst, die ihm sein Lehrprinz beibrachte: ein dünnes Zirpen kommt zwischen seinen gespitzten Lippen hervor und läßt die Füchse verhoffen. So schwach das Geräusch auch ist, das das Richten der Waffe erfordert, sie vernahmen es doch; aber ehe daß sie wenden können, reißt sie der Hagel zusammen. Der eine will wieder hoch, doch der Würgelauf spricht sein Donnerwort. Der Jäger lacht über das ganze Gesicht. Zwei Füchse, zwei starke Winterfüchse, beide gut im Balg, ein Rekel und eine Betze, das ist doch etwas anderes, als einen Krummen nach dem anderen im Kessel umzulegen. Eigentlich wolle er diesen Abend schon nach Hause; aber es waren drei Füchse da, und so bleibt er die Nacht im Kruge und zieht vor der Sonne zu Holze. Zu Schusse kommt er morgens am Bau freilich nicht, aber der dritte Fuchs liegt ihm zu sehr im Sinne; so verpaßt er den besten Zug und da der Neuschnee so weich und der Tag so warm ist, läßt er Geschäft Geschäft sein, pfeift auf die Stadt und bleibt, wo er ist. Da, wo er weiten Blick und etwas Deckung hat, frühstückt er ausgiebig von den derben Dingen, die ihm die Krugwirtin in den Rucksack tat, und dann bummelt er gemütlich, aber mit offenen Augen, durch sein Reich.
Es ist so viel zu sehen und zu hören im Walde, daß ihm bei seiner Pfeife die Zeit nicht lang wird. Meise, Häher, Dompfaff, Specht, Zeisig, Kreuzschnabel, Krähe, Zaunkönig und Ammer unterhalten ihn; er sieht dem Eichhorn zu, das Fichtenzapfen zerraspelt, und der Maus, die bei der Fasanenschüttung fett lebt, freut sich über den Eisvogel am Bachkolk und über des Bussards Gleitflug, und dann fällt ihm ein, daß in der Dickung da unten bei jedem Treiben ein Fuchs steckt. So meinte er, es lohne sich wohl, die Kanzel zu erklimmen und Musik aus der hohlen Faust zu machen. Gedacht, gemacht! Jämmerlich klingt Lampes Todesklage durch die Stille, mit Gezeter von den Hähern, mit Gequarre von den Krähen begleitet.
Eine kleine Viertelstunde vergeht. Der Jäger überlegt, ob er nicht wieder hinunterklettern soll. Aber fünf Minuten will er noch daran wenden. Aus fünf werden zehn, aus zehn fünfzehn. Nun, es ist wohl alle Tage Jagdtag, aber nicht jeden Tag Fangtag. Doch was war das? Da bewegte sich doch etwas am Rande der Dickung? Es kann ein Hase sein, aber vielleicht ist es das Gegenteil. Wahrhaftig, der Fuchs ist es. Da ist der Kopf, und da die Lunte; den Rumpf decken die Fichtenzweige. Aber jetzt tritt er vor, windet und tritt aus der Dickung heraus. So steht er gerade richtig für die Kugel. Drauf, eingestochen, gedrückt! Das glückte! Er rollt bergab, schlägt noch einige Male und rührt sich nicht mehr.
Sehr vergnügt ist der Jäger. Sobald er kann, will er wieder draußen sein. Es sind noch viel mehr Füchse im Berge, und Marder auch, und eine leere Redensart ist es, das Wort von der toten Zeit.
Wenn der Tauber ruft
Es gibt einen alten Spruch, der da lautet: »Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.« Er klingt kleinbürgerlich und philisterhaft in unserer großartig auftretenden Zeit, in der die Millionäre wie die Fliegenpilze aus dem sozialen Humus hervorbrechen, um freilich oft genug nach der Schwammerlinge Art zu vergehn und weiter nichts zu hinterlassen als Stank und Schleim.
Darum ist es gar nicht so dumm, kramt man einmal wieder das alte, arg verschossene Sprichwort heraus, denn ein bißchen philiströse Gewissenhaftigkeit, so ein wenig kleinbürgerliche Genauigkeit, die kann uns im täglichen Leben wahrhaftig nichts schaden. Auch der Jäger tut gut, neben Patronen, Butterbroten, Zigarren und Kognakfläschlein dieses Leitwort unsrer Ahnen im Rucksack zu verstauen, sintemal und alldieweil er von der Hauptkrankheit unserer Zeit, der dicketuerischen Großmannsucht, recht erheblich angesteckt zu sein pflegt. Einst war die Jagd bei uns ein adlig Spiel, adlig insofern, als es ernst genommen wurde. Kein Zweig der Jagd galt als gering, jeder mußte, sollte der Jäger nicht als Fleischmacher und Luderjäger gelten, gerecht gehandhabt werden. Heute ist das anders: »a' la mode-Kleider, a' la mode-Sinnen; wie sich's wandelt außen, so sich wandelt binnen.« Nicht nur ihre abgelegten Kleidermoden trägt der deutsche Jäger den engelländischen Halbvettern nach, er zieht sich dadurch auch eine karierte Gesinnung zu und wird zum Sportschützen, zum Schießer und Rekordathleten.
Von des deutschen Weidwerks heimlicher Luft versteht er so viel, wie die Kuh vom Kunstdünger. Die Beute, das ist ihm die Hauptsache, das Was, aber nicht das Wir ist sein Ziel, die hohe Ziffer sein Ideal. »Na, wieviel Böcke haben sie denn jetzt tot?« das ist die gängigste Frage am Jägerstammtisch. Man möchte meinen, es handle sich um den Stand der Aktien oder um Kurengewinne. Auch die Höhe der Strecke hat ihren Wert, aber nur bei Treibjagden auf Hasen oder ein anderes gemeines Feld-, Wald- und Wiesenwild. Sobald aber das Wild zur Mittel- und Hochjagd gehört, soll nicht die Endsumme der erbeuteten Stücke, sondern die Stärke des einzelnen Stücks und die Art, in der es erlegt ist, das wichtigste daran sein. Drei Hirsche, vor der Treiberwehr geschossen, wiegen nicht so schwer wie einer, nach wochenlanger Mühe auf der Pirsche erbeutet, und das Gehörn ist dem wahren Weidmann am liebsten, das ihn die meisten Schweißtropfen kostete.
»Welch ein Blödsinn!« sagt der Mann von heute, dem der mühelos erworbne Gewinn, sei es Mammon, sei es eine Jagdtrophäe, lieber ist denn der, so mit Schweiß und Arbeit verknüpft ist; »wie ich den Bock oder den Hirsch kriege, das ist mir wurst, wenn ich ihn nur kriege.« Es muß auch solche Leute geben, es ist sogar gut, daß es solche gibt, denn wenn es keine Schießer gäbe, so hätte der Weidmann nicht das wärmende Gefühl unter der Weste, neunundneunzig Prozent mehr wert zu sein als der Jagdprolet, und wenn dieser auch die Tasche voll brauner Lappen hat, einen Kragen mit Rückantwort trägt und im eigenen Auto zu Holze stänkert. Der andere aber fährt dritter Klasse, trägt ein Flanellhemd und dreht jede Mark in der Hand herum, ist aber doch dreißig Male und drei mehr Jäger, als der Jagdprotz. Der saust im Sechzigkilometertempo zu Jagd, liest derweilen ein Börsenblatt, nimmt in dem Herrenzimmer des Dorfkruges den Bericht des Jagdaufsehers entgegen, keilt in den drei Tagen drei Böcke vorbei und erschlägt sechse unter Zuhilfenahme von Streifenlader, Zielfernrohr und Zielstock, und gondelt in dem erhebenden Bewußtsein, seinen Gästen beim Rochefort die neuesten Knochen, einer noch kapitaler als der andre, vorweisen zu können, dem großen Asphaltdorfe wieder zu, froh, seinem Jägerruhm einige neue Lorbeerblätter hinzugefügt zu haben.
Na ja, es gibt solche Jäger und so 'ne, so 'ne aber sind die meisten. Knöpft man einem so'nem den Kieker und den Zielstock ab, setzt ihn piquesolo und unbevormundet durch den Jagdaufseher in einem leidlich besetzten, möglichst urwüchsigen Reviere ab mit dem guten Rate, es einmal mit der Pirsche aus der freien Hand zu versuchen, wetten, daß er verloren und verkauft ist? Oder stellt ihn in den Vorfrühlingswald und sagt ihm: »So, Verehrtester, nun beweist einmal, daß ihr pirschen könnt, und schießt in einer Stunde einen Ringeltauber, aber wohlgemerkt, nicht einen, der Euch zusteht, sondern den da, der da hinten ruckst und der leicht an dem gedoppelten Endreim seines Rufes zu erkennen ist!« übel steht es mit dem Manne; er wird dahinpoltern wie ein altes Holzweib, wird dem Tauber eine ganze Masse Bewegung verschaffen, aber kriegen wird er ihn nicht. Denn es ist nicht so einfach, sich an den rucksenden Tauber heranzupirschen, und mancher Mann, der ganze Wände voll selbsterbeuteter Rehkronen und einige gute Geweihe darunter hat, kann sich krumm und krüppelig schleichen, und muß doch heimziehen, ohne einen der Waldbauchredner bekommen zu haben.
»Aber,« wird dieser Mann sagen, »zu was soll ich denn hinter diesem Jammervogel herkrebsen, der noch nicht einmal auf dem Jagdscheine steht? So bei Wege kann man ja mal auf eine abstreichende Wildtaube hinhalten, aber sich um sie abzuquälen, wie um einen Bock, das hat doch sehr wenig moralischen Wert!« Hierauf könnte man ihm antworten: »Ihre Meinung in Ehren, Allerwertester, aber sie ist blödsinnig.« Man kann wohl einer abstreichenden Taube hinhalten, besonders wenn man Wert darauf legt, sich mit Aasjägerodeur zu parfümieren, denn Tauben, das heißt, weibliche Tauben, schießt ein anständiger Mensch erst im Herbste. Aber einen Täuber kann man immer schießen, denn es gibt genug Junggesellen davon, die liebendgern eine Taubenwitwe trösten. Jetzt zum Beispiele, wo der Wald noch laublos ist, da kann man bei der Jagd auf den rufenden Tauber das Pirschen lernen; nachher, wenn der Wald erst dicht ist, ist es keine große Kunst mehr. Leicht ist es nicht, jetzt den Weißkragen zu erbeuten; aber schlägt er hart zwischen die Blumen, die im Fallaube leuchten, dann hat man seine Freude an seiner Geschicklichkeit. Geduld muß man freilich haben, eine Bussardsgeduld, denn hat schon der Birkhahn auf jeder Feder ein Auge, der Tauber hat darauf mindestens zweie, und er vernimmt noch dazu sehr scharf. Da heißt es denn oft, zehn Minuten und länger sich so still zu benehmen, wie ein frischgebackner Reichstagsabgeordneter, und hinter dem Baume auszuharren, bis der abendwolkenfarbige Vogel seinen Argwohn schießen läßt und sein dunkles Lied wieder beginnt. Schlumpt es, so braucht man vielleicht eine halbe Stunde dazu, um einen einzigen Ringeltauber herunterzuholen, aber es kann auch eine volle Stunde darauf hingehn. Macht man das aber öfter, dann bekommt man das Pirschen so in die Glieder, wie der Artist seine Arbeit, und man braucht sich nicht erst, pirscht man sich an einen Bock heran, bei den Ohren zu nehmen und sich zu sagen: »Jetzt wird gepirscht, oller Junge!«. Man pirscht, wie man ißt oder trinkt oder raucht.
Die Sonne fällt auf die altsilbergrauen Buchenstämme; die Windröschen im goldbraunen Vorjahrslaube blitzen luftig, und fröhlich leuchten aus dem grünen Moose am Grabenborde die treuen Blüten des Leberblümchens. In jedem Baume beinahe sitzt ein Fink und zeigt, was er kann, vor dem Wipfel der zopftrocknen Eiche verzapfen die Stare einen ulkigen Heringssalat von Melodien, ein halbes Dutzend von Meisensorten piepsen auf ebenso viele Weisen, selbst der Häher bekommt es mit der Dichteritis, und sogar die Krähe empfindet das Bedürfnis, sich lyrisch zu benehmen, wenn der Versuch auch nur höchst mangelhaft ausfällt; dazu trommelt der Buntspecht nach der Schwierigkeit, der Zaunkönig riskiert eine Lippe, als wäre er nicht einen Zoll lang oder vielmehr kurz, sondern einen halben Fuß, die Amsel jodelt, die Spechtmeise flötet wie ein Scherenschleifer, das Monstrekonzert ist in vollem Gange. Aber einer fehlt noch, der mit dumpfem, warmen Rufe alle anderen Laute übertönt, der Tauber. Da hinter ruft einer. »Dudu, dududu,« ruft er seiner Taube zu, wirft sich vom Aste, schwingt sich über die goldig schimmernden Kronen, schwebt da in herrlichem Fluge, klatscht wie ein Berufsklaqueur, tanzt auf und ab, fußt auf der Eiche, verschweigt eine Weile und fängt dumpf zu knurren an. »Hurr, hurr, hurr,« klingt es. Den wollen wir uns einmal langen.
Pst, nicht so eilig! Erst muß er wieder rufen, sonst äugt er uns und reitet ab. Jetzt los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Schritte. Halt! Er will eben »huk« sagen und das ist der Schlußvers. Eine ganze Weile sagt er gar nichts, aber jetzt legt er wieder los. Also vorwärts, marsch, aber Vorsicht, Vorsicht! Denn er äugt scharf. Also immer in Deckung geblieben, und leise getreten, sonst geht er hin und singt nicht mehr, oder vielmehr da irgendwo ganz hinten im Walde. Sie schwitzen ja jetzt schon, Liebwertester, und den Tattrich haben Sie auch! Sehen Sie, der Appetit kommt en mangeant! Sie haben Blut geleckt, die Sache fängt an, Ihnen Spaß zu machen! Und nun: noch einmal, weil es so schön ging! So recht, so schön, so brav, das haben Sie gut gemacht! Da sitzt er, da! Sie sehen ihn nicht? Kein Wunder, denn nicht umsonst gab ihm die Natur fast dieselbe Farbe, die der Himmel hat. Da, wo der spitze Hornzacken steif gegen den Himmel steht, links davon, das ist er! So, nun noch sechzig Gänge, dann haben Sie ihn! Aber das dicke Ende kommt immer zuletzt, denn nun geht uns die Deckung aus. Sehen sie zu, daß Sie da nach der Fichtengruppe hinkommen. Jetzt ist es Zeit, jetzt ruft er wieder. So, nun dreißig Gänge, dann gehört er Ihnen. Los! Halt! Er hat Unrat gewittert. Wir haben ja Zeit, er aber auch. Endlich! Eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte, halt! Warten, warten, noch zu weit: der Tauber hat eine Art von Doweschen Panzer an und kann viel vertragen. Darum noch zehn Gänge näher heran, bis zu der Eiche da, und jetzt ist es Zeit. Er ist unbequem, der Schuß steil nach oben, aber um so schöner ist es jetzt, wo der bunte Vogel uns dicht vor die Füße schlägt und dann ein Gestöber von weißen Federn hinterherrieselt. Blanke Augen haben Sie, eine nasse Stirn, vergnügte Finger und linkerhand unter Ihrer Weste klopft irgendetwas recht deutlich. »Na, war das nicht schön? und haben Sie nicht viel gelernt bei Ihrem ersten Tauber?«
Man soll nicht viele Tauber schießen, denn sie rufen so schön. Aber man soll sich so oft wie möglich an einen heranpirschen, und so nahe, als es eben geht, und möglichst an solche, die ganz hinten im Walde rufen. Denn ist auch ein gut gedämpfter Tauber nicht zu verachten, des Bratens wegen schießen wir ihn wahrhaftig nicht. Lernen sollen wir an ihm die edle Kunst der Pirsche aus der freien Hand, des Schleichens von Stamm zu Stamm, beibringen soll er uns die Fähigkeit, lautlos zu sein und unsichtbar, damit wir sie in den Gliedern haben, gilt es dem guten Bocke oder dem braven Hirsch. Ob Hirsch, ob Bock, ob Tauber, im Grunde ist das gleich. Die Hauptsache ist es, sich als Urmensch zu betätigen, seine Sinne zu gebrauchen, seine Kräfte anzuspannen, einmal wieder ganz Mann zu sein und Mensch, den Asphalt zu vergessen und die ganze städtische Lackiertheit, die uns allen Murr und Purr aus den Knochen saugt und uns solange knechtet und knetet, bis wir uns wie unsere eigenen Urgroßväter vorkommen und ganz vergessen, daß der Mensch seine Augen nicht nur zum Lesen und Schreiben über die Nase gesetzt bekommen hat, und mit den Ohren auch noch etwas anderes anfangen kann, als den Hörer des Fernsprechers davor zu halten.
Und das ist das Beste, das Wichtigste und Wertvollste, das uns die Jagd bietet. Sie legt uns einmal wieder der Natur an die runde nahrhafte Brust, auf daß wir daraus neue Kräfte und frische Stärke saugen, wir armen Kinder einer Zeit, die mit unseren Nerven Schindluder spielt und unsere Sinne zu Appelmus rührt. Auf dem Asphalt, im Kurszettel, im Salon, da finden wir uns zurecht; wehe aber, wenn wir in die Natur hineingeraten, wo sie der Wege und Wegweiser entbehrt. Dann stehen wir da wie die Muhkuh vor dem neuen Tore, brüllen ängstlich, wissen nicht aus noch ein und kommen uns vor, wie der bekannte Leipziger Wassergreis mit der mangelnden Hilfswissenschaft. Im Kursbuche haben wir im Handumdrehen die Anschlüsse von Inowrazlaw nach Cognac bei Bordeaux herausgeknobelt; aber nach der Wetterseite der Bäume und dem Stande der Sonne den Weg zu finden, dazu sind wir viel zu gebildet, viel zu fein, Gott sei's geklagt. Und deshalb stellt sich der junge deutsche Mann, steckt ihn der Staat in den bunten Rock, so dämlich an, wenn er bei der Felddienstübung oder im Manöver auf Patrouille muß, denn die Natur, in der er aufwuchs, besteht aus Backsteinen, Asphalt, Schienen, Leitungsdrähten und Restaurants, und verraten und verkauft ist er, sieht er um sich herum einmal weiter nichts als Wald und Heide.
Der Sportplatz, das Ruderboot, das Rad und das Auto, sie geben uns das nicht wieder, was die Zivilisation uns nahm an gesunden Instinkten, und die Jagd, wie sie gemeiniglich betrieben wird, auch noch nicht. Hühner- und Hasensuche und Treibjagd bringen uns der Natur nicht näher: das kann nur die Pirsche aus der freien Hand. Diese aber erlernt man nur, wenn man sie oft ausübt. Woran, das ist ganz gleich. Ist der Bock noch nicht frei, nun, pirschen kann man immer, heute auf die Ente in der Uferbucht, morgen auf das Kaninchen, den anderen Tag auf den alten Fasanenhahn, auf die streunende Katze und den stromernden Fix.
Jeder solcher Pirschgang, und ist die Beute, die er bringt, auch noch so gering, bringt uns dauernden Gewinn, schärft unsere Sinne, ölt unsere Gelenke, schafft den Gliedern Leichtigkeit und den Bewegungen Sicherheit.
Darum soll man nicht versäumen, der Pirsche zu pflegen um die Zeit, wenn der Tauber ruft.
Hahnenfieber
Es gibt unterschiedliche Arten von Hähnen: Zins-, Mist-, Gewehr-, Kampf-, Kirchturm-, Manöver-, Kanarien-, Haupt- und andere Hähne. Im Vordergrund des jagdlichen Interesses steht in der demnächstigen Zukunft der Birkhahn.
Die Farbe des Birkhahns ähnelt im großen und ganzen denen des Deutschen Reiches, doch ist das Schwarz mehr ein schillerndes Blau. In der Jugend ist er etwas weniger patriotisch gefärbt. Das Gefieder der Birkhenne ist politisch indifferent.
Das Beste am Birkhahn ist nächst dem Braten das Spiel, worunter man den Stoß begreift, denn einen Schwanz hat er bekanntlich ebensowenig wie die übrigen jagdbaren Tiere, z.B. das Reh. Sonstige Eigentümlichkeiten des Birkhahnes sind, daß er auf jeder Feder ein Auge hat, wodurch er stets in der Lage ist, sich über alles, was um ihn vorgeht, so gut zu orientieren, als ob er ein Orientale wäre. Ferner besitzt er eine große Abneigung gegen Schrotkörner, die er nur dann annimmt, wenn es gar nicht anders geht.
Lange bevor Ernst von Wolzogen und die sieben Scharfrichter auftraten, erreichte der Birkhahn schon Überbrettl, indem er mit mehreren von seinesgleichen jeden Morgen um dieselbe Stunde zusammenkam und mit Spiel und Tanz sich und die im Kreise versammelten weiblichen Festteilnehmer ergötzte. Wie sein Gesang dem Schnadahüpfl, so ähnelt sein Tanz dem Schuhplattler. Der Hahn macht bald einen langen Hals und bläst sein Tschuhuit, oder er trommelt wie unklug und rutscht dabei über die Erde. Manchmal hopst er in die Höhe, manchmal läßt er es bleiben. Zu diesen Überbrettlvorstellungen ladet sich der Jäger gern zu Gast. Er macht sich in der Nähe der Bühne ein Loch in die Erde, steckt Wachholderzweige herum und bezieht bei nachtschlafender Zeit diese Parterreloge, um der Dinge zu warten, die da kommen sollen.
Meist kommt erst eine ganze Weile gar nichts, nur daß irgendwo im Hintergrunde die Mooreule seufzt. Dann geht in der Luft das Gemecker der Bekassinen los. Darauf macht sich der Wind auf, worauf der Jäger kalte Füße bekommt, weswegen er einen Schnabus trinkt, infolgedessen es ihm nach einer Viertelstunde so kalt über den Rücken läuft, daß er noch einen trinken muß. Eine ganze Weile kommt dann weiter nichts als eine Gänsehaut nach der anderen. Die kalten Füße verlängern sich bis an die Gegend, wo die Hosenträger ihr Ende finden. Auch die Finger werden bis an die Schultern kalt, das, was zwischen den Zehen und Fingern sitzt, schließlich auch, und der Jäger stellt mit Entsetzen fest, daß seine Pulle nichts mehr enthält.
Um sich zu erwärmen, raucht er, worauf sich jener Zustand einstellt, der den spanischen König seinerzeit veranlaßte, auszurufen: »Der Aufruhr gärt in meinen Niederlanden.« In diesem schönen Augenblick geht es: »Dß, dß, dß« über den Jäger hin, »buff« sagt es, denn nun wird die Sache erst richtig, denn der Hahn ist da. Wo, das weiß der Jäger nicht, er weiß nur, daß er sich jetzt nicht rühren darf. Eine Viertelstunde vergeht; dem Jäger wird elend. Es folgt eine zweite Viertelstunde; dem Jäger wird nicht besser. Eine dritte Viertelstunde sinkt im Meere der Vergessenheit; der Jäger nimmt alle fünf Sinne zusammen, aber sowohl der Un- wie der Schwach-, der Stumpf- wie der Blöd,- ja sogar der Irrsinn lassen ihn im Stiche. Er hört nichts als das Schweigen, und er sieht nichts als die Dunkelheit.
Endlich hört er halblinks einen Ton, ähnlich dem eines Menschen, dem etwas übel wird. Erst denkt der Jäger, sein eigener innerer Mensch sei es, denn ihm ist danach zumute, aber bei reiflicher Überlegung kommt er zu dem Ergebnis, der Hahn müsse es gewesen sein. Nach einer Viertelstunde hört er den Ton wieder. Und dann ist abermals alles still. Endlich, als der Jäger schon im Hintergrunde seiner Seele den freventlichen Wunsch äußert, im warmen Bett geblieben zu sein, hört er halbrechts einen andern Ton. Der Hahn schüttelt sein Gefieder. Dem Jäger läuft es so warm über den Rücken wie beim Kaisergeburtstagsessen, als ihm der Lohndiener die Suppe hinter den Halskragen goß.
Mittlerweile wird es auch ein wenig heller. Durch die Schießlücke zwischen den Wacholderbüschen seines Schirmes sieht der Jäger einen dunklen Fleck, der sich bewegt. »Er ist es!« frohlockt des Jägers Herz. Da geht, es rechts: »Tschuhuit.« Also ist er es nicht, sondern ein Busch Heide. Aber nun wird die Szene lebendig. Die Mooreule gibt ein ulkiges Couplet zum besten. Der Kiebitz trägt eine rührselige Romanze vor. Alles bei verdunkelter Bühne. Endlich wird es etwas heller, so hell, daß der Jäger sagen kann: »Wenn das da vor mir kein Binsenbusch ist, dann ist es der Hahn oder ein Heidbult, wenn es überhaupt etwas ist.« Und nun balzen auf einmal zwei Hähne bei ihm, nein drei, oder sogar vier, wenn nicht fünf. Einen sieht er genau.
Wäre der Jäger nun schlau, dann schösse er. Er schösse ja vorbei, denn das, was er sieht, ist der Hahn nicht, und wenn er es wäre, so knallte er erst recht daneben. Aber dann jagte er wenigstens alle Hähne fort und könnte ohne Gewissensbisse machen, daß er fortkäme; denn in seiner rechten Keule zwickt es ihn bedenklich und in der linken Schulter auch, und ein siebenmal verlöteter Backenzahn, der seit Wochen keinen Spur von eigenem Leben mehr verriet, beginnt, sich auf seine alten Rechte zu besinnen, und verlängert sich ein wenig. Aber der Jäger bleibt sitzen, teils weil er zuviel Charakter, teils weil er zu wenig eigenen Willen mehr hat. Die vier Hähne um ihn herum haben ihn mit ihrem Blasen und Kullern so hypnotisiert, daß er die freie Selbstbestimmung völlig verlor. Und so sitzt er und beobachtet teils die dunklen Klumpen, die er für Hähne hält, teils die Fortschritte, die die Ischias in seiner rechten Lende und der Rheumatismus in seiner linken Schulter machen.
Ein scharfer Wind pustet über das Moor. Das Heidkraut bedeckt sich mit Reif, der Jäger mit einer neuen Gänsehaut. Es scheint ihm allmählich, als hätte er längst jeden inneren Zusammenhang mit seinen Zehen verloren. Am Himmel taucht ein Rosenschimmer auf. Ergriffen von der Schönheit des Vorfrühlingsmorgens klappert der Weidmann heftig mit den Zähnen, wobei er feststellt, daß die siebenmal plombierte Festruine in der letzten Viertelstunde um das Doppelte ihrer vorschriftsmäßigen Länge zugenommen hat.
Die Sonne geht mit einem plötzlichen Ruck auf. Ringsum balzen die Hähne, nur die nicht, die irgendwo um den Schirm des Jägers sein müssen. Der Brachvogel flötet so jämmerlich, als hätte er sich die Zehen erfroren. Ein vorüberfliegender Schwarzspecht lacht den Jäger aus, desgleichen eine Krickente, desgleichen eine Mooreule, desgleichen die Bekassine, desgleichen der Kiebitz, desgleichen die Krähe, desgleichen die Schwarzdrossel, desgleichen der Pieper, desgleichen der Würger, desgleichen der Grünspecht. Der Jäger lacht hysterisch in sich hinein. Er sieht eine Fata Morgana vor sich, bestehend aus einem warmen Bett, und darin liegt er, und seine Frau bringt ihm heißen Kaffee mit zwei dick belegten Brötchen, oder Kakao, oder Tee, oder Punsch, oder Grog, oder Fleischbrühe, oder seinetwegen auch heiße Milch, kuhheiße Milch, wenn möglich mit einem Kognak oder zweien; drei schaden auch nicht.
Er strengt seine Augen an, daß sie wie bei einem Hummer aus dem Kopfe kommen. Er versucht seine Ohren zu verlängern. Alles balzt herum, nur seine vier Hähne balzen nicht. Aber auf hundert Schritt balzt einer. Der Jäger überlegt, ob er nicht mit einer Kugel hintupfen soll. Beinahe ist er entschlossen, da balzt es dicht bei ihm. Er stößt einen lautlosen Fluch aus. Da balzt nun ein Hahn zu weit und einer zu nahe. Wenn er will, kann er ihm einen Tritt geben. Aber schießen? Kein Schimmer von einem Schein von einer Spur von einer Ahnung von einem Dunst von einer Idee einer Möglichkeit. Erstens würde der Hahn in tausend Fetzen geschossen und zweitens geht es überhaupt nicht. Der Jäger hat das Gefühl, als habe er einen Ameisenhaufen unter dem Hut, dessen Einwohner zur Gründung einer Zweitniederlassung über seinen Rücken marschieren. Ein wohltätiger Schweiß stellt sich ein. Ihm folgt ein weniger wohltätiges Frostgefühl. Der Senior der Hähne macht sich immer bemerkbarer.
Der Hahn balzt vor den eiskalten Zehen des Jägers und nun balzt auch unmittelbar hinter dem Rücken des Jägers ein Hahn. Eine Henne fußt auf dem Schirm unmittelbar über dem Kopfe des Jägers und macht sich in der gemeinsten Weise über den unglücklichen Menschen lustig. Weit weg fällt ein Schuß. Das Herz des Jägers ist eine Mördergrube. Da streicht die Henne fort und die Hähne folgen ihr. Der Jäger kann nun singen: »Ich bin allein auf weiter Flur«, aber er tut es nicht. Er trampelt sich die Eisbeine warm und stellt mit Befriedigung fest, daß der Hahn vor ihm, von dem er glaubte, daß er nicht mehr da sei, nun auch abstreicht. Wutentbrannt steckt er seinen Kopf aus dem Schirm. Da geht noch ein Hahn ab. Der Jäger sinkt in sich selber hinein. Er schnürt den Rucksack auf und langt ein Butterbrot heraus. Gerade hat er sein Butterbrot ausgekramt, da fällt in guter Schußnähe ein Hahn vor ihm ein. Er hat das Knittern des Papiers vernommen und äugt scharf nach dem Schirm hin. Der Jäger sitzt da wie eine ägyptische Königsbildsäule, nur daß er kein Sichelschwert, sondern ein Schinkenbutterbrot in der Hand hat. Das Gewehr liegt gesichert zu den Füßen des Jägers. Die Sachlage ist einfach niederziehend und bleibt es eine ganze Viertelstunde.
Fünfzehn geschlagene Minuten äugt der Hahn nach dem Schirme. Fünfzehn geschlagene Minuten sitzt der Jäger da, ein Viertel des Schinkenbutterbrotes im halboffenen Munde, den Rest in der fieberisch zitternden Männerhand. In allerliebster Abwechslung laufen ihm kalte und warme Schweißausbrüche über die gerunzelte Epidermis. Zur richtigen Zeit stellt sich ein Hustenreiz ein und nötigt den Jäger, seine Backentaschen schnell von ihrem Inhalte gemischter Nahrung zu befreien. War die Situation bisher shakespearisch, so wird sie jetzt sophokläsisch, entwickelt sich zum Schicksalsdrama schwerster Gattung.
Der Jäger denkt: »Nun brauchte ich nur noch zu niesen, dann war es richtig.« Die durch diesen Gedanken beeinflußte Nase beeilt sich ihn in die Tat umzusetzen. Er sucht sie daran zu verhindern, indem er sie mit Daumen und Zeigefinger krampfhaft schließt. Aber die Nase niest nun gerade, und nicht zu knapp, nur infolge der Fingerpressung etwas außergewöhnlich, so daß es klingt, als ob ein Birkhahn blase. Der Hahn da drüben fällt auf den Schwindel hinein. Er hält die Nase des Jägers für einen Nebenbuhler und beeilt sich, den Nebenbuhler, daß heißt in Wirklichkeit die Nase, aus dem Felde zu schlagen. Er reckt den Hals, sperrt den Schnabel auf und zischt. Der Jäger macht ein Gesicht wie ein Schafottanwärter, dem der Staatsanwalt die Begnadigungsurkunde vorliest. Aus jedem Auge laufen zwei dicke Tränen, von denen je zwei die Freude, je zwei die Nasenexplosion zur Ursache haben. Der Jäger, bis eben noch ein willenloser Spielball unlenkbarer körperlicher Kräfte: Epidermisrunzelung, Schweißdrüsentätigkeit, Hüftnervenaffektion, Zahnwurzelhautentzündung, Hustenreiz und Nieszwang, ist mit einem Male wieder ein höheres, mit freiem Willen und Vernunft begabtes Wesen. Ruhig und besonnen bückt er sich, nimmt das Gewehr auf, spannt es, zieht den Kolben an die Backe, schiebt die Mündung durch die Schießlücke, krümmt den Drückefinger und nimmt den Hahn auf das Korn.
In demselben Augenblick streicht der Hahn ab und fällt zwanzig Schritte weiter rechts ein. Das Antlitz des Jägers, das eben die Siegesfreude mit purpurner Glut bedeckte, wandelt sich mit affenartiger Plötzlichkeit zu fahlem Asch- oder Eselgrau um und der Ausdruck seines Gesichtes weist neunzig Prozent Intelligenz weniger auf, als von einem zum aktiven und passiven Wahlrechte befähigten Staatsbürger billig verlangt werden kann. Was er denkt, ist nichts Christliches. Der Hahn sitzt in der langen Heide. Der Jäger sieht nichts als den Kopf mit feuerroten Rosen. »Oller Siegellackkopp,« knirscht er vor sich hin, und frißt erst seinen Grimm, dann sein Schinkenbutterbrot in sich hinein, und als er damit fertig ist, tut er so, als pfiffe er auf alle Birkhähne, wappnet sich angesichts der Fatalitäten dieses Morgens mit Fatalismus und steckt sich eine Zigarre in die verlängert Physiognomie. Kaum brennt sie, da balzt der Hahn los. Einen Hopser nach dem anderen macht er, und bei jedem kommt er dem Jäger besser. Der hat längst die Zigarre in den feuchten Boden gesteckt, wo sie ächzend und stinkend ihren blauen Geist aufgab, und nun sitzt er da, hat den Kolben an der Backe und wartet, daß der Hahn schußgerecht kommt.
»Jetzt,« denkt er, »nur noch einen Hopser, dann hab' ich dich.« Aber der Hahn macht keinen Hopser mehr, sondern einen langen Hals. Der Jäger bekommt es mit der Angst und denkt: »Der Hahn hat mich geäugt.« Kreidebleich wird ihm zumute. Das Herz klopft dem Jäger erst im Halse, dann im Flintenkolben, dann im Gewehrschaft, dann im Gewehrlauf, so daß der hin und her pendelt wie ein freudig erregter Hundeschwanz. Jedes Glied gibt sich auf eigene Kanne Bier dem Veitstanze hin. Der Jäger ist kein Mensch mehr. Was er ist, weiß er nicht genau, aber er hat so eine Ahnung, daß er eine Kreuzung von Kamelelefantenkalb und Hammelkuh sei, ein Riesen- oder Abgottsidiot in idealer Konkurrenz mit einem Gummizelleninsassen hoch Vier, ein zielbewußter Idiot, ein konsequenter Gehirnweichling, ein umgekehrter Übermensch oder sonst etwas Außergewöhnliches. Fünf Minuten später sind seine Gefühle anderer Art. Denn der Hahn gibt einen seltsamen Ton, ein giftiges, haßerfülltes Girren von sich, und fortwährend girrend, schiebt er sich, einer schwarzweißroten Schlange ähnelnd, durch das Heidkraut, und gerade wie der Jäger den Finger krumm machen will, da kommt der selbe böse Ton von links, und von da schiebt sich auch ein Hahn näher, und jetzt stehen sich beide gegenüber, zischend, girrend, kullernd, und nun fahren sie aufeinander los, ein schwarzweißroter Ball wirbelt in dem Heidkraut umher, merkwürdige Laute erschallen, Federn, Grasblätter, Heidkrautstengel, Sand und Steine sausen in der Nachbarschaft herum, im Hintergrunde applaudieren sieben Hennen laut und anhaltend, und jetzt hält es der Jäger für angebracht, der häßlichen Szene ein Ende zu machen. Er krümmt den Finger, es knallt, rundherum ist alles blau und es riecht beträchtlich nach Pulver.
Der Jäger steht auf. Langsam verzieht sich der Dampf. Da liegt ein Hahn; er rührt sich nicht mehr. Der andere kam mit dem Leben davon. Schade! denkt der Jäger und geht hin, seinen Hahn zu holen. Da liegt der andere Hahn auch, ebenso tot wie der andere. Der Jäger nimmt die Hähne auf. Er hat alles vergessen, Hunger, Kälte, Übelkeit, allgemeine geistige Körperschwäche, sogar den Zahnveteranen. »Das Weidwerk das ist voller Lust und alle Tage neu,« denkt er und sucht im Rucksack seine Zigarrentasche. Die Tasche ist da, die Zigarren sind hin; sie vertragen es nicht, tritt man sie mit Füßen. Aber selbst über diesen Schmerz setzt er sich hinweg. Er hat zwei Hähne. Und was für Hähne! Alte Haupthähne! Mit Spielen, so lang, und mit Rosen, wie Daumendöppe dick!
Vor einer Stunde schwor er noch, sofort nach Hause zu fahren und nie wieder zur Balz zu gehen. Jetzt denkt er anders; er will noch einen Tage draußen bleiben, vielleicht auch zwei, wenn nicht gar drei.
Denn nun hat es ihn erst recht, das Hahnenfieber.
Raubzeug
Die Jagd ist heutzutage in Deutschland, faßt man sie rein wirtschaftlich auf, ein Nebenzweig der Land- und Forstwirtschaft; die Interessen des Landwirtes, Forstmannes, Waldbesitzers und ähnlicher Berufsarten, wie des Gärtners und Fischzüchters, sind also stets den Interessen des Jägers voranzustellen.
Dieser Grundsatz wird meist außer acht gelassen, wenn es sich um die Bewertung derjenigen Tiere handelt, die sich zum Teil von Wildbret nähren. Nur ganz wenige Jäger, und meistens nur solche, die entweder Land-, Forst- oder Nutzgartenbesitzer oder Forstverweser sind, vermögen bei der Beurteilung des von dem Haar- und Flugraubzeuge in der Wildbahn angerichteten Schadens den Nutzen mit in Rechnung zu bringen, den die Räuber in anderer Weise bringen.
Der größte Teil der Jäger ist auch gar nicht imstande, diesen Nutzen zu erkennen. Die meisten Jäger sind naturwissenschaftlich so wenig gebildet, daß sie die Lebensweise des Raubzeuges so gut wie gar nicht kennen. Sie leben in dem Wahne, daß der Fuchs nur von Hasen, Hühnern, Fasanen usw. lebe, und als Flugraubzeug schlechthin gilt ihnen alles, was einen krummen Schnabel und wehrhafte Griffe hat, mag es nun der böse Hühnerhabicht oder der reizende, harmlose und durch das Vogelschutzgesetz wenigstens auf dem Papier geschützte Turmfalke sein.
Es ist noch nicht lange her, da wurde in der Jagdpresse unausgesetzt der Krieg gegen das Raubzeug gepredigt. Man bekam fast keine Nummer in die Hand, in der nicht die Losung: »Tod dem Raubzeug!« und das Feldgeschrei: »Fort mit dem Raubgesindel!« zu lesen war, meist unter höchst verdächtiger, stark nach Provisonsschriftstellerei riechender Empfehlung dieses oder jenes Fallenfabrikanten.
Diese kindische Hetze, die meist in eine Form gekleidet war, als gelte es den Kampf gegen den Gottseibeiuns, und die ganz mittelalterlich hexengläubig anmutete, hat sich ein wenig gelegt, seitdem Fachmänner, in erster Reihe Prof. Dr. G. Röhrig von der Versuchsanstalt für Land- und Forstwirtschaft zu Dahlem, in mehr als zehnjährigen, an vielen Tausenden von erlegten Raubvögeln vorgenommenen Kröpf- und Mageninhaltsuntersuchungen den unumstößlichen Nachweis geführt hat, daß der Glaube, der Bussard und einige andere Raubvögel seinen gefährliche Jagdschädlinge, ein Irrwahn naturwissenschaftlicher Laien sei. Auch die Meinung, daß das Haarraubwild jagdlich nicht so schädlich ist, als der Durchschnittsjäger meist annimmt, bricht sich mehr und mehr Bahn.
Der Fuchs ist ein hervorragender Mäusevertilger, der in der Hauptsache von Mäusen und nur nebenbei von Wild lebt, worunter außerdem das angeschweißte und das gefallene Wild noch mindestens die Hälfte bildet. Außer Mäusen vertilgt der Fuchs noch eine Unmasse von Kerbtieren und deren Larven; so frißt er Maikäfer sehr gern, desgleichen Saateulenraupen und Drahtwürmer, die ich mehrfach in großen Mengen in erlegten Füchsen fand. In ähnlicher Weise nützen die Marderarten: Dachs, Baum- und Steinmarder, Iltis, Groß- und Kleinwiesel, dem Landwirt, Forstbesitzer und Gärtner.
Ebenso steht es mit dem Flugraubzeug. Selbst die gefährlichsten Feinde der Niederjagd, der Wanderfalke und der schon recht selten gewordene Hühnerhabicht, stiften neben dem vielen Schaden, den sie anrichten, nicht unbeträchtlichen Nutzen. Beide greifen recht viele Krähen und Wildtauben, die dem Landwirt zu Zeiten recht unbequem werden, und der Habicht räumt stark unter den Eichhörnchen und Hamstern auf. Außerdem, und das kommt auch für das Haarraubzeug in Betracht, sind sie jagdlich von Nutzen, denn sie erbeuten in erster Reihe kranke, kümmernde, schwache und mit schlechten Sinnen ausgerüstete Stücke, beugen also der Seuchenausbreitung vor und dienen der Höherzüchtung des Schlages ihrer Beutetiere. Deswegen soll nun der Jäger nicht ausnahmslos diese beiden Räuber schonen. Für den Wanderfalken wäre allerdings eine Schonung in der Horstzeit zu empfehlen, denn dieser stolze Vogel ist schon so selten bei uns geworden, daß sein Verschwinden bevorsteht. Der Hühnerhabicht ist hinwieder so gerissen, daß er so leicht nicht ausgerottet werden wird, und da sein Schaden sehr groß ist, soll der Niederjagdbesitzer ihn nicht schonen, während der Inhaber einer Hochwildjagd ein paar schon dulden darf. Unsere übrigen Raubvögel bringen aber entweder deswegen der Allgemeinheit keinen Schaden, weil sie sich meist von ganz gemeinen Vögeln oder von solchen Tieren nähren, die schädlich oder wirtschaftlich und ästhetisch bedeutungslos sind, und sie leben auch meist nur dort, wo ein Überfluß von Kleingetier aller Art ist. Ob nun die Rohrweihe einmal eine Jungente schlägt, ob die Korn-, die Wiesen- und die Steppenweihe Lerchennester plündert, das ist belanglos für das allgemeine Wohl dem Nutzen gegenüber, den diese Räuber durch die Vertilgung von Mäusen leisten. Es gibt so viele Lerchen und Ammern, daß es gar nichts bedeutet, greift der Baumfalke oder der Merlin eine Lerche oder Ammer, und der Turmfalke nützt so sehr durch Mäuse- und Maikäferaufnahme, daß man ihm einen Jungvogel schon gönnen darf. Selbst der Sperber ist lange nicht so schädlich, wie man annimmt. Er schlägt manchen Singvogel, aber doch meist die überaus gemeinen, offen lebenden Arten, wie Lerche, Ammer, Star und Amsel, macht diesen zweifelhaften Schaden aber durch den unzweifelhaften Nutzen wieder gut, den er durch das Kröpfen von Sperlingen, Mäusen, Käfern und Raupen stiftet.
Zu neunundneunzig Teilen vom Hundert nützlich aber sind unsere beiden Bussarde, der Mäuse- und der Wespen-Bussard, und nicht minder der nordische, uns wintertags besuchende Rauhfuß-Bussard. Fast ebenso nützlich sind beide Milane, der rote und der schwarze Gabelweih, beide ganz selten bei uns. Der Nutzen der Eulen ist so allbekannt, daß es nicht zu begreifen ist, daß der Raubvogelfang mit dem Pfahl- und Hügeleisen, in denen sich zur Hauptsache Eulen fangen, noch nicht gesetzlich verboten ist. Eine Falle, die unterschiedslos jedem Vogel, der in sie hineingerät, die Beine zerbricht, gehört dahin, wo Daumenschrauben und Halseisen sind, in das Museum. Wo unter besonderen Verhältnissen ein planmäßiger Raubvogelfang nötig ist, z.B. in Fasanerien, soll der Habichtskorb oder eine andere Falle zur Anwendung kommen, die den gefangenen Vogel unversehrt fängt, so daß harmlose Stücke wieder in Freiheit gesetzt werden können. Unter den Griffen, die ein Jagdaufseher seinem Brotherrn einsandte, fand ich fünfzig Paare vom Turmfalken und vierundzwanzig vom Steinkäuze, unserer kleinsten, niedlichsten, fast nur von Mäusen und Kerbtieren lebenden Eulen. Alle diese Turmfalken und alle Käuzchen waren in einem Vierteljahr im Pfahleisen gefangen. Wo es die Mittel und die Umstände erlauben, wende man auch gegen das Haarraubzeug Fallen an, die, wie die Kastenfalle, das Tier entweder unversehrt fangen, oder die, wie die Knüppel-, Mord- und Würgefallen, es sofort und schmerzlos töten. Es läuft auch bei der notwendigen und zuverlässigen Bekämpfung des Raubzeuges noch sehr viel Tierschinderei mit unter, eine Tatsache, die sich eben nur daraus erklären läßt, daß viele Jäger dem Raubzeug gegenüber in einer Art von mittelalterlichem Irrwahn sich befinden. Der Fuchs, das ist ein entsetzlicher Dämon, der nachts umgeht und suchet, was er verschlingen könne, der Habicht gilt als eine Art von Vampyr, der aus dem Grunde seiner schlechten Seele auf Unheil sinnt. Und wie man im Mittelalter in den Hexen den ††† selber zu treffen suchte, wenn man sie zu Tode marterte, so bekämpft der Jäger im Raubwilde die Vertreter des schlechten Prinzips, ausführende Organe Kloakenkaspers, Ahrimans oder Siwas, denen gegenüber man zu keiner Rücksicht verpflichtet ist. So schießt man die Füchsin in der Heckezeit und läßt die Welpen elend verhungern, man knallt das Habichtsweibchen vom Horst fort und läßt die Brut verschmachten, läßt den Fuchs vierundzwanzig Stunden im Eisen sitzen und sieht seine Pfahleisen nur gelegentlich nach, so daß Eulen und Bussarde oft tagelang mit zerschmetterten Füßen darin hängen.
Ein solches Verfahren ist unwürdig. Sind wir gezwungen, uns des Raubzeugs zu erwehren, so haben wir das unter Einhaltung aller für die Ausübung der Jagd auf Nutzwild üblichen Rücksichtsnahme auf das Schmerzgefühl der Tiere zu tun. Andernfalls sind wir genau solche Aasjäger, als wenn wir auf fünfzig Schritt Rehe oder Rotwild mit Schrot bespritzen oder ein angeschweißtes Stück Wild nicht nachsuchen. Werden also Fallen gestellt, so sind sie in der Morgenfrühe nachzusehen. Aasjäger ist außerdem auch, wer fremdes Eigentum nicht achtet, wer also Eisen so legt, daß Haus- und Hirtenhunde leicht hineingeraten können. Manche Hunde sind der Jagd schädlicher als alles andere Raubzeug zusammen, und bietet sich eine gesetzliche Handhabe, so kann man es dem Jagdinhaber nicht übelnehmen, legt er sie um. Viele Jäger nehmen sich aber das Recht, jeden Hund, den sie im Revier treffen, niederzuschießen, selbst wenn es sich um nachweislich nicht jagende Hunde handelt, die womöglich für den Besitzer sehr wertvoll sind, wie Hütehunde. Ein solches Verfahren ist ein Zeichen von Gemütsroheit und verdient in jedem Falle strengste gesetzliche Ahndung. Überhaupt soll der Jäger stets einige Patronen mit halber Pulverladung und dünnstem Schrot bei sich führen, mit denen er einen jagenden Hunde, ohne ihm weiter zu schaden, seine Jagdleidenschaft sehr bald austreiben kann.
Zum Raubzeuge im weiteren Sinne gehören dann noch die Katzen, die aber verhältnismäßig wenig jagdlichen Schaden anrichten. Wo auf die Niederjagd großer Wert gelegt wird, sind sie im Felde doch schließlich nicht zu dulden. Die Krähen nützen durch Mäuse- und Ungeziefervertilgung sehr viel, richten allerdings durch das Abpflücken reifender Ähren und durch das Abbrechen von Tragreisern an Obstbäumen bedeutenden Schaden an. Außerdem ist ihr jagdlicher Schaden nicht unbedeutend. So kann man sie, zumal sie recht häufig sind, getrost abschießen. Die Elster schadet dem Land- und Forstwirt kaum und ist nur dort abzuschießen, wo sie sich zu sehr vermehrt, zumal ihr jagdlicher Schaden ziemlich gering ist. Der Häher kann in Saatkämpen sehr lästig werden und ist deshalb dort, wo es nötig ist, kurz zu halten. Als Jagdschädling ist er bedeutungslos. Dasselbe gilt von der Eichkatze. Ein Vogel, der so selten geworden ist wie der Kolkrabe, ist mit dem Abschusse völlig zu verschonen, zumal er in der Hauptsache von Kleingetier und Aas lebt.
Von den Tieren, die der Fischzucht Abbruch tun, ist der Otter niemals zu schonen, denn der Schaden, den er anrichtet, ist bedeutend. Auch der Reiher verdient nur insofern Schonung, als man die sowieso schon kurz gehaltenden Siedlungen im naturwissenschaftlichen Interesse bestehen lassen soll. Im übrigen wird sein Schaden nur dort sehr groß sein, wo Teichwirtschaft getrieben wird, und außerdem ist er ein fleißiger Mäusevertilger. Der Storch ist überall zu schonen, wo er nicht allzu häufig auftritt. Er nimmt zwar Junghasen und junge Hühner und Fasanen auf, vertilgt aber eine Unmenge von Mäusen und sonstigen Unzeug, plündert aber auch gern Fischteiche. Als schädlich gelten auch zwei unserer reizendsten Vögel, Eisvogel und Wasseramsel, die aber in der Hauptsache von zum Teil der Fischbrut sehr schädlichem Gewürm leben. Deswegen soll man ihnen das gelegentlich erbeutete Fischchen gönnen.
So kommen also für den Jäger, der die Jagd neben der Land- oder Forstwirtschaft betreibt, folgende Gesichtspunkte für sein Handeln in Frage: Es ist immer zu überlegen, ob der sonstige Nutzen eines Tieres nicht größer ist als sein jagdlicher Schaden. In Gegenden, wo leicht Mäusefraß in Feld und Wald eintritt, sind, liegen nicht besondere jagdliche Verhältnisse vor, der Fuchs, die Marder und die Wiesel und selbstverständlich Bussarde und Weihen zu schonen. Spielt dagegen die Niederjagd eine sehr wichtige Rolle und ist Mäusefraß nicht zu befürchten, so ist es etwas kürzer zu halten, das sogenannte Raubzeug.
Der Grenzbock
Kein Tag im Jahre verursachte ehedem bei allem, was einen grünen Rock trug, eine solche Aufregung, wie der erste Mai.
Schon wochenlang vorher krebsten die Jäger in ihren Jagden umher, suchten Wechsel, Plätze und Fegestellen, und zählten abends, wenn die Sonne sich verabschiedete, und in der Frühe, wenn sich der Morgen vor ihnen graute, die Häupter ihrer Lieben und das, was daraufwuchs.
Der Bock, der Bock, und nichts als der Bock, das war das Alpha und das Omega aller Reden, so an jedem Tische geschwungen wurden, wo drei Jäger sich mit Bierverdrängen beschäftigten. Schon Anfang April hatte Meier einen gesehen, der blank gemachte hatte, worauf Müller ihn mit einem übertrumpfte, der um dieselbe Zeit völlig verfärbt war.
Die Böcke waren also reif, abschußreif; das stand fest. Na, und wenn einer auch noch so grau war, wie ein Milchwagenesel, schad't nichts, macht nichts, ist alles einerlei, man jug ja um die Decke nicht, man jug ja um das Geweih! Denn man war kein Fleischmacher, kein Wildbretschütz, man war Weidmann, gerechter Weidmann, sah verächtlich auf den Bratenjäger und kam sich als wunder wer weiß was vor, trug man im Rucksack ein braves Gehörn heim, an dem so nebenbei zwanzig oder vierundzwanzig Pfund Wildbret herumbaumelten, für das der Wildhändler einen Pappenstiel herausrückte.
So mancher Bock wurde damals vordatiert, hing schon vor dem ersten Mai aufgebrochen und gut verblendet in einer Dickung, denn es war ein Grenzbock und er hätte am ersten Mai vielleicht den Einfall haben können, dem Nachbar den Gefallen zu tun und über die Grenze zu wechseln. Denn der Grenzbock, das ist ein gemeines Tier. Eine Kreuzotter, Klapperschlange oder Kobra ist so harmlos wie ein Regenwurm im Vergleiche zu dem Grenzbock. Aller Tücken voll ist er, arglistigen Herzens und schmutzig von Besinnung. Andauernd wimmelt er an der Grenze umher, und es ist ihm eine Wollust, bald hüben, bald drüben den Revierinhaber zum Narren zu halten. Den ganzen April trat solche Bestie jeden geschlagenen Abend Punkt siebeneinhalb Uhr auf den Klee in Maiers Jagd aus, so daß Meier schon das Gehörn an der Wand und den Rücken auf dem Tische hatte; am Abend des ersten Mai aber spazierte er hohnlachend über die Grenze und ließ sich von Müller totschießen.
Ja der Grenzbock! Es ist nicht Treu noch Glauben in ihm. Gerieben ist er, wie ein Viehhändler, und boshaft, wie ein Affe. Eine Wonne ist es ihm, Meier zu veralbern und Müller zur Raserei zu bringen. Denn Müller hat auch einen Grenzbock, und der ist noch viel gemeiner. Acht Tage lang hat Müller auf ihn angesessen, aber das Schwein, wie Müller bei sich sagt, tritt immer so aus, daß er Wind kriegt, oder er hält sich außer Büchsenschußnähe, oder er tritt erst dann in Erscheinung, wenn das Büchsenlicht anfängt, negativ zu werden. Und morgens verzieht sich das Ekeltier so früh in die sichere Dickung, daß Müller erst recht nichts anfangen kann. Er hockt draußen, bis er das Ende seiner Kanone nicht mehr sehen kann, er schlägt sich eine Nacht nach der anderen um die Ohren, er schleppt seine müden Knochen auf die Faulpürsch und läßt ihnen auch über Mittag, wenn der Bock seinen dummen Gang hat, keine Ruhe, aber es ist alles gelogen.
Endlich aber, endlich, endlich hat er Weidmannsheil. Er hat eines Morgens die Zeit verschlafen und bummelt mehr aus Gewohnheit, denn in böser Absicht, an der Grenze herum, zu der es ihn immer wieder hinzieht, wie den Bräutigam zur Braut. Wie er nun so, den Leib voll Ärger und das Herz gefüllt mit Mißmut, hinter den Büschen herkriecht, da denkt er, er soll umfallen, denn fünfzig Gänge vor ihm steht der Bock und äst sich so seelenvergnügt, als wenn es keinen grünen Jäger gäbe. Er steht zwar ein bißschen sehr hart an der Grenze, denkt Müller, aber dafür steht er ja auch so schön breit, so daß es mit dem Kuckuck zugehen müßte, bekäme er die Kugel nicht zwölfe Ring und bliebe im Feuer. Und so jagt der gute Müller alle Bedenken in die Ecke, nimmt dem Bocke das Maß, macht den Finger krumm und schreit innerlich: »Ha là lit!« und »Bock tot!« Denn im Feuer sah er den Bock koppheister schlagen. Und als er sich dann vorsichtig heranstiehlt, um ihm den Fang zu geben, da verlängert sich seine Physiognomie um das Doppelte ihrer vorschriftsmäßigen Länge, denn Schweiß ist da, sehr viel Schweiß sogar, so viel, als wäre er mit einer Gießkanne ausgegossen, aber wer nicht da ist, das ist Musche Blix, denn mit dem letzten Reste von Besinnung hat sich Urian über die Grenze gemacht und ist gerade vor Meiers Jagdaufseher zusammengebrochen. Na, und da Müller und Meier in demselben zärtlichen Verhältnisse stehen wie ein Teckel und ein Zaunigel, so kann Müller sich die Rehbratenzähne vorläufig ausziehen, und der Platz an der Wand, den er für das Gehörn vorgemerkt hatte, bleibt so wie er ist.
Ist es nach solchen Erfahrungen Meier und Müller zu verdenken, wenn sie den Grenzböcken Krieg bis auf das Messer erklären? Nein, nein und zum abermalten Male nein, denn schließlich ist sogar der Jäger ein Mensch und kein Engel. Meier schwur Rache und Müller gelobt dasselbige, und nun muß alles daran glauben, was in der Nähe der Grenze von Rehen lebt und mehr als zwei Lauscher auf dem Haupte hat, und sowohl der Jüngling wie der Greis am Stabe, das heißt, jeder Untertianer von Spießbock wie der alte Bock mit runzeligen Zügen muß daran glauben. Denn das Scheußliche ist: die Grenzböcke werden nicht alle. Kaum liegt der eine auf der Decke, ist schon ein Ersatzmann da, denn die Grenze ist gesucht bei den Böcken, angeblich wegen der dichten Dickungen, des guten Windes und der üppigen Äsung, in Wirklichkeit aber, so glauben Meier und Müller wenigstens, weil die entsamten Böcke sich ein Vergnügen daraus machen, ihnen beiden die Schwindsucht an den Hals zu besorgen. Anders läßt sich das nämlich gar nicht erklären, denn sonst würden hier doch nicht immer die besten Böcke stehen.
An der Grenze stehen nämlich immer die besten Böcke. Wenigstens gilt ein krummer Gabelbock, der dort seinen Stand hat, Meier dreimal mehr als ein Hauptbock, der in der Mitte der Jagd steht, und Müller ist derselbigen Ansicht. Sogar ein Spießbock, der sich als Grenzer verkleidet, genießt Ansehen genug, um der Kugel gewürdigt zu werden. Er wiegt zwar nicht viel mehr als ein alter Rammler, sieht auch so grau aus, wie ein Aschermittwochmorgen, und so ruppig, als säßen die Motten drin, und das Gehörn, ach du lieber Himmel, es ist halbfingerlang und gänzlich ungefegt! Aber Grenzbock bleibt Grenzbock, und so schlägt Meier ihn tot und freut sich aus dem Grunde seiner vergrämten Seele, daß Müller ihn nicht kriegte, und da eine Liebe der anderen wert ist, metzelt Müller drei Tage später ein ähnliches Jammertier nieder. So geht es das ganze Jahr über, und da die Grenze lang ist und an ihr die Hauptrehstände sind, rennen in der Brunft die jungen wie die alten Rehdamen voller Verzweiflung herum, erfüllen die Luft mit Sehnsuchtslauten und sind froh, wenn sie alle zusammen, dreißig und mehr, eines elenden Schneiders habhaft werden, der sich ihrer erbarmt, was beiden Teilen natürlich nicht besonders bekommt.